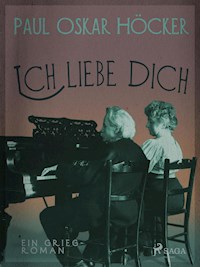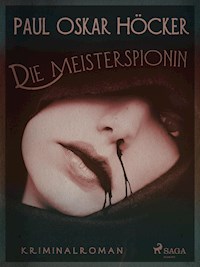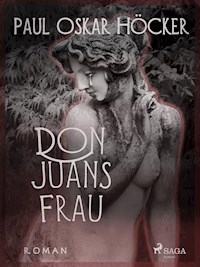Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt steht Kopf im August 1914. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, verändert sich auch für Helene Martin in Lille alles, zudem die Martins, aus Deutschland stammend, erst seit kurzem die französische Staatsangehörigkeit besitzen. Schnell merken sie, dass ab jetzt das Volk auf der Straße und der Krieg ihr Leben beherrschen werden. Zum Autor: Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Ein Liller Roman
Saga
Der telephonische Verkehr von Lille mit Paris war seit dem frühen Morgen unterbrochen. Helene Martin hoffte umsonst auf ein Ferngespräch mit ihrem Gatten. Sie wusste nicht, ob er’s trotz der Kriegsgerüchte gewagt hatte, seine Geschäftsreise fortzusetzen, oder ob er zu ihr nach Lille unterwegs war.
Ein Glück, dass Manon Dedonker diesen Nachmittag aus dem Bad zurückkehrte. Helene suchte die Freundin in der Liller Stadtwohnung ihres Vaters, des Herrn Léon Ducat, am Boulevard Vauban zu erreichen. Sie waren jetzt beide Strohwitwen. Vor der Sommerreise hatten sie für diese paar Augusttage noch so übermütige Pläne geschmiedet, um ihre Männer eifersüchtig zu machen. Dem Rennen in Lambersart würden sie beiwohnen, und vielleicht gab es auch eine Autofahrt mit Offizieren des Regiments in Armentières. Nun jedoch war bei der Männerwelt für nichts mehr Sinn als für diese abenteuerlichen Mobilisationsgeschichten.
Endlich bekam Helene Verbindung mit dem Boulevard Vauban. Der alte Herr Ducat war am Fernsprecher, ernst, sorgenvoll wie immer. Natürlich sing auch er gleich von den Alarmnachrichten an. Er hielt die Lage für bedenklich. Auf der Durchfahrt durch Paris hatte er Poincarés Empfang auf dem Nordbahnhof miterlebt, seinen Triumphzug bis zum Elysée. Die Stimmung gegen die Deutschen sei sehr gereizt ... Wenn es wirklich zum Krieg zwischen Frankreich und Deutschland käme, was dann aus Helene und ihrem Gatten werden solle? Dass die Naturalisation immer noch nicht ausgesprochen sei! Ob ihr Mann denn nicht schleunigst hier auf der Präfektur alles ins Gleis bringen wolle?
Manons drollige Lachtonleitern unterbrachen Herrn Ducat immer wieder, schliesslich musste er seiner Tochter das Hörrohr ausliefern, und die beiden Freundinnen kamen endlich zur Aussprache. Nein, was hatten sie einander alles zu erzählen. Es war noch dieselbe übermütige Offenheit zwischen ihnen wie damals in der Pension; die Heirat, die Zeit, die Trennung hatten gar nichts daran geändert. Manon Ducat hatte mit siebzehn Jahren den Belgier Henri Dedonker geheiratet, dessen Zuckerfabrik nahe bei Lille lag, in Tirlemont, Helene ein Fahr später Henris Freund George Martin, der in die Maschinenfabrik ihres Vaters als Teilhaber eingetreten war und vor drei Jahren den Vertrieb landwirtschaftlicher Maschinen hier in Lille eröffnet hatte. Beide Ehen waren bis jetzt kinderlos. Helene zählte dreiundzwanzig, Manon schon fünfundzwanzig Jahre. Aber Manon wirkte viel jünger. Soviel Laune und Liebenswürdigkeit und Lebenskraft steckten in ihr. Sie wickelte ihren Mann ebenso um den Finger wie ihren Vater, sie bezauberte und beherrschte alle Welt. In Dinant, in ihrer wundervollen Pensionszeit, hatten sich sogar die frommen Schwestern von ihr gängeln lassen.
„Also, liebste Helene, Paris war diesmal eine Enttäuschung. Niederziehend, sage ich dir. Auf den Strassen ein wüstes Geschiebe — kein Taxameter zu haben — elegante Welt gar nicht zu sehen. Und nichts zu hören als Politik, Politik. Was gibt’s hier Neues?“
„Drüben beim Museum steht so ein infamer Bengel, der schreit die neuesten Depeschen aus. Ich kann sein greuliches Liller Patois noch immer nicht verstehen. Soll ich hinüberschicken?“
Manon lachte. „Du Süsse, nein, die Depeschen liest mir ja schon Papa vor. Ich soll durchaus zuhören ... Pa, du bist garstig, so lass mich doch ... Hast du das „Echo“ von heut Morgen gesehen, Helene, den Liller Spielplan für die Wintersaison? Nicht? O, es wird fabelhaft. Zur Einweihung der Oper komme ich natürlich von Tirlemont herüber. Papa hat Loge links genommen. Ihr auch? Dein Mann hat mir heilig gelobt, mir sehr die Kur zu machen.“
„Sieht ihm ähnlich. Aber ich werde nicht so leicht eifersüchtig. So wenig wie dein Mann.“
„Pa ist schrecklich philiströs und zankt uns beide aus. Leichtfertig seien wir.“
„Ach, Manon, es ist mir gleich wieder wohl, wenn ich nur deine Stimme höre, dein Lachen. Die letzten vierundzwanzig Stunden waren grässlich. So ganz allein hier. Und immer das Geschrei mit den Depeschen. Kannst du zum Tee zu mir kommen, Manon?“
„Nein, Süsse, ich hab’ Hausarrest. Mein Mann hat mittags von Tirlemont aus hier angerufen und sagen lassen: wenn er ein Auto austreibt, kommt er noch heute nach Lille.“
„Und nimmt dich dann gleich wieder mit? Nach Tirlemont? Aber das wäre ja ein Jammer. Dann hätt’ ich ja gar nichts von dir.“
„Ach, Süsse, und dabei graut mir diesmal vor Tirlemont wie noch nie. Was ich gegen Tirlemont habe? fragt Papa. Es ist eben belgisch. Pa wird böse, Helene, wir schwatzen ihm zu viel dummes Zeug. Ich darf dich doch erwarten? Wann?“
„Wenn hernach noch Zeit bleibt, gern. Schneider hat sich angesagt.“
„Schneider? Euer Sauerkraut-Ideal? Du Ärmste. Du wirst dir von ihm doch nicht die Kur schneiden lassen, aus Verzweiflung?“
„O du —! Aber nein, denke, nur ein Drittel der Arbeiter ist heute früh in der Fabrik angetreten. Der Betrieb müsse wahrscheinlich ganz schliessen. In Madeleine auf unserem Neubau wird auch nicht mehr gearbeitet. Alles, was Militär ist, wird eingezogen. Es ist grässlich.“
„Du hast mir versprochen, dass eure Villa im Herbst fertig wird. Das gibt doch wieder einen Vorwand, von Tirlemont herüberzuflüchten ... Ja, ja, ich schliesse schon, Pa! ... Auf Wiedersehen, Süsse!“
Helene legte die Hände an die Schläfen und schritt nachdenklich über das spiegelglatte Parkett der schmalen, saalähnlichen, lichtdurchfluteten Räume. Ab und zu blieb sie an einem der ungemütlich hohen Fenster stehen und blickte auf den im weissen Sonnenglast liegenden Platz zwischen Museum, Präfektur und Faidherbedenkmal. Noch immer schrie der Junge seine Depeschen aus, neue Trupps von Zeitungsausträgern stürmten lärmend über den Platz und teilten sich dann in die fächerartig auseinanderstrebenden Strassen. Das Haus war fast leer. Die Familien, die das Erdgeschoss und das obere Stockwerk bewohnten, weilten noch im Bade. Der Diener war wegen seiner Militärpapiere unterwegs, die Köchin machte Einkäufe, das Hausmädchen nähte in der Anrichte, war aber neu zugezogen und der Herrin noch fremd.
Nun musste sie an ihre Kindheit und an die Eltern denken. Ihr ganzer Lebenszuschnitt und das Zeitmass ihres Daseins gaben ihr sonst nur selten Gelegenheit dazu. Nicht erst durch ihre Heirat war sie dem Vaterhaus entfremdet; der frühe Tod ihrer Mutter trug mit Schuld daran. Ihr Vater, der Vielbeschäftigte, konnte sich ihr nicht widmen; so hatte er sie erst in Lausanne, dann in Dinant in Pension gegeben. Über ein Jahr währte auch ihre englische Pensionatserziehung. „Sprachen lernen, den Horizont erweitern!“ Kommerzienrat Kampff pflegte im Interesse seines Geschäfts weitreichende internationale Verbindungen. Als kleiner Maschinenbauer hatte er in Brandenburg angefangen, heute besass die Firma Weltruf. Nach Japan und Holländisch-Indien ging die Hauptausfuhr der landwirtschaftlichen Maschinen. Sehr willkommen war dem Kommerzienrat da als Schwiegersohn der weltkundige, sprachgewandte George Martin gewesen. An seinem Alter hätte der Kommerzienrat sich vielleicht gestossen — George war achtzehn Jahre älter als Helene —, aber Helene selbst hatte ihn damals herzlich ausgelacht. So frisch und anregend und wohlgepflegt und weltgewandt, so smart wie George war keiner der jungen Herren, die ihr sonst den Hof machten. Und sie waren ja auch beide sehr glücklich miteinander geworden. Beides ganz moderne Leute von Lebenskunst und Geschmack. Dass kein Familienzuwachs kam, war des Kommerzienrats Kummer. Helene hatte Kinder bis jetzt nicht vermisst. Ihr buntes, bewegtes, abwechselungsreiches Leben führte sie in dem ersten Frühling ihrer Ehe nach Südamerika und nach Japan. Mit dem darauffolgenden glänzenden Jahr in Brüssel, wo George die erste selbständige Filiale der zur Aktiengesellschaft erweiterten Kampffschen Fabrik eingerichtet hatte, war der Aufenthalt in Lille ja freilich nicht zu vergleichen. Die Trauer um den plötzlich erfolgten Tod des Vaters hinderte Helene zuerst daran, sich hier heimisch zu fühlen. Festen Boden in den sonst so schwer zugänglichen Liller Kreisen gewann ihr dann aber die herzliche Freundschaft mit Manon. Nun baute ihr George die prächtige Villa an dem neuen Boulevard, der nach Roubaix führte. Sein Unternehmen wuchs von Monat zu Monat. Millionen waren hier zu verdienen. Da sie beide den internationalen Schliff von Kindheit an besassen, nicht nur die Landessprache, sondern auch Englisch tadellos beherrschten und die guten Brüsseler Beziehungen geschäftlich wie gesellschaftlich den Weg ebnen halfen, kam es nie zu Reibungen wegen ihrer deutschen Abstammung. Die meisten hielten sie für Belgier, natürlich wurden ihre Namen nie anders als französisch ausgesprochen — sie nannten sich teils aus Vorsicht, teils aus Bequemlichkeit selbst so — und George Martin war jetzt schon im Begriff, von Lille aus weite Gebiete Frankreichs mit den in Brandenburg, Düsseldorf und Mainz entstandenen landwirtschaftlichen Maschinen zu versorgen, die hier nur zusammengesetzt und mit der französischen Firma versehen wurden. Unbedingt war das deutsche Haus jedem Wettbewerb Frankreichs überlegen. Georges fabelhafte Geschmeidigkeit und Beweglichkeit, sein fein abgeschliffenes Weltbürgertum und seine in allen Erdteilen gesammelten Menschen- und Geschäftskenntnisse bewunderte Helene immer wieder. Als George es für ratsam hielt, sich in Frankreich naturalisieren zu lassen, erschienen ihr die eigenen Einwände schliesslich selbst kleinlich und philisterhaft. George hatte seiner Auslandstätigkeit halber nur wenig militärische Übungen in Deutschland machen können. Da er sich im deutschen Drill nie so recht wohl gefühlt, durch sein so ganz anders gerichtetes Leben auch gar keinen rechten Anschluss an Offizierskreise gesucht oder gefunden hatte, so nahm er an der Grenze des Schwabenalters als Leutnant vom Landwehrtrain zweiten Aufgebots seinen Abschied, unter Verzicht auf die Uniform. Schwierigkeiten konnte seine Naturalisation hier nicht verursacht haben. Es wäre Helene jetzt aber doch eine grosse Beruhigung gewesen, wenn die Formalitäten schon ihre Erledigung gefunden hätten. Die schwarzseherischen Bemerkungen von Manons Vater gingen ihr nicht aus dem Sinn.
Da war denn auch der Besuch des Herrn Schneider nicht dazu angetan, ihre Stimmung aufzuhellen. Schneider war ein gründlich gescheiter, fleissiger und zuverlässiger Mensch, aber in allem der verkörperte Gegensatz seines Chefs. So ernst, so schwer nahm er das Leben. Zu dem leichten Tändelton, den Helene auch ihm gegenüber zuweilen anschlug, konnte er sich schon gar nicht finden. Helene ahnte, dass Schneider heute sehr trübe gestimmt sein würde. Wenn der grosse, starke, blonde Mann sie mit seinen ernsten, blauen Augen so eindringlich ansah, dann verging ihr die Spottlust. Sie wollte seinen Pessimismus erst gar nicht zu Worte kommen lassen, und fiel ihm gleich in die Rede: „Sie sollen doch Französisch sprechen. Immer üben, üben. Seien Sie froh, dass ich so für Ihre Aussprache besorgt bin. Die anderen lachen Sie nur aus.“
„Das tun Sie, Madame, nebenher ja auch. Aber heute ...“ Er zog das Taschentuch und fuhr sich über den Kopf. „Es geht nicht gut aus, gnädige Frau, ich hab’ es so in den Knochen. Die zweite Sekretärin aus Lemonniers Bureau ist vorhin von ihrem Urlaub zurückgekommen. In Cambrai, sagt sie, sind schon gestern die vierten Kürassiere verladen worden. Und überall Bahnschutzmannschaften. Haben Sie die Proklamation vom Maire Don Lille gelesen? Danach ist es doch so ziemlich ausgeschlossen ... Dass Herr Martin so gar nichts von sich hören lässt. Er wird doch hoffentlich sofort von Paris abgereist sein?“
„Ich hoffe es auch. Aber ziehen Sie doch, bitte, keine so fürchterliche Grimasse, Verehrtester. Sie sollten ja nicht gleich an die Laterne.“
Er zuckte die Achsel. „Ich warte jetzt noch die Abendblätter ab. Wenn sich’s da noch kritischer zuspitzt, muss ich leider fort, ohne Ihren Herrn Gemahl gesprochen zu haben.“
„Sie müssen fort?“
„Jede Stunde kann doch die Mobilisation bringen. Und dann —“
„Sie fürchten Fatalitäten? Im Ernst? Aber ich begreife nicht — Sie, ein grosser, starker Mann —“
„Fatalitäten — wohl auch. Aber zu allermeist fürchte ich den Anschluss zu verpassen. Denn ich bin doch Soldat.“
„Herr Schneider! Sie — Soldat?“ Es reizte sie nun doch, ihn aufzuziehen. „Kanonier? Füsilier? Schwere Reiterei?“
Er ging auf ihren Ton nicht ein. „Infanterist. Landwehrmann. Ich bin Vizefeldwebel. Offizier werden konnte ich nicht, so immer im Ausland. Aber wenn es jetzt losgeht —“
„Losgeht. Losgeht. Unken Sie doch nicht so ... Ich bin nur froh, dass mein Mann nichts mehr damit zu tun hat. Wenigstens in der Hinsicht könnte man ruhig sein.“ Aber sie stand jetzt doch hastig auf und trat ans Fenster. „Natürlich ist es aufregend, dieses ewige Geschrei da draussen. Aber kennen Sie Lille anders? Hier schreit man immer.“
„Da drüben scheint’s irgendeine Rauferei zu geben ... Ja, gnädige Frau, die Belgier sind heute früh auch schon aufgerufen worden. Und Herr Martin wird doch wohl kaum hierbleiben wollen, wenn ...“ Er zog das „Echo“ aus der Tasche und wies erregt auf den Leitaufsatz, aus dem er, brockenweise, das Fettgedruckte vorlas: „Donnerstag früh Bombardement von Belgrad wieder angefangen — Deutschland hat noch kein Sterbenswort zugunsten des Friedens gesprochen, wünscht anscheinend den Krieg — Russland setzt Mobilisierung fort — Frankreich tat alles, um einen Konflikt zu vermeiden, ist aber gerüstet, seine nationale Ehre ...“
„Wenn Sie nur hergekommen sind, um mir das „Echo“ vorzulesen, lieber Herr Schneider —“
„Krieg und Frieden — es hängt nur noch an einem Faden. Ich hatte ja — offengestanden — nie daran gedacht, dass es einen mal so unterwegs erwischen könnte. Meine drei Brüder — die werden sich natürlich freuen. Einer ist bei der Marine, die beiden anderen stehen in Königsberg. Im Osten wird’s wohl zuerst losgehen. Es sind meine Zwillingsbrüder.“
„Offiziere? Aktiv?“ fragte Helene erstaunt. Ihn wunderte es nicht weiter, dass sie es ihm nicht zutraute. Er war ihr dafür nicht elegant genug. Sie hatte ihn zu ihren Empfängen ja auch niemals eingeladen.
„Jawohl, gnädige Frau, der eine Infanterist, der andere Pionier.“ Nun sprach er Deutsch. Und es war ihm wie eine Erlösung. Seine erregten Blicke strichen über den Platz hin. Bei der Hauptpost hatte sich eine grosse Menschenmenge angesammelt. Und von allen Seiten schoss es herzu — aus dem Boulevard, aus den anderen drei Strassen — und der Lärm wuchs.
Helene hatte das Fenster geöffnet. Nun hörte man einzelne Rufe. „Ein Spion — ein Spion!“ Sie zerrten da irgendein Wesen wie ein Bündel hin und her. Männer, Weiber, Halbwüchsige, Mairiebeamte drängten sich dazwischen. Es war aufregend.
„Sicher ein Deutscher,“ sagte Schneider und atmete tief auf. „Sie waren schon gestern in der Fabrik wie elektrisch geladen ... Drei Jahre habe ich doch jetzt gute Freundschaft gehabt mit Challier ...“
„Aber das ist ja schauderhaft, das da draussen!“ Helene stampfte leicht auf und schloss das Fenster. „Wenn erst die Plebs die Herrschaft bekommt ... Ich mag gar nicht hinsehen.“
Schneider griff nach seinem schwarzen Melonenhut. „Vielleicht sehe ich Ihren Gatten nicht mehr. Bitte um meine ergebenste Empfehlung, gnädige Frau. Challier ist ja da und wird alles übergeben. Lemonnier hat die Hausangelegenheiten. Ich gehe jetzt noch rasch nach der Grand’ Place, um die neuesten Depeschen abzupassen.“
„Und ich fahre nach Madeleine. Meine Freundin wird mich gewiss begleiten. Lassen Sie mir doch noch rasch das Auto kommen, lieber Herr Schneider.“
„Die beiden Autos waren schon mittags beschlagnahmt, übrigens musste auch Jean gleich früh zur Zitadelle, sich stellen.“
„Da bin ich ja wunderschön versorgt. Wie allerliebst. Gut, marschieren wir also ...“
Sie klingelte dem Hausmädchen vergeblich. Die Jungfer stand unten in der geöffneten Haustür und liess sich von der Frau des Concierge die Ursache des Auflaufs da drüben erklären. Unschlüssig, ob er die junge Frau erwarten sollte, da sie sich von ihm noch nicht verabschiedet hatte, stieg Schneider die Treppe hinab.
Helene musste sich Hut, Seidenjacke und Sonnenschirm selbst besorgen. Als sie in den Marmorflur trat, kam es aber nicht mehr dazu, dass sie die Bedienstete zur Rede stellte. Eine schlanke junge Dame, mit grossen, grauen Augen und seltsam hellblondem Haar, das wie gefärbt wirkte, stürmte herein, atemlos, ohne Hut ... Als sie Helene sah, erfasste sie ihre beiden Hände ... „Solche Angst hatt’ ich um dich! Ich bin herübergelaufen, wie ich war! An der Post haben sie einen Deutschen halb totgeschlagen!“
„Ach, Geneviève, du liebe, gute, kleine Fee!“
Die Pförtnersfrau und das Hausmädchen mischten sich ein. Vor dem Hause waren Leute stehengeblieben. Der Lärm drüben wuchs, er kam näher.
Schneider hatte vor Fräulein Geneviève Laroche höflich den Hut gezogen. Sie beachtete ihn nicht, sondern nahm Helene sofort mit sich zum Treppenaufgang zurück. „Komm’, Liebe, ich muss mit dir sprechen, komm’ rasch.“
„Aber ich wollte noch eben mit Herrn Schneider ...“
Geneviève Laroche warf ihr einen blitzenden, verweisenden Blick zu.
„Um Gottes willen!“ flüsterte sie dabei und riss sie mit sich.
So war es also doch zu keinem Abschied mehr gekommen. Schneider setzte den Hut wieder auf, knöpfte seine marineblaue Jacke zu und verliess das Haus. Er hatte aber noch nicht die Anlagen am Faidherbedenkmal erreicht, als ein halbwüchsiger Bursche sich aus der Schar löste, die unter Geschrei die Polizisten und ihr Opfer zur Mairie begleiteten, und auf ihn mit dem Ausruf zurannte: „Da ist noch einer, da ist noch einer! Ein Alboche! Ein Alboche!“
Vom Eckfenster aus wurden die beiden Freundinnen Zeuge des wüsten Auftritts. Helene war ratlos. Sie wollte die Balkontür öffnen, hinaustreten, aber Geneviève hielt sie zurück.
„Und du wärst imstande gewesen, Helene, dich an seiner Seite auf der Strasse zu zeigen. Unverantwortlich. Ich wollte dir schon immer sagen, dein Mann hätte ihn längst wegschicken sollen.“
„Aber sieh nur, sieh nur — o, sie schlagen ihn —!“
„Irgend jemand muss ihn erkannt haben. Komm’ jetzt doch bloss vom Fenster weg, Helene.“
Es war nur ein Knäuel von Menschen zu sehen mit erhobenen Fäusten, drohend geschwungenen Spazierstöcken. Aber da — der grosse, helle, glattgeschorene Schädel des Deutschen tauchte soeben wieder auf — der Hut fehlte, und es rann ihm etwas Rotes, Glänzendes über das Ohr und den Nacken. Helene überlief es eiskalt. Waren das noch Menschen? In der Überzahl einen Wehrlosen überfallen und misshandeln!
„Geneviève — er blutet — aber das ist ja fürchterlich!“
„Es reizt die Leute jetzt schon eine Kleinigkeit. Er sieht auch gar zu teutonisch aus. Sie schieben ihn wohl nach der Mairie ab ... Das ist wie ein Fieber über die Leute gekommen, überall wittern sie Spione.... Also Mama lässt dir sagen, du sollst sogleich zu uns hinüberkommen und heute auf alle Fälle bei uns schlafen. Sie macht sich solche Sorge um dich.“
„Wie denkt dein Vater über die Lage?“
„Ach, Vater ist ganz erschüttert. Ich hätte nicht geglaubt, dass so viel Weichheit in ihm ist. Er hat keine Hoffnung mehr, dass Frieden bleibt. Aber wie wundervoll ist die Proklamation von Delasalle. Hast du sie gelesen? Vater hatte ganz nasse Augen, als er sie las.“
Helene hatte sich gesetzt. „Mir sind die Beine schwach geworden. Und im Magen ist mir — so seltsam wie vor einer Seereise.“
„Arme Helene, wäre doch dein Mann erst da!“ Geneviève setzte sich zu ihr auf die Lehne des Fauteuils und umfasste sie zärtlich. „Da sind sie mit ihrem schrecklichen Herrn Schneider endlich abgezogen,“ sagte sie, noch einen Blick durchs Fenster werfend, und atmete auf. „Manon hat mich vorhin angerufen. Wir sprachen gerade von dir, und da kam noch eben Berthe mit Benjamin, ganz aufgelöst, sie hatten gesehen, wie der Spion in die Post flüchten wollte.... Manon weiss nun auch nicht, was werden soll. Ihr Mann gehört zur Bürgergarde, müsste also eigentlich in Tirlemont bleiben. Vielleicht lassen sie ihn gar nicht mehr fort.“
„Ja — und George? Ihr macht mir jetzt solche Angst.“
„Dein Mann ist französischer Staatsbürger geworden — ihm kann niemand etwas anhaben. In Paris hat er ja die besten Beziehungen. Und Vater sagt: eine einzige Anfrage hierher an die Präfektur genügt.“
„Man kann aber nicht mehr sprechen — die Verbindung mit Paris ist unterbrochen.“
„Für die Behörden nicht.“
„Ach, Geneviève, wenn sich dein Vater unser annähme! Weisst du, Manons Papa ist nie so recht warm zu mir gewesen. Aber wenn du deinem Vater zusprächst — er hat hier doch so viel Einfluss —“
„Sag’ lieber, er hat ein goldenes Herz.“ Das junge Mädchen strich der Freundin über die kalte, schmale Hand.
Helene fühlte die Wärme, die von Geneviève ausging, belebend und zugleich beruhigend. „Ja, das hat er,“ sagte sie rasch.
„Komm’, Helene, mach’ dich fertig. Du wirst dich gleich wohler fühlen, wenn du drüben bei uns bist.“
„Weisst du, Geneviève, es ist mir ordentlich bange nach deinen Geschwistern.“
Geneviève lachte. „Die Apfelgesichter, hast du früher gesagt ... Weisst du, und dann telephonieren wir Manon, dass sie zu uns kommt.“
„Ihr Papa lässt sie jetzt wohl kaum weg. Aber reizend wäre es. Dann versetzen wir uns im Geist wieder nach Dinant. Gelt?“
„Damals ist mir’s aber immer ziemlich schlecht bei euch ergangen.“
„Nun ja, du warst doch ein Baby gegen uns.“
Genevièves Blicke glitten bewundernd über die schlanke Pariser Gestalt der Pensionsfreundin. Mit ihren braunen Augen, braunen Haaren, tiefdunkeln und langen Wimpern, die wie ein Schleier wirkten, mit der geschwungenen Nase, dem lebhaften Mienenspiel, mit ihrer ganzen überlegenen und doch geschmeidigen Art hatte Helene tatsächlich etwas von einer Pariserin, was in Genevièves Meinung das höchste Lob darstellte. Sie kam sich recht unansehnlich neben ihr vor.
Während sie die Wohnung verliessen, sagte Geneviève: „Und seltsam — nicht? — wie rasch ich gealtert habe. Nein, nein, es ist schon so. Wenn Mutter krank war, lag immer alles auf mir. Und Vater kann gar nicht mehr ohne mich auskommen. Ich sei sein Hausgeistchen, hat er gesagt. Ist das nicht hübsch? Ach, ich liebe Vater.“
Sie gingen hastig über den Republik-Platz. Links, vor dem Museum, in der grellen Sonne, weilte kein Mensch, aber rechts, vor der Präfektur, standen erregt redende Gruppen. In der klaren, weissen Nachmittagsluft zitterten ungewisse Töne wie Musik oder Glockenläuten aus der Ferne; und die Strassenrufe bildeten eine ununterbrochene, aufpeitschende Melodie.
Und immer schärfer und bestimmter hob sich aus dem Gemisch jetzt ein seltsamer Fanfarenruf ab. Helle Trompetensignale waren es.
Sie blieben am Eingang zur Inkermanstrasse stehen. Überall erstarrte jetzt das Leben. Man horchte auf — sah einander an.
Drüben vor der Präfektur rief ein Herr, der den Strohhut schwang: „Das ist die Mobilisation!“
Geneviève wusste von ihrem Vater: nach der gesetzlichen Vorschrift hatte in der ganzen Republik die Polizei unter Trompetenschall das Dekret zu verkünden. Also war es jetzt so weit.
„Hoch die Armee!“ schrie der Herr drüben, den Strohhut schwenkend.
Und da und dort fiel man ein. Aber die meisten setzten sich sofort in Bewegung und stürmten dem Stadtplatz zu, wo sich die Hauptwache und das Hauptblatt der Stadt und des Departements befanden.
Als die beiden jungen Damen im Eilschritt in die Inkermanstrasse einbogen, kam ihnen schon Herr Laroche in höchster Erregung entgegen. Die Fanfaren hatten ihm die Gewissheit gegeben: der Krieg war erklärt!
Der Rausch der Begeisterung kam in den nächsten Stunden über die Stadt. Auch die Besonnenen und die Zagen waren sich nicht mehr klar über die Gefahren, denen der Staat entgegentrieb. Der Heisshunger ausgepeitschten Ehrgeizes, ausschweifende Schwärmerei und verstiegener Stolz rissen alle mit sich fort. Das Wesen dieses Volkes war nie dazu angetan, sich Rechenschaft über Stimmungen abzugeben. Es hätte den als Verräter gekreuzigt, dem es eingefallen wäre, die Vernunft als Richterin anzurufen. Man wollte nicht Geschichte — man suchte den Taumel. Und man war glücklich in ihm.
Unvergessliche Bilder rollten sich vor Laroche und seinen beiden jungen Begleiterinnen ab. Geneviève hatte links, Helene rechts bei ihm eingehängt. Berthe, der die Tränen in den Augen standen, weil sie den Vater nicht auch mit in die Stadt begleiten durfte, hatte Geneviève noch den Hut in den Flur gebracht — sonst wäre die kleine Vizemama am Ende gar barhäuptig mitgezogen.
Auf dem Boulevard de la Liberté kam man noch flott vorwärts, aber durch die Rue Nationale ging es nur im Schritt. Und überall drängten Bekannte an Laroche heran, begrüssten ihn, riefen ihn an. Es war vielen, die ihn sahen, ein Bedürfnis, in dieser erregenden Stunde ein gutes Wort von ihm zu hören. Soviel Überzeugung und Sicherheit lag in seiner Auffassung. Und dies innere Feuer, das in ihm brannte, und das seine grossen, grauen, wimperbeschatteten Augen verrieten, wenn er sie so voll aufschlug!
Auch Helene schwärmte für den Vater ihrer Freundin. Sie hatte sogar seinen politischen Auseinandersetzungen immer gern zugehört, weil er so männlich schön und edel war, wenn er in Begeisterung geriet, und weil er mit seinem Schwung der Rede jeden mitfortreissen musste. Und von allen Freundinnen seiner Tochter verzog er wieder Helene am meisten. Es sprach vielleicht auch der Triumph mit, dass er die hübsche junge Frau allmählich zur Vollblutsranzösin erzog. „Sie ist im Zuge halb zwischen Brüssel und Paris,“ hatte er einmal im Scherz gesagt, „also im besten Begriff, in Lille anzukommen.“
„Und was mich am meisten freut,“ sagte Helene mitten im Gewühl, von dem sie sich wie von einer Woge tragen liessen, „ist, dass es hier keine Schutzleute gibt.“
Laroche meinte lächelnd: „O, sie sind schon da, aber man braucht sie nicht. Ja, das muss man unseren Landsleuten lassen, sie fühlen sich selbst im Rausch der Begeisterung als Kulturvolk ... Und hören Sie diesen wundervollen Rhythmus ...“
Irgendwer hatte mitten auf der Strasse die Marseillaise angestimmt, immer mehr fielen ein. Es klang wirklich schön, Helene kamen unwillkürlich die Tränen in die Augen.
„O sieh, Papa, Helene weint auch!“ sagte Geneviève. „Gelt, man braucht sich deshalb nicht zu schämen?“
Kein Wagen, kein Auto, keine Strassenbahn kam mehr vorwärts. Eine einzige grosse Armee war es, die über die ganze Breite der Rue Nationale nordwärts zog. Arbeiter, Studenten, Verkäuferinnen, Herren jeden Alters, dazwischen keck aufgeputzte Dämchen ...
Die Marseillaise ward übertönt von Trompetenklängen. Des Ausrufers Stimme liess sich dann vernehmen. Aber selbst die dicht dabei Stehenden konnten in dem allgemeinen Gewühl kein Wort verstehen. Wieder Fanfaren. Und alles klatschte Beifall. Und helle, schrille Stimmen erhoben sich aus der Menge: „Es lebe die Armee! Es lebe die Armee!“
Die Plätze vor den Cafés und Restaurants waren von Tischen und Stühlen geräumt. Das wogte in ununterbrochener Flut rund um die Siegessäule, andere Ströme ergossen sich in die breite Rue Faidherbe und zum Nordbahnhof. Für jeden vom Stadtplatz Verschwindenden kamen aber zwei neue hinzu. Vor der Hauptwache stand die Menge festgekeilt. Oben war die Trikolore gehisst. Und immer von neuem begann der Gesang der Marseillaise.
Doch eine schmale Gasse zwischen den lebenden Mauern wussten sich vom breiten Tor des „Echo du Nord“ die flinken Zeitungsjungen zu bahnen, die mit schweren Stössen der Abendausgabe beladen waren.
Und im Umsehen änderte sich das Bild. In die dunkle Masse mischte sich das grelle Weiss. Alle Hände griffen nach den druckfeuchten Zeitungen. Durch Hunderte von Kanälen floss die neue Farbe. Und schliesslich zählten die Blätter, die da rauschend und knisternd entfaltet wurden, nach Tausenden.
Das allgemeine Geschrei sank herab. Einzelne Stimmen traten dafür hervor.
Laroche war mit seinen Begleiterinnen auf den Perron bei der Säule geraten. Selbstbestimmung gab es nicht mehr. „Es wird den jungen Damen zuviel?“ fragte er etwas besorgt.
Sie schmiegten sich beide näher an ihn. „Es wird mir unvergesslich sein!“ sagte Helene. Und Geneviève weinte und küsste heimlich den Ärmel des Vaters, indem sie sich gegen seine Schulter lehnte.
„Das ist der Tag, auf den das arme brutalisierte Frankreich über vierzig Jahre gewartet hat!“ Laroche wiegte sie beide mit sich hin und her. Aber durch Helene ging ein Schauer. Sie fühlte aus Laroches Ton zum erstenmal einen Hass heraus, der sie erschreckte. Galt der Hass auch dem Hause ihres Vaters? Es war ihr ja niemals Heimat gewesen, aber doch ...
Wieder zerriss die Gedankenkette. Laroche begann zu singen. Sie blickte auf. In tiefer Bewegung sang er die Marseillaise. Sie schaute in sein leuchtendes Angesicht, das ganz jung geworden war. Sein Gesang hob sich durch den Wohlklang der Stimme und durch die klare Aussprache so vorteilhaft von dem Durcheinander ab, dass im Umkreis alles aufhorchte. Gegen Schluss der ersten Strophe erst wagten andere einzustimmen. Und nun sang auch Geneviève mit. Und selbst Helene.
Sie war viel zu sehr Phantasiemensch, als dass sie sich dem Schauspiel nicht ohne alle Skrupel hingegeben hätte. Nein, an ihre deutsche Abstammung wollte sie jetzt gar nicht denken. Deutschland hatte ihr kaum mehr als ihre Muttersprache gegeben. Französischem und englischem Einfluss verdankte sie alles, was sie wusste, was sie empfand, was sie war. Nur hinderlich war ihr die deutsche Abkunft gewesen. Und sie hatte ja oft genug in ihren Ferien den eigenen Vater verärgert über die Kleinlichkeit deutschen Beamtentums, über die Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit deutscher Behörden, über den Krähwinkelstandpunkt der deutschen Politik losziehen hören. Und das Wort ihres Vaters, der die ganze Welt kannte, hatte Gewicht. Ihr Mann urteilte noch absprechender. „Dem Deutschen ist nun einmal die Schlafmütze angewachsen,“ sagte er. Und der preussische Gardeassessor war ihm aufs bitterste verhasst. Hatte Helene auf den weiten Auslandsreisen Deutsche getroffen, dann waren es meist Gestalten, denen man am liebsten auswich. Ärmlichkeit, Knickrigkeit neben Protzentum. Die selteneren Landsleute — die eleganten, gewandten, grosszügigeren und aufgeklärteren — legten gleich ihr und ihrem Mann keinen Wert darauf, als Deutsche von Deutschen angesprochen zu werden.
„Nur die vielen jungen Menschen in beiden Ländern tun mir leid, die man da so unnütz hinopfert,“ sagte Helene, als die Hochrufe auf das Militär verbraust waren.
Laroche nickte ernst. „Mein liebes Kind, glauben Sie mir, Deutschland hat in seiner Gesamtheit die Kulturhöhe noch lange nicht erreicht, um sich solcher Verantwortlichkeit bewusst zu werden. Es ist unersättlich. Aber die Vergeltung ist unterwegs.“
Helene seufzte. Sie wusste nichts zu erwidern. Trug Deutschland wirklich die Schuld ganz allein?
Geneviève schrie plötzlich auf. In der Gruppe neben ihr war ein wilder Lärm entstanden. Ein paar junge Burschen drängten an ihr vorbei. Einer blieb mit dem Rockschoss an ihrer Gürtelschnalle hängen. Und so wurden sie alle drei unversehens in einen Knäuel Menschen mit hineingezogen, der sich hin und her schob, ohne dass ein Mittelpunkt erkennbar war. Aber man hörte schlagen, schreien, man sah erhobene Fäuste.
„A bas la guerre!“ Ein Halbwüchsiger war es, der es gerufen hatte. Und erbarmungslos entlud sich der Zorn der Menge über sein Haupt.
„Vive l’armée! A bas Guillaume! Hou! Hou! les Alboches! Conspuez les Alboches! Conspuez Guillaume!“
Laroche hatte die beiden jungen Damen fest an sich gepresst; mit der ganzen Wucht seines Körpers warf er sich rückwärts gegen die anstürmende Menge, die links und rechts an ihnen vorbeidrängte; Schritt für Schritt kamen sie so aus dem Knäuel wieder heraus.
„O Gott — jetzt aber rasch nach Hause!“ rief Geneviève, von Angst gepackt. Ihr Hut hing schräg herab, ihr Haar war gelöst, ein Blusenärmel war halb abgerissen.
Das wüste Toben ward schon wieder übertönt von dem Gesang der Marseillaise. Nur bruchstückweise hörte man sie. Aber die ganze Luft schien davon erfüllt. Bald von hier, bald von dort schmetterten die flammenden Verse. Es war ein Rausch, der alle gepackt hatte.
Endlich hatten sie die Rue Esquermoise erreicht. Durch eine stillere Seitenstrasse entflohen sie dann dem Gewühl.
„Aber ich freue mich, dass wir dabei waren,“ sagte Geneviève aufatmend, sich die nassen Augen wischend.
Laroche machte sich einen Plan zurecht, um mit seinen Begleiterinnen unbehelligt heimzukommen. Die Rue Nationale musste man jetzt unter allen Umständen vermeiden. In dichten, breiten Ketten zog dort das Volk singend, schreiend entlang. Damen waren da nicht am Platze. Er wollte lieber den Umweg um den Sommergarten machen, um den Boulevard wiederzugewinnen. Doch als sie zu dem kleinen Park gelangten, sahen sie, dass sich vorn am Denkmal von Desrousseau ein Spalier von zwanzig, dreissig Reihen staute. Man hörte Musik — helle, fröhliche Militärmusik.
„Die Dreiundvierziger ziehen von der Zitadelle zum Bahnhof!“ Laroche erfuhr es von einem im Seschwindschritt vorbeistürmenden Jungen.
Und da bekam auch Geneviève wieder Mut. Ihr Lieblingsregiment zog aus! O, da mussten sie dabei sein! So viele der Offiziere kannten sie — und die meisten Soldaten stammten aus der Stadt selbst! Auch der Bruder von Angele, ihrer Köchin! Das ganze Regiment war seit gestern auf der Zitadelle zusammengehalten worden. Niemand hatte gewusst, was mit ihm geplant war.
Nun liefen sie alle drei hinter dem Jungen her. Sie hörten das Beifallklatschen und Hochrufen der spalierbildenden Menge und dazwischen die Fanfaren der stolzen Kapelle.
Hinter der Mauer von Menschen konnten sie nichts sehen. Geneviève hüpfte lachend ein paarmal in die Höhe, um einen Blick über die Köpfe zu erhaschen. Aus einem Erdgeschossfenster rief da ein Mann dem Dreiblatt zu: „Im Hausflur steht eine Bank, Monsieur Laroche. Ich werde sie Ihnen durch meinen Jungen schicken.“
„Danke! Danke! Ich hole sie selbst!“ Und Laroche kam gleich darauf, flott eine Bank über dem Haupt balancierend und die Melodie der Kapelle mitsummend, aus dem Hause zurück. Er kannte den Fremden nicht; es kam aber häufig vor, dass man ihn bei seinem Namen ansprach.
Von ihrem erhöhten Standplatz aus übersahen sie bequem den Teil der Strasse bis zum Boulevard, aus dem der Anmarsch der Truppen erfolgte. Aber das waren nicht nur Soldaten, nein, Männer in Zivil, Knaben, Frauen, Kinder, Mädchen zogen aus beiden Seiten der Kolonne mit. Viele weinten. Viele lachten. Viele sangen. Aus den Reihen der Soldaten wurden Scherzworte in die Menge geworfen. Ein blondbärtiger Herr, den man allerdings leicht für einen Deutschen halten konnte, und der festgekeilt in der zweiten Reihe hinter einem Zigarettenverkäufer stand, hatte viel auszustehen. Einer spie sogar nach ihm. Er sei kein Deutscher, verwahrte sich der. „Was will der Uhrendieb?“ riefen sie. „Du, sag’ doch, Alboche!“ — „He, wo hat er seine Mobilisationsorder?“ — „Du, bald trinken wir in München einen Bock!“ So schob sich das weiter und weiter. Dichter Staub lag über allem. Es roch nach Leder und Schweiss und Zwiebeln. Dazwischen flatterten Wolken von Zigarettendampf. Der Blonde lachte nervös und teilte immerzu Zigaretten aus; er kaufte dem Jungen den ganzen Vorrat ab. Er sei Schweizer, versicherte er mehrmals. Aber er blieb während des ganzen Vorbeimarschs ein Angriffsziel. Helene klopfte das Herz, jedesmal, wenn es gegen den Blonden ging, musste sie an Schneider denken; und wieder überschlich sie eine heimliche Furcht vor diesem Volk, dem sie von Kind auf vertraut war, die Furcht, als sei es ihr in der Tiefe des Herzens doch immer noch fremd geblieben.
Aus der Menge auf der anderen Seite der Strasse schrie einer mit fast komisch hell und hoch klingender Stimme: „Marcel, Marcel!“ Und in einer Gruppe von Soldaten hob einer das Gewehr hoch, auf dem ein grosser Rosenstrauss steckte. „Marcel, bring’ mir eine Pendule mit von den Alboches! Gib dir Müh’, dass du die findest, die sie meinem Grosspapa anno Siebzig gestohlen haben!“
Darüber gab’s ein schallendes Gelächter. Am lautesten lachte der Blonde. Einer wiederholte es dem andern. In der einsinkenden Dämmerung und dem dicken Staub unterschied man nicht mehr die einzelnen Gestalten, nur noch die blaue, quirlende, rinnende, brandende Woge, auf der einzelne Reiter vorbeigetragen wurden, Blumen, Bänder, Gewehrläufe, da in die Luft zappelnde Kinderarme, Sommerhüte von Bräuten, Schwestern, Frauen ...
Längst hörte man nichts mehr von der Musik. Aber mit dem neuen Bataillon, dessen Spitze eben um die Ecke bog, kam ein ganz neuer Eindruck. Kein Lärmen, kein Schreien in der Truppe; auch die Volksmenge horchte allmählich auf.
„O, sie singen ‚Quinquin‘!“ sagte Geneviève, die in der Mitte auf der Bank stand. Und sie packte ihres Vaters und Helenens Arm und presste sie an sich. Es erschütterte sie geradezu, dass diese in den Krieg ziehenden erwachsenen Männer den wunderhübschen Einfall hatten, hier beim Vorbeimarsch am Denkmal von Desrousseau, dem Liller Volkssänger, dessen volkstümlichstes Lied anzustimmen, das Wiegenlied im Liller Platt, das wohl den meisten in der Kindheit von Mutter, Schwester, Tante oder Wärterin einmal vorgeträllert worden war. Und da es nun zu Sieg oder Tod ging, wirkte sie so herzlich, so sinnig, die alte liebe Kinderweise.
„Dors, min p’tit quinquin, min p’tit pouchin, min gros rojin, Te m’f’ras du chagrin, si te u’dors point qu’à d’main!“
Sie klatschten Beifall. Sie sangen hüben und drüben mit. Aber die Kehle ward ihnen eng dabei. Nun konnte auch Laroche nicht mehr an sich halten. Er schluchzte plötzlich auf. Aber gleich darauf lachte er, er zwang sich dazu, und dann stimmte er mit seiner schönen Stimme in das Kinderlied mit ein. Dazwischen gab’s wahre Beifallssalven, sobald eine am Denkmal vorbeiziehende Kompagnie gerade eine Strophe beendigt hatte. Und in das zärtlich-neckische Schlummerliedchen mischten sich schon wieder die Fanfaren der Kapelle, die dem letzten Bataillon voranzog.
In Helene kämpften Angst und Rührung. Eine plötzliche Gorge um ihren Mann peinigte sie. Und irgend etwas trieb sie, Geneviève den Gefallen zu tun und dem blutjungen Fähnrich, der den letzten Zug führte, Kusshände zuzuwerfen. „Ja — muss man sie nicht liebhaben?“ sagte sie, nur um nicht zu schweigen.
Geneviève schluchzte leise auf. „Rocher ist erst siebzehn Jahre!“
„Ich freue mich, dass Sie das mit erleben, Helene,“ sagte Laroche. Zum erstenmal nannte er sie bei ihrem Vornamen. Und er küsste erst seine Tochter, dann sie je zweimal auf die Wangen, links und rechts vom Mund. Geneviève fuhr sich immer wieder über die Augen. Sie war ganz aufgelöst. Beim Küssen aber verloren sie das Gleichgewicht, und sie mussten schleunigst alle drei von der Bank hinunterspringen.
Da lachten sie dann und zogen aus dem Umweg nach Hause.
Helene wusste, dass Laroche sie lieb hatte. Es war eine seltsame Mischung von väterlicher Güte und manchmal heiss aufflammender Sinnlichkeit, die den Fünfzigjährigen ganz verwandeln konnte. Sie hatte damit gespielt, sie war es ja gewohnt, dass man ihr den Hof machte. Aber in dieser Stunde trieb sie ihre unbestimmte Angst, mehr als sonst aus sich herauszugehen, in Ton und in Blick, und sie liess es geschehen, dass er sie im Weitergehen zärtlich an sich drückte. Innerlich schalt sie wohl mit sich: das ist Feigheit. Aber so recht kam sie in dem Wechsel der Eindrücke und der Stimmungen gar nicht zur Besinnung über sich selbst. Nur dass sie einen Schutz brauchte, das wusste sie.
In der Inkermanstrasse wurden sie im Flur, im Treppenhaus und in dem langen, schmalen, an den Wintergarten anstossenden Erdgeschosssaal, der nach der Strasse zu als Salon, jenseits der Samtportierenteilung als Speiseraum diente, stürmisch von der ganzen Familie Laroche empfangen. Alle sprachen sie zu gleicher Zeit. Das war eine Aufregung — aber eigentlich kam niemand zu Worte. Am wenigsten die Hausfrau, die darüber mit den Kindern zu schmollen begann.
Helene hatte sich früher eine französische Familie ganz anders vorgestellt gehabt als die Laroches. Die „Apfelgesichter“ hatte sie sie genannt. Laroche selbst war ja als Franzose unverkennbar, auch Geneviève, aber von der blonden, dicklichen, gutmütigen Mama Laroche an bis zum kleinen Benjamin hätten sie alle ebensogut aus Pommern stammen können. Frau Laroche war übrigens sehr gekränkt, wenn man sie nicht für eine Vollblutfranzösin, sondern etwa für eine Flämin hielt. Eine ihrer Grossmütter war sogar Pariserin. Die jüngeren Töchter hatten eine fabelhafte Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Der Ehe waren acht Kinder entsprossen, sechs befanden sich noch am Leben. Die Lücke, die der Tod der zweiten und dritten Tochter gerissen hatte, zeigte sich zwischen Geneviève, die jetzt einundzwanzig Jahre alt war, und der fünfzehnjährigen Berthe. Louise zählte dreizehn, Fleurette elf, Madeleine zehn Jahre. Mit Benjamin, dem jetzt Neunjährigen, hatte der Segen sein Ende gefunden. Familien von so starker Kopfzahl bildeten auch hier in Lille eine Ausnahme, wenn freilich in Flandern das Zweikindersystem nicht so vorherrschte wie in Paris. Laroche konnte sich bei seinem grossen Reichtum den Luxus zahlreicher Erben gönnen. Die Einkünfte aus seinen Weingütern versprachen allen fünf Schwiegersöhnen gute Zeiten. Übrigens stammte auch Frau Laroche aus einer der reichsten Webereibesitzersfamilien des Dreistädtebezirks.
Frau Laroche war ein bisschen weinerlich; sie liess sich gern bedauern, hatte ja auch meist über irgend etwas zu klagen. Sie machte ein Schmollmäulchen gerade wie Berthe und Madeleine. Und immer war es Geneviève, die ihr zusprach, sie beschwichtigte, weil sie wusste, dass der Vater die ewig kindliche Art von Mama nicht mehr recht vertrug.
Die Heimgekommenen wollten von draussen erzählen, die Daheimgebliebenen hatten zu berichten, was an Neuigkeiten inzwischen ins Haus gelangt war. Es war nicht wenig.
Berthe stürmte gleich aus Frau Helene zu, packte sie in ihrer drollig ungeschlachten Art an beiden Armen und rief: „O, — und Manon sucht Sie wie eine Stecknadel. Sie hat drüben bei Ihnen angerufen — bei uns — immer wieder. Manons Vetter André, der Herr Major, hat den Drachman hergeschickt — im Automobil aus Armentières. Ebenezer Drachman ist sein Unterleutnant, Sie wissen doch? Der kam direkt aus Paris. Und da hat er erzählt, er habe Monsieur Martin gesehen, denken Sie, und er sei arretiert!“
„Mein Mann?!“ Helene stürmte, den Backfisch mit sich ziehend, in den Wintergarten. Alle Türen standen auf. Auch die Tür zur Küche. Es war ein Lärmen, ein Geschnatter, dass man sein eigen Wort kaum hörte. „Sag’ doch, Berthe! Aber das ist ja entsetzlich!“
„Ja, auf dem Bahnhof St. Lazare hat er ihn gesehen. O, da waren so furchtbar viel Deutsche, ja, und alle mussten sie ihre Koffer selber tragen, und sie würden nun in ein Konzentrationslager gebracht, alle!“
Berthe sprach unglaublich schnell, sie haspelte ihre Sähe herunter, dass sie am Schluss immer ganz atemlos war.
„Aber mein Mann ist doch kein Deutscher —!“
„O, Sie müssen Drachman hören. Er wollte Monsieur Martin helfen, aber da wäre es ihm beinahe schlecht gegangen. O, eine solche Wut sei aus die Alboches. Und Monsieur Martin hätte immer gerufen: er sei naturalisiert, er sei französischer Bürger, und er lasse sich das nicht bieten! Hören Sie nur Drachman!“
Geneviève war ihnen gefolgt. Mit ein paar Worten unterrichtete sie den Vater, der draussen noch vom Vorbeimarsch der Dreiundvierziger erzählte und vom Gesang des „Quinquin“. Bestürzt kam er ihr nach. Und nun drängten sich alle Apfelgesichter in den Wintergarten, und um den runden Kinderesstisch herum baute sich die ganze Familie aus. Es war inzwischen fast dunkel geworden, das helle Blond der Köpfe bildete einen schimmernden Kranz. Und die hellgrauen Augen mit dem Porzellanweiss blitzten. Benjamin war glücklich darüber, dass Geneviève ganz vergass, ihn zu Bett zu schicken. Geneviève tröstete die Freundin: es könne sich ja nur um ein Missverständnis handeln. Zunächst müsse man mit Drachman sprechen.
Also liess sich Laroche mit dem alten Herrn Ducat verbinden. Die ganze Familie folgte über den Küchengang nach dem Billardzimmer, wo der Schreibtisch mit dem Fernsprecher stand.
Laroches Miene während des Gesprächs, von dem man nicht viel verstand, weil er nur kurze Einwürfe machte, gefiel Helene nicht. Er schüttelte jetzt den Kopf. „Hmhmhm,“ machte er und zog die Brauen zusammen.
Und da ging Helene hastig auf ihn zu und erfasste seine Rechte, die nervös mit der Bleifeder spielte, während er den Schallbecher am linken Ohr hielt. Sie streichelte sie ein paarmal, und dann legte sie sie an ihr Herz. „Solche Angst hab’ ich,“ flüsterte sie, „bitte, bitte, helfen Sie mir!“
Er lächelte ihr zu und liess ihr seine Hand.
„Drüben bei Dr. Goldschmid,“ sagte nun Mama Laroche wichtig, „haben sie ein paar Scheiben eingeschlagen, weil der deutsche Name am Schild steht, und da hat Dr. Goldschmid einen Zettel an die Haustür angeklebt: er sei Franzose und seine beiden Söhne stünden im Heer. O, sonst wär’ es ihm vielleicht schlimm ergangen.“
„Warum erzählst du uns das!“ verwies Laroche seine Frau. Er war verstimmt, so oft seine Frau sich eine Blösse gab; aber durch seine kühl aburteilende Art machte er’s selbst gewöhnlich noch schlimmer. Da musste dann immer Geneviève ausgleichend eingreifen. Da der dicklichen Mama schon wieder die Tränen in den Augen standen, klopfte sie ihr die Wangen und küsste sie. „Gewiss, gewiss, Ma, du meinst es ja nur gut.“ Aber sie schob sie doch mit samt den jüngeren Geschwistern zur Tür und bat sie, dafür zu sorgen, dass Benjamin zu Bett käme, sie könnte sich heute nicht so drum kümmern. „Gelt, du verzeihst, Ma, dass ich eine so schlechte Vizemama bin.“
Frau Laroche war schon wieder getröstet. „Ach, ein Goldkind bist du, Geneviève. Ist sie’s nicht, Berthe?“
„Ja, — und ich muss zu Bette!“ schmollte Benjamin. „Immer wenn es am schönsten wird!“
Darüber lachten sie dann alle durchs ganze Treppenhaus. Man hörte die Kleinsten noch aus dem obersten Stockwerk krähen.
Geneviève hatte sich aufs Billard gesetzt und zog Helene zu sich herauf. „Zunächst bleibt sie bei uns. Nicht war, Papa? Ich schliefe hier keine Stunde ruhig, wenn ich wüsste, sie ist da drüben.“
„Der alte Herr Ducat hat sich nicht gut geäussert?“ fragte Helene.
„Nein.“ Laroche sagte es fast scharf. Ein bisschen Trotz zitterte auch in seinem Ton. Er konnte sehr temperamentvoll sein. „Und darin sah ich mal wieder den ganzen Ducat.“
„Sprich doch, Papa.“
„Er hält es für gerechtfertigt, dass Monsieur Martin mit abgeschoben wird. Da Monsieur Martin kein Franzose sei, habe er auch keinen Anspruch, als solcher angesehen und behandelt zu werden.“
„Aber er ist es doch, er ist es doch!“ wandte Helene weinend ein.
Geneviève strich über ihren Arm. „Ruhe, Ruhe, Papa wird schon helfen. Ein Gang zur Präfektur. Nicht wahr, Papa? Oder vielleicht nur zur Mairie. Dir tun sie schon den Gefallen, die Papiere nachzusehen, um nach Paris Nachricht geben zu können.“
„Für Ducat wäre es eine Kleinigkeit ... Gewiegter alter Notar ... Mit aller Welt hat er amtlich zu tun.“
Laroche ging ärgerlich um das Billard herum. Dann blieb er vor den beiden stehen, stützte sich auf ihre Knie, tätschelte sie und lachte.
„Ja, was soll ich tun, wenn zwei so schöne Augenpaare mich anbetteln?“
„Deine Augen sind viel schöner als unsere, Papa,“ sagte Geneviève. „Gelt, Helene, so oft hast du’s gesagt: wie es einem durchs Herz gehen kann, durch und durch, wenn Papa einen so ansieht.“
„O ihr Schmeichler.“ Fast etwas abwesend sagte er’s. Dann raffte er sich auf und ging zur Tür.
„Ist er nicht lieb?“ fragte Geneviève. „Geh’, Helene, nun hat er aber auch einen Kuss verdient.“
Helene sprang ihm nach und umarmte ihn.
„Hätten Sie Ducat den Kuss auch gegeben, wenn er bereit gewesen wäre, Ihnen zu helfen?“ forschte Laroche.
„O, Vater Ducat!“ Helene lachte. „Er hat einen Bart wie ein Fusssack. Überhaupt ... Wie er nur zu der entzückenden Manon kommt?“
„Vielleicht ist sie ihm allein gar nicht zu verdanken,“ sagte Laroche.
Selten nur sagte er so Leichtfertiges. Geneviève drohte ihm. „Wenn so was nun die Kinder hörten, Papa! Oder Mama!“
„Noch schlimmer, wenn es Ducat hörte!“ sagte Laroche.
Helene atmete auf. Laroche war gutgelaunt — er würde ihr helfen.
Es waren Tage voll beispielloser Erregung. Helene ward das Herzklopfen nicht mehr los. Sie wusste, dass nur die Aufnahme im Hause Laroche sie vor trübem Schicksal gerettet hatte. Fast stündlich brachten die Kinder oder die Mädchen oder Bekannte die wildesten Schreckensbotschaften ins Haus. Da waren in Wambrechies zwei junge Deutsche gefasst worden, die sich an den Eisenbahngleisen zu schaffen gemacht hatten, offenbar Spione. In Fives hatten drei deutsche Anarchisten Telegraphendrähte durchschnitten. Wo auf der Strasse Deutsche erkannt wurden, da fiel die aufgebrachte Menge über sie her. Einer hatte sich auf die Grand’ Place gewagt und unter die Menge gemischt, um die Nachrichten zu lesen, die an der Empfangshalle vom „Echo du Nord“ aushingen. Man hatte sich den jungen Burschen reihum gereicht. In jämmerlichem Zustand war er schliesslich durch die Markthalle seinen Verfolgern entschlüpft.
Eine bestimmte Nachricht darüber, ob der Fall Martin auf der Präfektur schon geklärt war, konnte Laroche nicht erhalten. Die Mobilisation nahm alle Kräfte der Bureaus in Anspruch. Es herrschte in den Schreibstuben aller öffentlichen Ämter eine heillose Verwirrung. Die Mehrzahl der eingearbeiteten Beamten hatte sofort die Feder hinlegen müssen, um zu der Truppe abzureisen. Laroche wäre schliesslich, Helene zuliebe, selbst nach Paris gefahern. Aber mehrere Tage hindurch gab es für Zivilpersonen überhaupt keinen Eisenbahnverkehr, und die Verbindungen waren fürchterlich, man brauchte bis Paris einen ganzen Tag, alle Hauptlinien waren durch Truppentransporte besetzt. Auch Briefe bekam man nicht. Mehrmals am Tage schickte Helene eins der Kinder nach dem Boulevard hinüber, um beim Pförtner, bei der Köchin Nachfrage zu halten. Es war für sie aber nichts angekommen. Wo mochte George stecken, der Ärmste?
Die Begegnung mit Drachman war auch nicht dazu angetan, sie zu trösten. Der Unterleutnant mochte ein tapferer Haudegen sein, ein Seelenkundiger war er nicht. Ebenezer Drachman hatte von der Pike auf gedient, er war nicht mehr jung. Seinem Major war er von alten Zeiten her blind ergeben. Es wurde davon erzählt, dass die beiden mancherlei Abenteuer gemeinsam erlebt hatten. Drachman war eine ins gewöhnliche geartete Ausgabe seines Chefs. Schwarz das Haar, schwarz der Schnurrbart, schwarz die funkelnden Augen. Guter Futterzustand, ein mächtiges, kerngesundes, weisses Gebiss, die Haut an Kinn und Wangen immer bläulich, auch schon beim Heraustreten aus dem Barbierladen. Bei André Ducat ging das alles ins lebemännisch Smarte. Aber was ihm allenthalben Erfolge eintrug, war gewiss auch das skrupellose Draufgängertum.
Helene gegenüber glaubte Drachman durch möglichst realistische Schilderung der Vorgänge beim Abtransport der Deutschen aus Paris sich ein Verdienst zu schaffen. Die Verzweiflung der eleganten Herren und Damen, die ihre Koffer selber schleppen mussten, hatte auf ihn den stärksten Eindruck gemacht. Tröstend meinte er: Herr Martin sei ja französischer Staatsangehöriger, also werde er bald freigelassen werden müssen, auch wenn er vorläufig wirklich in eins der Konzentrationslager der Normandie, der Bretagne oder der Pyrenäen verschleppt werden sollte.
Auf die Strasse wagte sich Helene nun doch nicht mehr. Auch nicht in die Fabrik oder zum Neubau. Übrigens stand ja an beiden Plätzen alle Arbeit still. Die Kriegserklärungen jagten einander, die ersten Nachrichten vom Kriegsschauplatz liefen ein, und es kam dann in der Stadt immer zu aufgeregten Szenen, von denen die Hausgenossen durch die Mädchen erfuhren, die es von der Haustür brachten. Die Botschaft von der Ermordung Jaurès’ ging verhältnismässig spurlos vorüber. Die Sozialistenpartei der Stadt hatte überall grosse Plakate angeschlagen: „Ruhe, Genossen, Ruhe!“ Die Seele der Stadt war jetzt die Zeitungsausgabe an der Grand’ Place. Hunderte, Tausende kamen da zusammen.
Von der russisch-deutschen Grenze brachte das „Echo“ die Kunde, dass die Deutschen mordend, sengend und brennend über das wehrlose russische Bauernvolk herfielen. In diesen Tagen kam die Bezeichnung „Barbaren“ für Helenens frühere Landsleute auf. Sie schämte sich da ihrer Abstammung. Sie ahnte ja nichts von der Kunst der Verleumdung, die die käufliche Presse so meisterhaft handhabte. Noch schlimmer waren die Meldungen aus Belgien. Manon Dedonker verging vor Sorge. Ihr Mann war nicht gekommen; er hatte in Belgien Zurückbleiben müssen, da er der Bürgergarde angehörte. Der Völkerrechtsbruch der Deutschen, ihr grausames Vorgehen gegen die Belgier wurde in allen Häusern voll Entrüstung besprochen. Helene konnte nichts als schweigen. Ost fragte sie sich, ob denn derlei Schandtaten möglich seien. In ihrem Herzen regte sich etwas, das dem widerstritt. Aber ihr Verstand sah die Beweise schwarz auf weiss gedruckt. Und sie stand — wie alle hier — unter dem Bann der Zeitung.
Da brachte Geneviève eines Vormittags die Nachricht: eben, als sie mit der Köchin aus der Markthalle trat, war sie dem Major Ducat begegnet, und der hatte ihr so wundervolle Dinge erzählt von der Stimmung an der Front ... Ein paar Leichtverwundete hatten da allerhand ergötzliche Geschichten mitgebracht ... „Ja, und denkt nur, das Regiment, das er führen soll, wird die Dreiundvierziger ablösen. Es kommt hierher, auf die Zitadelle! Manon weiss natürlich schon! Komm’, Helene, wir wollen sie gleich einmal anrufen!“
André Ducat war früher aktiver Offizier gewesen. Seine masslose Verschwendung, sein Leichtsinn im Spiel und in Liebesabenteuern hatten ihm eine grössere Laufbahn unmöglich gemacht. Fast fünf Jahre war er aus der Front gewesen. Wovon er damals in Paris gelebt hatte, wusste kein Mensch. Durch eine grosse Erbschaft, die ihm wie ein Wunder in den Schoss fiel, sah er sich dann plötzlich imstande, seine alten Schulden abzutragen. Dass er dies zu allererst auch wirklich tat, das ward ihm hoch angerechnet. Seitdem lebte er wieder in Saus und Braus und war der Liebling von aller Welt. Es war nur ein Territorialregiment, das man ihm jetzt übertragen hatte. Durch die lange Pause war er mit seinen vierundvierzig Jahren erst knapp Major. Es hätte ihm aber wohl kaum gepasst, Dienst in einer Truppe zu tun, wo er um ein, zwei Rangstufen unter denen stand, die mit ihm zusammen Fähnrich gewesen waren.
Manon telephonierte: Vetter André sei den Tag über dienstlich beschäftigt, müsse auch im Kasino mit seinen Herren frühstücken, aber zum Tee habe er sich angesagt, und sie erwarte natürlich Geneviève und Helene dazu. Und ob nicht Laroche auch mitkommen wolle, lasse ihr Vater fragen. André bringe eine Fülle glänzender Nachrichten von draussen.
Das ward dann das erste fröhliche Ereignis für sie alle seit Kriegsausbruch, dieser Teebesuch am Boulevard Vauban.
Der Notar Léon Ducat besass am Boulevard, dicht bei der Zitadellenbrücke, eines der prunkvollsten Häuser der Stadt. Es war schon mehr ein Palais, wuchtig in gelbem Sandstein hingelagert mit zwölf Fenstern Breite. Im Erdgeschoss bildete ein Wintergarten die Mitte der Strassenfront. Durch die mächtigen Spiegelscheiben sah man von draussen den hochstrebenden Palmenwald mit den blendend weissen Marmorbildwerken. Abends brannte dort verschwenderisch das elektrische Licht. Ducat liess seinen Reichtum gerne sehen. Das Grundstück dehnte sich mit dem Garten bis zur nächsten Strasse aus. Hinten lagen die Garage, der grosse Stall, die Remise.