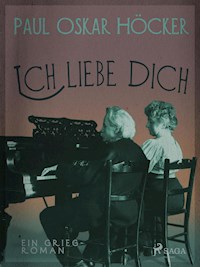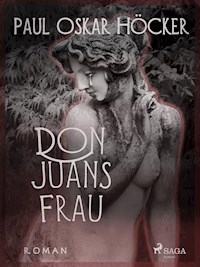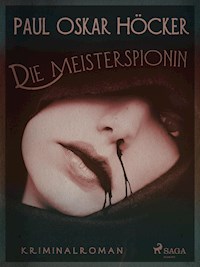
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es beginnt alles in einer renommierten Pension im Botschaftsviertel Berlins. In der angrenzenden Junggesellenwohnung des Kunstseidefabrikanten Dr. Zeck wird die attraktive Frau von Lolli tot aufgefunden. Ein geheimnisvoller Kriminalfall nimmt seinen Lauf. Ist Frau von Lolli wirklich die Herausgeberin der Korrespondenz "Europa" gewesen oder ging sie noch anderen Tätigkeiten nach? Unterhielt sie eine Liebesbeziehung mit Dr. Zeck oder trifft dies nicht eher auf die Rechtereferendarin Petra Astern zu? Zum Autor: Paul Oskar Höcker, geboren 1865 in Meiningen, gestorben 1944 in Rastatt, war ein deutscher Redakteur und Schriftsteller. Höcker verfasste Lustspiele, Kriminalromane, Unterhaltungsromane, historische Romane und auch etliche Jugenderzählungen. Er galt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts als überaus erfolgreicher Vielschreiber. Einige seiner Romane wurden verfilmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Oskar Höcker
Die Meisterspionin
Roman
Saga
Wir alle entsinnen uns noch des geheimnisvollen und aufregenden Kriminalfalles, der im vorigen Herbst ganz Berlin beschäftigt hat. Frau von Lolli, die Herausgeberin der Korrespondenz „Europa“, eine vermögende junge Witwe aus dem Rheinland, elegante Weltdame, die in den ersten Gesellschaftskreisen des Berliner Westens verkehrte, infolge ihrer literarischen Tätigkeit auch gute Fühlung mit verschiedenen Ministerien besass, war am Spätnachmittag des 10. Oktober in der Junggesellenwohnung des Dr.-Ing. Zeck, Direktors der Kunstseidefabriken Bombje & Co., erschossen aufgefunden worden. Dr.-Ing. Benjamin Zeck (die Namen sind hier aus naheliegenden Gründen verändert, auch verschiedene Schauplätze abgewandelt) hatte auf dem Polizeibüro folgendes zu Protokoll gegeben: Frau von Lolli habe sich bei ihm um sechs Uhr zum Tee eingefunden, wie im Laufe der letzten Wochen mehrmals, er sei aber durch eine Nachricht von der Fabrikzentrale gegen halb sieben Uhr abgerufen worden und habe seinen Gast auf kurze Zeit allein lassen müssen; bei seiner Rückkehr habe Frau von Lolli als Leiche auf dem Teppich neben dem Schreibtisch gelegen, den abgeschossenen Revolver in der Hand. Die kriminalpolizeiliche Untersuchung hat damals einwandfrei ergeben, dass es sich nicht um Selbstmord handeln konnte. Dr.-Ing. Zeck ist noch am gleichen Abend unter dem dringenden Verdacht, den Mord an Frau von Lolli als an der ihm lästig gewordenen Geliebten begangen zu haben, verhaftet und ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert worden.
Schon während der Voruntersuchung waren sensationelle Dinge zur Sprache gekommen, die dem Fall neben der rein menschlichen Teilnahme das allgemeine öffentliche Interesse zuwandten: wurden dabei doch sowohl aussenpolitische als auch wirtschaftspolitische Fragen von stark aktueller Bedeutung berührt. Und der Mordprozess Lolli selbst, der eine ganze Woche hindurch die Gemüter nicht nur der Berliner Zeitungsleser in starker Spannung hielt, hat dann durch das in allen Verhandlungsberichten eingehend geschilderte Auftreten der Zeugin Petra Astern jene überraschende Wendung genommen, die späterhin zu zahlreichen juristischen Kommentaren in der Tagespresse und der Fachliteratur Anlass gab.
Aber noch weit über das Tatsachenmaterial hinaus, das die spannende Voruntersuchung und die dramatisch zugespitzte Hauptverhandlung gegen den Angeklagten Zeck enthüllt haben, fesseln uns die Einblicke in die psychologischen Voraussetzungen zu diesem Kriminalfall.
Das Gericht hat gesprochen — doch die Urteile der Laien wollen nicht zum Schweigen kommen. Immer wieder begegnet man im Publikum völlig abwegigen Behauptungen über die Rolle, die Fräulein Petra Astern — die Referendarin Dr. jur. Petra Astern ist die einzige Tochter des 1926 verstorbenen Reichstagsabgeordneten und bekannten Politikers — in diesem Drama gespielt habe. Darum sei hier der ganze „Fall Lolli“ in seinen einzelnen Phasen übersichtlich wiedergegeben. Der Verfasser erklärt dabei, dass er in einem beträchtlichen Teil seiner Darstellung, nach eingehender Prüfung, den Angaben von Fräulein Astern folgt. Man hat diese junge Dame vielfach schwer verdächtigt, sie hat aufs bitterste um die Wahrheit ringen müssen, es wird manche geben, die ihr sogar heute noch misstrauen, — weil ja die Zeitungsberichte über Prozessverhandlungen in ihrer Knappheit keine vollgültigen Stimmungsdokumente sind, den Ton der Rede und Gegenrede, vor allem das lebendige Bild des vor den Schranken Stehenden und Kämpfenden nicht wiedergeben können. Nun, der Verfasser, der Fräulein Astern seit ihrer ersten Kinderzeit kennt, weiss, dass er ihr unbedingten Glauben schenken darf, und es wird sein Gerechtigkeitsgefühl stärken und zugleich seinen Ehrgeiz befriedigen, wenn es ihm gelingt, alle, die seine Ausführungen hier lesen, restlos von ihrer Unschuld an dem Verbrechen zu überzeugen.
*
Die ersten Begegnungen zwischen Petra und dem Angeklagten fanden in der Pension Urbach in der Bendlerstrasse statt. Petra stand damals in ihrem Doktorexamen und nahm daher nur selten an den gesellschaftlichen Veranstaltungen teil, durch die Fräulein Urbach ihrer grossen Fremdenkarawanserei Schliff und Reiz und Bedeutung zu geben wusste. Die Nachbarschaft mehrerer Botschaften, Gesandtschaften und Generalkonsulate mit ihrem ausgedehnten Heimatsverkehr brachte es mit sich, dass unter den ständigen oder vorübergehenden Gästen der Pension Urbach die Ausländer vorherrschten, neuerdings besonders Angehörige der südamerikanischen Staaten. Aber auch die europäischen Länder waren so ziemlich alle vertreten; nur dem Balkan gegenüber zeigte Fräulein Urbach bei der Aufnahme neuer Pensionäre eine gewisse Scheu. Slavische Sprachen hörte man daher in der jetzt schon das dritte grosse Mietshaus umfassenden Pension fast gar nicht; neben Englisch am meisten Französisch und Spanisch, seltener Italienisch. Zu dem Ruf der Pension Urbach und dem Behagen der Gäste hatte es wesentlich beigetragen, dass die Inhaberin neben ihrem grossen gesellschaftlichen Schick auch die Gabe besass, sich mit fast jedem ihrer Pensionäre in dessen Muttersprache unterhalten zu können. Petra war zu Fräulein Urbach in der festen Absicht gezogen, ihre Kenntnisse in den modernen Sprachen durch den täglichen Umgang mit gebildeten Ausländern zu vervollkommnen. Sie hatte indes die Summe von Arbeit unterschätzt, die ihr die Dissertation aufbürden sollte. Während sich in den festlich erleuchteten Empfangsräumen, die das erste Stockwerk der Vorderfront einnahmen, oft das Leben und Treiben wie in einem gutgeleiteten mondänen Badehotel abspielte — mit Gästetees, Musik-, Bridge- oder Tanzabenden und anderen Routs —, sass Petra still für sich in ihrem Balkonzimmer, das nach der Gartenseite lag, und büffelte fürs Examen. Es bedurfte schon des persönlichen Eingreifens von Fräulein Urbach, um die angehende Juristin gelegentlich einmal von ihren trockenen Kommentaren in das bunte Durcheinander der fremden kleinen Welt herüberzuholen, mit der sie Tür an Tür lebte.
Die Gäste wechselten. Man vergass die meisten rasch. Besonders die Nordamerikaner, die einander ja gar zu ähnlich waren — in englischer wie in deutscher Aussprache, im Anzug und Gesichtsschnitt wie in der Naivität ihrer Weltanschauung. Aber unter den länger verweilenden Pensionären entwickelte sich mit der Zeit doch meistens ein gewisser Zusammenhalt. Damit auch der von Fräulein Urbach nach Kräften immer wieder unterdrückte Pensionsklatsch. Dessen neuestes Opfer war der junge Direktor der Kunstseidefabriken Bombje & Co., der Chemiker Dr.-Ing. Zeck, der zwar eine ständige Wohnung auf Schwanenwerder besass, sich aber während des Umbaus der auf dem Grundstück Bendlerstrasse 76 a/c gelegenen Stadtbüros der bequemeren Aufsicht halber in der Pension einquartiert hatte. Das ganze grosse Gelände, dessen Hinterland noch alte kleine Villen aus der Schinkelzeit und mächtige Tiergartenbäume aufwies, gehörte dem Kommerzienrat Bombje. Fräulein Urbach hatte schon mehrfach versucht, den Grossindustriellen zu dem Verkauf der drei Häuser zu bestimmen, die nun allmählich von ihrem Pensionat fast ganz ausgefüllt waren; vergeblich; wenigstens hatte sie aber im Frühling erreicht, dass man ihr auch die drei Erdgeschosse, die unter sich durch Durchbruch schon verbunden waren und nun von den Büros geräumt wurden, für die dringend erforderlichen Repräsentationsräume, für Kontor, Service, Speisesaal und Wintergarten zur Miete überliess. Der Umbau im Innern wie der Neubau der Stadtbüros auf dem für solche Zwecke nach Fräulein Urbachs Ansicht viel zu kostspieligen Gartengrundstück hinter dem Hause brachte für die Pensionäre viel Unruhe mit sich; aber es zog deswegen doch niemand aus der Pension weg. Nur mussten mehrere Umquartierungen vorgenommen werden. Und es wurde damals unter den Stammgästen reichlich über die verschiedenen Manöver getuschelt, durch die es Frau von Lolli, die lebenslustige junge Witwe aus dem Rheinland, durchsetzte, Zimmernachbarin von Dr. Zeck zu werden. Fräulein Urbach hatte dies wohl aus bestimmten Gründen vermeiden wollen, denn sie besass Menschenkenntnis, Lebenserfahrung und Hotelierinstinkt genug, um sich zu sagen: dass die explosive Natur dieser jungen Journalistin an dem eleganten, klugen, repräsentativen, anscheinend kühlen, aber gesellschaftlich äusserst gewandten jungen Herrn sehr rasch Zündstoff finden würde.
Petra hatte von diesem Spiel hinter den Kulissen zunächst noch keine Ahnung. Sie verkehrte ja nur wenig mit den Pensionsgenossen; die meisten jungen Herren sahen sie nur als Tanzpartner bei den grösseren Empfängen. Aber dem allwissenden und allweisen Fräulein Urbach war es nicht entgangen, dass gerade Dr. Zeck ihr’s angetan hatte. Vielleicht waren’s zuerst nur die überraschend blauen Augen, die Petra anzogen. Zeck hatte eine gute Figur, ein intelligentes Gesicht. Und hinter der vornehmen Überlegenheit verbarg sich Temperament. Etwas Spott spielte meist um seine Lippen. Man konnte sich gut mit ihm streiten; wenigstens verstand er’s, sofort witzig in gleicher Münze zurückzugeben, wenn man sich mit ihm auf eine flüchtige Frozzelei einliess. Eine sehr schöne Kopfform besass er übrigens. Petra hatte als Gymnasiastin mit dem Gedanken gespielt, Bildhauerin zu werden, sie betrachtete und beurteilte die Menschen, die ihr begegneten, hauptsächlich nach der Modellierung der Stirn, der Schläfen, der Kinnpartie. So fiel ihr sogleich der gutgebildete Schädel auf. Zeck trug das dunkelblonde Haar ganz kurz geschoren; um so deutlicher sah man über der linken Ohrenpartie die sich nach dem Wirbel strichfein hinziehende Narbe, die von einem winzigen Granatsplitter herrührte.
Zeck war als neunzehnjähriger Student in den Krieg gezogen: er zählte, als Petra ihn kennenlernte, knapp zweiunddreissig.
Im Winter einmal wurde Zeck von einer weisshaarigen, imponierenden alten Dame besucht, die selbst das stockaufrecht sich haltende Fräulein Urbach noch um eine halbe Kopflänge überragte; das war seine Mutter, die Geheimrätin Zeck aus Schwanenwerder. Sie hatte dieselben hellen und grossen „friderizianischen“ Augen wie ihr Sohn. In der Halle war Petra der vornehm wirkenden, sehr liebenswürdigen alten Dame vorgestellt worden. Petra hatte soeben ihren Dr. jur. bestanden, „leider bloss cum laude“, wie sie mit etwas hochmütigem Selbstspott erklärte. Die alte Dame war reizend zu ihr gewesen. „Ich komme so selten in diese weltumwälzende Metropolis, hatte daher vor den gelehrten Jungfrauen hier einen zitternden Respekt. Aber Sie heilen mich nun von allen Ängsten. Wenn man als blutjunger Referendar und Doktor gar — selbst bloss cum laude — ein so frisches und liebes Gesicht hat, und dabei nicht einmal die mir so schreckliche Etonfrisur trägt, dann ist für das Frauengeschlecht der Rucksack mit all’ dem Pandektenkram vielleicht doch nicht so schwer belastend und entnervend, wie ich mir das in gelegentlichem Alpdrücken vorgestellt habe!“ Es entspann sich ein anregendes Plauderviertelstündchen zwischen den an Alter so ungleichen beiden Damen. Frau Geheimrat Zeck nahm Anteil an den persönlichen Schicksalen der jungen Waise. Fräulein Petra Astern hatte vor kaum zwei Jahren den Vater verloren; nähere Verwandte besass sie sonst nicht; sie schien ganz einsam dazustehn. „Sie müssen mich einmal, wenn Sie Zeit haben, auf Schwanenwerder besuchen, Fräulein Doktor Astern. Wollen Sie? Es würde mich freuen. Ohne Umstände: zur Kaffeestunde, auf einem Erholungsmarsch an der Havel, einfach ins Haus eintreten, da bin ich, bitte Schwarz oder Melange. Sie bekommen übrigens auch Tee, wenn sie den vorziehen. Und für einen knusprigen Blechkuchen sorgt meine Auguste regelmässig. Ich selber darf ihn freilich des Zuckergehalts wegen nicht essen, aber er gilt auf Schwanenwerder als Zecksche Familienberühmtheit ...“
Wegen der herzlichen Ansprache seiner Mutter, noch mehr aber wegen der prächtigen Burschenhaftigkeit, die Benjamin Zeck in einem drolligen Gemisch von Zärtlichkeit und Rauhbeinigkeit der alten Dame gegenüber an den Tag legte, war Petra ihm von diesem Tage an wirklich gut. Bei ihr prägte sich das am sichersten darin aus, dass sie bei jeder Begegnung mit ihm einen lustigen kleinen Wortstreit begann; sie konnte überraschende, oft verblüffend offenberzige Dinge sagen, und es kostete Geistesgegenwart, ihr richtig heimzuzahlen.
Sie war dann, im Frühjahr, obwohl sie beim Rechtsanwalt Kötzschau ihren ersten praktischen Dienst „abbüsste“ und fast noch weniger Herrin ihrer Zeit war als während des Examens, zu dem Besuch auf Schwanenwerder fest entschlossen. Dr. Zeck, dem sie’s ins Fabrikbüro sagen liess, wollte das Auto seines Bruders schicken, das sie nachmittags abholen sollte, er selbst gedachte nach Büroschluss im Fabrikauto zu folgen. An diesem Mittag aber brachte das Wohnungs-Gegenüber von Frau Lolli, eine mittelalterliche Dame aus Oslo, die in allem Muff des Hauses sehr erfahren war, zum erstenmal den heimlichen Klatsch über die beiden Zimmernachbarn an die grosse Glocke. Es war sehr peinlich. Da sagte Petra also die Fahrt nach Schwanenwerder wieder ab, sie mied alle Begegnungen mit Dr. Zeck, soweit dies möglich war, und verfiel wieder in ihre fast gesellschaftsfeindliche Isoliertheit des letzten Examenwinters. Der Klatsch ärgerte sie masslos. Sie war durchaus nicht prüde. Nach ihren neun Semestern in Berlin, München und wieder Berlin kannte sie das Grossstadtleben dazu viel zu gut. Sie legte weder auf Einzelfeststellungen Wert, noch beteiligte sie sich je an allgemeinen moralischen Anklagen. Aber in ihrer nächsten Nähe verlangte sie’s doch nach Sauberkeit.
Natürlich merkte Benjamin Zeck, dass die junge Pensionsgenossin ihn vom Tage der Absage an schnitt. Bei einer zufälligen Begegnung, wo sie nicht mehr ausweichen konnte, sagte er ihr’s auf den Kopf zu. Und in diesem Gespräch gab es Spitzen von beiden Seiten. Sie waren beide nicht auf den Mund gefallen. Petra konnte recht angriffslustig sein; wenn sie innerlich engagiert war, sogar sehr scharf. Das reizte ihn nun wieder. Und das harmlose Verhältnis von früher schien damit zu Ende. Auch als sie nach den Sommerferien, die sie auf Hochtouren zugebracht hatte, nach Berlin zurückkehrte und ihr hübsches Gartenbalkonstübchen in der Pension Urbach wieder bezog, blieb die Spannung zwischen ihnen bestehen. Wer ihren gelegentlichen Plänkeleien zuhörte, konnte jetzt befürchten, es müsse jeden Augenblick zu Hieb und Stich kommen. Petras Ton war noch schneidender geworden, ihre Miene noch hochmütiger.
*
Drollig, dass die gewandte junge Witwe aus dem Rheinland sich inzwischen alle Herzen in der Pension, sogar das der mittelalterlichen Splitterrichterin aus Oslo, erobert hatte. Nur Petra Astern hielt sich abseits: Frau von Lolli war überhaupt Luft für sie. Als die Rheinländerin Ende September Geburtstag feierte und aus diesem Anlass einen grossen Tee gab, sparte sie mit Einladungen nicht. Auch ein paar durchreisende Gäste, zu denen sie kaum Beziehungen haben konnte, lud sie ein. Und wer trgend Zeit hatte, nahm an. Schon deshalb, weil eine vielgefeierte Grossfilmdiva, ein berühmter Bariton von der Metropolitan Opera und der beliebteste junge Komiker Berlins, der den Konferencier einer kleinen Vortragsfolge spielen sollte, erwartet wurden. Der Empfang ward ein festliches Ereignis. Bekannte Persönlichkeiten aus verschiedenen Ministerien, Presseleute, Künstler mischten sich in den blumengeschmückten Salons der Pension mit Mr. und Mrs. Soundso und ein paar Dutzend anderer Globetrotter. Auch die rotblondgefärbte Tennismeisterin Madame Ronsard, die soeben Frankreich beim Match draussen im Grunewald vertrat, war der Einladung gefolgt, sowie ihr Gatte (der in seinem tadellosen Anzug eine vollendet schöne Schaufensterpuppe hätte abgeben können, wenn ihn nicht die von einer Malariaerkrankung herrührende gelbe Hornhaut und gelbe Gesichtsfarbe und die vom ewigen Zigarrettendrehen tabakfarbenen Finger etwas unappetitlich gemacht hätten). Es gab eine Reihe musikalischer Genüsse, es wurde getanzt, der Tee zog sich bis in die achte Abendstunde hin, nicht nur kommandierte Attachés tanzten heute, sondern sogar ein leibhaftiger Gesandter, ein Ministerialdirektor und andere Spitzen; die glänzend erleuchteten Räume waren erfüllt von Lachen, schönen Frauen, den neuesten Tanzschlagern und kostbarsten Gewändern, Zigarrettenduft und allerhand andern leichten Wohlgerüchen, und es gab Herren, die sich’s nicht verdriessen liessen, geistig Toilette zu machen, um in dem interessanten Kreis zu wirken. Dazu gehörte auch Dr.-Ing. Benjamin Zeck. Die Büros auf dem Villengelände waren inzwischen fertiggestellt; er wohnte jetzt nicht mehr in der Beletage neben Frau von Lolli, sondern in dem kleinen Schinkelhaus, zu dem man auch die Zugänge durch die beiden Nachbarhäuser benutzen konnte; die Besuche, die er da ausserhalb der Bürostunden empfing, waren also nicht mehr wie früher von dem garstigen Wachtposten aus Oslo zu kontrollieren. Zeck pflegte nur mit jungen und hübschen Tänzerinnen zu tanzen; die Dame aus Oslo hatte darum keine Aussicht, von ihm bemerkt zu werden. Er aber wurde heute vom Geburtstagskind ganz besonders ausgezeichnet; wieder und wieder sah man Frau von Lolli in seinen Armen. Sie hatte beim Tanzen eine Art, sich mit ihrem Tänzer körperlich zu vereinigen, die von der Dame aus Oslo absolut nicht gebilligt wurde. Doch Frau von Lolli merkte das nicht. Sie schien heute im Glück zu schwimmen. Für jeden Gast fand sie liebenswürdige Worte. Sie sprach die drei Hauptsprachen fliessend. Natürlich scherzte man in einzelnen Zirkeln darüber, den wievielten Geburtstag sie wohl heute feiern mochte. Manchmal wirkte sie wie sechsundzwanzig, manchmal wie zweiunddreissig. Fräulein Urbach, die ja die Anmeldezettel zu unterschreiben pflegte und das Alter wissen musste, schwieg darüber; aber die Dame aus Oslo munkelte etwas von siebenunddreissig bis vierzig. Das war unbedingt übertrieben. Frau von Lolli wirkte in ihrer äusseren Erscheinung auf den ersten Blick garnicht so besonders glänzend. Ihre Gestalt erreichte kaum das im modernen Sportleben selbstverständliche Mittelmass. Und sie neigte auch sichtlich zur Fülle. Ihr etwas puppenhaftes Gesicht mit den beiden Grübchen und dem vollen Kinn gab ihr freilich gerade den jugendlichen Anstrich. Sie arbeitete unablässig an sich, das heisst an ihrer Linie. Die Vorstellung, stark zu werden, trieb sie oft zu ganz verrückten Massnahmen. Plötzlich brach sie auf, mitten in einem Gespräch, um ein Dampfbad zu nehmen. Oder sie hatte unversehens wieder mit Reiten, Turnen, Schwimmen oder Laufen begonnen. Da musste ernsthaft trainiert werden. Oder sie empfing hier in ihrer Wohnung oder auch in ihrer Redaktion am Anhalter Bahnhof einen Fechtlehrer, eine Masseuse, einen Gymnastikprofessor. Man durfte sich bei ihr über nichts wundern. Fabelhaft geschickt im Erfassen und überraschend schnell in all’ ihren Entschlüssen war sie. Das hübsche, fast kindliche Gesichtchen verriet das kaum. Aber aus ihren etwas verschleierten, vergissmeinnichtblauen Augen (Petra nannte die ihr unangenehme Farbe: Vergissmeinnicht in Milch gekocht) konnte es gelegentlich Blitze schiessen, und dann merkte man, dass sie klug war, sehr klug sogar. Sie kleidete sich kostbar, doch ohne jede Überladung, mit viel Geschmack. Unbegreiflich, woher sie die Zeit auch noch für Konferenzen mit Schneider und Schneiderin nahm. Ab und zu fuhr oder flog sie nach London oder Paris und kam von da neu ausgestattet zurück. In Paris liess sie sich stets auch die Dauerwellen machen: die gleichmässig rundum in kurzen Etagen festliegenden, wie in einer Puppenperücke wirkenden Locken ihres superoxydhellblonden Bubikopfes verschoben oder verdrückten oder verhedderten sich nie.
Petra hatte die auch an sie ergangene Einladung zu dem völkerverbindenden Geburtstagstee unter irgendeinem Vorwand — der ihr inzwischen wieder entfallen war — abgelehnt. Als sie kurz vor neun Uhr von ihrem Balkonzimmer aus den Gang entlang kam, um die Telephonzelle aufzusuchen, traf sie am offenen Eingang des gelben Salons mit Zeck und dem Geburtstagskind zusammen. Die beiden tanzten durch die breite Flügeltür. Frau von Lolli hielt ihren Tänzer wieder eng umschlungen. Sie summte einen sentimentalen englischen „Waltz“ (die kleine Tanzkapelle war schon seit einer halben Stunde entlassen), sie hatte die Augen geschlossen und den Mund zu ihrem Tänzer erhoben... Als ob sie die Begegnung mit Petra fühlte, riss sie plötzlich im Summen ab, öffnete die Augen und löste sich von ihrem Partner, in sofortiger Beherrschung der Konversationsform. „Oh, wie schade, Fräulein Doktor Astern, ich wusste ja nicht, dass Sie nun doch zuhause geblieben sind — ich vermutete Sie bei Ihrer Konferenz —, sonst hätte ich Sie selbstverständlich gebeten, noch zu meinem kleinen Fest zu kommen. Es war viel Stimmung.“
„Das sehe ich, gnädige Frau. Meine Arbeit hat mich bis jetzt festgehalten. Verbindlichsten Dank.“ Damit wollte sie an dem Paar vorbei.
Benjamin Zeck ärgerte sich. Frau von Lolli kompromittierte nicht nur sich selbst, sondern auch ihn mit ihren hektischen Anwandlungen. Sie hatte ihn vorhin mit dieser Walzerumarmung ganz unversehens wieder überfallen. Retten liess sich nun nichts mehr; jedes Wort machte die Sache nur noch peinlicher.
Aber Frau von Lolli schien das nicht anzufechten. „Sind Sie mir eigentlich böse, Fräulein Doktor Astern?“ fragte sie naiv und zutraulich und streckte die Hand nach der Referendarin aus.
Fräulein Urbach kam gerade mit Madame Ronsard, der Grunewald-Championne, in den gelben Salon und meinte sofort: „Wer könnte Ihnen böse sein, liebes Geburtstagskind!“
„Bitte, sagen Sie doch?“ drängte Frau von Lolli.
„Ich gehe meinen Weg geradeaus, gnädige Frau,“ erwiderte Petra in ihrem dunkelgefärbten Ton und hob das Kinn, sodass sie über den blonden Bubikopf der etwas kleineren Rheinländerin hinwegsah, „und kümmere mich um nichts, was links und rechts der Strasse im Chausseegraben vorgeht.“
Das war so verächtlich herausgestossen, dass ein paar Sekunden lang ein bedrücktes Schweigen herrschte.
Der Augenblick dieses Zusammentreffens blieb Fräulein Urbach—aber auch Benjamin Zeck—noch lange im Gedächtnis. Das flackernde Licht der Kerzenbeleuchtung im gelben Salon bemalte die beiden Frauenköpfe: den des hübschen blonden Püppchens und den der ernsten, äusserlich kühlen, innerlich leidenschaftlichen Petra Astern. Petras feiner Kopf mit den dunklen, klugen Augen erhielt das Besondere durch die schöngeschnittene Nase und das halbkurz geschnittene braune Haar, dessen leicht sich lockende Spitzen links und rechts übers Ohr ins Gesicht hinein fielen und es noch durchgeistigter erscheinen liessen, weil es so noch schmaler wirkte.
‚Sie überragt als Mensch, als Charakter, die andere hoch!‘ musste jeder sagen, der Petra mit Frau von Lolli verglich. Zeck fühlte es in dieser Sekunde geradezu wie beschämt.
Aber Petra ging weiter, als ob sie von nichts berührt sei.
„Ich habe ihr doch niemals etwas getan!“ sagte Frau von Lolli bittend, als suche sie Schutz bei Fräulein Urbach.
Fräulein Urbach zog sie künstlich lachend und lebhaft plaudernd mit sich fort. Oh, im Empfangszimmer seien noch Blumen und Blumenkörbe für das Geburtstagskind angekommen; da gäbe es jetzt noch viel Arbeit!
... Das war Mittwoch den 26. September, vierzehn Tage vor der Ermordung der Frau von Lolli.
*
Petra fühlte, dass sie sich in ihrer Ausdrucksweise vergriffen hatte. Durch die Schärfe der Tonart, die sie angeschlagen, hatte sie sich Frau von Lolli gegenüber ins Unrecht gesetzt. Sie war noch den ganzen folgenden Morgen unzufrieden mit sich. Dr. Kötzschau hatte sie aufs Amtsgericht bestellt, wo er ein paar unbedeutende Klagesachen vertreten musste. Den letzten Fall überliess er der Referendarin, in der ihn nicht trügenden Annahme, dass es gar nicht mehr zur Verhandlung kommen würde, weil die Zeit zu stark vorgerückt war. Petra wartete pflichtgemäss die verlorenen Stunden ab, kehrte dann aber nicht mehr aufs Büro zurück. Das Wetter war noch ganz sommerlich. Sie fuhr nach Wannsee und besuchte eine Bekannte im Akademischen Bootsklub. Es lockte sie zu schwimmen; ihr Badeanzug befand sich noch im Klubhaus in Verwahrung. Weit schwamm sie in den See hinaus. Und als sie vom Wasser aus die hübschen Villen von Schwanenwerder sah, entschloss sie sich, heute endlich ihren Besuch bei Frau Geheimrat Zeck auszuführen. Sie fürchtete — im Unterbewusstsein, ohne dass sie sich’s eingestand —, dass ein gewisser junger Herr seiner Mama gegenüber die Äusserung fallen lassen könnte: diese Referendarin Astern sei eine freche Berliner Pflanze, die man als Dame nicht für voll ansehen könne. Dem musste vorgebeugt werden.
Auf einem Riesenumweg — denn sie hasste das Freibad mit seinem Schlafstubengeruch, und mied darum die kürzere Durchquerung — gelangte sie zu der klemen Halbinsel, die nördlich vom Badestrand den Wannsee von der Havel scheidet. Da sich auf dem Werder keine Restaurants befinden, nur Privatvillen in kleineren Parks, herrscht dort wohltuende Ruhe. Nach dem Lärm am Freibad empfindet der Spaziergänger diese Stille wie ein Geschenk. Petra hatte bald das Gartentor gefunden, an dem sich der Name Zeck auf einer kleinen Bronzetafel neben der elektrischen Klingel befand: es war noch das Schild des verstorbenen Geheimen Medizinal-Rats Professor Dr. August Zeck.
Ein ziemlich grosses Landhaus mit winzigem Vorgarten. Hinter dem Hause aber zog sich ein weites Grün bis zum Havelstrand hinunter. Rechts und links von dem englischen Rasenplatz befanden sich üppige Staudenbeete. Es leuchtete da ganz sommerlich: Phloxe, selbst Rittersporn blühten noch. Alles beherrschend prangten aber in dichten Gruppen unzählige Dahlien in buntgemischten Farbentönen.
Frau Zeck sass in der offenen Veranda, obwohl es schon ziemlich kühl vom Wasser heraufkam. Sie hatte die Pelzjacke angezogen und eine Decke über die Knie gelegt. „Ich kann mich von dem Bild nicht trennen,“ sagte sie zu dem unverhofften Besuch, als müsse sie sich entschuldigen, „die Dahlien blühen diesen Herbst so wild wie nie, und nun färben sich auch schon die Linden am Wege bunt und die Birken unten am Ufer. Das blaue Havelwasser und der himbeerfarbene Sonnenuntergang noch dazu ... Ich weiss ja, die Maler von heute nennen das kitschig, aber ich habe nun ’mal so einen naturproletischen Geschmack. Wir müssen jetzt wohl ins Haus, liebes Fräulein Astern, ich werde sonst von den Jungens ausgescholten, dass ich Sie Stadtkind wegen einiger ländlicher Palettenklexe der Gefahr eines gigantischen Herbstschnupfens aussetze!“
„Ich himmele gern noch ein Weilchen mit, gnädige Frau,“ sagte Petra lächelnd.
„Wenn es Ihnen wirklich kein Opfer ist ... Also geben Sie mir Ihren Arm, liebes Kind, wir schlendern dann noch über den Strandweg.“
Petra ging in diesem Viertelstündchen mehr aus sich heraus als sonst. Es tat ihr so wohl, mit einem natürlichen, harmonischen, erfahrenen Menschen zu sprechen. Der glückliche Optimismus, der von der Geheimrätin ausstrahlte, hüllte sie so ein, dass sie sich bald ganz geborgen fühlte. Die alte Dame schien es gewohnt, von jungen Leuten ins Vertrauen gezogen zu werden. Sie wusste ja auch schon, dass Petra Astern ein besonders einsames Wesen war. „Von Ihrem Vater las man viel. Die Jungens stritten sich oft über seine Politik. Meine Söhne gehören den verschiedensten Richtungen an. Das ist für die Stimmung im Hause sehr erfrischend, aber für die Geschäftsordnung nicht immer ganz bequem. Sie haben keine Fühlung mehr mit dem Kreis Ihres Vaters? Er hat ja eine unendliche Schar von Anhängern gehabt.“
„Die Partei hat ihn mir zu seinen Lebzeiten völlig entzogen — und nach seinem Tod hatte sie mir nichts mehr zu bieten.“
Eine nachdenkliche kleine Pause. Armes Ding! dachte Frau Zeck und zog im Weitergehn Petras Arm fester an sich. „Und sagen Sie mir einmal — wenn Sie mir überhaupt vertrauen wollen — wie war Ihr Vater im Leben eigentlich?“
„Ein wirkliches Leben lebte er ja gar nicht“, sagte Petra. Ein melancholisches, etwas bitteres Lächeln stand auf ihrem Gesicht. „Die Partei war ihm alles: Glück, Gott, Zeit, Familie, Arbeit, Erfolg. Sein Lebenselement war die Wahlperiode. Da verdreifachte er sich an Energie. Oft mehrere Reden an einem Tage. Und dazwischen die Reisen. Er scheute unterwegs keine Strapazen. Wenn der D-Zug nicht zurechtkam, wurde im Auto ein Achtzigkilometertempo angeschlagen. Und natürlich wusste oft das Flugzeug aushelfen. Hunderttausende wollten ihn im Verlauf einer Woche hören. Wenn er zurückkehrte, körperlich erschöpft, dann strahlte er doch immer vor Befriedigung. Wir verstanden uns in seinen letzten Lebensjahren recht schlecht. Er nahm mir’s wohl übel, dass ich nicht regeren Anteil an seinen Triumphen nahm. Meine Gleichgültigkeit der Partei gegenüber verdross ihn. Ich habe es ihm ja nie gesagt, aber wenn er so geschäftig, von sich und seiner Mission erfüllt, den Beifall noch in den Ohren, heimkam und mich flüchtig auf die Stirn küsste, dann hatte ich immer das Gefühl: er unterscheide sich eigentlich in nichts von einem verwöhnten Operntenor, der überall dieselbe Arie singt.“
„Hm. — Und Ihre Frau Mutter?“
„Mama ist früh gestorben. Als ich in Quarta sass. Das ist nun schon über ein Dutzend Jahre her. Sie muss sehr stolz auf Vaters wachsende Erfolge gewesen sein. Wenigstens fühlte ich es wie einen versteckten Vorwurf für mich aus manchem Ausspruch heraus, den er mir gegenüber tat.“
„Die Jungens brechen heute abend hoffentlich keine Reichtagsdebatte vom Zaun. Ich glaube, ich wäre ein undankbarer Tribünenbesucher, wenn Julius wieder sein Paradepferd aus der Box herausholte. Für ihn war doch Astern der einzige Mann im Reich, der dem Vaterland und nicht der Partei diente.“
„Ich bin von Hause aus keine Bilderstürmerin, gnädige Frau. Und gar in solchen Fällen weiss ich wundervoll zu schweigen. Denn Begeisterung ist ja an sich etwas so Schönes.“
„Ich sehe schon, liebes Fräulein Astern, ich muss dafür sorgen, dass Sie bald einen netten Mann bekommen. Ihre Einsamkeit bedeutet ja einen sündhaften Verlust. Warum sollen all’ die klugen Sachen, die Sie zu sagen wissen, keinen verständigen Mithörer finden? Am liebsten würde ich sogleich ein Komplott mit Ihnen schmieden. Mein Jüngster, der Benjamin, macht mir nämlich ein bisschen Sorge. Den müsste ein fabelhaft gescheites Mädel ’mal am Ohrläppchen kriegen und tüchtig zausen, damit er sich besinnt und dieser schrecklich-blonden Frau Susi oder Susanna den Laufpass gibt. Aber wenn sich Mütter einmengen, dann erreichen sie ja meist gerade das Gegenteil.“
Petra war es durch uud durch gegangen, als der Name der Fremden fiel. Sie hatte nicht angenommen, dass der Klatsch aus der Pension schon bis hierher gedrungen sei. Sie selbst wollte mit keiner Silbe auf das Thema eingehn. Frau Zeck erwartete es auch nicht, sie war jetzt entschlossen, ins Haus einzutreten: das Himmelsfeuerwerk erlosch und man sah schon den Atem.
Als Frau Zeck mit ihrem Besuch in die Diele gelangte, wo im englischen Kamin ein Lustfeuerchen brannte, gab es einen grossen Aufstand. Die drei ältesten Söhne des Hauses erhoben sich scharrend und kamen den Eintretenden entgegen. „Hier meine Jungens“, stellte Frau Zeck das Vierteldutzend kurzerhand vor. „Und hier Fräulein Petra Astern, angehende Juristin, Doktor, was ihr wollt, vor allem aber meine jüngste Freundin.“
In dem Halbdunkel konnte Petra die „Jungens“ nicht recht erkennen. Das hinter ihnen mit eingetretene alte Gesellschaftsfräulein machte jetzt aber Licht, und da hatte Petra Mühe, ihre Verblüffung zu verbergen. Die „Jungens“ waren nämlich drei Männer von gut über vierzig Jahren. Benjamin, das „Nesthäkchen“, der ja auch schon auf die Mitte der Dreissig zusteuerte, befand sich nicht dabei. Frau Zeck gab in ihrer humorvollen Art noch ein paar Erläuterungen über ihre Söhne, und es wirkte sehr lustig, wie die sich’s scheinbar geschmeichelt gefallen liessen, um dann kampflustig ihre Erwiderungen anzubringen. Das stand für Petra sofort fest: sie schwärmten für ihre Mutter, nein, sie vergötterten sie. Übrigens war es geradezu lächerlich, wie ähnlich die Augen all’ dieser Menschen waren: dasselbe helle, strahlende Blau der Mutter, ganz ebenso wie Benjamin es hatte. Auch im Gehaben, in der übrigen Erscheinung glichen die Brüder einander: gross, gewichtig, breitschultrig wie die Mutter waren sie, aufrecht, fraglos nicht unbedeutende Männer. „Lauter Junggesellen,“ sagte Frau Zeck, „ist es nicht unerhört?“
Der Älteste, Dr. August Zeck, der das Erbe des Vaters übernommen hatte, die Riesenpraxis des grossen Sanatoriums in Nikolassee, wandte ein: „Diese Bemerkung, mein gnädiges Fräulein, pflegt Mummi gewohnheitsmässig einzustreuen, damit darauf einer von uns galant-verschlagen erwidern kann: wir hätten’s zuhause so gut, Mummi sei eben selbst daran schuld, dass uns kein anderes Weib unter der Sonne mehr gefallen kann.“
„Vor diesem Herrn, liebes Fräulein Petra, warne ich Sie ganz besonders,“ sagte Frau Zeck lachend, „er ist durch wehrlose Patienten und ein Heer von gläubig zu ihm aufschauenden Pflegeschwestern masslos verwöhnt.“
„Bei uns heisst er dafür Mors Imperator!“ erklärte Professor Julius, der Zweitälteste. „Nun kommst du an die Reihe, Paulchen!“ wandte er sich an den Dritten. „Sag’ etwas Geistreiches. Als Verleger wissenschaftlicher Werke bist du dazu verpflichtet, übrigens hast du ja die schönste Auswahl, beinahe kostenlos.“
„Reizt ihn nicht, Jungens,“ mahnte Frau Zeck, „sonst legt er euch wieder wie neulich mit dem posthumen Rabelais hinein.“ Alle drei lachten.
Soeben fuhr draussen das Auto Benjamins vor. „Ich stelle fest — Ben kommt vertragswidrig pünktlich zum Abendbrot!“ sagte der Geschichtsprofessor. „Ein Fabrikdirektor muss doch eigentlich schon des Kredits halber so tun, als ob ihm seine Millionengeschäfte auch nicht zwei Minuten Zeit übrigliessen.“
Petra hatte sich weit über Absicht hier aufgehalten. Aber als sie aufbrechen wollte, wehrte die Geheimrätin energisch ab. „Seltenes Schauspiel — alle vier Jungens ’mal um den Tisch herum — das Gezanke müssen Sie miterleben, Fräulein Astern. Die Sache kann heute gut werden.“ Frau Zeck lachte schon gewissermassen auf Vorschuss.
*
Zwischen Petra Astern und Benjamin Zeck herrschte bei der Begrüssung natürlich Waffenstillstand. Sie ignorierten beide den gestrigen Vorfall.
Benjamin Zeck hatte für sein seltenes Erscheinen hier draussen die glaubhafte Erklärung, dass er während der Verlegung der Stadtbüros und deren Neueinrichtung stets rasch auffindbar sein müsse. Auf den besonderen Wunsch des Generaldirektors war er für die ganze Zeit des Umbaues nach der Stadt gezogen. Die kleine Wohnung in der Schinkelvilla sollte später weiter ausgebaut werden, damit sie einem der verheirateten Direktoren angeboren werden konnte. In ihrem jetzigen Ausmass entsprach sie noch eben den Anforderungen, die an ein Junggesellenquartier zu stellen waren. Frau Zeck kündigte ihrem Sohn ihren Besuch für einen der nächsten Tage an. Sie wolle einmal nach dem Rechten sehn. Es gehe doch nicht an, dass er ganz ohne Bedienung Hause, nur morgens eine Aufwartefrau beschäftige. Benjamin meinte, das sei ja bloss für den Übergang. Solange die Registratur und die sehr wichtigen Fabrikationspapiere noch nicht richtig in den Schliessfächern eingeordnet seien, wolle er fremde Personen, die ihm nicht als ganz einwandfrei bekannt seien, nicht in die Räume hereinlassen, schon gar nicht während seiner Abwesenheit.
„Wisst ihr das neueste?“ sagte er bei Tisch. „Wir kriegen einen Riesenprozess. Wir: das heisst Bombje & Co. Die Krimmlerwerke in Mainz behaupten nichts Geringeres, als dass wir mit unserer neuen Seide, Marke G, ihr Verfahren kopieren. Sogar ihre Werkzeuge, ihre Maschinen, kurz die ganze Fabrikation.“
„Die Marke G ist doch deine Erfindung?“ warf der Älteste ein.
„Ist sie. Ihr wisst ja selbst, wie ich daran laboriert habe. Da im Keller neben der Remise im kleinen Studio.“
„Hiess bei uns schon immer: Hexenküche!“ erläuterte Frau Zeck dem Besuch.
„Und in der Fabrik haben Ketschendorfer und Seidl monatelang Tag für Tag Fortschritte — oder Nichtfortschritte — in stiller Qual oder Spannung oder auch Schadenfreude miterlebt. Ohne richtigen Maschinenfachmann hätte ich die Versuche ja gar nicht anstellen können. Der Generaldirektor ist über das ganze einschlägige Gebiet unterrichtet. Er kennt jede Marke, die auf dem Markt auftaucht. Ihm waren auch die Fabrikate der Krimmlerwerke bekannt. Ganz ausgeschlossen sei’s, sagt er, dass die ein auch nur annähernd ähnliches Fabrikat aufzuweisen gehabt hätten. Ein ganz minderwertiges Konkurrenzmanöver sei das jetzt. Eigentlich unter der Würde der Firma Bombje & Co., auf derlei Gekläff ernsthaft einzugehn. Aber er hat sich doch gleich den Syndikus kommen lassen, um eine geharnischte Erklärung abzugeben und die kleinen Herrschaften aus Mainz gebührend in ihre Schranken zurückzuweisen.“
„Famos gesagt: gebührend in ihre Schranken zurückzuweisen,“ lobte Paulchen. „Man hört es ordentlich säbelrasseln.“
Frau Zeck hatte sich heute nicht auf Fachsimpelei eingestellt; sie war unzufrieden mit Benjamins trockenem Bericht. „Wenn ihr in Tegel draussen einen tüchtigen Juristen braucht,“ sagte sie mit geheimnisvoller Miene, „dann wendet euch nicht immer an den alten Justizrat Hörnitz, sondern lasst auch ’mal eine junge Kraft die Feuerprobe bestehn.“
„Mummi protegiert Sie offenbar, gnädiges Fräulein,“ flüsterte der Geschichtsprofessor geheimnisvoll Petra zu. „Fabelhafte Aussichten eröffnen sich für Sie.“
„Vorläufig heisst es erst die schwindelndhohe Position eines Gerichtsschreibers überwinden,“ gab Petra zurück.
„Das sind doch wohl ganz kleine Pintscher, diese Mainzer?“ nahm Paulchen das Thema wieder auf. „Komm doch schon endlich zu Rande, Ben. Ist Schadenersatz gefordert? Wie soll sich die Sache weiter abspielen?“
„Weiss ich selbst nicht. Ich habe zunächst einmal eine Denkschrift über die Entstehung unserer Marke G, deren Fabrikation, Rezepte und Maschinen aufgesetzt, natürlich ohne irgendetwas von unseren Geheimnissen zu verraten.“
Petra lächelte. Gerade in dem Bagatellstreit, in dem sie heute ihren Rechtsanwalt hatte vertreten sollen, war eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs anhängig gewesen. „Kötzschau hatte sofort seinen Klienten vermahnt, vorsichtig zu sein. Es sei ein ganz bekannter Trick, den Konkurrenten zu zwingen, dass er zu seiner Entlastung vor Gericht Fabrikationsgeheimnisse preisgebe, die der Kläger sich dann zunutze machen könne.“
„Nimm dir ein Beispiel, Ben, an dem, was unsere junge Porzia sagt.“ Frau Zeck nickte Petra wie vertröstend zu, sie erwartete noch irgendeine kleine Teufelei ihrer ‚Jungens‘. „Als Dank für Ihren warnenden Hinweis muss Ihnen die Firma Bombje zu Weihnachten einen schönen Karton Marke G schicken. Einschmeichelnd weiche Waschseide in ausgewählten Mustern, garantiert farbecht.“
„Aber für Bucheinbände unter keinen Umständen zu empfehlen,“ erklärte der Verlagsbuchhändler. „Ich werde euch, lieber Ben, meine Kundschaft kaum zuwenden können.“
Benjamin lachte. „Das wird Bombje & Co. einen Riesenschreck einjagen. Im Jahre ein Verlust von gut sechzig Metern. Wie?“
„Immerhin steigerungsfähiger Absatz. Wenn ich zum Beispiel das neue Buch von Julius in Verlag nehme, in Luxusausgabe, echt imitierte Kunstseide ...“
„Ein Buch von Julius?“ rief August. „Du Ärmster! Über den Vertrag zu Olmütz? Ich garantiere zweiundfünfzig Exemplare. Natürlich einschliesslich derer, die Mummi kauft, um sie allen teuren Anverwandten unter dem Weihnachtstisch aufzubauen. Aber Olmütz und Seide —?“
Paulchen wehrte überlegen ab: „Du ahnst nicht, mein Teurer, wie sehr sich dein Bruder Julius modernisiert. Sein Buch wird ein Leckerbissen für die ganze und halbe Welt. Es enthält nämlich die allerneuesten geschichtlichen Quellen über die Gräfin Königsmark.“
„Ihr Verderbten!“ rief August. „Kann ich übrigens nicht erst ’mal das Manuskript lesen?“
„Unmöglich, Gustel. Für Sanatorien ist das keine Lektüre. Es könnte dein ganzes Schwesternpersonal demoralisieren.“
„Grundgütiger!“
Nun waren sie so richtig im Zuge. Und es ging dann Schlag auf Schlag. Frau Zeck hatte sich behaglich zurückgelehnt und lachte oft so herzlich, dass auch Petra mitlachen musste.
Der Geschichtsprofessor gab schliesslich in seiner etwas feierlichen Art ein paar neue Forschungen aus dem Briefwechsel der Gräfin mit Brühl zum besten. Er trug die betreffenden Stellen in dem gezierten Französisch jener Zeit vor. Sie waren ziemlich papriziert.
„Ein Glück,“ sagte Frau Zeck zu ihrem Gast, „dass wir überhaupt kein Französisch verstehen.“ Aber sie musste sich die Lachtränen aus den Augen wischen, als sie, Petras Arm nehmend, die Tafel aufhob, um in die Diele zum Kamin zurückzukehren.
Hier wurde von der Gesellschafterin der Mokka eingeschenkt, August stellte eine kleine Batterie von Likören auf, Paulchen versorgte die Gesellschaft mit Rauchmaterial. „Sie brauchen sich nicht daran zu stossen, Fräulein Petra,“ sagte Frau Zeck, „dass ich keine Zigarette nehme — ich rauche dafür nach dem ersten Schluck Mokka eine kleine Havannazigarre.“ (Die war übrigens gar nicht so klein.) Zu diesem Nachtischplauderstündchen stellte sich noch ein Ehepaar aus Wannsee ein, ältere Exzellenzen. Die Unterhaltung floss munter fort, löste sich nun aber in Einzelgespräche.
So kam es zum erstenmal zwischen Petra und dem jüngsten Sohn des Hauses zu einer eingehenderen Aussprache.
Benjamin Zeck wollte sich irgendwie rechtfertigen, denn er fühlte sich schuldig. Petra war zu scharfsinnig, als dass sie die Beweggründe nicht sofort erriet. Das Renkontre vom vorigen Abend wurde auch jetzt mit keiner Silbe berührt — aber einmal fiel der Name von Frau Lolli dann doch. Wer hatte ihn eigentlich in die Debatte geworfen?
„Sie kennen die Dame schon vom Kriege her, hört’ ich.“
„Jawohl, gnädiges Fräulein.“ Und erst noch ein wenig zögernd erstattete er eine Art Bericht, der viel ausführlicher geriet, als Petra ihn erwartet hatte. Aber er war da nun einmal schon in Zug geraten. „Sie führte damals noch ihren Mädchennamen. Susi Hetzerath, soviel ich mich erinnere. Das war in Roubaix vor meiner ersten Verwundung. Sie war deutsche Sprachlehrerin in einer französischen Familie —, freulaïne heisst es dort —, hatte wie durch ein Wunder den Kriegsausbruch überstanden, ohne unter dem allgemeinen Fanatismus zu leiden, wurde aber Weihnachten 1914 bei der grossen Deportation mit nach England abgeschoben, wo sie recht schlechte Zeiten durchgemacht haben soll. Ich war nach meiner Genesung wieder eine Weile in Roubaix, war in demselben Hause, bei einem Arzt, einquartiert wie vor meiner Verwundung. Und da hörte ich von der Deportation der damals noch blutjungen deutschen Lehrerin. Ein bürokratischer Missgriff, so etwas ist überall möglich, aber es tat mir doch sehr leid. Dr. Dubois sagte zu mir, er habe mir Nachricht geben wollen, damit ich für meine verängstigte junge Landsmännin vermittelnd einträte, aber die Etappe habe seinen Einspruch abgewiesen. Ich lag damals im Kriegslazarett und hätte kaum intervenieren können. Fräulein Hetzerath hat später reich geheiratet, ist Witwe geworden, ertrug es aber nicht, mit müssigen Händen dazusitzen. So kam’s in Berlin zur Gründung ihrer Korrespondenz.“
Warum erklärt er mir das alles? fragte sich Petra. Will er sie verteidigen? Wer hat sie angeklagt?
„Ich glaube nicht, dass irgendwer Frau von Lolli ihre journalistische Betätigung verdenkt,“ sagte sie vollkommen kühl und sachlich; schlug dann aber sogleich ein anderes Thema an.
Als die alte Exzellenz aufbrach, erhob sich auch Petra, küsste der Hausfrau dankend die Hand und verabschiedete sich. Frau Zeck umarmte sie herzlich. „Es war mir ein trautes Gefühl, wieder ’mal ein Töchterchen im Hause zu haben. Ich hab’ ja meine beiden Mädels an wildfremde Männer hergeben müssen, die sie durchaus heiraten wollten. Hoffentlich hat’s Ihnen ein bisschen gefallen hier. Wenn ich in der Bendlerstrasse auftauche, als drohende Gewitterwolke, um bei Ben Ordnung zu schaffen, dann mache ich Ihnen meinen Gegenbesuch. Haben Sie schönen Dank für Ihr Kommen. Sie werden doch selbstverständlich im Auto heimgebracht?“
„Exzellenz Feldern will mich bis zur Wannseebahn im Auto mitnehmen.“
„Ausgeschlossen, gnädiges Fräulein,“ sagte Benjamin, „wir haben ja einen Weg.“
So fuhren sie also zusammen über die Avus nach Hause.
Der Chauffeur hatte das Licht im Wageninnern abgedreht. Sie sassen im Dunkeln und sahen links und rechts von der Autostrasse die Schilder und Stangen und Waldrestchen gespenstisch beleuchtet an sich vorbeifliegen. Nach der lebhaften Unterhaltung und dem vielen herzlichen Lachen legte sich die Stille fast beklemmend auf sie. Petra nahm ein paarmal den Anlauf zu einem Gespräch, liess den Faden aber wieder fallen, da er ihn nicht aufhob.
„Ich möchte Ihnen, bevor wir heute auseinandergehen, gnädiges Fräulein, eine Art Beichte ablegen“, sagte er endlich, als sie den Ausgang der Avus mit dem blendend hellen Funkturm schon dicht vor sich sahen. „Jedenfalls — bevor meine Mutter als drohende Gewitterwolke in der Bendlerstrasse auftaucht und Ihre freundliche Hilfe als Verschworene in Anspruch nimmt.“
„Glauben Sie, Herr Zeck, dass eine Frau, die den klugen, überlegenen und erfahrenen Blick Ihrer Mutter hat, einer so winzigen fremden Hilfe wirklich bedürfte?“
„Hm. Ich fühle aber doch: Mummi hat Sie ins Vertrauen gezogen.“
„Es war wohl nicht mehr als ein Stossseufzer.“
„Über die Nichtsnutzigkeit von Ben?“
„Ach nein. Etwa wie Carlos im Clavigo sagt: da macht wieder einmal einer einen dummen Streich.“
Ein Weilchen Schweigen. Das Auto rollte durchs Tor und schwenkte am Funkeck nach rechts ab.
„Mummi ist ein Juwel,“ sagte er dann. „Sie findet immer das erlösende Wort. Mehr sollte auch meine Beichte nicht ausdrücken. Dummer Streich. Ja. War’s. Und ist als solcher erkannt. Schon deshalb weil — nun, weil mich da neuerdings ein Misstrauen gepackt hat.“
„Ich stelle aber ausdrücklich fest, Herr Benjamin Zeck, dass ich das Thema diesmal nicht wieder angeschlagen habe.“
„Sie haben gestern ein vernichtendes Urteil ausgesprochen, gnädiges Fräulein.“
„In der Form war es unbedingt zu scharf. Ich hab’ es hinterher bedauert. — Welcher Art ist Ihr Misstrauen?“
Er kämpfte wieder gegen sich an. „Frau von Lolli spielt ein doppeltes Spiel. Was ich über ihre Korrespondenz, die „Europa“, gehört habe, hat mich stutzig gemacht. Politisch stimmt da etwas nicht. Und auch sonst ... Sie ist mir unheimlich geworden. Irgendeiner Gefahr muss man sich bei ihr versehen. Ich wollte schon vor Wochen mit ihr brechen, aber sie hält fest. Man ist in der Pension von allen Seiten beobachtet — und es soll nach aussen hin kein Aufsehn geben. Darauf stützt sie sich. Auf ihr Prestige, ihre Stellung.“
„Ich habe nie sonderliches Interesse für sie gehabt. Hörte nur gleich stark betonen: sie wird in der Wilhelmstrasse empfangen, verkehrt in allen massgebenden Salons.“
„Ja. Und von den Pressechefs bekommt sie Material für ihre Korrespondenz, sie kennt die wichtigsten Politiker persönlich, vor allem die führenden Industriekapitäne ... Neulich hat mich ein äusserst orientiertes Wort von ihr über mein Spezialfach verblüfft. Ich wollte da einhaken, aber sie weiss einem aalglatt zu entwischen. Sie sehen, mein gnädiges Fräulein, ich bin auf meiner Hut, brauche vor diesem ‚dummen Streich‘ nicht erst gewarnt zu werden. Aber einen Kameraden könnte ich jetzt gut gebrauchen, der mir hilft, Frau von Lolli zu beobachten. Mein Verdacht nämlich wächst von Tag zu Tag.“
„Wenn ich das recht verstehe, was Sie nur andeuten ... Sie halten sie für eine Spionin?“
„Für eine Meisterspionin sogar.“
„Politisch? Wirtschaftlich?“
„Für skrupellos gewillt, Werkspionage zum Schaden der deutschen Industrie zu treiben.“