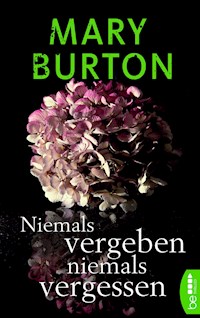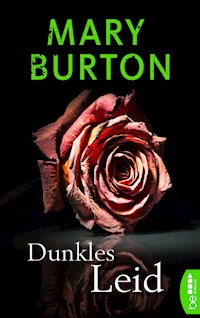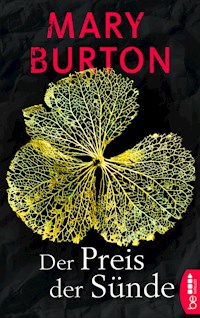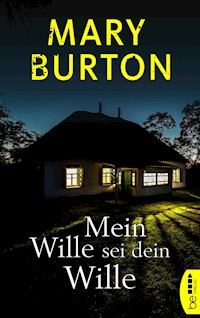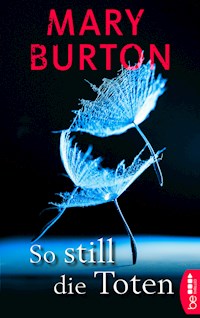4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Alexandria-Reihe - Romantic Suspense
- Sprache: Deutsch
Wenn dich die Vergangenheit einholt ...
Eva Rayburn saß zehn Jahre im Gefängnis - verurteilt für ein Verbrechen, von dem sie nicht weiß, ob sie es begangen hat. Als Eva schließlich in ihre Heimatstadt zurückkehrt, treibt dort ein Serienkiller sein Unwesen. Er scheint ihre Vergangenheit zu kennen: Denn bei den Opfern handelt es sich um ihre ehemaligen Freundinnen, die damals gegen sie ausgesagt haben. Detective Deacon Garrison und sein Partner Malcolm Kier nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf die Verbindung zu Eva. Doch plötzlich gilt sie als tatverdächtig. Aber Deacon merkt schnell, dass Eva unschuldig ist - und selbst in großer Gefahr schwebt ...
"Düster, packend und überraschend - nichts für zarte Gemüter!" Romantic Times
Weitere Romantic-Suspense-Titel von Mary Burton bei beTHRILLED:
Die Alexandria-Reihe: Das Flüstern der Albträume. So still die Toten. Der Preis der Sünde.
Die Richmond-Reihe: Mein Wille sei dein Wille. Niemand hört dich schreien.
Die Texas-Reihe: Das siebte Opfer. Dunkles Leid. Niemals vergeben, niemals vergessen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumProlog12345678910111213141516171819202122EpilogWeitere Titel der Autorin
Die Alexandria-Reihe
Band 2: So still die Toten
Band 3: Der Preis der Sünde
Die Richmond-Reihe
Band 1: Mein Wille sei dein Wille
Band 2: Niemand hört dich schreien
Die Texas-Reihe
Band 1: Das siebte Opfer
Band 2: Dunkles Leid
Band 3: Niemals vergeben, niemals vergessen
Über dieses Buch
Wenn dich die Vergangenheit einholt …
Eva Rayburn saß zehn Jahre im Gefängnis – verurteilt für ein Verbrechen, von dem sie nicht weiß, ob sie es begangen hat. Als Eva schließlich in ihre Heimatstadt zurückkehrt, treibt dort ein Serienkiller sein Unwesen. Er scheint ihre Vergangenheit zu kennen: Denn bei den Opfern handelt es sich um ihre ehemaligen Freundinnen, die damals gegen sie ausgesagt haben. Detective Deacon Garrison und sein Partner Malcolm Kier nehmen die Ermittlungen auf und stoßen auf die Verbindung zu Eva. Doch plötzlich gilt sie als tatverdächtig. Aber Deacon merkt schnell, dass Eva unschuldig ist – und selbst in großer Gefahr schwebt …
Über die Autorin
Mary Burton ist im Süden der USA aufgewachsen und hat an der Universität von Virginia Englisch studiert. Nach einer Karriere im Bereich Marketing begann sie äußerst erfolgreich Thriller zu schreiben. Burton lebt und arbeitet in Virginia. Weitere Informationen über die Autorin finden Sie unter: www.maryburton.com.
MARY BURTON
Das Flüstern der Alpträume
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Will
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Mary Burton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Senseless«
Originalverlag: Zebra Books als Teil der Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA
Published by arrangement with Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2013/2019 by LYX/Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Claudia Schlottmann
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AlexanderTrou | pr_camera | Christian Musat
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-7553-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Samstag, 1. April, Mitternacht
Klebeband dämpfte das heisere Stöhnen der Frau, während eine vermummte Gestalt die Glut im Ofen schürte. Seit sie bei Bewusstsein war, schrie und kämpfte die Frau, in der Hoffnung, ihren Kidnapper auf sich aufmerksam zu machen. War es eine Stunde her, dass sie aufgewacht war? Zwei Stunden? Hier unten in ihrem Kellergefängnis verrann die Zeit wie tropfendes Wasser aus einem undichten Rohr.
So laut sie auch schrie oder mit den Ketten auf den Steinboden schlug, nichts lenkte die schattenhafte Gestalt von den hungrigen, zuckenden Flammen ab, die an den Holzscheiten in dem alten Ofen leckten. Scheit um Scheit fütterte ihr Kerkermeister die Flammen, wie eine zärtliche Mutter, die ihr Kind nährt, und schaute nicht ein einziges Mal zu ihr herüber. An diesem muffigen Ort war sie unsichtbar, unbedeutender als der dreibeinige Stuhl in der dunklen Ecke oder die Müllsäcke, die neben der morschen Treppe gestapelt waren.
Der harte, unebene Steinboden, auf dem sie lag, ließ ihre Rückenmuskulatur verkrampfen und ihre Haut taub werden, und langsam wurde ihr klar, dass es kein Entkommen gab. Sie würde sterben.
Die Frau schloss die Augen. Das laute Pochen ihres Herzens mischte sich mit dem Knistern des Feuers und dem metallischen Klirren des Schürhakens gegen den Rost, auf dem die Holzscheite lagen. Von klein auf hatte man ihr gesagt, dass sie Glück und ein erfülltes Leben nicht verdiente. Böses Mädchen. Du bist ein böses Mädchen. Ihr Leben lang hatte sie sich dagegen aufgelehnt und sich hemmungslos genommen, was sie nur konnte – um zu überleben, aber auch, um zu gewinnen. Aber vielleicht stimmte die düstere Botschaft ja, die man ihr seit der Wiege eingetrichtert hatte. Mit bösen Mädchen nahm es immer ein schlimmes Ende.
Wie eine dunkle Gewitterwolke stieg Verzweiflung in ihr auf, schnürte ihr die Kehle zu und verlockte sie, aufzugeben. Es wäre so einfach, sich in ihr vorherbestimmtes Schicksal zu fügen. So leicht, die Augen zu schließen und sich von der Dunkelheit zudecken zu lassen.
Sie trieb auf den Abgrund zu, bereit, sich ihrem Schicksal zu überlassen, doch ein instinktiver Überlebenswille riss sie im letzten Moment zurück.
Nein! Du willst leben! Du verdienst es zu leben!
Sie öffnete die Augen und sah zu ihrem Kidnapper hinüber. Er war gar nicht so groß. Er wirkte gar nicht so stark. Oder so böse. Vielleicht konnte sie einen kleinen Keil der Vernunft durch seine eiskalte Schale treiben und ihn dazu bringen, Mitleid zu empfinden.
Sie nahm all ihre verbliebenen Kräfte zusammen, schrie und strampelte, aber sein Blick bewegte sich nicht vom Feuer weg.
Gott, was hatte er vor? Was mochte er mit ihr im Sinn haben? In ihrer Fantasie malte sie sich die schlimmsten Szenarien aus, und die aufsteigende Panik entfachte ihren Kampfgeist von Neuem.
Bitte, Gott, hol mich hier raus. Tausend Versprechungen, Schwüre und Vorsätze jagten ihr durch den Kopf, während sie mit Gott verhandelte.
Und dann kam das Wunder – ein dumpfer Knall im Stockwerk über ihr. Das Geräusch drang durch den Strom ihrer Schwüre. Sie drehte den Kopf zu der morschen Treppe, die nach oben führte. Jemand war gekommen! Ihr Herz schlug schneller und lauter, und ihr Magen zog sich so fest zusammen wie eine Stahlfeder.
Sie schaute zu ihrem Kidnapper und forschte nach einem Hinweis in seiner Körperhaltung. War der Neuankömmling dort oben gut oder böse? Hatte dieser Mistkerl einen perversen Freund, der sich zu ihnen gesellen würde? Oder hatte sie einen Retter?
Seine schmalen Schultern versteiften sich, und die Art, wie er ruckartig den Kopf zur Tür wandte, verriet ihr, dass es kein geladener Gast war.
Hoffnung machte sich in ihr breit. Vielleicht hatte jemand gemerkt, dass sie entführt worden war.
Oh Gott. Oh Gott. Bitte schick jemanden, der mich rettet!
Sie riss an ihren Fesseln und schrie. Gedämpft drang ihr Flehen durch das Klebeband.
Die Sonnenbrille und die Kapuze verbargen das Gesicht des Mannes weitgehend, doch sie erhaschte einen Blick auf einen struppigen Bart, als er den Schürhaken bedächtig ablegte und die Stufen zum Erdgeschoss hinaufstieg. An der Kellertür schloss er ein glänzendes, neues Vorhängeschloss auf, öffnete die Tür und machte sie hinter sich wieder zu.
Das Herz schlug ihr bis zum Hals, während sie angestrengt lauschte. Über ihr knarrte die Decke, während ihr Kerkermeister auf der Suche nach dem Eindringling das Erdgeschoss durchquerte.
Bitte, irgendjemand soll mich retten, bitte.
Die Dielen knarrten unter den sachten, zögerlichen Schritten des Neuankömmlings, der sich oben ungehindert bewegte. Sekunden vergingen, und die Schritte wurden selbstsicherer, so als rechne der Besucher nicht damit, Gesellschaft zu bekommen.
Sei vorsichtig! Er wartet auf dich!
Sie schrie, bis ihre Kehle brannte, doch das Klebeband erstickte die Worte und verstümmelte ihre Warnungen.
Der Einbrecher bewegte sich durch das Erdgeschoss. Ihr Kerkermeister verharrte ganz ruhig, lauernd wie eine Schlange, die auf die Gelegenheit zum Angriff wartet.
Und dann ein lauter Ausruf: »Scheiße!«
Ein Handgemenge folgte. Körper prallten gegen Wände. Glas klirrte. Gedämpftes Stöhnen erklang, und etwas Großes fiel zu Boden, wie ein Mensch, der unter dem eigenen Gewicht zusammensackt. Und dann Stille.
Das Herz der Frau schlug so heftig gegen ihre Rippen, dass sie fürchtete, es könnte ihren Brustkorb sprengen. Panisch starrte sie zur Tür und hoffte auf ein Wunder. Wer hatte den Kampf gewonnen? Sie zerrte an ihren Fesseln, versuchte, das Seil zu zerreißen, das in ihre Haut schnitt.
Oh Gott, rette mich!
Ihre Fantasie schlug Purzelbäume, und sie malte sich aus, wie die Polizei den Keller stürmen und ihre Fesseln durchschneiden würde; wie man ihr in beruhigendem Tonfall mitteilen würde, dass sie nun in Sicherheit sei. Man würde sie fragen, was geschehen war, und sie würde nüchtern berichten.
»Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, wie ich an der Theke im Moments gesessen habe, einer kleinen, gehobenen Bar am Potomac. Da kann man gut hingehen. Ganz normale Leute treffen sich dort, um etwas zu trinken, Ärzte, Anwälte, Banker. Es ist kein Lokal, wo sich Verrückte herumtreiben. Es ist ungefährlich.«
Auf jeden Fall würde sie erwähnen, dass sie nur ein einziges Glas Weißwein getrunken und die meiste Zeit mit der Barkeeperin geplaudert hatte, während sie auf ihr Blind Date wartete. Seit mehr als einem Jahr war das ihre übliche Beschäftigung an Samstagabenden.
Irgendwann hatte sich ein Mann auf einen Barhocker neben ihr gesetzt. Er hatte eine Sonnenbrille aufgehabt, sein Bart war ordentlich gestutzt, und er trug einen eleganten, etwas zu großen dunklen Anzug. Es war ein seltsamer, stiller Mann, den man kaum als übermäßig maskulin bezeichnen konnte. Ihr Stiefvater hätte ihn weibisch genannt. Er hatte Wodka bestellt, und beim Klang seiner leisen, krächzenden Stimme war es ihr kalt über den Rücken gelaufen. Aber als sein Drink kam, trank er ihn ohne großes Aufheben, als wäre er ganz zufrieden so allein. Es war einfach gewesen, ihn zu ignorieren.
Sie erinnerte sich, dass eine Frau hereingekommen war und gerufen hatte, sie habe eine Reifenpanne und brauche Hilfe. Die schrille Stimme hatte die Gespräche und die leise Jazzmusik übertönt.
Sie hatte sich umgedreht, um zu sehen, wer da so einen Lärm machte. Sie hatte die Frau als uninteressant eingestuft, als bedeutungslose Unbekannte. Sie hatte sich wieder ihrem Getränk zugewandt und den Zwischenfall bereits vergessen, bevor sie den nächsten Schluck trank.
Und dann … dann war sie hier aufgewacht. In einem dunklen, muffigen Keller, an den Fußboden gekettet.
Oh Gott, wie sehr wünschte sie sich, diese Geschichte zu erzählen. Gerettet zu werden.
Sekunden vergingen, Minuten. Schließlich hörte sie bedächtige Schritte. Bedächtig, nicht hastig. War es die Vorsicht eines Retters oder die sorglose Ruhe eines Wahnsinnigen? Unmöglich zu sagen.
Sie hatte noch immer Hoffnung. Wenn ihr Retter nun einfach nur vorsichtig war? Er wusste ja nicht, dass sie hier unten lag. Er musste auf der Hut sein.
Bitte, beeil dich.
Die Tür oben an der Treppe öffnete sich, und der Umriss einer Gestalt wurde sichtbar. Wer war das? Er stieg die Stufen herab und trat langsam in den Lichtschein des Feuers.
Ihr Kidnapper.
Kein Retter.
Kein Entkommen.
Tränen stiegen ihr in die Augen, rannen seitlich über ihr Gesicht und sammelten sich in ihrem wirren, blonden Haar.
Er ging an ihr vorbei, als wäre sie unsichtbar, und richtete seine ganze Aufmerksamkeit wieder auf das Feuer. Er stocherte in der Glut und pfiff leise, während er die Flammen hingebungsvoll weiter anfachte.
Immer noch strömten ihr Tränen über das Gesicht. Schau mich an, verdammt noch mal! Sieh die verängstigte Frau in mir! Sie war ein guter Mensch. Sie kam aus einer anständigen Familie. Natürlich, sie feierte gern. Aber wer tat das nicht? Vor vielen Jahren hatte sie eine furchtbare Lüge erzählt, doch diese Lüge hatte sie seitdem fast jeden Tag gequält, und sie hatte gebetet, dass Gott ihr verzeihen möge. Zu Weihnachten hatte sie für ein Tierheim gespendet. Ostern ging sie in die Kirche. Auf das Grab ihres Stiefvaters hatte sie Blumen gelegt, obwohl das Schwein keinerlei Respekt verdient hatte. Himmel, sie war doch gerade erst dreißig geworden.
Gute Menschen starben nicht auf diese Weise.
Sie hatte das nicht verdient!
Ihr Kopf sank nach hinten, während sie versuchte, die Panik zu unterdrücken und sich darauf zu konzentrieren, wie sie hier vielleicht herauskommen könnte.
Heilige Muttergottes, das musste doch ein Albtraum sein. Es musste so sein! So etwas passierte normalen Frauen einfach nicht.
Doch ihre aufgescheuerten Handgelenke und der Schmerz in ihrem Rücken sagten ihr etwas anderes. Das hier war kein Albtraum.
Sie starrte den Mann an, und die Angst ballte sich zu einem Klumpen in ihrem Magen zusammen. War es der aus der Bar, der sich neben sie gesetzt hatte? Sie wusste es nicht, aber sie spürte, dass er es war. Wer sonst würde ihr so etwas antun? Der einzige Mann, von dem sie wusste, dass er die nötige Grausamkeit besessen hätte, war schon seit vielen Jahren tot.
»Weißt du, es war leicht, dich zu finden.« Seine Stimme klang wie Sandpapier. »Du bist nur fünf Blocks von deinem Elternhaus weggezogen.«
Sie hörte auf zu kämpfen und zermarterte sich den Kopf darüber, wer er sein könnte. Doch so sehr sie sich auch bemühte, den Schleier der Verwirrung zu durchdringen, sie kam nicht darauf. Furcht stieg in ihr auf, und sie konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. Es klang wie bei einem Tier, das in einer Falle festsitzt.
Der Mann richtete sich auf und drehte sich zu ihr um. Er trug einen weiten, langen Mantel, wodurch sich seine Größe schwer schätzen ließ – vielleicht eins fünfundsiebzig. Während er auf sie zukam, spiegelte sich ihr verängstigtes Gesicht in seiner Brille. Er zog das Klebeband von ihrem Mund und riss dabei ihre Lippen auf. Sie schmeckte Blut.
»Überrascht, mich wiederzusehen?«
Beim Klang der krächzenden Stimme schauderte sie. Im Feuerschein erkannte sie, dass er eine Perücke trug, und auch sein Bart schien falsch zu sein. Die dunklen Gläser verbargen seine Augen.
Sie zuckte zusammen und befeuchtete sich die rissigen Lippen mit der Zunge. »Sie waren in der Bar.«
»Ja.«
Wenn sie im Moments nicht so darauf bedacht gewesen wäre, ihn zu ignorieren, hätte sie gemerkt, dass er ein Freak war. »Sie haben mir etwas in den Wein getan.«
»Ja.«
»Warum?«
»Es macht dich vernünftiger.« Mit einer behandschuhten Hand schob er ihr Oberteil hoch und entblößte ihren flachen Bauch.
»Was tun Sie da?« Sie bebte vor Angst.
Sanft strich er ihr über die weiße Haut. »So hübsch und rein. Aber wir beide wissen, dass du nicht rein bist, nicht wahr?«
»Ich bin ein guter Mensch.«
»Nein, das bist du nicht.«
Ihre Gedanken überschlugen sich. Dring zu ihm durch. Mach diesem Verrückten klar, dass du ein Mensch bist. »Ich habe eine Familie. Eltern. Ein Kind.«
Er ließ den Zeigefinger um ihren Bauchnabel kreisen. »Die hast du alle schon lange nicht mehr gesehen. Die wollen nichts mehr von dir wissen.«
Die Worte wühlten sie auf. Er hatte recht. Sie hatte keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie. Sie rang um die richtigen Worte, die ihr Aufschub verschaffen würden. »Da oben war jemand! Er weiß, dass Sie hier sind. Dass ich hier bin.«
»Er ist gefesselt wie ein Schwein vor der Schlachtung. Ich werde mich um ihn kümmern, wenn ich mit dir fertig bin.«
Wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. »Bitte lassen Sie mich gehen.«
Amüsiert zog er die Brauen hoch. »Ist das nicht witzig? Dass ausgerechnet heute Abend jemand in dieses Haus einbricht. Wirklich schlechtes Timing.« Um seinen Bart zuckte ein Lächeln. »Schrei nur, wenn du willst.«
Ihr Herz trommelte gegen ihre Rippen wie ein rasender Güterzug. Tränen liefen ihr über die Wangen. »Ich werde nicht schreien.«
Der Mann legte den Kopf schief. »Wieso nicht? Du hast allen Grund zu schreien.«
Oh Gott. Bitte. »Ich werde nicht schreien.«
Das Lächeln wurde breiter und entblößte kleine, gelbliche Zähne. »Das werden wir ja sehen.«
Vor Angst blieben ihr die Worte schier im Hals stecken. »Was wollen Sie?«
»Dich.«
»Warum? Ich bin niemand. Das haben Sie doch selbst gesagt. Meine Familie will nichts von mir wissen. Ich bin es nicht wert.«
»Doch, du bist etwas Besonderes.«
Etwas Besonderes. Das hatte ihr Stiefvater immer gesagt. Du bist mein ganz besonderes kleines Mädchen, und das hier bleibt unser Geheimnis, ja? »Was wollen Sie?«
»Eigentlich nicht viel. Alles, was du tun musst, ist, ruhig liegen zu bleiben.« Die behandschuhten Hände glitten über ihr Haar und zogen die blonden Locken straff nach hinten.
Sie versuchte sich wegzudrehen. »Ich will hier raus.«
»Nein.«
Die Panik drohte sie zu ersticken. »Man wird mich vermissen.«
»Nein, wird man nicht.«
Mit schnellen, zornigen Bewegungen stieß der Mann eine Metallstange in die Glut. Nach einer Weile zog er sie heraus und inspizierte die Spitze, die die Form eines vierzackigen Sterns hatte.
Die Erinnerung an längst vergangene Ereignisse stieg in ihr auf und rief ihr eine Zeit ins Gedächtnis, die sie nach Kräften verdrängt hatte. »Was haben Sie damit vor?«
»Du erinnerst dich an den Stern, oder?«
»Wovon sprechen Sie?«
»Von dem Stern. Und dem Geheimnis.«
Die Erinnerungen bahnten sich den Weg in ihr Bewusstsein. »Nein, ich erinnere mich nicht«, log sie.
»Lügnerin.«
»Wirklich, ich schwöre es.« Sie wand sich und riss an ihren Fesseln, aber die Knoten zogen sich nur noch fester zusammen.
Der Mann rückte seine Sonnenbrille zurecht und betrachtete den rot glühenden Stern. »Ich verspreche dir, noch ehe ich fertig bin, wird es dir ins Gedächtnis eingebrannt sein.«
Sie schluchzte, und ihre Furcht wuchs ins Unermessliche. »Bitte, ich will mich nicht erinnern.«
Er kniete sich neben sie auf den Boden, und der grobe Stoff seiner Hose streifte ihre Hüfte. »Deine Aufgabe ist es, den anderen eine Botschaft zu schicken.«
Die anderen. »Sie wissen doch nichts von den anderen.«
»Oh doch, das tue ich, das tue ich. Und bald wird jeder von ihrem Verrat wissen.« Der Geruch nach heißem Metall hing in der Luft und beschwor die alte Sünde herauf, die unter einem Jahrzehnt voller Alkohol und Verleugnung begraben lag.
»Bitte.« Gebannt starrte sie auf die rote Spitze der Eisenstange, und jeder Muskel in ihrem Körper zog sich vor Angst zusammen.
»Wenn ein Stern in finstrer Nacht
strahlend dir entgegen lacht,
schau zum Himmel und du hast
drei Wünsche frei …«
Dann drückte er ihr das heiße Eisen auf den Bauch, und das Metall versengte die Haut. Der Schmerz nahm ihr augenblicklich den Atem, sie konnte nicht einmal wimmern. Ihr ganzer Körper verkrampfte sich. Der Mann zog das Eisen weg, und der Schmerz ließ nach. Ihr Herz hämmerte so ungestüm, als wollte es dieser Qual entfliehen.
Die Sonnenbrille verbarg die Augen ihres Folterers, aber das feine Lächeln um seine Lippen verriet eine beinahe euphorische Freude, als bereitete dieser Augenblick ihm ein lange versagtes Vergnügen. »Wenn ich fertig bin, werden sie dich sehen, und sie werden wissen, dass die Zeit der Buße gekommen ist.«
Ihre Lungen weiteten sich und füllten sich mit Luft.
Sie brüllte wie ein Tier, das in der Falle saß.
1
Montag, 3. April, 21:15 Uhr
»Was tust du da?«, flüsterte Eva.
Die Angst in ihrer Stimme fachte seinen Zorn und seine Erregung an, während er ihren sternförmigen Anhänger über den tanzenden Flammen baumeln ließ. »Du bist so stolz auf diesen Anhänger. So stolz darauf, zu den Himmelssternen zu gehören. Jetzt wirst du diesen Stern für immer bei dir tragen.«
Sie drückte sich gegen den Kamin, um ihm zu entfliehen, doch er presste sich mit seinem ganzen Gewicht gegen sie. Ihre Wange scheuerte am Stuck, und als sie wimmerte, verstärkte sich seine Erektion an ihrem Rücken. Das Metall wurde heißer, und sie wusste, dass eine erneute Vergewaltigung nichts gegen das wäre, was er jetzt vorhatte. »Josiah, tu es nicht. Du hast genug angerichtet.«
»Noch lange nicht.« Er zog den Stern aus den Flammen, ließ ihn auf den Boden fallen und drückte Eva dann so weit nach unten, dass ihre rechte Schulter das heiße Metall berührte. Sofort brannte es sich durch ihr Oberteil in ihre Haut.
Sie schrie laut auf. Seine Erregung steigerte sich, doch als er nach ihrem Rocksaum griff, ließen die unerträglichen Schmerzen alles um sie herum schwarz werden.
Eva Rayburn schreckte aus dem Schlaf hoch. Sie umklammerte das Lenkrad des Transporters und rang nach Atem. Ihre Muskeln waren angespannt, bereit zum Kampf.
Mehrere Sekunden verstrichen. Da war kein brennender Schmerz auf ihrer Haut, und sofort entspannten ihre Muskeln. Dunkelheit hüllte sie ein, nur die Geräusche des fernen Verkehrs und das Zirpen eines Grashüpfers waren zu hören. Langsam hob sich der drückende Schleier des Traums, und sie nahm ihre Umgebung wahr. Sie saß am Steuer des alten Transporters, der in einer Straße am Stadtrand parkte. Es ging ihr gut, sie war in Sicherheit. Viele Jahre trennten sie von der schrecklichen Nacht, die sie damals durchlitten hatte.
»Verdammter Mist.« Sie legte die Stirn auf das Lenkrad, atmete tief ein und dann ganz langsam wieder aus. »Nur der Traum. Es war nur der Traum.«
Sie ließ sich in den Sitz zurücksinken und hob den Saum ihres T-Shirts an, bis der Schweiß zwischen ihren Brüsten getrocknet war. Es war Jahre her, seit sie diesen Albtraum zum letzten Mal gehabt hatte, und dass er jetzt zurückkam, verhieß nichts Gutes.
Eva sah auf ihre Armbanduhr, verfluchte sich, weil sie eingeschlafen war, und schaute dann zu dem Bungalow auf der anderen Straßenseite hinüber. In der Einfahrt stand inzwischen ein roter 72er Porsche, was bedeutete, dass der Mann, den sie beliefern sollte, zurück war.
»Mach nur weiter so, Eva«, murmelte sie. »Verschlaf deinen Auftrag.«
Sie stopfte ihr langes Haar unter eine Fleurop-Kappe, ergriff einen Strauß Margeriten und ein Klemmbrett und ging zu dem Haus hinüber. Sie klingelte und verdrängte einen Anflug von Besorgnis. Die Glühbirne über ihr warf einen schwachen Lichtschein auf eine abgetretene Fußmatte und die rissigen Steinstufen der vorderen Veranda. Es war nicht sehr hell, aber hell genug für einen schnellen Rückzug.
Den Aushilfsjob hatte sie nun seit etwa drei Monaten. Er ließ sich gut mit ihrer Arbeit als Kellnerin und Barkeeperin im King’s Pub und mit ihrem Nebenjob als Nachtaufsicht in einem Obdachlosenheim vereinbaren. Normalerweise übernahm sie keine Fahrten, wenn sie nach Feierabend im Pub nachts auch noch im Heim arbeitete, aber ihr Chef, Luke Fraser von LTF, hatte ihr für die heutige Lieferung einen Bonus versprochen. Das zusätzliche Geld war zu verlockend gewesen, um abzulehnen.
Bei Luke hatte es geklungen, als wäre der Auftrag ein Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Luke zahlte für einfache Aufträge nie einen Bonus, und da die Vorladung zum Familiengericht für einen Typen bestimmt war, der den Spitznamen Herkules trug, hatte sie beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen und den Trick mit der Blumenlieferung durchzuziehen. Eva rückte die Kappe zurecht und klingelte erneut. Der Strauß, den sie hinter einem Blumenladen in der Nähe des King’s aus dem Müll gefischt hatte, verströmte einen leicht unangenehmen Geruch. Alles, was sie brauchte, war eine Unterschrift.
Sie läutete ein drittes Mal.
Eva richtete ihre zierliche Gestalt zu ihren ganzen ein Meter vierundfünfzig auf. Um ihre schlanken Hüften schlackerten ausgeblichene Jeans, und ein weiter schwarzer Kapuzenpullover verbarg ihre schmalen Schultern und ihre flache Brust. Wie ihre Mutter immer gesagt hatte, wog sie »in klatschnassem Zustand« fünfundvierzig Kilo. Ihre geringe Körpergröße und ihre Kleidung führten dazu, dass die meisten Leute sie für eine Jugendliche hielten und nicht für die Frau von Ende zwanzig, die sie war. Sie hoffte, dass auch dieser Kerl auf ihr Äußeres hereinfiel, denn üblicherweise unterschätzten die Menschen Jugendliche.
Hinter der Haustür erklangen Schritte. Evas Herzschlag beschleunigte sich ein wenig, doch sie hielt den Kopf gerade und bemühte sich um eine lässige Haltung. Nur eine Unterschrift. Kinderspiel. Bring es hinter dich und dann verschwinde.
Die Tür ging auf, und vor ihr stand einer der größten Männer, die sie je gesehen hatte. Er war mindestens zwei Meter groß und wog locker hundertdreißig Kilo. Über seiner breiten Brust spannte sich ein fleckiges Muskelshirt, und sein gewaltiges vorspringendes Kinn wurde von einem Dreitagebart bedeckt. Herkules.
Das nur von einer Tischlampe erhellte, unaufgeräumte Zimmer hinter ihm war mit einer abgewetzten Couch und einem Sechzig-Zoll-Flachbildfernseher möbliert, in dem eine Quizshow lief.
»Ich soll etwas für Bruce Radford abliefern.«
Der Typ schnaubte. »Ich hab keine Ahnung, was du verkaufst, Mädchen, aber ich will’s nicht.« In seiner tiefen Raucherstimme schwang Verärgerung mit.
»Ich verkaufe nichts, ich liefere nur aus.« Eva ließ ihre Stimme betont selbstsicher klingen, um ihre Nervosität zu überdecken. »Sind Sie Bruce Radford?«
Der Mann schickte sich an, die Tür zu schließen. »Hier hat keiner irgendwelche beschissenen Blumen bestellt.«
Eva zuckte die Schultern und achtete darauf, ihre Miene ausdruckslos zu halten. »Wie gesagt, ich verkaufe nichts, Mister. Ich liefere nur Blumen ab. Sind Sie jetzt Bruce Radford oder nicht?«
Die blutunterlaufenen Augen verengten sich zu Schlitzen.
»Wenn nicht, sagen Sie es doch einfach. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich sag dem Chef, dass Sie die Blumen nicht wollten.« Sie wandte sich zum Gehen.
»Wer schickt sie?« Er war vorsichtiger, als sie erwartet hatte.
Eva blieb stehen, sah auf ihr Klemmbrett und tat so, als läse sie. »Irgendeine Wanda.«
»Ich kenne keine Wanda.«
»Eine klasse Braut, die kurz vor Ladenschluss ins Geschäft gekommen ist. Rotes Kleid, blonde Haare.«
Das Misstrauen in den Augen des Mannes schwächte sich ein wenig ab. »Blond?«
»Ja. Und große Titten.«
Die vollen Lippen des Mannes umspielte der Anflug eines Lächelns. Er wusste zwar nicht, wer zum Teufel Wanda war, aber gegen blonde Haare und große Titten hatte er nichts einzuwenden. »Ich nehme die Blumen.«
»Also sind Sie Bruce Radford?« Seine Körperausdünstungen mischten sich mit dem Geruch nach kalter Pizza und abgestandenem Bier.
»Ja, ich bin Radford.«
»Super.« Eva zog einen Kugelschreiber hinter ihrem Ohr hervor, hielt ihn dem Mann hin und fügte noch ein Lächeln hinzu. »Ein Autogramm bitte.«
Bruce studierte das Blatt Papier, konnte aber die kleine Schrift bei der schwachen Beleuchtung unmöglich entziffern. »Muss wohl die Kleine bei Hanson Trucking sein. Die hat ’ne Schwäche für mich.«
Eva hielt ihm das Klemmbrett hin und verdeckte den größten Teil der Seite mit ihrer Hand. »Unterschreiben Sie einfach hier, dann sind Sie mich los.«
Radford schürzte die Lippen, um ein Lächeln zu verbergen, und nickte. »Okay.«
Er nahm den Stift, den sie ihm hinhielt, und kritzelte nachlässig seinen Namen. Die Mischung aus Druckbuchstaben und Schreibschrift erinnerte Eva an einen Drittklässler. »Danke.«
Sie drückte ihm die Blumen in die Hand und riss den Durchschlag des Lieferscheins ab. »Schönen Abend noch.«
Zerstreut nahm er den Zettel entgegen. »Klar.«
Eva ging auf den Transporter zu und betete im Stillen, dass der Anlasser funktionierte. Hätte sie doch nur genug Benzin im Tank gehabt, um den Motor laufen lassen zu können. Schnell durch den Vorgarten und hinters Steuer, bevor Radford klar wird, was er da wirklich unterschrieben hat – eine Zusage, vor Gericht zu erscheinen. Wenn er dahinterkommt, dass man ihn reingelegt hat, wird er mächtig sauer sein.
Eva angelte die Schlüssel aus ihrer Hosentasche, stieg in den Wagen und tastete nach dem Zündschloss. Ein Blick zurück über die Schulter verriet ihr, dass Radford noch immer die Blumen anstarrte. Er schnüffelte daran wie ein liebeskranker Trottel. Die Überbringerin hatte er bereits vergessen. Die erste Runde ging an Eva.
Sie drehte den Zündschlüssel.
Nichts. Sie probierte es erneut. Immer noch nichts. Mist. Sie schaute wieder zu Radford hinüber und merkte, dass er jetzt den Zettel näher betrachtete. Aus dem Gesichtsausdruck eines dümmlichen Schuljungen wurde Verwirrung, dann Zorn. »He, was zum Teufel ist das?«
Evas Magen krampfte sich zusammen. Sie drehte den Zündschlüssel. Nada.
Was hatte King, ihr Chef, noch gleich gesagt, als er ihr den Transporter geliehen hatte? Bis drei zählen, dann der nächste Versuch. Scheiße. Eins. Sie sah, wie Radford über den Rasen auf sie zu sprintete. Zwei. Nach wenigen Sekunden war er an der Straße und hatte sie bereits halb überquert, als Eva die Nerven verlor und den Schlüssel drehte.
Klick. Klick. Klick.
Der Motor machte keinen Mucks.
Im Normalfall wäre sie ausgestiegen, hätte ein paar Kontakte festgezogen, und die Sache wäre erledigt gewesen, aber wenn sie jetzt ausstieg, würde Radford sie zu Brei schlagen.
Radford zerknüllte das Papier in der Hand und brüllte: »Was zum Teufel ist das, du Miststück?«
Eva atmete tief ein. Verdammt. Verdammt. Verdammt. Sie verriegelte die Türen und wünschte sich sehnlichst, sie hätte den Motor laufen lassen. Ein paar Kilometer von hier entfernt mit leerem Tank liegen zu bleiben, wäre sicherlich besser gewesen als das hier.
Radford streckte die Hand nach dem Türgriff aus. Als er merkte, dass die Tür verriegelt war, ließ er die Faust gegen die Scheibe krachen. Eva fuhr zusammen. Ihre Hände waren feucht. Bald würde die Batterie leer sein.
Wieder schlug Radford gegen das Fenster, das unter dem Schlag knirschte und leicht nachgab. Noch ein paar solche Schläge, dann würde es bersten wie dünnes Eis.
»Miststück. Wer zum Teufel schickt dich?«, brüllte er. »Meine verdammte Frau schickt dich, was? Ich lass mich nicht scheiden. Geldgierige Nutte.«
Eva konzentrierte sich weiter auf den Anlasser. Ihre Hände hörten auf zu zittern, und ihr Verstand wurde seltsam klar. Sie hielt sich nicht mit Gebeten auf – schon vor langer Zeit hatte sie gelernt, dass sie ihre Probleme nur selbst lösen konnte.
Wieder krachte die Faust gegen das Glas, und diesmal blieb ein Spinnennetz aus feinen Rissen zurück. »Ich vermöbel dir deinen knochigen Arsch.«
Eva ließ das Zählen sein und drehte den Zündschlüssel. Der Motor heulte auf und erwachte stotternd zum Leben, gerade, als Radford erneut gegen die Scheibe schlug. Hätte sie nachgegeben, wäre seine Faust in Evas Gesicht gelandet.
Sie legte den Gang ein und trat aufs Gaspedal. Schotter knirschte, als die Hinterreifen durchdrehten.
Radford lief neben ihr her und bearbeitete die Karosserie mit der Faust. Eva umklammerte das Steuer. Der Wagen wurde schneller, und Radford konnte nicht mehr Schritt halten. Um ihren Mund zuckte ein Grinsen.
Radford brüllte wüste Beschimpfungen, kam beinahe ins Straucheln und ließ die Tür los. »Ich bring dich um, du Schlampe. Ich bring dich um.«
Eva hielt das Lenkrad so fest umklammert, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel und sah, wie der Typ hinter dem Transporter her rannte und mit der Faust in die Luft hieb. Schließlich blieb er stehen und beugte sich vornüber, um zu Atem zu kommen.
Sie ignorierte ein Stoppschild und fuhr ein ganzes Stück, bevor sie langsamer wurde und um eine Ecke bog. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und Schweiß lief ihr den Rücken hinunter. Die Benzinanzeige stand beinahe bei Null. Sie fuhr noch fast drei Kilometer, bevor sie die angehaltene Luft aus ihrer Lunge entweichen ließ.
Das Adrenalin in ihren Adern machte sie benommen und – unglaublich, aber wahr – aufgekratzt. Es gefiel ihr, wenn sie Schlägertypen wie Radford eins auswischen konnte. Machtbesessene Scheißkerle.
Für diesen Auftrag war ihr Luke wirklich etwas schuldig. So viel würde sie klarstellen, wenn sie ihm Bericht erstattete.
Eva warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Viertel vor zehn, sie musste sich beeilen, aber sie hatte das letzte bisschen Benzin verbraucht. Als sie in ihrer Hosentasche kramte, fand sie drei verknüllte Dollarscheine und hielt an der nächsten Tankstelle. Sie tankte für genau drei Dollar und ließ den Motor an. Die Benzinanzeige zeigte nur knapp über Null, aber sie wusste, dass sie für die nächsten fünfzig Kilometer genug hatte. Gerade eben genug.
Eva fuhr zurück auf die Umgehungsstraße und dann in Richtung »Haus Hanna«. Montags verbrachte sie die Nächte im Übergangswohnheim, wo sie als eine Art Pförtnerin und Mädchen für alles arbeitete. Meistens blieb alles ruhig, doch sie hatte auch schon Nächte erlebt, in denen sich die Bewohner wie verrückt um die Fernbedienung oder den letzten Keks gestritten hatten.
Wieder schaute Eva auf die Uhr. Heute Abend hatte Sally, die Leiterin des Heims, frei, deshalb sollte sie möglichst pünktlich dort sein. Eva enttäuschte sie nur ungern. Sally war Anfang fünfzig, eine moderne Hippiefrau, die Glasperlenarmreifen, gebatikte Blusen und langes Haar liebte. Sie hatten sich vor sechs Monaten im King’s kennengelernt, wenige Tage, nachdem Eva nach Alexandria zurückgekehrt war. Eva hatte bedient, Sally hatte ein Sandwich bestellt, und sie waren sofort miteinander ins Gespräch gekommen. Sally kümmerte sich um Menschen, um die sich sonst niemand scherte, womit sie bei Eva direkt einen Stein im Brett hatte.
Eva sah sich um und merkte, dass sie sich in eine Gegend verirrt hatte, die sie seit ihrer Rückkehr nach Alexandria sorgfältig gemieden hatte. Hier gab es lauter prächtige Backsteinhäuser, gepflegte Rasenflächen und saubere Bürgersteige – ein wohlhabendes Viertel, in dem man nach allgemeiner Auffassung wunderbar Kinder großziehen konnte.
Eigentlich hätte Eva den Stadtteil durchqueren müssen, aber sie fuhr immer weiter hinein in das Netz aus Straßen, bis sie den alten Backsteinkasten erreichte. Hier war sie einige Male auf Partys dabei gewesen, sie, die Stipendiatin, die nicht so recht in das private College gepasst hatte. Doch Kristen Hall, die tonangebende Senior-Studentin, hatte sie unter ihre Fittiche genommen und sie in die Welt der oberen Zehntausend eingeführt. In Kristens Haus war sie umgeben von Wohlgerüchen, schönen Kleidern und funkelnden Lichtern. Sie hatte eine neue Welt kennengelernt, fernab von ihren Pflegeeltern, eine Welt ohne laute Zankereien und fettige Essensgerüche. Jeder Besuch bei den Halls hatte Evas Glauben an Märchen und Happy Ends neue Nahrung gegeben.
Abwesend rieb sie die Narbe an ihrer Schulter. Gott, wie sehr hatte sie sich geirrt.
Eva schüttelte Zorn und Traurigkeit ab, trat aufs Gaspedal und fuhr langsam weiter. Keine Erinnerungen mehr. Keine Traurigkeit. Nach vorne blicken. Das war seit mehr als zehn Jahren ihr Mantra.
Sie konzentrierte sich auf die Straße und die nächtliche Arbeit im Wohnheim, die vor ihr lag. Die Vergangenheit war tot. Sie streckte die Hand nach dem Radio aus und stellte einen Sender mit Rockmusik ein, deren Texte die Vergangenheit aus ihrem Kopf hämmerten.
Während sie auf direktem Weg zum Obdachlosenheim fuhr, das im südöstlichen Teil Alexandrias lag, knurrte ihr der Magen, und ihr fiel ein, dass sie seit dem Frühstück nichts mehr gegessen hatte. Das King’s war heute brechend voll gewesen. Eigentlich wäre ihre Arbeitszeit um sieben zu Ende gewesen, aber sie war noch länger dort geblieben und hatte geholfen, den Ansturm zu bewältigen. Danach war sie hastig aufgebrochen und hatte das Abendessen vergessen, das ihr Chef ihr eingepackt hatte. Hoffentlich gab es reichlich Brot und Erdnussbutter im Wohnheim.
Sie war gespannt, wer sich heute zur Nacht eingefunden hatte. Vielleicht hatte Tony, der ehemalige Soldat und Boxer, der gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden war, eine neue Geschichte auf Lager. Er ließ gern seine ruhmreichen Tage im Ring wiederaufleben und hatte geschworen, sein Temperament in Zukunft zu zügeln. Oder Pam. Sie war seit drei Wochen alkoholabstinent und redete davon, das Sorgerecht für ihre Kinder zurückzubekommen und eine Arbeit zu finden. Dann gab es noch Luna, eine jugendliche Ausreißerin. Eva hatte versucht, das Mädchen zum Besuch einer Abendschule zu überreden.
Sie hatte gerade den zweiten Block aus Einfamilienhäusern zur Hälfte passiert, als sie in einiger Entfernung blinkende Lichter sah. Als sie näherkam, bemerkte sie mehrere Feuerwehrwagen und Polizeiautos, die sich am Ende der Sackgasse drängten, in der das Wohnheim lag. Sie setzte zurück und fuhr in eine parallel verlaufende Anwohnerstraße. Dort stellte sie den Transporter ab, stieg aus und ging zwischen den Gärten hindurch, die die beiden Straßen voneinander trennten.
Helle Flutlichter, die von der Feuerwehr aufgestellt worden war, beleuchteten das »Haus Hanna«. Das künstliche Licht warf einen unheimlichen Glanz auf das zweistöckige Gebäude, das vom Feuer in eine rauchende Ruine verwandelt worden war. Obwohl die Männer den Brand im Griff hatten, spürte Eva die schwelende Hitze auf ihrem Gesicht.
Rund um das Gebäude zuckten die blauen und roten Lichter unzähliger Feuerwehr- und Polizeiwagen.
In Evas Kopf drehte sich alles. Die Erinnerung an ein anderes Feuer stieg in ihr auf und schnürte ihr die Luft ab. Sie konnte kaum atmen und wäre am liebsten stehen geblieben. Doch sie ging stetig weiter und fuhr sich mit zitternden Händen durch das lange, schwarze Haar. Suchend blickte sie sich in der Menge nach bekannten Gesichtern um. Sally, die Leiterin, war nirgendwo zu sehen. Von Rhonda, der Abendaufsicht, ebenfalls keine Spur.
Oh Gott. Oh Gott.
Ihr fielen die Menschen ein, die die Nacht wahrscheinlich im Heim hatten verbringen wollen. Tony. Pam. Luna. Sie hoffte inständig, sie bei einem der Einsatzwagen zu entdecken, in eine Decke gewickelt, in Sicherheit. Doch sie sah niemanden.
Sie schlang die Arme um sich und wäre am liebsten unter dem gelben Absperrband hindurchgekrochen, um die Polizei nach den Bewohnern des Hauses zu fragen, doch sie tat es nicht. Seit sie vor sechs Monaten aus dem Gefängnis entlassen worden war, ging sie Polizisten aus dem Weg. Cops bedeuteten Ärger, und sie hatte sich geschworen, nie wieder einem von ihnen zu vertrauen und nie wieder ins Gefängnis zu gehen.
Aber ihre Freunde. Gott, sie musste herausfinden, was los war.
Sie zog den Kopf ein und bewegte sich auf die Menge der Schaulustigen zu. Die Hitze war immer noch so stark, dass sie einem die Lungen hätte versengen können.
Eva stellte sich zu einem älteren Mann, der eine Brille mit Stahlgestell trug und dessen Steelers-Sweatshirt sich über seinem runden Bauch spannte. »Hey, wissen Sie, was hier passiert ist?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich habe gerade Der Preis ist heiß geguckt, als ich die Sirenen gehört habe. Da bin ich rausgelaufen und habe gesehen, dass ein Haus brennt.« Er nickte in Richtung Osten. »Ich wohne anderthalb Blocks entfernt, aber ich konnte die Flammen ganz deutlich erkennen.«
Eva erstickte fast an dem Kloß in ihrer Kehle. »Wissen Sie, wie es angefangen hat?«
»Nee.«
Die Lichter der Polizeiwagen flackerten, und Eva widerstand dem Drang wegzulaufen. »Weiß sonst jemand irgendetwas?«
»Keine Ahnung.«
Die Ungewissheit machte sie ungeduldig. »Hat man jemanden rausgeholt? Aus dem Wohnheim, meine ich.«
»Nicht, dass ich wüsste. Die Feuerwehrleute haben die Flammen gerade so weit zurückgedrängt, dass sie nahe ans Haus herankonnten. Vielleicht sind auf der Rückseite noch Leute.«
»Danke.«
Eva schlang wieder die Arme um sich und bahnte sich einen Weg durch die Menge, wobei sie genau zuhörte, was die Leute redeten.
»Anscheinend hat es um sieben angefangen.«
»Ich hab eine Explosion gehört. Diese alten Gasöfen sind gefährlich.«
»Da gehen immer so komische Leute ein und aus. Ich wusste doch, dass es irgendwann Ärger geben würde. Aber wie’s aussieht, haben die Cops inzwischen ihre hohen Tiere geschickt. Die nehmen die Sache ernst.«
Die Nähe so vieler Polizisten machte Eva nervös und angespannt. Mit primitiven Schlägern wie Radford konnte sie umgehen, die Polizei dagegen bedeutete richtigen Ärger. Sie atmete gepresst aus und vergrub ihre Befürchtungen tief in ihrem Inneren. Das Gefängnis hatte sie gelehrt, dass das Zeigen von Gefühlen nicht nur von Schwäche zeugte, sondern Gegnern auch ein Druckmittel in die Hand gab.
Eva konzentrierte sich auf das schwelende Gebäude. Wer konnte das gewesen sein? Sally wusste, dass ihre Bewohner oft in Schwierigkeiten steckten, und achtete sehr darauf, den Frieden zu wahren. Es gab Codewörter und Sicherheitssysteme. Eva bewunderte Sally für ihre Vorsichtsmaßnahmen.
Ihr Blick glitt über die Menge der Gaffer, die verstört und verängstigt wirkte. Der Schock in den Gesichtern verstärkte Evas Ängste. Als sie sich zum Gehen wandte, blieb ihr Blick an einer einzelnen Gestalt hängen, die jenseits des gelben Absperrbandes stand. Der Rücken des Mannes wirkte angespannt, die Arme hielt er vor der Brust verschränkt. Er jammerte und flüsterte nicht und zeigte auch keine Furcht, während er die Verwüstungen betrachtete, sondern starrte grimmig in die schwächer werdende Glut.
Der Mann war größer als die meisten Umstehenden. Er hatte breite Schultern und eine kämpferische Haltung, die eher zu einem Krieger vergangener Tage passte als zu einem Mann der Gegenwart. Als er den Kopf ein wenig zur Seite drehte, fingen die Feuerwehr-Scheinwerfer sein Profil ein. Dunkle Stoppeln bedeckten sein vorspringendes Kinn, das ihn zornig aussehen ließ. Auf seinen Kragen fiel dunkles Haar, das förmlich nach einem Schnitt schrie.
Das hier war ein Kampfhund, der gewaltig nach Spitzen-Cop roch. Jede Wette, dass er sich so schnell nicht von einem Fall abbringen ließ.
Ein Schauer kroch Eva über den Rücken, und etwas legte sich um ihre Kehle und schnürte ihr die Luft ab. Vor zehn Jahren hatten Polizisten, die entschlossen gewesen waren, einen Fall zu lösen, ihr zehn Jahre ihres Lebens gestohlen. Sag einfach, dass du ihn getötet hast. Sag es einfach …
Als sie den Rückzug antrat, drehte sich der Polizist wie ferngesteuert um. Sein Blick blieb an ihr hängen wie der eines Jägers an einem Reh. Sie erstarrte und bemühte sich, keine Furcht zu zeigen, während sie unablässig nach Anzeichen für drohenden Ärger Ausschau hielt.
Eva schluckte. Ihre Haut kribbelte, und die Muskeln in ihrem Kreuz zogen sich schmerzhaft zusammen. Nicht gut. Gar nicht gut. Exhäftlinge, die klug waren, mieden die Nähe von Cops, besonders an einem Tatort.
Es war ein Fehler gewesen, hierzubleiben. Sie wollte nicht auffallen, schon gar nicht einem Polizisten, der wie ein Kampfhund wirkte. Eva bemühte sich angestrengt um einen neutralen Gesichtsausdruck und wandte den Blick langsam ab. Sie tat so, als würde sie über etwas lächeln, was der Mann neben ihr gesagt hatte, und irgendeinen Kommentar dazu abgeben. Dann verschwand sie in der Menge, ganz so, als wäre sie nur ein Mädchen, das gerade einen Abendspaziergang macht.
Ihre Muskeln schrien: Lauf, versteck dich!
Doch sie tat es nicht.
Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass selbst die Unschuldigen schuldig wirkten, wenn sie wegrannten.
2
Montag, 3. April, 22:20 Uhr
Deacon Garrison, Detective im Morddezernat von Alexandria City, beobachtete, wie die Frau sich zurückzog. Sie war klein, schmal wie ein Junge und hatte langes, dunkles Haar, das ihr bis auf den Rücken fiel und ihr blasses Gesicht umrahmte. Sie trug Jeans und einen Kapuzenpulli, der nicht so aussah, als würde er sie sonderlich warm halten. Sie hätte leicht als Jugendliche durchgehen können, wäre da nicht diese Intensität gewesen, die ihre ganze Haltung ausstrahlte.
Für diese Frau war das Feuer nicht nur eine abendliche Ablenkung. Es war etwas Persönliches, Schmerzliches, und so sehr es auch den Anschein hatte, als wollte sie sich von der Szenerie abwenden, so sehr bezweifelte er, dass sie es konnte. Über ihre blasse Wange rann eine Träne, und sie wischte sie energisch weg. Die Frau gehörte nicht hierher.
Wer sie auch war, er musste sie befragen, bevor sie ihm entwischte. Sein Instinkt sagte ihm, dass sie über Informationen verfügte, die sich als wertvoll erweisen würden.
Als er ihr nachging, rief jemand seinen Namen. »Deacon.«
Garrison drehte sich um und erblickte seinen Partner, Detective Malcolm Kier, der gerade unter dem gelben Absperrband hindurchtauchte. Malcolm hatte die muskulöse Statur eines Boxers, pechschwarzes Haar und eine zynische Art, die man bei Männern Anfang dreißig selten sah. Er trug Jeans, ein graues Sweatshirt und abgetragene Lederstiefel. An einer Kette um seinen Hals baumelte seine Polizeimarke, und an seiner rechten Hüfte steckte seine Pistole. Während der letzten Tage war er den Appalachenweg entlanggewandert und erst heute zurückgekehrt.
Garrison und Malcolm gehörten zu einer vierköpfigen Spezialeinheit des Morddezernats in Alexandria, Virginia, einer Stadt, die im Norden an den Potomac River grenzte. Eine wechselvolle Geschichte, Wohlstand und Armut charakterisierten die Stadt.
»Ich habe gerade von dem Feuer gehört.« Ein leichter Akzent verriet Malcolms Herkunft aus Zentralvirginia.
Garrison stemmte die Hände in die Hüften und schaute wieder zu der Gruppe von Neugierigen hinüber. Die Frau war verschwunden. Forschend schweifte sein Blick über die Menge, doch sie war nicht mehr zu sehen. Mist. Er seufzte frustriert und fragte sich, ob die Überwachungskameras sie eingefangen hatten. »Ich habe hier eine Frau gesehen, die ganz absorbiert zu sein schien von dem Brand.«
Malcolm runzelte die Stirn. »Willst du versuchen, sie zu finden?«
»Ja. An die Leiche kommen wir sowieso nicht ran, bevor alles abgekühlt ist. Und das dauert noch.«
»Und wonach suche ich?«
»Zierlich, lange, schwarze Haare, sieht wie ein Teenager aus, ist aber keiner.«
Während der nächsten halben Stunde durchkämmten die beiden Detectives die Menge und befragten die Leute, um herauszufinden, ob jemand die Frau kannte. Doch niemand hatte sie gesehen. Einer Hundebesitzerin war jemand mit Kapuze aufgefallen, sie hatte sich aber nicht gemerkt, in welche Richtung er oder sie gegangen war. Immerhin wusste die Zeugin, dass die Person durchdringend blaue Augen hatte.
Garrison fragte sich, wieso die Frau ihm direkt aufgefallen war. Hatten die sieben Jahre bei der Polizei seine Sinne für Brandstiftung geschärft, oder war es einfach der ramponierte Ritter in ihm, der auf die Furcht einer Frau reagierte? Was auch immer ihn an ihr faszinierte, er tat gut daran, sich zu erinnern, dass eine elfenhafte Erscheinung mitunter gefährliche Untiefen verbarg.
Eine Dreiviertelstunde später hatten sie die Frau immer noch nicht gefunden. Falls sie noch in der Nähe war, versteckte sie sich gut.
»Irgendein Zeichen von ihr?« Garrison fuhr sich mit den Fingern durchs Haar.
»Nein«, antwortete Malcolm. »Sie ist anscheinend verschwunden.«
Verdammter Mist. »Okay.«
»Hat sie das Feuer gelegt?«
»Ich weiß es nicht. Aber irgendetwas an dem Brand hat ihr ganz schön zugesetzt.«
»Deacon Garrison.« Die heisere, unverwechselbare Stimme gehörte Lieutenant Macy LaPorta, Brandermittlerin der Feuerwehr von Alexandria.
Garrison drehte sich um und sah Macy zwischen zwei Feuerwehrleuten stehen. Sie hob eine Hand. Die Geste kannte er. Bleib, wo du bist.
Macy war einen Meter zweiundsiebzig groß und gertenschlank. Neben den beiden massigen Feuerwehrleuten, die beide über einen Meter achtzig waren, wirkte sie beinahe zerbrechlich. Aber nur ein Dummkopf hätte sie für zerbrechlich gehalten. Sie ließ sich von niemandem einschüchtern, weder durch Körpergröße noch durch Rang.
Ihr lockiges, rotbraunes Haar war kinnlang, und fachkundig aufgetragenes Make-up verlieh ihrem von Natur aus blassen Teint Farbe, gleichzeitig deckte es die Sommersprossen auf ihrer Nase ab. Sie hasste diese Sommersprossen.
Wie immer war sie sorgfältig gekleidet. Sie trug dunkle Hosen, ein figurbetontes weißes Oberteil und einen dunklen Blazer. Ihre braunen Augen verrieten höchste Konzentration.
Der Feuerwehrmann, mit dem sie gerade sprach, hatte den Kopf leicht vorgebeugt, damit ihm ja kein Wort entging. »Ja, Ma’am«, sagte er. »Ich gebe Ihnen Bescheid, sobald das Gebäude gefahrlos untersucht werden kann.«
»Danke.« Sie wandte sich vom Feuer ab und ging zu Garrison hinüber. »Das ging ja schnell.«
»Du rufst nie ohne Grund an«, erwiderte Garrison.
Ihr Blick wanderte zwischen den beiden Detectives hin und her. »Ja, das stimmt.«
Garrison und Macy waren vor ein paar Jahren ein Paar gewesen. Sie hatten viel gemeinsam, und der Sex war großartig gewesen. Aber irgendwann hatte sie mehr gewollt, und mehr hatte er ihr wirklich nicht bieten können. Als ihre Geduld erschöpft war, hatte sie ihm ein Ultimatum gestellt. Er hatte sich entschieden und Schluss gemacht.
Macy hatte getobt und gewütet und ihm Beleidigungen an den Kopf geworfen, die er vermutlich verdient hatte. Doch er musste ihr zugutehalten, dass sie höflich blieb, wenn sie sich bei der Arbeit über den Weg liefen.
»Also, warum hast du uns zu einem Hausbrand gerufen? Doch sicher nicht wegen meines einnehmenden Lächelns.«
Macy nickte. »Wir vermuten Brandstiftung.«
Garrison betrachtete die verkohlten, rauchenden Balken, aus denen es immer noch zischte, wenn die Feuerwehrleute Wasser in die Glut spritzten. »Gibt es Tote?«
»Eine.«
»Wie viele Leute haben sich retten können?«, fragte Malcolm.
»Sieben. Und das grenzt an ein Wunder. Zeugen haben ausgesagt, dass das ganze Haus innerhalb von zwei Minuten in Flammen stand.« Macy massierte sich den Nacken und blickte auf die verkohlten Balken. »Sie sind alle mit dem Leben davongekommen, weil sie im vorderen Teil des Hauses ferngesehen haben. Und als die Rauchmelder losgingen, sind sie rausgerannt.«
»Und wo war die Tote bei Ausbruch des Feuers?«, fragte Garrison.
»Das ist es ja gerade«, antwortete Macy. »Sie ist nicht durch das Feuer gestorben.«
»Wo ist sie?«, fragte Malcolm.
»Hinten im Garten.« Macy deutete mit dem Zeigefinger. »Kommt mit.«
Garrison und Malcolm folgten ihr um das gelbe Absperrband herum in den Garten des Wohnheims. Fünfzehn Meter vom Haus entfernt hatte man eine kleine Fläche mit rotem Absperrband abgetrennt, wie man es bei Verbrechen benutzte. In der Mitte des Areals lag, zugedeckt mit einem weißen Tuch, ein menschlicher Körper.
Macy ging zu der Leiche, hockte sich hin und griff nach dem Tuch. »Wir haben sie zugedeckt, um bis zur Löschung des Brands keine Spuren zu vernichten. So dicht beim Haus ist es ein Wunder, dass sie nicht klatschnass ist.«
Garrison gesellte sich zu der Brandermittlerin, holte Gummihandschuhe aus der Tasche und streifte sie über.
Macy hob das Tuch an und enthüllte das leblose Gesicht einer Frau. Ihre Züge waren fahl, und ihr Mund stand offen. Das Feuer hatte ihr Gesicht unversehrt gelassen, der Tod würde ihr das einst blendende Aussehen erst noch nehmen müssen: volle Lippen, hohe, ausgeprägte Wangenknochen und blondes Haar, das ihr sicherlich ebenso teuer gewesen war wie die großen Brüste, die das Tuch verbarg.
»Sie sieht nicht aus wie eine, die im Obdachlosenheim unterschlüpft. Ist sie aus diesem Haus gekommen?«, fragte Garrison.
»Ich glaube nicht.« Macy hob das Tuch ein Stück weiter an und enthüllte Stichwunden in der Herzgegend.
Malcolm streifte sich ebenfalls Handschuhe über und stellte sich auf die andere Seite der Leiche. Die beiden Detectives gingen neben der Toten in die Hocke und betrachteten die tiefen, gezackten Wunden. »Das erinnert mich an die Frau, die wir vor ein paar Monaten in der Nähe der U-Bahn-Station gefunden haben. Die Stichwunden sehen ganz ähnlich aus.« Bei dem damaligen Opfer hatte es sich um die siebenundfünfzig Jahre alte Eliza Martinez gehandelt. Sie hatte allein gelebt, als Haushaltshilfe gearbeitet, und ihre einzige Tochter war ein Jahr zuvor an Krebs gestorben. Sie hatte weder Drogen genommen noch war sie je verhaftet worden. Den Nachbarn zufolge war sie eine nette Frau gewesen. »Eine gute Katholikin«, wie einer von ihnen bemerkt hatte. Ihre größte Freude waren die Besuche ihres Enkels gewesen. Niemand hatte verstanden, wieso irgendjemand Eliza hatte töten wollen. Der Fall war bisher ungelöst, und mit jedem Tag wurde es unwahrscheinlicher, dass er noch gelöst werden würde.
»Die Wunden bei diesem Opfer wirken tiefer, was auf sehr große Wut schließen lässt«, meinte Garrison. »Martinez hatte nur einen einzigen Messerstich in der Brust, und sie war nicht nackt. Der Mörder hat ihr Gesicht sogar mit einem Handtuch zugedeckt.«
»Zwischen den beiden Opfern gibt es noch einen anderen großen Unterschied.« Macy zog das Tuch jetzt ganz weg, und der Anblick, der sich ihnen bot, schockierte Garrison zutiefst. Um den Bauchnabel der Frau waren vier Brandmale in Form von vierzackigen Sternen angeordnet.
»Scheiße«, entfuhr es Malcolm.
Garrison betrachtete die roten, zornigen Sterne. Himmel, sie musste furchtbare Schmerzen erlitten haben. Er meinte beinahe, die Schreie der Frau hören zu können. »Martinez wurde ganz sicher nicht wie dieses Opfer hier gefoltert.«
Garrison sah sich in dem eingezäunten Garten um. Am Ende des Grundstücks schlug leise ein Tor zu, als wäre gerade jemand hindurchgegangen. »Irgendwelche Blutspuren?«
»Nein. Und es deutet nichts auf einen Kampf hin. Offensichtlich wurde sie nicht hier draußen gefoltert und ermordet«, sagte Malcolm.
»Warum hat man sie hier abgelegt?«, fragte Macy.
»Das müssen wir herausfinden«, meinte Garrison. »Du gehst von Brandstiftung aus, hast du gesagt?«
Macy nickte. »Ich würde einen Monatslohn darauf verwetten.«
Garrison stand auf. Der leichte Schmerz in den Knien erinnerte ihn an seine Zeit als Fallschirmjäger bei der Luftwaffe. »Warum?«
»Schwer zu sagen. Ein sehr heftiger Brand, der urplötzlich an der Hintertür entstanden ist. In der Nähe der Tür scheint es aber nichts gegeben zu haben, was versehentlich derart hätte hochgehen können.«
»Wie lange brauchst du, um sicher zu sein?«, fragte Garrison.
»Gut möglich, dass ich die Asche erst morgen untersuchen kann, wenn alles abgekühlt ist und keine Gefahr mehr besteht.«
»Sag mir Bescheid, sobald du etwas hast.«
»Wenn euer Mörder diesen Brand gelegt hat, um seine Spuren zu verwischen, hat er sich nicht besonders klug angestellt«, meinte Macy. »Eher unwahrscheinlich, dass die Tote durch das Feuer im Haus vollständig verbrannt worden wäre.«
»Ich bin mir nicht so sicher, dass der Mörder die Leiche vernichten wollte«, sagte Garrison.
»Wieso sollte er seine Spuren nicht verwischen wollen?«, fragte Macy.
Malcolm schüttelte den Kopf. »Wenn die Leiche beseitigt wird, kann niemand sein Werk besichtigen.«
Macys Blick ruhte einen Moment auf der Leiche, dann sah sie weg. »Glaubt ihr, er wird es wieder tun?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Garrison.
Macy schüttelte den Kopf. »Ein Feuer ist zwar unberechenbar, aber ich weiß wenigstens, dass es mich tötet, wenn ich nicht aufpasse.« Sie betrachtete den ausgestreckten, leblosen Körper. »Bei Menschen dagegen weiß man nie richtig, was sie antreibt. Sie sind voller Rätsel.«
Garrison wusste nicht recht, ob sie ihn oder den Mörder meinte. »Niemand soll sich der Leiche nähern – auch nicht deine Leute. Was ich am wenigsten gebrauchen kann, ist, dass irgendein Irrer diesen Mord kopiert.«
Macy stemmte die Hände in die Hüften. »Ein paar haben sie schon gesehen, aber sie werden nichts ausplaudern, dafür verbürge ich mich.«
Garrison sah sie an. »Ich verlasse mich darauf.«
Sein Tonfall reizte sie offenbar, denn sie streckte das Kinn vor. »Kümmere du dich um deine Leute, ich kümmere mich um meine.« Ihre Augen blitzten, und er wusste, wenn er nicht lockerließ, würde er sich einen ausgewachsenen Streit einhandeln. Macy stand hundertprozentig hinter ihren Mitarbeitern und legte sich persönlich mit jedem an, der schlecht über ihr Team sprach.
Was Garrison brauchte, war Kooperation und nicht Streitereien über Zuständigkeiten. Und wenn er in etwas gut war, dann darin, andere Leute von seinem Standpunkt zu überzeugen. Also bemühte er sich, Macy zu besänftigen. »Hast du mit den Überlebenden des Brandes oder mit der Heimleitung gesprochen?«
»Das ist eure Sache, nicht meine.« Sie war immer noch in Abwehrhaltung, aber schon ein bisschen entspannter. »Ich bin nur hier, um euch die Leiche zu zeigen, dann mache ich weiter und versuche rauszukriegen, wer das Feuer gelegt hat.«
Malcolm rieb sich die Hände, als wären sie schmutzig. »Okay.«
Garrison lächelte Macy an. »Und wenn es irgendwas Neues über das Feuer gibt, sagst du mir Bescheid.«
»Dir zuallererst.« Sie ging zu dem Pulk von Feuerwehrwagen zurück, und das geordnete Chaos verschluckte sie.
»Du hast echt eine Begabung, sie zu verärgern«, bemerkte Malcolm.
»Ich bin eben ein Naturtalent.«
Malcolm fluchte unterdrückt. »Du warst mal mit ihr zusammen, oder?«
»Ja.«
»Herrgott nochmal, gibt es eigentlich irgendeine Frau in der Stadt, mit der du nicht zusammen warst?«
»Ich lüge nie und mache nie Versprechungen.«
»Und deswegen lieben dich die Frauen?« Es klang sarkastisch.
Garrison ignorierte die Bemerkung. »Die Spurensicherung ist auf dem Weg und müsste bald hier sein. Als Erstes sollen sie Fingerabdrücke nehmen und die Tote identifizieren. Wenn es auch nur die geringste Möglichkeit gibt, dass die beiden Morde zusammenhängen, müssen wir das wissen.«
»Die Taten wirken, als wären sie von unterschiedlichen Leuten begangen worden.«
»Das war auch mein erster Gedanke.« Trotzdem würde er die Spurensicherung arbeiten lassen.
»Die Tote scheint Klasse zu haben«, meinte Malcolm. »Es sieht eher nicht so aus, als hätten sie und das erste Opfer in denselben Kreisen verkehrt.«
»Das muss nicht heißen, dass sie nicht irgendetwas gemeinsam haben.« Garrison warf einen Blick auf die nachgewachsenen dunklen Ansätze in dem blonden Haar. Die Frau sah aus, als habe sie sich gut ernährt, und es gab keine Einstiche an ihren Armen. Ihre Brüste waren allem Anschein nach durch eine Schönheitsoperation vergrößert worden. Er deckte sie mit dem Tuch wieder zu.
»Soll ich noch mal mit den Schaulustigen reden?«, fragte Malcolm.
»Ja. Und halt weiter nach dieser Frau Ausschau. Vielleicht ist sie zurückgekommen. Ich kümmere mich um die Hausbewohner.« Es würde eine lange Nacht werden.
»Okay.« Malcolm verschwand in Richtung Straße, während Garrison in den Vorgarten ging, wo die sieben Überlebenden saßen, in Decken gehüllt und mit Kaffeebechern in den Händen. Sie starrten stumpf vor sich hin – ein Zeichen des Schocks.
Das Feuer hatte die erschöpfte, abgerissen wirkende Gruppe offenbar schwer mitgenommen. Garrison musterte einen nach dem anderen, beginnend mit einer Frau, die er auf Anfang fünfzig schätzte. Graue Strähnen durchzogen ihren dünnen Pferdeschwanz, sie hatte ledrige Haut und Krähenfüße unter den tiefliegenden braunen Augen.
Am anderen Ende saß ein Mann von Mitte dreißig mit mokkafarbener Haut. Er trug einen dicken Jagdanorak, der ihm zwei Nummern zu groß war, eine ramponierte Baseballkappe mit dem Aufdruck ACE, Stiefel mit Stahlkappen, ein graues Hemd und eine Jeans, die mit einem halben Dutzend Flicken übersät war.
Garrison würde einzeln mit ihnen sprechen müssen, damit keiner mit seiner Geschichte die der anderen beeinflusste. Die Erinnerungen von Augenzeugen, die ein Trauma erlitten hatten, waren oft verzerrt.
»Ich hab gesehen, was passiert ist.« Der Mann mit der ACE-Kappe hatte das Wort ergriffen.
Garrison schob eine Hand in die Tasche, holte ein Päckchen Kaugummi heraus und schlenderte zu ihm hinüber. Er bot dem Mann einen Streifen an und wartete geduldig, bis dieser das Kaugummi ausgewickelt und in den Mund gesteckt hatte.
Der Mann nickte. »Danke.«
»Gehen wir ein Stück.«
»Okay.«
Die beiden begaben sich außer Hörweite der anderen sechs Überlebenden. Garrison hatte vor langer Zeit gelernt, dass er oft mehr erfuhr, wenn er bei der Befragung nicht drängte, und dass ein wenig Freundlichkeit mehr brachte als bohrende Fragen.
»Kann ich die restlichen Kaugummis auch noch haben?«, fragte der junge Mann.
»Klar.« Garrison gab ihm das Päckchen. »Ich bin Detective Garrison.«
»Ich heiße Ace.«
»Genau wie Ihre Kappe.«
Garrison zog einen dünnen Notizblock und einen Stift aus der Tasche seines blauen Sakkos.
»Wegen der Kappe nennen sie mich Ace.« Er fingerte an dem Kaugummipäckchen herum, hielt es sich unter die Nase und inhalierte tief. Dann steckte er es in seine Jackentasche.
»Wie ist ihr richtiger Name?«
Die dunklen Brauen zogen sich zusammen. »Ich weiß nicht mehr.«
Garrison lächelte. »Vielleicht fällt es Ihnen ja wieder ein.«
Ace runzelte die Stirn, als würde er sich darüber ärgern, dass er seinen Namen nicht mehr wusste. »Manchmal fällt es mir ein. Warten Sie ab.«
»Nun, dann bleiben wir erst mal bei Ace. Also, was ist passiert? Wie ist das Feuer ausgebrochen?«
»Ich saß gerade vor der Glotze. Wir haben alle Entertainment Tonight geguckt. Ich mag Mary Hart. Gucken Sie auch Entertainment Tonight?«
»Nein. Ich sehe nicht viel fern, außer in der Footballsaison.«
»Ich finde ET super. Da sieht man, dass sogar berühmte Leute Probleme haben. Wenn ich solche Berater hätte wie die Stars, ging’s mir vielleicht auch noch besser.«
»Wahrscheinlich können wir alle ab und zu ein bisschen Beratung gebrauchen.« Verdammt, es hatte eine Zeit gegeben, da waren seine Eltern zu ihm gekommen und hatten ihn wieder ins Lot gebracht. Nicht auszudenken, was aus Garrison geworden wäre, wenn er sie nicht gehabt hätte. »Ist das Feuer während oder nach der Sendung ausgebrochen?«
»Zum Glück erst danach. Ich bin gerade aufgestanden und wollte aus der Küche Wasser holen, da hab ich im Vorgarten die Flamme gesehen.«
»Eine Flamme?« Garrison machte sich eine Notiz.
»Ja. Irgend so’n Typ hatte eine Flamme in der Hand.«
»Einen Molotowcocktail?«
»Kann sein. Ich hab noch nie einen gesehen.«
»Was ist dann passiert?«
»Der Kerl ist auf das Haus zugegangen und hat die Flasche mit dem Feuer gegen die Wand geschmissen. Als sie das Haus getroffen hat, ist sie irgendwie explodiert. Wenn Sie mir nicht glauben, können Sie ja die Augen überprüfen.«
»Augen?«
»Kameras. Sie sind überall. Sie nehmen alles auf.«
Garrison ließ den Blick schweifen. »Es gibt hauptsächlich Wohnhäuser hier in der Gegend.«
»An dem Haus an der Ecke ist ’ne Kamera. Der Typ hat Angst vor uns. Will in seiner Straße keine Obdachlosen haben. Mit der Kamera kann er uns beobachten.«
»Welches Haus?«
»Das weiße an der Ecke.«
»Danke. Ich schau es mir an.« Garrison massierte sich den Nacken. »Fällt Ihnen irgendjemand ein, der das Wohnheim niederbrennen wollen würde?«
»Ein paar.«
»Zum Beispiel?«
»Hier gibt’s immer einen, der auf jemand sauer ist. Letzte Woche hatte ich Streit wegen der Fernbedienung. Darryl wollte sie bei ET haben. Ich bin wütend geworden, und dann haben wir uns geprügelt.«
»Ist Darryl heute Abend hier?« Garrison schrieb sich den Namen auf, bezweifelte aber, dass irgendetwas von alldem ihn weiterbringen würde.
»Nee. Hab ihn seit einer Woche nicht gesehen.«
»Wissen Sie, wo er ist?«
»Nee. Er kommt und geht. Er wohnt nicht immer hier, so wie ich.«
»Okay.«
Die Nasenflügel des jungen Mannes blähten sich. »Sie glauben mir das mit der Flamme nicht.«
Garrison schüttelte langsam den Kopf und verzog die Mundwinkel zu einem Lächeln. »Ich glaube Ihnen, Mann. Ich glaube Ihnen.«
Aces Augen verengten sich. »Sie müssen es mir nicht glauben. Gucken Sie bei den Augen nach. Die sehen alles.«
»Das werde ich tun. Danke, Ace.«
Ace wischte sich die Nase mit dem Handrücken ab. »Wie heißen Sie noch mal? Ich hab’s vergessen.«
»Garrison. Deacon Garrison.«
»Ich werd’s mir merken.«
»Gut.« Garrison klopfte Ace auf die Schulter. »Wo schlafen Sie heute Nacht?«
»Weiß nicht.«
»Sobald ich mit allen geredet habe, sehe ich zu, dass ich irgendwo eine Schlafgelegenheit für Sie finde.«
»Danke, Chef.«
»Ace, haben Sie hier mal eine kleine, zierliche Frau gesehen? Dunkle Haare. Sieht aus wie ein junges Mädchen.«
Ace zögerte und legte die Stirn in Falten wie ein Kind, das ein Geheimnis hat. »Könnten viele sein, glaub ich. Weiß nicht genau.«
Er log. »Sie stand vor einer Stunde zwischen den Schaulustigen.«
Ace spielte mit dem Kaugummipapier. »Tut mir leid.«
Garrison beugte sich so weit vor, dass er die übliche Distanz unterschritt, achtete aber darauf, Ace nicht zu berühren. »Sie verschweigen mir doch nichts, Ace?«
Ace blickte zu Boden. »Nein.«
»Gut, ich will ihr nämlich keinen Ärger machen. Ich will nur mit ihr reden.«
»Tut mir leid, Chef. Kann Ihnen da nicht helfen.«
Ace schützte die Frau. Aber wieso? War er ein verhinderter Ritter so wie Garrison, oder hütete er ein dunkleres Geheimnis?