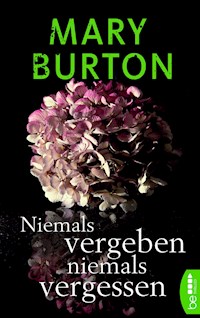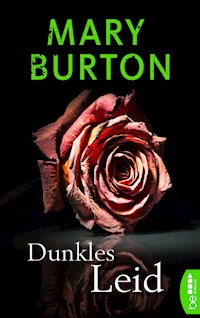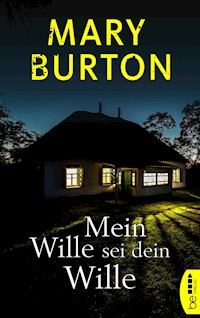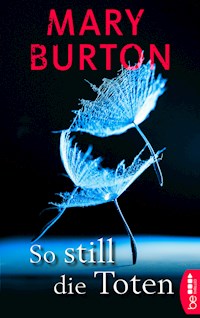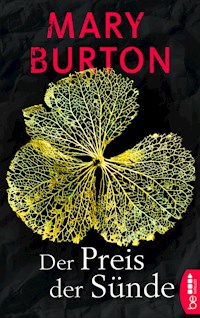
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Alexandria-Reihe - Romantic Suspense
- Sprache: Deutsch
Der Vergangenheit entkommt niemand ...
Staatsanwältin Charlotte Wellington hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen - die Erinnerung an ihre ermordete Schwester ebenso wie an ihre Kindheit bei einem Wanderzirkus. Doch achtzehn Jahre später ist der Zirkus wieder in der Stadt, und in einer Jagdhütte wird die nackte Leiche einer jungen Frau gefunden. Auf ihrer Stirn prangt frisch tätowiert das Wort "Hexe". Als weitere Morde geschehen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Wie es scheint, hat der Hexenjäger es auf die Schausteller abgesehen. Zusammen mit Detective Daniel Rokov muss Charlotte die Rätsel ihrer Vergangenheit lösen, bevor noch mehr Menschen sterben ...
"Nach diesem Thriller lässt man beim Schlafen lieber das Licht an!" Publishers Weekly
Weitere Romantic-Suspense-Titel von Mary Burton bei beTHRILLED:
Die Alexandria-Reihe: Das Flüstern der Albträume. So still die Toten. Der Preis der Sünde.
Die Richmond-Reihe: Mein Wille sei dein Wille. Niemand hört dich schreien.
Die Texas-Reihe: Das siebte Opfer. Dunkles Leid. Niemals vergeben, niemals vergessen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumProlog123456789101112131415161718192021222324EpilogWeitere Titel der Autorin
Die Alexandria-Reihe
Band 1: Das Flüstern der Alpträume
Band 2: So still die Toten
Die Richmond-Reihe
Band 1: Mein Wille sei dein Wille
Band 2: Niemand hört dich schreien
Die Texas-Reihe
Band 1: Das siebte Opfer
Band 2: Dunkles Leid
Band 3: Niemals vergeben, niemals vergessen
Über dieses Buch
Der Vergangenheit entkommt niemand …
Staatsanwältin Charlotte Wellington hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen – die Erinnerung an ihre ermordete Schwester ebenso wie an ihre Kindheit bei einem Wanderzirkus. Doch achtzehn Jahre später ist der Zirkus wieder in der Stadt, und in einer Jagdhütte wird die nackte Leiche einer jungen Frau gefunden. Auf ihrer Stirn prangt frisch tätowiert das Wort »Hexe«. Als weitere Morde geschehen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Wie es scheint, hat der Hexenjäger es auf die Schausteller abgesehen. Zusammen mit Detective Daniel Rokov muss Charlotte die Rätsel ihrer Vergangenheit lösen, bevor noch mehr Menschen sterben …
Über die Autorin
Mary Burton ist im Süden der USA aufgewachsen und hat an der Universität von Virginia Englisch studiert. Nach einer Karriere im Bereich Marketing begann sie äußerst erfolgreich Thriller zu schreiben. Burton lebt und arbeitet in Virginia. Weitere Informationen über die Autorin finden Sie unter: www.maryburton.com.
MARY BURTON
Der Preis der Sünde
Aus dem amerikanischen Englisch von Karin Will
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Mary Burton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Before she dies«
Originalverlag: Zebra Books als Teil der Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA
Published by arrangement with Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2014/2019 by LYX/Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Claudia Schlottmann
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AlexanderTrou | Luca Calzone
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-7555-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
Vor achtzehn Jahren
Er konnte den Tag, die Stunde, selbst die Sekunde, in der er sein erstes Opfer ausgewählt hatte, genau benennen. In jenem geheiligten Moment hatten Furcht, Regeln und Konsequenzen jegliche Bedeutung verloren und lange gehegte Fantasien die Oberhand über die Vernunft gewonnen. Er hatte den Schalter umgelegt und die Grenze überschritten.
Er sah zu dem jungen Mädchen hinüber, das mit verbundenen Augen an den Holzstuhl gefesselt war. Sie saß zusammengesackt da, bewusstlos von den Medikamenten, die er ihr verabreicht hatte. Dichtes, schwarzes Haar fiel ihr in das blasse, schmale Gesicht, floss über die vollen, festen Brüste bis zu den sanft gerundeten Hüften. Das Mädchen, das höchstens siebzehn oder achtzehn Jahre alt war, arbeitete auf dem Rummelplatz. Sie war Hellseherin. Wahrsagerin. Verführerin. Für andere Menschen bedeutete sie eine nette Zerstreuung, ein harmloses Vergnügen. Aber er war etwas Besonderes und verfügte über Kräfte, die es ihm erlaubten, ihre Jugend und Schönheit zu durchschauen und das Böse dahinter wahrzunehmen.
Die Entscheidung, sie zu töten, war vor sieben Tagen gefallen, als er auf dem Rummelplatz bei ihr gewesen war. An jenem Abend hatte er geduldig in der Schlange gewartet, die sich vor ihrem Zelt gebildet hatte. Er war nervös und gereizt gewesen und hatte noch keine Ahnung gehabt, dass sein Leben gleich eine neue Wendung nehmen würde.
Als er endlich ihr Reich betreten hatte, flackerten Kerzen in dunklen Ecken, aus unsichtbaren Lautsprechern drang leise Musik, und ein schwerer Weihrauchduft lag in der Luft. Sie saß hinter einem vergoldeten Tisch und trug ein fließendes, hellrotes Zigeunergewand. Eine dunkle Perücke umrahmte ihr liebliches Gesicht, das eine schwarze Augenmaske halb verbarg. Bei ihrem Anblick wallte Erregung in ihm auf, und er setzte sich ihr gegenüber.
»Madame Divine«, sagte er.
Sie nickte, nahm seine Hand und drehte sie mit der Innenfläche nach oben. »Ja.«
»Sie sehen so jung aus.«
»Lassen Sie sich von meiner Jugend nicht täuschen.« Aus ihren Worten sprach Selbstbewusstsein, und sie fuhr mit dem Finger seine zerklüftete Lebenslinie entlang.
Er ließ sich nicht hinters Licht führen. »Ich habe die wartenden Menschen draußen gesehen. Sie scheinen ganz schön beliebt zu sein.«
Die grünen Augen bohrten sich in seine. »Wie lautet Ihre Frage?«
Ärger über ihre Schroffheit stieg in ihm auf, aber er hielt ihn sorgsam unter Verschluss. »Hat sie mich geliebt?«
Madame Divine nickte wieder und fuhr eine weitere Linie auf seiner Handfläche nach. »Für zwanzig Dollar kann ich diese Frage beantworten.«
Seine Haut kribbelte. Er zog die Hand zurück, holte eine zerknitterte Zwanzigdollarnote aus seiner Jeanstasche und legte sie auf den Samtstoff zwischen ihnen. Sie stellte die Zeitschaltuhr, die neben ihr stand, und ergriff wieder seine Hand. Ihre Haut war weich und warm. Ein leichter Hauch von Parfüm umgab sie und vermischte sich mit dem beißenden Geruch der Duftkerzen. Sie schloss die Augen und bat die Geister um Hilfe.
Während er auf die zarte Linie starrte, die ihre Stirn furchte, gab er sich der Vorstellung hin, wie es sein würde, ihr die Kleider vom Leib zu reißen und sie zu verprügeln, bis sie weinte. Wie mochte wohl ihre Stimme klingen, wenn sie bettelte? Ganz bestimmt würde sie betteln, weinen, flehen. Und wenn er die Finger um ihren Hals schloss, wie lange würde es wohl dauern, bis Leben und Wärme ihren Körper verließen? All das ging ihm durch den Kopf, während sie die Lebenslinie auf seiner Handfläche nachzeichnete und von Glück und Wohlstand sprach.
Und dann richtete sie sich plötzlich auf, als hätte der Teufel ihr einen Schlag versetzt. Ihre Finger verkrampften sich ein wenig, und ihr Atem wurde flach. Sie ließ seine Hand los, als hätte sie sich daran verbrannt. Sie starrte ihn an, und in den grünen Untiefen ihrer Augen glomm Furcht auf.
In diesem panischen Moment wusste er, dass sie ihn durchschaut hatte.
Die Erkenntnis verwirrte ihn. Noch nie hatte jemand hinter seine Fassade geblickt. Sie war eine echte Seherin. Eine Hexe.
Sie war die Eine, die er für Gott töten sollte.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Ja. Ja. Alles bestens.« Sie befeuchtete sich die Lippen. »Erzählen Sie mir von dieser Frau, die Sie lieben.«
Er lächelte. Wenn er es darauf anlegte, konnte er durchaus gewinnend sein. »Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Wir sind im selben Jahrgang.«
»Wie heißt sie?«
»Carrie. Ich habe sie sehr geliebt. Warum hat sie meine Liebe nicht erwidert?«
Angesichts der banalen Frage löste sich die Spannung in ihrem Körper ein wenig, und sie beugte sich leicht zu ihm vor. Sie lächelte, aber er wusste, dass ihre Furcht noch da war, so deutlich sichtbar wie die Schweißperlen auf ihrer Stirn. »Carrie liebt Sie, aber sie hat Angst vor … ihren Gefühlen.«
Obwohl er entschlossen war, stark zu bleiben, berührte es ihn, als sie mit ihrer leisen Stimme Carries Namen aussprach. Er hätte gerne geglaubt, dass Carrie ihn liebte. »Sie hat gesagt, sie hasst mich.«
»Sie hasst Sie nicht. Sie liebt Sie. Sie müssen zu ihr gehen und ihr sagen, was Sie empfinden.«
Sie quatschte noch mehr Blödsinn über Schicksal und Glück, doch als der Wecker klingelte, ließ sie sofort seine Hand los.
Er ließ die Hand noch ein wenig liegen und sehnte sich nach ihrer Berührung. Sein Gefühl drängte ihn, sie jetzt gleich zu nehmen. Töte. Töte. Töte. Doch seine Vernunft hielt ihn an der kurzen Leine. Warte ab. Bereite dich vor.
Also verließ er das Zelt in aller Ruhe und nutzte die nächste Woche, um den Raum für sie herzurichten. Sie war sein erstes Opfer, und alles sollte perfekt sein.
Am siebten Abend nach seiner Sitzung bei ihr wartete er im Schatten. Als sie von ihrer Hurerei in der Stadt zurückkehrte und die Toilette des Rummelplatzes aufsuchte, die am Waldrand lag, packte er sie und hielt ihr mit der behandschuhten Hand den Mund zu. Die Spritze, die er ihr in den Arm jagte, ließ sie augenblicklich schlaff und gefügig werden. Mühelos verfrachtete er sie in den Kofferraum seines Wagens und brachte sie zu der Jagdhütte, die tief in den Wäldern Virginias verborgen lag.
Jetzt fiel Mondlicht durch die kleinen Fenster und mischte sich mit dem Schein dreier Laternen. Das einzige Zugeständnis an Luxus in der einfachen Hütte war eine Pumpe, aus der Wasser in ein tiefes Becken floss. An Möbeln gab es nur einen langen Holztisch und ein paar schlichte Stühle mit gerader Lehne, die neben einem verrußten Ofen standen. Wer hier wohnte, führte ein spartanisches Leben – eine Vorstellung, die ihm gefiel.
Innerlich glühte er vor Vorfreude. Die Träume und Sehnsüchte so vieler Jahre würden nun in Erfüllung gehen, und es war schwer, die Kontrolle zu bewahren. Seine Haut kribbelte, sein Magen zog sich zusammen. Wenn er der primitiven Energie, die in ihm pulsierte, nicht bald freien Lauf ließ, würde er noch den Verstand verlieren.
Da er nicht so lange warten konnte, bis sie von allein aufwachte, ergriff er einen Eimer mit kaltem Wasser und schüttete es ihr ins Gesicht. Fluchend, schreiend, schimpfend wachte sie auf. Die leichte Panik in ihren Schreien verstärkte seine Erregung noch. Er starrte auf ihr seidiges Oberteil, das jetzt nass war und an ihren unglaublich vollen Brüsten klebte.
Er konnte kaum atmen, seine Muskeln schmerzten vor Verlangen, und er zog sich in eine Ecke der Hütte zurück. Er hatte nicht mit so heftigem Begehren gerechnet. Immer hatte er sich für einen keuschen, besonnenen Mann gehalten, aber sie weckte dunkle, böse Gelüste in ihm.
Die Vorfreude brannte in seinem Körper, und er wusste, wenn er seine Begierde nicht im Zaum hielt, würde er den Schwur brechen, den er vor Gott geleistet hatte.
Erst muss sie ein Geständnis ablegen und geläutert werden.
Sie hustete, und leise betete er zu Gott und bat ihn um Geduld. Er holte die kleine Bibel aus der Tasche und küsste sanft das geprägte goldene Kreuz auf dem abgewetzten schwarzen Leder. Die Bibel hatte ihm seine Mutter zu seinem zehnten Geburtstag geschenkt. Sie war zwar weder kostbar noch besonders groß, schenkte ihm jedoch Antworten und Einsichten und war ihm in Zeiten der Bedrängnis eine lenkende Kraft.
Mit zitternden Fingern blätterte er durch die Seiten, überflog einzelne Passagen, las andere ganz. Während er sich auf die Worte konzentrierte, spürte er mit einem Mal ihren Blick durch die Augenbinde. Sie hatte den Kopf gehoben und in seine Richtung gedreht. Von ihrem Hals und ihrem Gesicht tropfte über eine goldene Kette Wasser in den Ausschnitt zwischen ihre Brüste.
Gefesselt, nass und durchgefroren, wie sie war, hätte sie eigentlich Angst und Reue empfinden müssen, aber stattdessen strahlte sie eine dunkle Konzentriertheit aus, die ihn verstörte. Dass sie keine Furcht hatte, gefiel ihm gar nicht.
»Starr mich nicht an«, sagte er.
Sie schüttelte den Kopf. »Meine Augen sind verbunden. Ich kann gar nichts sehen.«
»Du schaust mich an.«
»Und wenn?« Ihre Stimme war rau, verführerisch.
»Du bist ein Kind des Satans.«
Sie lächelte doch tatsächlich. »Das höre ich nicht zum ersten Mal.«
Der Zorn setzte ihm zu. Er durchquerte den Raum und packte sie an den Haaren. Er zog ein Messer aus seiner Gesäßtasche und drückte es ihr an den Hals, sodass sie die scharfe Spitze spüren konnte. Unter der Klinge pulsierte ihre Halsschlagader.
Er war kurz davor, ihr die Kehle aufzuschlitzen, als seine Vernunft wieder die Oberhand gewann.
»Du musst deine Sünden vor Gott bekennen, damit du diese Erde in einem Zustand der Reinheit verlassen kannst.«
Ihr Kinn wirkte so trotzig wie ihre Worte. »Für mich ist die Zeit der Reinheit längst vorbei.« In der Stimme des Mädchens lag jahrelange Erfahrung.
»Ich brauche deine Beichte. Ich muss dich geläutert zu Gott schicken.«
»Dann ist heute wohl nicht dein Glückstag.« Sie legte den Kopf schief.
Aus der Nähe fing er einen Hauch ihres würzigen, nicht süßen Parfüms auf, das sich mit dem muffigen Geruch ihres fadenscheinigen Zigeunergewands vermischte. Er drehte ihr Gesicht grob zur Seite, sodass der Laternenschein ihre hohen Wangenknochen hervorhob. Sie war hübsch, hatte aber etwas Abgebrühtes, Empfindungsloses an sich, das sich mit der Zeit noch verstärken würde. Mit dreißig würde sie ausgelutscht und verbraucht sein.
Warum hatte sie vor einer Woche so anders gewirkt?
»Du und ich, wir sind ganz allein hier, Baby«, flüsterte sie. »Warum spielen wir nicht lieber, anstatt zu kämpfen? Manche Jungs mögen es hart, aber glaub mir, zärtlich ist es besser.«
Er zog fester an ihren Haaren. »Nenn mich nicht Baby.«
Sie erinnerte ihn an eine Katze, die mit einer Maus spielt. »Warum nicht? Ich bin gut, und was ich für dich tun kann, wird dir gefallen.«
Von ihren honigsüßen Worten in Versuchung geführt, ließ er den Blick zu ihren Brüsten sinken, die so rund und voll waren. Er brannte darauf, sie zu berühren, an ihnen zu saugen. Das Gleichgewicht der Kräfte geriet ins Wanken. »Halt den Mund.«
»Komm her zu mir, dann vergisst du die Peitsche und diese Hütte, das verspreche ich dir.«
Er riss an ihrem Haar, und sie schrie auf. »Hure. Dirne.«
Tränen, die dem Schmerz, nicht der Angst entsprangen, rannen unter der Augenbinde hervor und über ihre Wangen. »Baby, nimm mich doch. Du weißt, dass ich gut sein werde. Ich bin immer gut.« Trotz der Fesseln konnte sie ihre Hand genug bewegen, um ihm mit den Fingerspitzen über den Oberschenkel zu streichen.
Die sanfte Berührung durch seine Jeans löste einen Sturm der Gefühle in ihm aus, und augenblicklich bekam er eine Erektion. Ihre Worte, süß wie der Gesang der Sirenen, stellten seine Entschlossenheit auf die Probe und hätten ihn um ein Haar ins Straucheln gebracht. Er war zwar Herr über Leben und Tod, aber irgendwie hatte sie ihn mit ihren magnetischen Augen und einer simplen Berührung hypnotisiert.
»Du brauchst mir nicht wehzutun, Baby«, sagte sie. »Wir können es uns doch schön machen. Binde mich los, dann wirst du schon sehen.«
»Hältst du mich für blöd?«
»Nein.« Der Schwung ihrer Lippen strafte ihre Antwort Lügen. »Aber wir sollten lieber anfangen, bevor uns jemand erwischt.«
Nun war er es, der lächeln musste. »Niemand wird uns hier stören. Diese Hütte kennen nur eine Handvoll Leute, und die kommen bestimmt nicht vor Beginn der Jagdsaison.« Er strich ihr übers Haar. »Und bis dahin dauert es noch Wochen.«
Sie befeuchtete ihre trockenen, rissigen Lippen, und diesmal lag ein leises Beben in ihrer Stimme. »Küss mich. Ich weiß, dass du mich küssen willst.«
Und bei Gott, er wollte es. Seit er sie sieben Nächte zuvor zum ersten Mal gesehen hatte, hatte er davon geträumt, sie zu nehmen. Mehrere Male hatte er sich mit dem Rasiermesser in Oberschenkel und Bauch schneiden müssen, um bis zum rechten Moment Keuschheit und Selbstbeherrschung zu bewahren.
Er beugte sich vor und kostete ihre rosigen Lippen. Sie waren weich, salzig, und ehe er sich besinnen konnte, umfasste er ihre volle Brust mit der Hand. Er quetschte ihre Brustwarze, bis die junge Frau wimmerte. Seine Erektion verstärkte sich, und er stellte sich vor, wie er ihre Fesseln löste und sie nahm. Vielleicht könnte er sie für ein paar Wochen in die Kiste unter den Dielenbrettern sperren, in der er seine Spielsachen aufbewahrte. Dort könnte sie nicht weglaufen und wäre immer da, um mit ihm zu spielen. Mit ein bisschen mehr Zeit konnte diese Delila vielleicht geläutert werden und in Reinheit zu Gott gehen.
Und dann hörte er aus der Entfernung die Stimme, die ihn auf seinen Pfad zurückbefahl.
»Sie ist eine Hexe. Wenn du der Versuchung des Fleisches nachgibst, wird sie dir deine Seele nehmen.«
Er zuckte zurück und entfernte sich von ihr. Mit dem Handrücken wischte er sich über den Mund. Sie musste seine Panik gespürt haben, denn in ihrem Lächeln lag Hochmut. »Schon gut, Baby. Du darfst mich lieben. Mach mich los, dann zeige ich dir, wie man richtig Spaß hat.«
Er hatte vom Töten geträumt, es sich ausgemalt. Er hatte sein Opfer ausgewählt. Er hatte geplant. Und jetzt, da es um die Durchführung ging, zauderte er. Was war nur los mit ihm? Er wich vor ihr zurück, hob seine Bibel auf, murmelte wahllos Gebete und rief sich ins Gedächtnis, dass er ein Soldat Gottes war. »Ich bin nicht schwach. Ich bin stärker als deine Verführungskünste.«
Wieder befeuchtete sie sich die aufgerissenen Lippen. »Lass mich dich lieben, Baby. Lass mich dich lieben. Du musst mir nicht mal die Augenbinde abnehmen.«
Er legte die Bibel hin. »›Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen.‹«
Wellen der Geringschätzung gingen von ihr aus. »Ich liebe dich, Baby. Du musst mich nur losbinden, dann kann ich es dir zeigen.«
»Du bist eine Sünderin. Du musst die Beichte ablegen.« Seine Stimme war rau und verzerrt vor Verlangen.
»Ich habe nichts zu beichten.«
»Wir alle sind Sünder.«
Sie leckte sich die Lippen und veränderte ihre Position, sodass ihre Brüste leicht wippten.
Seine Erektion pulsierte.
Er presste die Hände auf die frischen Schnitte an seiner Brust, die er sich heute Morgen zugefügt hatte. Schmerz durchzuckte ihn, und einen Augenblick lang rang er nach Luft, während das Begehren seinen Körper verließ.
»›Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen.‹«
Immer wieder kamen die Worte aus dem Zweiten Buch Mose über seine Lippen, halb Feststellung, halb Gebet. Er war geboren, um das Böse zu vernichten, und nicht, um sich von dessen irdischen Verlockungen in Versuchung führen zu lassen.
Sein weißes Hemd und seine Hände waren inzwischen feucht von seinem eigenen Blut, das im Licht des Mondes schwarz aussah. Er verteilte es auf der Stirn der Frau und vermischte dabei sein Blut mit ihrem. Der Duft des Blutes war wahrhaft süß.
Er drehte sich um und ging zu der Wasserpumpe in der Zimmerecke hinüber. Er bewegte den Hebel auf und ab, bis das Wasser zu fließen begann.
Sie drehte den Kopf in seine Richtung. »Was machst du, Baby?«
Er füllte den Eimer und trug ihn zu einer länglichen Metallwanne in der Nähe der Frau. Den Vorgang wiederholte er so lange, bis die Wanne randvoll war.
Mit zitternden Fingern löste er ihre Handfesseln. »Jetzt beginnt das Spiel.«
»Gut«, sagte sie. »Du wirst sehr glücklich sein. Wir werden es uns schön machen.«
Er hob die zierliche junge Frau hoch, trug sie zur Wanne und zwang sie auf die Knie. Dann packte er sie an den Haaren und drückte ihr Gesicht dicht über die sich kräuselnde Wasseroberfläche.
»Was machst du denn?« Die Fassade der Tapferkeit konnte ihren Schrecken nicht länger verbergen.
»Gestehe und befreie dich von deinen Sünden.«
»Was soll ich gestehen?«
Er tauchte ihr Gesicht in das kalte Wasser und genoss es, wie ihr Körper zuckte und sich wand. Erst als er Luftblasen aufsteigen sah, zog er sie wieder hoch. Sie hustete, spuckte und umklammerte den Rand der Wanne mit zitternden Fingern.
»Wirst du jetzt gestehen?«
Das strähnige, nasse Haar klebte an ihrem Gesicht, während sie hustete, würgte und versuchte, sich zu befreien.
Sie fing an zu schreien.
Das Geräusch hallte von den Wänden der Hütte wider. »Niemand hört dich.«
Ihre Schreie wurden leiser und hörten dann ganz auf. »Warum machst du das? Ich habe nichts Böses getan.«
Er drückte ihr Gesicht so dicht über die Wasseroberfläche, dass sie sie mit der Nasenspitze berührte. »Du weißt, warum, Hexe.«
Sie riss an ihren Fesseln und bewegte den Kopf ruckartig hin und her. »Warum nennst du mich dauernd Hexe? Ich bin keine Hexe!«
Er drückte ihr Gesicht unter Wasser, zählte bis dreißig und riss ihren Kopf wieder hoch. Sie hustete und spuckte. »Ich habe gesehen, wie du heute Abend auf dem Rummelplatz aus dem Zelt der Zauberin gekommen bist. Vor einer Woche hast du meine Hand gehalten und deine Boshaftigkeiten von dir gegeben.«
Sie ruckte mit dem Kopf und versuchte, sich seinem Griff zu entwinden. »Wir sind harmlose Schausteller. Die Wahrsagerei ist nur ein Spaß.«
»Du liest aus der Hand. Du tust das Werk des Teufels.«
Ihr dichtes, schwarzes Haar klebte wie ein Spinnennetz an ihrem Gesicht. »Du weißt doch, dass das alles Unsinn ist. Nichts von alldem ist wahr. Es ist nur Show. Nur ein Spiel.«
Er ragte über ihr auf. »Du hattest bei zu vielen Dingen recht.«
»Ich bin gut darin. Eine der Besten. Aber es hat nichts mit Magie zu tun.« Sie schüttelte den Kopf. »Die Leute geben uns ein paar Dollar, und wir erzählen ihnen etwas über sie. Keine Magie. Das ist alles erfunden.«
Dieses Mal drückte er ihr Gesicht so lange unter Wasser, bis er bis fünfundvierzig gezählt hatte. »Lügnerin. Ketzerin.«
Sie würgte und drehte den Kopf zur Seite, hustete heftig und spie das Wasser aus. »Du willst mich«, sagte sie. »Ich spüre es. Ich bringe dich dazu, dass du dich besser fühlst. Bitte, ich mache, dass du dich besser fühlst.«
»Ich will dich nicht mehr.«
»Doch, du willst mich!« Es klang erbittert.
Ihre raue Stimme war immer noch voller Trotz, während ihr Gesicht über dem Wasser schwebte. Es war nur logisch, dass sie stark war. Sie war unter Schaustellern aufgewachsen, fahrenden Dämonen, die von einer Stadt zur nächsten zogen.
Als er ihren Kopf diesmal unter Wasser drückte, hielt er sie fest, bis sie nicht mehr um sich schlug und ihr Körper erschlaffte. Als sie aufgehört hatte zu kämpfen, zog er sie hoch und drehte sie auf die Seite, damit das Wasser aus ihr herausfließen konnte. Er tastete nach ihrem Puls, und als er ihn nicht fand, überfiel ihn Panik. »Sie muss gestehen.«
Er schob ihr den Kopf in den Nacken und begann mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage. Nachdem er einige Male auf ihren Brustkorb gedrückt hatte, holte sie tief Luft und machte die Augen auf. Sie erbrach Wasser aus der Lunge.
Er riss ihr die Augenbinde ab. Er wollte ihre Augen sehen. Er wollte, dass sie sein Gesicht sah.
Erkennen und Erschrecken blitzten in ihrem Blick auf, als sie ihn ansah. »Herrgott, warum tust du mir das an? Ich dachte, du magst mich.«
Reue. Das war der erste Schritt zur Rettung.
»Warum tust du mir das an? Bitte.« Ihre Stimme klang heiser.
Er beugte sich vor und strich ihr das nasse Haar aus dem Gesicht. Ihre Haut fühlte sich kalt und klamm an. »Was bereust du?«
Ihre leuchtend blauen Augen bohrten sich in seine. »Alles, was ich getan habe. Es tut mir leid. Nur bitte bestraf mich nicht mehr.«
Wieder überrumpelte ihn ihr Blick, lockte ihn, seinen Kreuzzug und seine Rechtschaffenheit zu vergessen. Wie gerne wäre er einfach in ihre Wärme eingetaucht. So wie er es sich viele Male vorgestellt hatte, küsste er sie sanft auf den Mund und strich ihr das Haar aus den Augen. »Wenn du nicht weißt, was du getan hast, wie kann es dir dann leidtun?«
Neue Panik trat an die Stelle des stummen Flehens. »Du hast mich Hexe genannt.«
Es war nicht zu leugnen, dass sie ein schlaues, gerissenes Mädchen war. »Ja.«
Sie leckte sich die Lippen. »Du bist nicht der Erste. Schon früher haben Männer gesagt, ich hätte sie verhext.«
Er fuhr mit der Hand über ihren flachen Bauch. Die Vorstellung, wie andere Männer sie angegafft und dabei lüstern gegrinst hatten, peinigte ihn. Sie gehörte ihm, nur ihm. »Du gibst also zu, dass du eine Hexe bist, eine Zauberin, eine Seelenräuberin? Nur deine magischen Fähigkeiten bringen mich dazu, das hier zu tun.«
Sie erwiderte seinen Blick und legte ihre Hand auf seine. »Ja, ich bin eine Hexe, und auch all das andere, was du gesagt hast.«
Er umschloss ihre Brust mit den Fingern und drückte zu. Sie zuckte zusammen, hörte aber nicht auf zu lächeln. Diese Frau kannte die Macht ihres Körpers und wusste sie einzusetzen. »Und du bereust? Du schwörst, dass du böse bist?«
»Ja.«
Für einen Augenblick legte er den Kopf zwischen ihre Brüste und lauschte dem raschen Pochen ihres Herzens. »Gelobt sei Gott.«
»Lass mich gehen«, sagte sie. »Ich verrate nichts. Wirklich nicht. Und ich kann dich immer noch sehr glücklich machen. Ganz bestimmt.«
Er schloss die Augen. »Nach dem, was ich dir gerade angetan habe, willst du mich immer noch?«
»Ja. Ich will dich. Nur wir zwei, Baby, sonst niemand.«
Nach wie vor sehnte er sich danach, an ihren Brüsten zu saugen und in ihre Weichheit hineinzustoßen. Als er den Blick hob und um Kraft betete, fiel ihm der rissige Mörtel zwischen den Holzbalken der Wände auf. Der Mörtel war wie seine Seele: voller Fehler, aber dennoch stark genug, die Last zu tragen. Mit zitternden Händen strich er ihr das Haar zurück. Sie starrte zu ihm hoch, verletzlich, voller Angst, bereit.
Ehe er der Versuchung erliegen konnte, drückte er ihren Kopf wieder unter Wasser. Sie wehrte sich heftig, zappelte und wand sich, während sie mit den Fäusten wild um sich schlug. Sie versuchte, nach ihm zu treten, doch er nutzte sein Körpergewicht, um sie daran zu hindern.
Langsam zählte er die Sekunden, bis das Gezappel nachließ und sie aufhörte zu kämpfen. Luftblasen stiegen nach oben, und immer noch hielt er ihr Gesicht unter Wasser – bis drei Minuten vorbei waren.
Als er sie diesmal losließ, sackte ihr Körper auf dem schmutzigen Fußboden zusammen – bleich, kalt und tot.
»Geh mit Gott, Grace.«
»Mariah!«
Grace Wells schrie den Namen ihrer Schwester, noch ehe sie richtig wach war. Sie setzte sich in ihrem breiten Bettsofa auf und griff sich an die Kehle. Mühsam rang sie nach Luft. Sie atmete mehrmals tief ein und aus, um sich zu beruhigen.
Im dunklen Wohnwagen sah sie sich nach Anzeichen dafür um, dass ihre Schwester zurückgekehrt war. Durch das kleine Fenster drang Licht und fiel auf die geblümte Bettdecke, die Stofftiere und ein Poster von Brad Pitt in dem Film Aus der Mitte entspringt ein Fluss.
Sie zupfte am ausgefransten Saum ihres rosa Nachthemds und versuchte, sich zu beruhigen. Seitdem ihre Mutter vor drei Jahren gestorben war, hatte sie unzählige Albträume gehabt und war einigermaßen daran gewöhnt, allein und verängstigt aufzuwachen. Aber dieses nächtliche Entsetzen war anders. Sie sah keine Gesichter und hörte nichts als Mariahs Hilfeschreie.
Grace presste die zitternden Finger gegen ihre Schläfen und starrte aus dem Fenster. Die Festwiese lag am Stadtrand. Bei ihrer Ankunft war der Boden durchweicht gewesen, sodass die Lastwagen der Schausteller tiefe Furchen darin hinterlassen und große Stücke der Grasnarbe herausgerissen hatten. Das Gelände unterschied sich kaum von den vielen anderen Rummelplätzen in Städten, die sie längst vergessen hatte.
Das Riesenrad und das Karussell lagen still und dunkel da. Die Klappen am Schießstand, am Ringwurfstand und beim Korbballwerfen waren geschlossen, die Läden am Kassenhäuschen verriegelt.
Alles wie immer.
Sie ging durch den Raum, den sie sich mit Mariah teilte, zu der kleinen Wiege und blickte auf das Baby hinunter. Das Mädchen, Sooner, war erst fünf Tage alt und sah Mariah jetzt schon so ähnlich.
Der tiefe, gleichmäßige Atem des Babys linderte Graces Ängste nur wenig. Eigentlich hätte sie heute Abend arbeiten müssen, aber sie hatte sich nicht wohlgefühlt, also hatte Mariah ihre Schicht übernommen. In vier Tagen würde der Jahrmarkt schließen, und sie hatten alle mit großem Andrang gerechnet.
Ich hab was gut bei dir, Schwester.
Ich weiß. Danke.
Warte nicht auf mich mit dem Schlafengehen. Ich hab noch eine Verabredung.
Mariah hatte jemand Neues kennengelernt. Einen Prinzen diesmal, stolz und kühn und womöglich der Richtige. Aber die jungen Typen, die sich auf dem Rummelplatz herumtrieben, suchten nicht nach Liebe, die von Dauer war.
Das Leben, das sie führten, war ein Wanderleben ohne festen Wohnsitz, ohne Schulen oder irgendwelche Wurzeln. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison sehnte Grace sich danach, an den nächsten Ort weiterzuziehen, wo es vielleicht besser sein würde.
Vor Kummer und Verlust war der Raum ganz kalt. Sie schlang die Arme um ihren Körper. »Oh Gott, Mariah, wo bist du diesmal hineingeraten?«
1
Gegenwart
Dienstag, 19. Oktober, 5:15 Uhr
Sie hatte Macht über ihn.
In diesem Raum, allein mit ihr, verließ ihn die Sprache. Hier übernahm sie die Führung, und er folgte ihr mit zielstrebigen Bewegungen, zog sich rasch aus und sank aufs Bett, bevor die Vernunft Einspruch erheben konnte. Der Sex war stets heiß, drängend und ließ ihn mit wild klopfendem Herzen zurück.
Wie die vorherigen Male stand sie auch diesmal auf, während sein Geruch noch an ihr haftete, und zog sich schweigend an. Er wusste, was nun kam. Sie würde ihr zerzaustes, rotbraunes Haar rasch zurechtmachen, sie würden gezwungene oder sogar leicht verlegene Floskeln austauschen, und dann würde sie gehen, ohne ein nächstes Mal vorzuschlagen.
Als sie jetzt jedoch das Bett verließ, gab sich Daniel nicht damit zufrieden, sie einfach gehen zu lassen. Er wälzte sich auf die Seite und sah zu, wie sie mit zitternden Fingern das hochgeschobene cremefarbene Seidenunterkleid hinunterzog. Sie ging zum Spiegel und inspizierte das ehemals sorgfältige Make-up, das jetzt sündhaft verschmiert war, und die blasse Haut, die nach dem Sex rosig strahlte.
Er wollte, dass sie wieder ins Bett kam und sich an ihn schmiegte, doch er zögerte, sie darum zu bitten. Von Anfang an hatte sie klargestellt, dass es ihr nur um guten, heißen Sex ging. Sie wollte keinen Liebhaber oder Freund oder sonst irgendeine Verpflichtung.
Damals, beim ersten Mal, hatte er ihren Bedingungen zugestimmt, seinen Glücksstern gepriesen und tatsächlich kaum mehr erwartet als Befriedigung und eine angenehme Erinnerung. Doch seit jenem ersten Mal konnte er nicht genug von ihr bekommen. Je mehr sie gab, umso mehr wollte er von ihr.
Die Grenze, die sie zwischen Beruf und Privatleben gezogen hatte, war inzwischen verblasst – jedenfalls für ihn.
Die gepflegten Finger glitten über das Unterkleid. Sie blickte auf die Uhr auf dem Nachttisch, seufzte und sammelte ihre verstreuten Kleidungsstücke vom Boden auf.
Er gab sich keine Mühe, seine Faszination zu verbergen. Sie waren jetzt fünfmal miteinander in diesem Motelzimmer gewesen, aber noch immer hatte er sie nicht völlig nackt gesehen. Sie hatte eine schmale, elegante Figur, samtige Haut, eine schlanke Taille und einen hübsch gerundeten Hintern. Er war nicht sicher, was sie vor ihm verbarg, aber nach jedem weiteren Sex brannte er mehr darauf, das Geheimnis zu lüften.
Beim letzten Mal hatte er die Narbe an ihrer Seite gesehen und geglaubt, er hätte ihr Geheimnis enthüllt. Als er sie danach gefragt hatte, hatte sie mit den Schultern gezuckt und gesagt: »Ich wurde angeschossen.«
Neugierig hatte er die Polizeiakte herausgesucht und die Einzelheiten der Schießerei nachgelesen. Es war vor drei Jahren passiert. Sie hatte abends lange gearbeitet. Ein von einem Mandanten angeheuerter Killer war in ihre Kanzlei gekommen und hatte auf sie geschossen, weil man sie als Risiko ansah. Blutüberströmt hatte sie sich in einen Toilettenraum geflüchtet und die Tür verriegelt. Da der Killer nicht zu ihr gelangen konnte, hatte er die Tür von außen verbarrikadiert und sie, wie er glaubte, sterbend zurückgelassen. Erst acht Stunden später hatte sie sich befreien und die Notrufzentrale anrufen können. Beim Anblick der Fotos vom Tatort hatte Rokov primitiven Zorn empfunden. Selbst jetzt erinnerte er sich noch lebhaft an ihr Blut auf dem Teppichboden des Toilettenraums, an die Türscharniere, die sie mit dem Absatz eines ihrer High Heels aufgehebelt hatte, und an ihre blutige Seidenbluse, die die Rettungssanitäter hatten liegen lassen.
»Denkst du an die Schießerei?«, hatte er gefragt, als er die Narbe geküsst hatte.
Sie war ihm mit den Fingern durchs Haar gefahren. »Nein.«
»Es muss dir doch zusetzen.«
Ihre Finger hatten verharrt. »Ich mache mir nie viele Gedanken über die Vergangenheit.«
Wenn sie nicht die Schusswunde verbergen wollte, warum zog sie dann nicht ihr Unterkleid aus? Letzte Nacht, als er versucht hatte, es ihr über den Kopf zu ziehen, hatte sie sich widersetzt. Was hatte sie sonst noch zu verbergen?
Sie schlüpfte in ihre Bluse und knöpfte sie geschickt zu, zog den schwarzen Bleistiftrock an, steckte die Bluse hinein und war, nachdem sie den Reißverschluss hochgezogen hatte, wieder ganz Eleganz und Klasse. Vielleicht hielt ja irgendeine alte Regel aus der Benimmschule sie davon ab, sich vollständig auszuziehen.
Das Nachdenken über dieses Unterkleid und das, was sich darunter verbarg, bescherte ihm eine weitere Erektion. »Wieso bleibst du nicht hier?«
Sie fand ihren Slip, drehte sich zu ihm um und stopfte ihn in ihre Handtasche. »Wir beide haben heute schon früh Termine.«
»Du hast gestern dein Schlussplädoyer gehalten. Bis die Geschworenen zurückkommen, ist der Druck erst mal raus. Geh heute später zur Arbeit. Du hast es dir verdient.«
Sie zog eine gepflegte Augenbraue hoch. »Ich bin noch nie zu spät gekommen.«
Er stützte den Kopf in die Hand. »Geh später hin.«
»Warum?«
»Bei dir ist einmal nicht genug.«
Sie richtete ihre Perlenkette, bis der Verschluss mit dem Diamanten wieder hinten war. Um ihre Lippen spielte ein Lächeln. »Ich wünschte, ich könnte für eine Zugabe bleiben. Wirklich. Aber ich habe Termine.«
»Arbeit allein macht nicht glücklich, Frau Anwältin.«
»Durch Arbeit allein bleibt Charlotte zahlungsfähig und kann ihre Rechnungen begleichen, Detective.«
Nackt stand er vom Bett auf und ging auf sie zu. Dicht vor ihr blieb er stehen, streckte die Hand nach den Perlen um ihren Hals aus und spielte damit. Sie roch nach Chanel und nach ihm. »Wir sollten mal zusammen essen gehen.«
Sie lächelte. »Wir hatten doch gerade den Nachtisch.«
»Ich meine richtiges Essen. Tische, Stühle, Gabeln, Messer, Löffel.«
Sie wich nicht vor ihm zurück. »Lieber nicht.«
»Du musst doch ab und zu etwas essen.«
»Wir haben eine Grenze gezogen. Die dürfen wir nicht überschreiten.«
Er wickelte die Perlen um den Zeigefinger. »Die Verteidigerin will also nicht mit einem Cop gesehen werden?«
»Vielleicht sollte man den Cop nicht mit der älteren Verteidigerin sehen.«
»Drei Jahre Altersunterschied zählen nicht. Und mir ist es egal, wer mich mit dir sieht.«
Sie löste seine Finger von den Perlen. »Man beurteilt die Leute nach den Menschen, mit denen sie zusammen sind.«
Der wehmütige, fast schon traurige Unterton überraschte ihn. Sie meinte nicht ihn. Aber wen dann? Noch ein Mysterium. Noch ein Grund mehr, sie zu begehren.
Als sie ihre Handtasche vom Boden aufhob, drückte er seine Erektion an ihren Rücken. »Nur noch ein paar Minuten.«
Sie ließ den Kopf nach hinten an seine Brust sinken. In der vergangenen Nacht war ihr Liebesakt leidenschaftlicher als sonst gewesen, was er dem Abschluss des Mordprozesses zugeschrieben hatte. »Ich kann nicht.«
»Klingt halbherzig.« Er spürte, wie sie schwankend wurde, schob ihr Haar zur Seite, küsste ihren Hals und hörte zufrieden, wie sie tief Luft holte.
»Ich muss gehen.« Die für sie typische, stählerne Härte war aus ihrer Stimme verschwunden.
Er drehte sie zu sich um und knöpfte ihre Bluse auf, bis er den cremefarbenen Spitzenansatz ihres Unterkleids sah. Er küsste sie auf Schulter, Kinn und Brustansatz.
»Wir haben doch die Regel, dass wir keine Verstrickungen wollen.«
»Scheiß auf die Regel. Und auf Verstrickungen.«
Sie schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn. Atemlos unterbrach sie den Kuss. »Ich muss in zwanzig Minuten gehen, sonst komme ich zu spät.« In den geflüsterten Worten war nichts mehr von der Frau zu spüren, die er gestern auf der Treppe des Gerichtsgebäudes gesehen hatte. Um jene Frau waren Reporter herumgeschwirrt, und nichts hatte ihre kühle Effizienz beeinträchtigt.
Die Gegensätze machten das Mysterium noch größer. »Geh mit mir essen.«
Ihre Finger schlossen sich um seine Erektion. »Wir haben keine Zeit zum Reden, Detective.«
Er schluckte und bemühte sich, einen klaren Kopf zu behalten. »Du weichst mir aus.«
Ihre Hand bewegte sich rasch und gleichmäßig. »Neunzehneinhalb Minuten.«
Bisher hatte sie die Oberhand. Aber das würde sich ändern. Bald.
Er verschob Abendessen und Machtspielchen auf ein andermal, küsste sie, hob sie hoch und legte sie mitten aufs Bett. Dann kniete er sich rittlings über sie und langte nach den Kondomen auf dem Nachttisch. Heftiges Verlangen durchfuhr ihn. Ungeduldig riss er die Verpackung auf und streifte sich das Kondom über.
Sie wand sich unter ihm, schob ihren Rock nach oben, und er hatte das Gefühl, explodieren zu müssen. Nichts auf der Welt war jetzt noch wichtig.
Als er sich zwischen ihre Beine schmiegte, vibrierte sein Piepser, der auf dem Nachttisch lag. Mist.
Fragend sah sie ihn an. »Musst du das nicht annehmen?«
»Die können warten«, knurrte er.
Sie packte ihn an den Schultern, als er in sie hineinstieß. »Sicher?«
»Ganz sicher.«
Dann vergaßen sie Termine, Mandanten und Verpflichtungen.
2
Dienstag, 19. Oktober, 6:45 Uhr
Detective Daniel Rokov parkte in der Nähe des Tatorts und schaltete den Motor ab. Er stieg aus und nahm seine Anzugjacke vom Kleiderbügel auf dem Rücksitz. Er schlüpfte hinein, zupfte den Kragen zurecht und überprüfte dann rasch Pistole, Handy und die Marke an seinem Gürtel. Er schüttelte die Müdigkeit ab und schloss die Tür des Streifenwagens.
Der Tatort befand sich in einem leer stehenden Restaurant, The Wharf, das zwischen der Union Street in der Altstadt von Alexandria und dem Potomac River lag. Das quadratische Gebäude mit dem verblichenen weißen Anstrich saß auf Pfeilern zweieinhalb Meter über dem Erdboden. Seit man das Restaurant vor mehr als zehn Jahren geschlossen hatte, war es verwahrlost, und die hölzernen Dielen und Treppen sahen aus, als würde der nächste richtige Sturm sie fortreißen. Früher einmal war das Lokal sehr beliebt gewesen, und auf der Dachterrasse hatte man eine der besten Aussichten auf den Potomac gehabt, die die Gegend zu bieten hatte. Wie er gehört hatte, hatte die Stadt das Gebäude gekauft, um es zu renovieren, aber angesichts der Wirtschaftskrise und der schrumpfenden Steuereinnahmen würde es wohl kaum dazu kommen.
Die Bäume entlang des Flusses hatten von tiefem Grün zu einer Mischung aus Orange, Braun und Gelb gewechselt. Die Temperatur lag bei kühlen fünfzehn Grad, was sich, verglichen mit den fast vierzig Grad im Sommer, phänomenal anfühlte.
Auf dem gepflasterten Parkplatz, den ein drei Meter hoher Maschendrahtzaun von der Union Street trennte, stand ein halbes Dutzend weißer Streifenwagen der Alexandria Police. Der Transporter der Spurensicherung parkte mit offenen Hecktüren neben dem Gebäude. Rokov hielt nach kleinen orangefarbenen Kegeln Ausschau, wie man sie zur Kennzeichnung von liegen gebliebenen Patronenhülsen, Bremsspuren oder anderen mutmaßlichen Beweisen benutzte, entdeckte jedoch keine.
Eine Handvoll Touristen hatten sich versammelt. In der Altstadt war jetzt der Höhepunkt der Saison. Jede Nacht fanden hier Gruseltouren und historische Stadtführungen statt, und Menschengruppen, die sich vorwärtsschoben, während ein Fremdenführer erläuterte, in welchen Gebäuden sich unglückliche Geister nach ihrem Dahinscheiden aufhielten, waren ein normaler Anblick. Vor sechs Monaten hatte Rokov mit einer Bekannten an einer Stadtführung teilgenommen. Monica. Sie arbeitete beim Fremdenverkehrsamt und hatte den Ausflug vorgeschlagen. Seine Scheidung lag weniger als ein Jahr zurück, und die Überstunden hatten ihm kaum Zeit für Verabredungen gelassen, weswegen er noch ein wenig aus der Übung war. Die Führung war ganz interessant gewesen, aber Monica hatte sich mehr für ihre eintrudelnden SMS als für ihn interessiert. Beim Abschied hatte sie ihn unflexibel genannt. Unflexibel. Nur, weil er ganz normale Höflichkeit erwartet hatte. Verdammt.
»Danny-Boy, ist das der Anzug, den du gestern auch schon anhattest?«
Die raue Stimme gehörte seiner Partnerin, Detective Jennifer Sinclair, einer hochgewachsenen Brünetten, die meist Jeans mit einem schwarzen Rollkragenpullover und dazu eine abgewetzte Lederjacke trug. Wie fast immer hatte sie ihr volles Haar im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Wenn sie es bei seltenen Gelegenheiten einmal offen trug, fiel es ihr bis auf den Rücken. Sie trainierte gern im Fitnessstudio und wirkte athletisch, schwor jedoch, sich nichts aus Sport zu machen. Sie war von ihrem Vater, einem Polizisten, allein großgezogen worden und bewegte sich leichtfüßig zwischen den Detectives und Streifenbeamten. Sie wurde niemals gehänselt oder aufgezogen und konnte, wenn nötig, gut Kontra geben.
Rokov stemmte die Hände in die Hüften. »Kann ich denn einen Anzug nicht mal zwei Tage hintereinander tragen?«
»Du ziehst deine besten Anzüge nur fürs Gericht an. Gestern war ein Gerichtstermin, heute ist keiner.«
Früh am Morgen hatte er Charlotte Wellington zu ihrem Auto gebracht, das vor dem Motelzimmer stand, sich mit einem sehr keuschen Kuss von ihr verabschiedet und dann den Kulturbeutel aus seinem Kofferraum geholt. Darin bewahrte er einen elektrischen Rasierer und andere lebensnotwendige Dinge auf. Nach zehn Minuten war er wieder präsentabel gewesen, aber er hatte keine Zeit gehabt, nach Hause zu fahren und sich umzuziehen. »Du bist ein lebender Terminkalender. Machst du demnächst auch noch die Wettervorhersage?«
Rokov und Sinclair waren Detectives in einem Morddezernat, das aus vier Mitarbeitern bestand. Am Vortag waren sie zusammen mit den beiden anderen, Deacon Garrison und Malcolm Kier, im Gericht gewesen, um die Plädoyers im Mordprozess gegen Samantha White zu hören. White, eine dreißigjährige Hausfrau, war wegen der Tötung ihres Ehemanns angeklagt. Die junge Frau hatte gestanden, ihrem Mann den Schädel mit einem Golfschläger zertrümmert zu haben, und alle waren davon ausgegangen, dass man sie, ohne lange zu fackeln, wegen Mordes verurteilen würde. Kein Pflichtverteidiger hatte den Fall übernehmen wollen. Und dann war Charlotte Wellington auf den Plan getreten, und die Karten waren neu gemischt worden. Wellington hatte darauf beharrt, ihre Mandantin habe in Notwehr gehandelt, und am Ende des Gerichtsverfahrens war die sicher geglaubte Verurteilung völlig ungewiss.
»Und, fragst du sie, ob sie mal mit dir ausgeht?«, erkundigte sich Sinclair.
»Wen?«
»Charlotte Wellington. Ich hab gesehen, wie du sie gestern im Gericht angestarrt hast. Ganz schön intensiv.«
Ein männlicher Kollege hätte sich mit diesem Seitenhieb einen bösen Blick eingehandelt, aber Jennifer erinnerte ihn so sehr an seine jüngere Schwester, dass er nur ein Schulterzucken zustande brachte. »Vielleicht hab ich ja ihrem Schlussplädoyer zugehört. Solltest du auch mal probieren.«
Jennifer grinste unbeeindruckt. »Also, fragst du sie?«
Daniel ließ den Blick über das Gelände vor dem Gebäude schweifen. »Wieso sollte ich sie fragen, ob sie mit mir ausgeht?«
»Weil du auf sie stehst.«
Ein unangenehmer Windstoß blähte seine Jacke. Die Hände auf den Hüften, fragte er: »Und welches Vögelchen hat dir das gezwitschert?«
»Mann, dafür brauche ich kein Vögelchen. Ich lese in dir wie in einem offenen Buch.«
Er lächelte, eher erleichtert als erheitert. Sie fischte nur im Trüben. »Sinclair, diese Mädchengespräche sind ja ganz nett, aber wir haben da ein Opfer, dem wir vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit widmen sollten.«
Ein halbes Lächeln kräuselte die vollen, ungeschminkten Lippen. »Wie du meinst, Danny-Boy.«
Sie tauchten unter dem gelben Absperrband hindurch und gingen an mehreren Polizisten und Streifenwagen mit blinkendem Blaulicht vorbei. Rokov fand den Streifenbeamten, der als Erster hier gewesen war und den Tatort gesichert hatte. Der Mann war Mitte vierzig, klein, untersetzt und trug einen dunklen Bürstenhaarschnitt und einen dichten Schnurrbart.
Rokov streckte ihm die Hand entgegen und stellte sich vor. »Sie sind Jack Barrow, nicht wahr?«
»Richtig.« Als der Detective seinen Namen aussprach, entspannte der Mann sich ein wenig. »Hab schon gehört, dass Sie ein gutes Gedächtnis haben.«
»Nee, eigentlich nicht. Ich weiß nur noch, dass Sie letztes Frühjahr diesen Preis bekommen haben für Ihre Arbeit mit den Jugendlichen im Seminary District.«
»Wieder richtig.« Barrow hakte einen kräftigen Daumen in seinen Gürtel.
Sinclair gab Barrow die Hand. »Hat Ihre Frau schon das Baby bekommen?«
»Noch nicht«, seufzte er.
»Herrje«, meinte Sinclair. »Das wievielte ist es, das vierte?«
»Das fünfte.« Er sah Rokov an. »Der alte Herr von dem Mädel hier hat mich ausgebildet, als ich ein junger Hüpfer war. Sie war damals wohl noch in der Grundschule.«
Sinclair schüttelte den Kopf. »Reden wir lieber nicht über diese finsteren Zeiten.«
Barrow zwinkerte ihr zu. »Sie hat einen verdammt guten Softball gespielt.«
»Wir sind nicht hier, um über mich oder Ihre Vergangenheit zu reden«, sagte Sinclair. »Geben Sie uns die Fakten.«
Barrows Blick wanderte zu dem Gebäude hinüber, und sein Gesicht verdüsterte sich. Nur wenige Außenstehende verstanden, wie Cops unter solchen Umständen Witze reißen konnten. Die Cops dagegen wussten, dass es die Scherze waren, die sie so etwas durchstehen ließen.
»Das hier ist wirklich abgefahren. Wenn die Einzelheiten durchsickern, wird es Stoff für Albträume und Gruseltouren sein.«
Barrow sah Sinclair an, jeglicher Humor war aus seiner Miene verschwunden. »Tut mir leid, dass Sie sich das ansehen müssen.«
Sinclair legte den Kopf schief. »Ich komme schon klar.«
»Würde ihrem alten Herrn das Herz brechen, dass Sie so einen Job machen.«
Zum ersten Mal hatte Sinclair keinen lockeren Spruch parat.
»Aus welchem Grund sind Sie hineingegangen?«, fragte Rokov Barrow.
»Hab im ersten Stock Licht gesehen. Als ob eine Kerze geflackert hätte. Das Haus ist verrammelt, weil es baufällig ist. Die Stadt hat es gekauft und wollte es eigentlich abreißen. Jedenfalls dachte ich, es sind vielleicht Landstreicher oder Junkies drin, also hab ich Verstärkung angefordert, und dann sind wir reingegangen.« Er massierte sich den Nacken. »Es war aber keiner da, nur das Opfer.«
»Männlich oder weiblich?«, fragte Rokov. Aus der Innentasche seiner Jacke zog er Stift und Notizblock.
»Weiblich.«
»Konnten Sie erkennen, woran sie gestorben ist?«
Das Morgenlicht warf Schatten auf Barrows Gesicht und ließ die Falten darin tiefer erscheinen. »Nein. Bei dem Tatort denkt man an … Ach, gehen Sie lieber rauf und sehen Sie es sich selbst an.«
»Okay«, sagte Rokov.
»Vorsicht auf der Treppe. Die ist alt und morsch.«
»Danke.«
Rokov ging an Sinclair vorbei und betrat die Treppe als Erster. Falls die Stufen nachgaben, hätte er noch Zeit, sie zu warnen. Außerdem ließ ihm der Gedanke keine Ruhe, wie ihr alter Herr schaudern würde, dass sein kleines Mädchen den Tatort betrat.
»Ich hätte genauso gut vorgehen können«, sagte sie.
Seine Partnerin hielt nicht viel von Ritterlichkeit, also ließ er sich nichts anmerken. »Dann beweg dich nächstes Mal schneller.«
Die Stufen ächzten und stöhnten und gaben leicht nach, als sie am Erdgeschoss vorbei in den ersten Stock hinaufstiegen. Tageslicht fiel ins Erdgeschoss, doch anstatt es freundlicher wirken zu lassen, erzeugte es eine gespenstische Atmosphäre, die die Schatten noch vertiefte.
Oben waren nur noch ein Cop und ein Mitarbeiter der Spurensicherung. Zweifellos hatte man angesichts der Bausubstanz Bedenken gehabt, zu viele Menschen den staubigen Raum betreten zu lassen. Außerdem, je weniger Leute hier oben waren, desto besser.
Die beiden Detectives streiften Papierfüßlinge über und zogen Gummihandschuhe an.
Sie näherten sich dem Kriminaltechniker, Paulie Sommers, einem mürrischen Endvierziger, der Unterbrechungen nicht leiden konnte. Paulie trug einen Overall, Füßlinge und Handschuhe. Er fotografierte und hielt sich nicht mit einer Begrüßung auf.
Paulie konnte als Kollege manchmal etwas schwierig sein, aber er war penibel und ein Meister darin, Beweismaterial zu finden, das ein weniger erfahrener Kriminaltechniker leicht übersehen hätte. Er würde eine ganze Weile fotografieren und jeden Quadratzentimeter des Tatorts dokumentieren, bevor er die Beweismittel sicherte.
Als Paulie auf die andere Seite ging, konnte Rokov das Opfer zum ersten Mal richtig sehen. Die Frau lag auf dem Rücken, die Arme ausgebreitet, die Handflächen nach oben. Jemand hatte durch ihre Hände und Füße Holzpflöcke in den Boden getrieben. Ein sauberer Kreis aus weißem Pulver umgab den Leichnam.
Rokov hatte gelernt, seine Emotionen zurückzustellen, wenn er einen Tatort begutachtete. Seine Aufgabe war es, Fakten zu sammeln, alles, was dazu beitragen konnte, den Mörder zu fassen. Daher konzentrierte er sich auf die Einzelheiten.
Die Frau war jung, zwischen zwanzig und dreißig, und hatte dichtes, schwarzes Haar, das ihre rechte Gesichtshälfte bedeckte. Ihre Haut war kalkweiß. Unter den primitiv gehauenen Pflöcken krallten ihre Finger sich in die Luft, als hätte sie versucht, sich loszureißen. Sie trug ein schwarzes Kleid und eine rote Lederjacke.
Er hielt nach Blutspuren in der Nähe der Leiche oder an den Wänden Ausschau – winzige Tröpfchen, kleine oder größere Lachen, die ihm mehr über ihren Tod verraten hätten. Aber da war nichts.
»Kein Blut«, meinte Sinclair.
»Nein.«
»Sie wurde nicht hier getötet.«
»Sehe ich auch so«, sagte Rokov.
»Das bedeutet, sie war tot, als man sie am Boden festgenagelt hat.«
»Ja.« Manchmal gibt es sogar unter den schlimmsten Umständen Anlass für Dankbarkeit, dachte Rokov, während er die Leiche betrachtete.
»Die Totenstarre ist ziemlich ausgeprägt«, sagte Paulie. Die langsame Versteifung der Muskeln begann drei Stunden nach Eintritt des Todes, erreichte aber erst zwölf Stunden nach dem Tod ihren Höhepunkt, worauf der Prozess sich langsam wieder umkehrte.
»Also seit acht bis zwölf Stunden tot?«, fragte Rokov.
»Mehr oder weniger. Und schau dir mal ihre Beine an.« Paulie hob den Rock der Toten an und enthüllte ihre Knöchel, an denen durch Blutansammlung unter der Haut blauviolette Flecken entstanden waren. »Sieh dir die Totenflecken an. Als sie gestorben ist, befand sie sich in aufrechter Position, möglicherweise sitzend. Sie hat mindestens eine Stunde so dagesessen, bevor man sie hierhergebracht hat.«
Wenn das Herz zu schlagen aufhörte, floss das Blut zum tiefstgelegenen Punkt des Körpers und färbte die Haut dunkel. »Ich habe die Unterseite ihrer Arme noch nicht richtig sehen können, aber an den Unterarmen scheinen auch Totenflecken zu sein.«
Rokov musterte den Hals des Opfers, auf der Suche nach Verletzungen. Es waren einige blaue Flecken zu sehen. »Wurde sie erdrosselt?«
»Ich weiß es nicht. Das muss die Pathologin herausfinden.«
»Messerstiche? Schusswunden?«
»Auf den ersten Blick nicht. Aber bevor ich die Pflöcke herausziehe, kann ich sie nicht so genau untersuchen, wie es nötig wäre.«
»Woraus besteht der Kreis?«, fragte Rokov.
Paulie kniff die Augen zusammen und blickte durch den Sucher seiner Digitalkamera. »Salz, glaube ich.«
»Salz?«
»Ganz normales Speisesalz.«
Rokov ging in die Hocke und sah sich den Kreis genauer an. Er spürte Sinclairs Blick auf sich. »Fällt dir was dazu ein?«
»Wenn wir davon ausgehen, dass es sich um Salz handelt?« Ihre Stimme klang leicht belegt.
»Ja.«
»Salz wird für alles Mögliche verwendet. Es hält Insekten ab. Vielleicht wollte der Mörder die Ameisen von ihr fernhalten.«
Rokov kam wieder hoch. »Man verwendet es auch bei Zaubersprüchen.«
Sinclair hob eine Augenbraue. »Das ist ziemlich weit hergeholt.«
»Hier ist alles ziemlich weit hergeholt. Sobald wir uns hier umsehen dürfen, schau nach, ob in den Ecken Salz ist.«
»Du machst Witze, oder?«
»Nein, tue ich nicht.«
Angesichts von Rokovs ernster Stimme wich jegliche Belustigung aus ihrem Gesicht. »Hexen. Wirklich? Ich dachte, die Samanthas und Endoras dieser Welt gäbe es nur im Märchen.«
»Ich habe nicht gesagt, dass diese Frau eine Hexe war. Aber vielleicht hat der Mörder das geglaubt. Er könnte Salz in die Ecken gestreut haben, um den Raum zu versiegeln.«
»Woher weißt du solche Dinge?«
»Meine Großmutter hat mir einiges erzählt.«
»Die ist in Russland aufgewachsen.«
»Wo Aberglaube weit verbreitet ist.«
Sinclair machte den Mund auf, um etwas zu erwidern, ließ es dann jedoch bleiben. In den anderthalb Jahren ihrer Zusammenarbeit hatten sie schon die merkwürdigsten Dinge erlebt.
Rokov wandte sich an Paulie. »Ist dir sonst noch etwas aufgefallen?«
Paulie machte drei weitere Fotos, dann richtete er sich auf. »An ihrem Hals befinden sich Strangulationsmale, und Haare und Kragen sind nass. Anscheinend Wasser.«
»Todesursache?«
»Frag die Pathologin.«
Der Kriminaltechniker achtete stets darauf, keine eigene Meinung zu äußern. Seine Aufgabe war es, Fakten zu sammeln – das sagte er oft, wenn man ihn um eine Einschätzung bat. Das Knobeln überließ er den Detectives.
»Identität?« Sinclair hockte sich neben die Leiche und betrachtete das von den Haaren halb verdeckte Gesicht der Frau.
»Kein Ausweis. Kein Schmuck. Und dann sind da diese roten Male seitlich an ihrem Hals. Sieht so aus, als hätte er sie mehrere Male mit einem Elektroschocker betäubt.« Paulie kniete sich hin und untersuchte die Haare, die der Toten in die Stirn fielen. Er machte noch ein paar Fotos und schob die Strähnen dann sanft beiseite. »Sieh dir das mal an.«
Sinclair folgte der Aufforderung. »Man hat ihr das Wort Hexe ins Gesicht tätowiert.« Die Buchstaben bedeckten den größten Teil der empfindlichen Haut auf der Stirn, die von der Tätowiernadel immer noch rot und wund war. »Mist.«
Rokovs halb gare Theorie war richtig gewesen, doch es freute ihn nicht. »Hat sie irgendwelche anderen Tattoos oder Markierungen?«
»An den unbedeckten Körperstellen nicht. Aber unter der Kleidung könnten noch mehr sein.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand freiwillig so etwas antut«, meinte Sinclair. »Andererseits haben wir schon die seltsamsten Dinge erlebt.«
Rokov sah sich im Raum um. Die Blumentapete hing in Streifen von der Wand, und zahlreiche Wasserflecken verunzierten die Decke. Es waren keinerlei Einrichtungsgegenstände mehr vorhanden, doch ein dunkler Umriss an der hinteren Wand ließ vermuten, dass dort einmal eine Bar gewesen war. Eine dicke Staubschicht bedeckte den Boden. »Fußabdrücke?«
»Zwei verschiedene«, erwiderte Paulie. »Die einen habe ich als die von Barrow identifiziert. Er war so nett, nicht überall herumzutrampeln, deshalb habe ich von den anderen einen ganz guten Eindruck.« Paulie deutete zum Fenster. »Der beste Abdruck ist dort drüben, ich habe ihn mit einem Kegel markiert und werde ihn später mit meinem elektrostatischen Spurenabnehmer sichern.«
Rokov ging vorsichtig zum Fenster hinüber. »Sieht nach Schuhgröße fünfundvierzig oder sechsundvierzig aus.« Er betrachtete das Profilmuster. »Turnschuhe?«
»Vermutlich ja, aber es wird eine Weile dauern, bis wir die Marke haben.«
»Die Abdrücke sind klar und deutlich. Er ist langsam gegangen, bedächtig.«
Paulie zuckte die Schultern. »Ich ziehe keine spontanen Schlüsse, das weißt du doch.«
»So etwas verlange ich auch gar nicht von dir«, sagte Rokov.
»Das sagen sie alle. Morgen kriegst du meinen Bericht.«
Rokov betrachtete den Abdruck. »Der rechte Absatz sieht hinten an der Innenseite abgetretener aus. Er belastet den Fuß stärker.«
Paulie schoss noch ein paar Fotos. »Könnte auch eine Verletzung sein, oder er hatte mal eine Warze, und das hat seinen Gang verändert. Muss nicht heißen, dass er den Fuß jetzt deutlich mehr belastet.«
»Er hat sie also hierhergebracht«, sagte Rokov. »Er legt sie hin, rammt ihr Pflöcke durch Hände und Füße, und dann geht er zum Fenster – was schaut er sich an?«
»Den Fluss. Den Vollmond. Gestern war eine klare Nacht. Er bleibt stehen, um sich am Vollmond zu erfreuen. Vielleicht hat er etwas gehört.«
»Wenn er es mit Hexen hat, ergibt der Mond Sinn«, überlegte Rokov. »In gewissen Kreisen wird dem Mond eine besondere Macht zugeschrieben. Es wäre nur logisch, wenn er sich davon angezogen fühlt.«
Sinclair richtete sich wieder auf. »Wir müssen herausfinden, wer sie ist. Ich gehe runter und rufe bei der Vermisstenstelle an. Mal sehen, was die haben.«
»Gut.« Rokov wandte sich an Paulie. »Hat sie Verletzungen, die auf einen Kampf hindeuten? Hat sie sich zur Wehr gesetzt?«
»Ich werde ihre Hände eintüten. Vielleicht findet die Pathologin ja etwas unter ihren Nägeln.«
Rokov kniete sich neben die rechte Hand der Toten und betrachtete den rohen Holzpflock, der ihre Handfläche durchbohrt hatte. Es musste enorme Kraft erfordert haben, das Holz durch die Hand zu treiben. Er fragte sich, ob sie ihren Angreifer gekannt hatte. Die meisten Frauen, die ermordet wurden, kannten ihre Mörder. Liebhaber, Ehemänner, Freunde. Liebe konnte sich im Handumdrehen in etwas sehr Hässliches verwandeln.
»Ich wollte, dass du sie siehst, bevor ich die Pflöcke herausziehe. Wenn ich das jetzt mache, kann ich sie umdrehen.«
»Brauchst du Hilfe?«, fragte Rokov.
»Geht schon.« Paulie zog Arbeitshandschuhe über die Chirurgenhandschuhe und packte den Pflock. »Die Dielen hier sind morsch.« Er zog fest, und das Holzstück löste sich aus dem Boden und der Hand der Toten. Bedächtig ging der Kriminaltechniker auf die andere Seite des Leichnams und wiederholte das Ganze, dann kamen die Füße an die Reihe. Der letzte Pflock erwies sich als widerspenstig, und Rokov musste mithelfen, ihn herauszuziehen.
Paulie breitete die Pflöcke aus und fotografierte sie, dann rollte er die Tote ganz vorsichtig auf die Seite. In ihre Jacke war das Wort Magic eingeprägt. Er sah nach dem Label der Jacke. »Tanner’s.«
Rokov kannte den Händler. »Tanner’s ist ein Laden in der Altstadt. Bekannt für seine maßgeschneiderten Lederjacken.« Er zog sein Notizbuch aus der Tasche und schrieb den Namen unter die vielen anderen Details, die er sich seit Betreten des Raumes notiert hatte.
»Okay. Mach du hier weiter«, sagte Rokov. »Sinclair und ich drehen draußen mal eine Runde. Vielleicht hat ja irgendjemand etwas gesehen.«
Rokov traf Sinclair neben dem Wagen an, wo sie in ihr Funkgerät sprach. Sie sah blass aus, wirkte aber entschlossen. »Danke. Falls Sie einen Treffer haben, rufen Sie mich an.«
»Kein Treffer?«
»Noch nicht. Aber vielleicht ist sie ja noch keine vierundzwanzig Stunden verschwunden.«
»Ihre Jacke ist ein Unikat. Das Geschäft liegt in der Altstadt. Ich glaube, es macht um zehn Uhr auf.«
»Gut.« Sinclair rieb sich den Nacken. »Gestern war ein Montagabend Ende Oktober. Sicher war alles voller Touristen, die Gruseltouren mitgemacht und die Bars gestürmt haben.«
»Die Geschäfte sind nach zweiundzwanzig Uhr zu, aber die Bars sind bis zwölf, ein oder zwei Uhr geöffnet.«
»Sie ist ungefähr um ein Uhr letzte Nacht gestorben, plus minus zwei Stunden.«
»Ja. Da drüben an der Ecke ist das O’Malley’s. Lass uns dort anfangen. Vielleicht ist ja jemandem irgendwas aufgefallen.«
Rokov winkte Barrow zu, Sinclair nickte, dann verließen die Detectives den Parkplatz. Mit raschen Schritten überquerten sie die Straße vor dem O’Malley’s.
Der Pub lag an der Ecke Union Street und Prince Street in einem dreistöckigen Gebäude, das über hundert Jahre alt war. Im Erdgeschoss des Backsteinbaus befand sich ein großes Fenster mit goldenem Schriftzug und grünen Vorhängen. Den Touristen gefiel das historische Flair.
»Für die Tourismusbranche ist das hier eine Katastrophe«, meinte Sinclair. »Die Medien werden sich darauf stürzen.«
Rokov warf einen Blick zurück zum Tatort. »In einer Stunde werden sie hier sein, und spätestens gegen Mittag sind die Nachrichten voll davon.« Er war stets bemüht, sich nicht über Dinge zu ärgern, auf die er keinen Einfluss hatte. Was die Medien anging, gelang ihm das aber nur begrenzt. »Wir können der Story ihre Brisanz nur nehmen, wenn wir den Fall so schnell wie möglich aufklären.«
»Ein abgeschlossener Fall wäre ein toller Start in die Woche.«
Rokov warf einen Blick ins O’Malley’s, und als er sah, wie sich drinnen etwas bewegte, hämmerte er gegen die Tür. In der Bar war es einen Moment lang still, dann ertönten Schritte.
Ein großer, schlanker, nicht ganz frisch rasierter Mann näherte sich der Tür bis auf etwa zwei Meter. Er trug Jeans und T-Shirt und darüber eine weiße Schürze. Über die rechte Schulter hatte er lässig ein Geschirrtuch geworfen.
»Wir haben bis drei Uhr geschlossen«, rief er.
Der Mann wollte gerade wieder in die Küche zurückgehen, als Rokov an die Scheibe klopfte und seine Dienstmarke hochhielt. Der Barkeeper drehte sich gereizt um.
»Wir haben ein paar Fragen«, sagte Rokov.
Der Mann zögerte und schüttelte den Kopf, als hätte ihm die Polizei gerade noch gefehlt. Schließlich kam er zur Tür, entriegelte und öffnete sie. Dabei ertönte eine Glocke, und der Geruch nach abgestandenem Bier und Zigarettenrauch schlug ihnen entgegen. »Hat sich jemand über uns beschwert?«
»Gäbe es dafür denn einen Grund?«, fragte Sinclair.
Der Barkeeper musterte sie langsam und ungeniert von oben bis unten. Er lächelte nicht und wirkte auch nicht lüstern, sondern nahm einfach nur jede Einzelheit in sich auf. Sinclair zog eine Augenbraue hoch, blieb ansonsten aber ungerührt.
»Haben Sie auch einen Namen?«, fragte Rokov.
»Richardson«, antwortete er und wandte seinen Blick von Sinclair ab. »Duke Richardson. Mir gehört der Laden hier.«
»Also noch mal: Gäbe es einen Grund für eine Beschwerde?«, wiederholte Sinclair.
»Und wer sind Sie?«, fragte Richardson.
Sinclair zog ihre Marke hervor. »Detective Sinclair. Das ist mein Partner, Detective Rokov.«
»Große Geschütze«, meinte Richardson. »Dann sind Sie wohl nicht wegen mir hier.«
»Wie kommen Sie darauf?« Nach zehn Jahren bei der Polizei hatte Rokov gelernt, nie dem äußeren Schein zu trauen. Er hatte so manchen Fall nur durch glückliche Umstände gelöst. Als Verkehrspolizist hatte er einmal einen SUV wegen eines kaputten Rücklichts herausgewinkt. Der Fahrer, ein dürrer Mann in einem karierten Hemd, war nervös und zappelig gewesen. Rokov hatte der Zentrale das Kennzeichen durchgegeben, doch es gab keine Vorstrafen. Der Kerl war allerdings so hibbelig gewesen, dass er ihn aufgefordert hatte auszusteigen. Plötzlich hatte der Mann die Autotür aufgerissen, um Rokov damit zu erwischen und auf die Straße zu schleudern. Rokov war der Attacke ausgewichen, ins Stolpern geraten und genau in dem Moment wieder hochgekommen, als der Mann eine Waffe gezogen hatte. Rokov hatte geschossen und den Angreifer tödlich getroffen. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann seine Frau ermordet und wollte gerade über die Staatsgrenze flüchten.
Immer noch gab es Augenblicke, in denen Rokov diese schrecklichen Sekunden im Flashback durchlebte. Ähnlich wie bei einem Film, der in Zeitlupe ablief, erinnerte er sich an jedes Detail. Wie der Blick des Mannes nach links gezuckt war. Wie seine eigenen Hände ganz leicht gezittert hatten, als er den Griff seiner Pistole fester umklammerte. Wie der Angreifer unter eine Zeitung auf dem Beifahrersitz gegriffen und eine Beretta hervorgezogen hatte. Rokov wusste noch, wie ein vorbeifahrender Wagen hinter ihm gehupt hatte, er erinnerte sich noch an den rostroten Fleck auf der Jeans des Mannes und an die Schweißperlen auf dessen Unterlippe. Es hatte sich angefühlt wie eine Ewigkeit, aber in Wirklichkeit waren es nur Sekunden gewesen.
Ohne dass er es gemerkt hatte, war seine Hand bereits zu seiner Hüfte geglitten, und er hatte die Finger um den Griff der Pistole gelegt.
Duke hob eine Hand. »Hey, ich will keinen Ärger.«