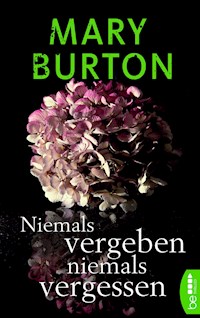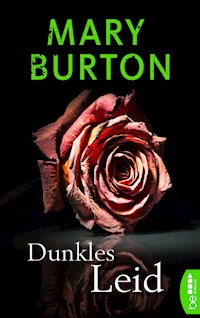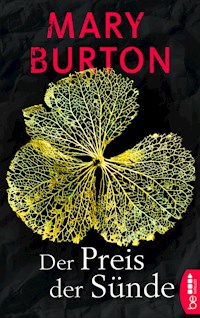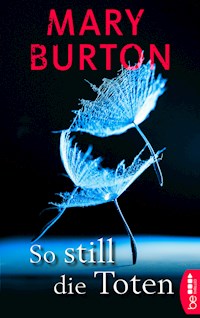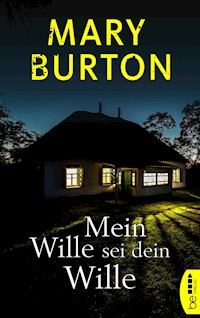
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Richmond-Reihe - Romantic Suspense
- Sprache: Deutsch
Verfolgt von einem Serienmörder ...
In ihrer Kindheit litt Lindsay O'Neil unter einem gewalttätigen Vater. Nun versucht sie selbst, zerrütteten Familien zu helfen. Eines Tages wird jedoch in der Nähe der Sozialeinrichtung, die sie leitet, eine Leiche gefunden. Und ausgerechnet ihr Ex-Mann, Mordkommissar Zach Kier, übernimmt die Ermittlungen in dem Fall. Als weitere Leichen auftauchen, wird deutlich, dass der Mörder eine besondere Verbindung zu Lindsay hat. Er verfolgt sie und schickt ihr grauenhafte Botschaften. Lindsay und Zach müssen alles daran setzen, den Schuldigen zu finden, bevor er erneut zuschlägt ...
"Mit ihren starken Figuren und der meisterhaft erzählten Handlung schlägt Burton den Leser in ihren Bann." Romantic Times
Weitere Romantic-Suspense-Titel von Mary Burton bei beTHRILLED:
Die Alexandria-Reihe: Das Flüstern der Albträume. So still die Toten. Der Preis der Sünde.
Die Richmond-Reihe: Mein Wille sei dein Wille. Niemand hört dich schreien.
Die Texas-Reihe: Das siebte Opfer. Dunkles Leid. Niemals vergeben, niemals vergessen.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Weitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressum1234567891011121314151617181920212223242526272829Weitere Titel der Autorin
Die Alexandria-Reihe
Band 1: Das Flüstern der Alpträume
Band 2: So still die Toten
Band 3: Der Preis der Sünde
Die Richmond-Reihe
Band 2: Niemand hört dich schreien
Die Texas-Reihe
Band 1: Das siebte Opfer
Band 2: Dunkles Leid
Band 3: Niemals vergeben, niemals vergessen
Über dieses Buch
Verfolgt von einem Serienmörder …
In ihrer Kindheit litt Lindsay O’Neil unter einem gewalttätigen Vater. Nun versucht sie selbst, zerrütteten Familien zu helfen. Eines Tages wird jedoch in der Nähe der Sozialeinrichtung, die sie leitet, eine Leiche gefunden. Und ausgerechnet ihr Ex-Mann, Mordkommissar Zach Kier, übernimmt die Ermittlungen in dem Fall. Als weitere Leichen auftauchen, wird deutlich, dass der Mörder eine besondere Verbindung zu Lindsay hat. Er verfolgt sie und schickt ihr grauenhafte Botschaften. Lindsay und Zach müssen alles daran setzen, den Schuldigen zu finden, bevor er erneut zuschlägt …
Über die Autorin
Mary Burton ist im Süden der USA aufgewachsen und hat an der Universität von Virginia Englisch studiert. Nach einer Karriere im Bereich Marketing begann sie äußerst erfolgreich Thriller zu schreiben. Burton lebt und arbeitet in Virginia. Weitere Informationen über die Autorin finden Sie unter: www.maryburton.com.
MARY BURTON
Mein Wille sei dein Wille
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristiana Dorn-Ruhl
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Mary Burton
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »I’m watching you«
Originalverlag: Zebra Books als Teil der Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA
Published by arrangement with Kensington Publishing Corp., New York, NY, USA.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2012/2019 by LYX/Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Karin Will
Covergestaltung: Tanja Østlyngen unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AlexanderTrou | OlenaBykova
eBook-Erstellung: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-7556-5
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Richmond, Virginia, Montag, 7. Juli, 4:10 Uhr
Du sollst nicht töten.
Kaum mehr als ein Schatten, so hockte er im Dunkel neben Harold Turners leblosem Körper. Zu seinem eigenen Erstaunen erfüllte ihn nicht Reue, sondern Erregung.
Das Gefühl von Macht und moralischer Überlegenheit war nahezu überwältigend. Er war der Beschützer, der Schutzengel, der Hüter. Nie war ihm Gottes Auftrag klarer gewesen als jetzt.
Er legte die .45er mit dem Schalldämpfer in eine schwarze Tasche und betrachtete die Leiche, die gegen die ramponierten Blechmülltonnen gelehnt dalag.
Selbst im Tod strahlte Harold Turner noch Arroganz und Selbstgefälligkeit aus.
Sein lichtes Haar wurde durch einen sauberen Scheitel geteilt. Die manikürten Fingernägel schimmerten im Mondlicht. Doppelreiher und weißes Hemd sahen immer noch sauber und frisch gebügelt aus, und seine gelbe Seidenkrawatte passte farblich zu dem Taschentuch in seiner Brusttasche. Die goldenen Manschettenknöpfe mit Monogramm verrieten sofort, dass er einen erlesenen Geschmack, aber auch das nötige Kleingeld dafür besaß.
Doch der teure Anzug verbarg Spuren an den Armen und in den Kniekehlen. Es war ein offenes Geheimnis, dass Harold Turner jahrelang drogenabhängig gewesen war.
Der Hüter rückte dem Toten die Krawatte so zurecht, dass sie den größer werdenden Blutfleck auf dessen weißem Hemd verdeckte. Unzählige Stunden hatte er in die Planung dieses ersten Mordes investiert, bis hin zur Erschöpfung. Doch am Ende hatte er den Kerl ganz einfach mit der Aussicht auf Drogen hierher gelockt. Und ihm die Kugel in den Leib zu jagen, war ein Kinderspiel gewesen.
»Ein passender Ort ist das hier, nicht wahr?«, sagte er leise. »Die Zuflucht geprügelter Ehefrauen. Deine Frau hätte sicher verstanden, warum ich diesen Ort gewählt habe.«
Das Frauenhaus hinter ihnen trug die gleiche weiße Kolonialstilfassade wie die anderen Gebäude in der Straße, sodass die meisten Nachbarn gar nicht ahnten, was es beherbergte. Der Mondschein tauchte den Garten hinter dem Haus in weiches Licht. Hinter einem zwei Meter fünfzig hohen Sichtschutzzaun verbargen sich Kickbälle, Fahrräder und angerostete Puppenwagen – Sachspenden für die Kinder, die in diesem Haus lebten. Es gab eine Schaukel und eine lange gelbe Rutsche, die in weichen Rindenmulch mündete.
Beim Gedanken an die Kinder stieg Wut in ihm auf. »Es dürfte solche Orte nicht geben«, murmelte er leise. »Kinder sollten sich in ihrem Zuhause sicher fühlen.«
Er warf einen prüfenden Blick auf Harold Turner. Der mächtige Strafverteidiger hatte heute Morgen noch einen Drogendealer vor Gericht vertreten und mit selbstzufriedener Autorität und sichtlicher Genugtuung »begründete Zweifel« an der Schuld seines Mandanten angemeldet.
Der Harold Turner aus dem Gerichtssaal hatte nichts gemein mit dem, der hier vor wenigen Minuten gestanden und mit tränenüberströmtem Gesicht um sein Leben gewinselt hatte. Der Harold Turner aus dem Gerichtssaal hatte nicht gewusst, dass die Angst einen Menschen auffressen konnte.
Dieser hier schon.
Dieser hier war auf die Knie gesunken. Er hatte Geld angeboten und alle möglichen Versprechungen gemacht, um sein erbärmliches Leben zu retten.
»Aber mich kannst du doch nicht mit deinem gedrechselten Gerede umstimmen, Harold«, hatte der Hüter erwidert. »Für dich gibt es keine Begnadigung.«
Eine leichte Brise ließ das dichte Blätterdach über ihm rascheln. Bald würde die Sonne aufgehen. Dieser Juli war einer der heißesten seit Aufzeichnung der Wetterdaten, Pflanzen verdorrten, der Grundwasserspiegel sank, und die Menschen waren gereizt.
In der Ferne bellte ein Hund. Eine Katze fauchte. Sie jagten durch die dunklen Gärten, die Geräusche verklangen in der Nacht.
Der Hüter blickte zum Haus hoch und versuchte festzustellen, ob die Tiere jemanden geweckt hatten. Im ersten Stock ging kurz ein Licht an, das aber im nächsten Moment wieder erlosch. Die Menschen in der Straße schliefen tief und fest.
Es war eine heilige, eine gesegnete Tageszeit. In den stillen, friedlichen Augenblicken vor der Dämmerung fühlte man sich unbesiegbar und unverwundbar.
Er löste den goldenen Manschettenknopf von Harolds linkem Handgelenk und steckte ihn in dessen Jacketttasche, um ihm dann Jacken- und Hemdärmel bis zum Ellbogen hochzuschieben. Am linken Ringfinger steckte ein Platin-Ehering.
»Der Herr ist von großer Macht, und Er lässt keinen ungestraft«, murmelte er. In den dunkelsten Stunden nach Debras Tod hatte dieser Bibelvers dem Hüter Trost gegeben. Die süße Debra, die mit neununddreißig gestorben war, durch die Hand ihres eigenen Ehemannes. Wie Harold war Debras Gatte nach außen hin ein angesehener Mann und zu Hause ein brutaler Schläger und Tyrann gewesen. Debra und ihre Tochter hatten jahrelang die Hölle durchlebt.
Die Erinnerung an Debra und ihr Kind erfüllte ihn mit Trauer und Reue. Debra hatte um Hilfe gerufen. Sie hatte ihre Ehe beenden und einen Neuanfang machen wollen, doch niemand hatte ihr geholfen. Niemanden hatte es gekümmert, was hinter verschlossenen Türen geschah.
Und dann hatte ihr Mann sie getötet. Er hatte sie zu Tode geprügelt und sich dann feige selbst gerichtet. Debras einzige Tochter hatte ihre Mutter gefunden und war davongelaufen. Das Erlebnis hatte sie fürs Leben gezeichnet.
Viele Nächte lang hatte der Hüter an Debra und ihr Kind gedacht und für ihre Erlösung gebetet.
Zwölf Jahre waren seither vergangen. Und dann hatte vor einigen Monaten Gott ein Zeichen gesandt – in Gestalt eines Artikels in einem Magazin. Es war so klar und deutlich gewesen, dass ihm die Tränen gekommen waren: Die Zeit der Vergeltung war gekommen.
Debra war für immer verloren, ebenso wie die Unschuld ihres Kindes. Doch diejenigen, die sich an ihr und ihrer Familie schuldig gemacht hatten, konnten aufgespürt und bestraft werden. Sie sollten für die Sünden bezahlen, die sie begangen hatten.
Der Hüter zog eine Machete aus einer schwarzen Tasche und hob die Klinge über den Kopf. Die Schneide war rasiermesserscharf, fachmännisch so lange gewetzt, bis sie Papier teilen konnte.
Das Mondlicht glitzerte auf der Klinge, ehe sie in einem Bogen auf Harolds linke Hand herniederging und sie vom Arm trennte.
Blut spritzte auf Harolds Gesicht und auf den Overall und die Handschuhe des Hüters. Im fahlen Licht sickerte es bräunlich aus dem Stumpf und bildete eine Lache auf dem ausgedörrten Boden neben der Leiche.
Archaische Kräfte durchströmten ihn. Das Leben hatte sich nie süßer angefühlt als in diesem Augenblick.
Die Rache ist mein.
Er wickelte die Hand in eine Gefriertüte mit Zipper und steckte sie zusammen mit der bluttriefenden Machete in die schwarze Tasche.
Zufrieden darüber, dass er unbemerkt geblieben war, schloss er den Reißverschluss der Tasche, trabte über den Rasen zum Zaun, schlüpfte hindurch und lief zu seinem Van, der ein paar Häuser weiter parkte.
Als er die Wagentür öffnete, ging die Innenraumbeleuchtung an. Blinzelnd stieg er ein und schloss die Tür rasch wieder. Sofort herrschte Dunkelheit. Mehrere Sekunden lang blieb er regungslos sitzen und ließ seine Augen über die Hausfronten wandern, um sicherzugehen, dass niemand etwas gesehen hatte. Doch die Häuser blieben stumm und dunkel.
Schließlich wandte er sich beruhigt der offenen Blumenbox auf dem Beifahrersitz zu. Sie enthielt lila Schwertlilien, die einzeln in Glaszylindern voller Wasser steckten.
Er nahm Harolds Hand aus der Tasche und wickelte sie behutsam in grünes Papier, um sie unter die Blumen zu legen.
Er hatte die Blumen ganz bewusst gewählt – Schwertlilien standen fürFreundschaft, Hoffnung, Weisheit und Mut. Sie würde die Bedeutung verstehen.
Nachdem er den Deckel wieder auf die Box gelegt hatte, schlang er ein rotes Seidenband darum und band eine ordentliche Schleife. Er nahm eine vorgeschriebene Karte aus dem Handschuhfach und schob sie unter den Knoten.
Dann startete er den Motor. Die Armaturenbeleuchtung fiel auf die Box und die mit dickem Stift handgeschriebenen Worte auf der Karte: »Für Lindsay.«
2
Montag, 7. Juli, 8:10 Uhr
Lindsay O’Neil war spät dran, verdammt spät – und zwar weil ihr Wecker wegen eines Stromausfalls nicht geklingelt hatte und sie fast drei Stunden verschlafen hatte.
Sie sah auf den Tacho ihres Geländewagens. Die Nadel zeigte etwas mehr als fünfundfünfzig Stundenkilometer an. Doch sie wäre gerne doppelt so schnell gefahren, wenn der Berufsverkehr auf der vierspurigen Broad Street es nur zugelassen hätte.
Sie war angespannt. Normalerweise brauchte sie fünfzehn Minuten für die sechzehn Kilometer von ihrer Wohnung zum Sanctuary-Frauenhaus, wo sie arbeitete. Doch normalerweise schlief sie auch nicht so tief wie letzte Nacht. In den meisten Nächten wachte sie regelmäßig aus Träumen auf und hatte kein Problem damit, früh um fünf aufzustehen und zur Arbeit zu fahren.
Lindsay schaltete das Radio ein und drückte mehrmals auf den Sendersuchlauf, bis sie einen Song fand, der ihr gefiel. Musik und Text beruhigten sie, und sie atmete ein paarmal tief durch, bis sich ihre Nervosität etwas löste.
Seit anderthalb Jahren leitete Lindsay das Sanctuary. Ihr Arbeitstag war normalerweise voll mit Beratungsterminen und verwaltungstechnischen Meetings, und meist kam sie noch nicht einmal dazu, mittags etwas zu essen.
Heute hatte sie sogar noch mehr Termine als sonst. Verpasst hatte sie bislang die Gruppenbesprechung, die sie jeden Montag um sieben Uhr abhielt. Die Besprechung war für alle Hausbewohner bindend. Ebenfalls vorbei war die auf acht Uhr angesetzte Telefonkonferenz mit der Vorstandsvorsitzenden des Frauenhauses, Dana Miller, die auf den neuesten Stand gebracht werden wollte.
Dass sie die Telefonkonferenz verschlafen hatte, war nicht ganz unproblematisch, aber da würde sie sich herausreden können. Dass sie aber die Gruppenbesprechung verpasst hatte, war ganz und gar inakzeptabel. Die Frauen waren alle Opfer häuslicher Gewalt. Viele von ihnen hatten seit Jahren nicht mehr gearbeitet, und die meisten hatten jetzt mehr Angst vor dem Unbekannten, das vor ihnen lag, als vor der physischen Gewalt in ihrer Beziehung. Häufig hörte Lindsay bei den Gruppentreffen nur zu, verteilte Taschentücher und nahm die Frauen in den Arm. Das Entscheidende war, dass sie immer da war, um ihnen Mut zu machen. Immer.
Nur heute nicht. Heute hatte sie sie alle hängen lassen.
Lindsay klappte ihr Handy auf. Sie hatte das Haus heute früh so hektisch verlassen, dass sie ganz vergessen hatte, im Büro anzurufen. Aber das Display blieb dunkel – der Akku war leer. Hatte sie es nicht über Nacht aufgeladen? Doch dann fiel es ihr wieder ein: »Der Stromausfall. So ein Mist!«
Sie hielt an einer roten Ampel und warf das Handy auf den Beifahrersitz. Die Hitze des schwarzen Asphalts drang durch das Bodenblech, obwohl die Klimaanlage auf Hochtouren lief. Die Motorkühlung sprang an, und binnen Sekunden geriet der Motor ins Stottern und drohte abzusterben.
»Oh verdammt!«, murmelte sie.
Seit Monaten nahm sie sich vor, den Wagen zur Inspektion zu bringen, hatte es aber immer wieder aufgeschoben. Nie war genug Zeit. Aber jetzt machten die hohen Temperaturen dem Motor zu schaffen. Sie schaltete die Klimaanlage ab und kurbelte das Fenster herunter. Schwere, heiße Juliluft drang ins Innere.
Ohne die Belastung der Klimaanlage lief der Motor wieder ruhiger, doch bald fing sie an zu schwitzen.
»Verdammt, ich hasse das.«
Es war, als wollte die Hitze sie erdrücken, sie reizte ihre Nerven und ließ verdrängte Erinnerungen an die Oberfläche steigen.
»Mom«, flüsterte sie und schloss die Augen.
Es war zwölf Jahre her, da war sie, gerade siebzehn, an einem heißen, stürmischen Nachmittag früher von ihrem Job als Poolaufsicht nach Hause gekommen. Normalerweise hatte sie immer bis zum Schluss gearbeitet, meist bis nach einundzwanzig Uhr. Doch dieser Tag war so gewittrig gewesen, dass der Bademeister das Schwimmbad schon gegen vierzehn Uhr geschlossen und seine Leute nach Hause geschickt hatte.
Joel, ein Kollege aus dem Verein, hatte sie heimgefahren. »Hallo, wie wär’s, wollen wir ins Kino gehen?« Joel war ein magerer Schlacks mit fleckiger Haut und Zahnspange. »Ich lad dich ein.«
Sie wusste, dass Joel in sie verknallt war, und wollte seine Gefühle nicht verletzen. »Danke, das ist nett, aber ich habe immer so wenig Zeit mit meiner Mom. Nächste Woche gehen wir, versprochen.«
»Also dann – abgemacht.« Er ließ sie auf der kreisförmigen Auffahrt aussteigen, direkt vor dem schön begrünten Haus, das ihre Urgroßeltern vor fast hundert Jahren gebaut hatten.
Lindsay winkte und sauste mit ihrer Schwimmtasche durch die preisgekrönten Vorgartenbeete ihrer Mutter, die mit Lilien, Begonien und Tagetes bepflanzt waren. Seltsamerweise war die Tür nicht abgeschlossen. Sie hatte ihrer Mutter extra eingeschärft, immer abzuschließen.
Zwei Monate zuvor hatte ihre Mutter den Vater rausgeworfen, weil sie seine verbale und physische Gewalt nicht mehr ertragen konnte. Seitdem war die Atmosphäre zu Hause wesentlich besser. Ihre Mutter hatte wieder zu singen begonnen und trug neuerdings sogar Make-up. Lindsay hatte immer nach Vorwänden gesucht, um nicht nach Hause gehen zu müssen – jetzt freute sie sich darauf.
Lindsay ließ ihre Tasche an der Eingangstür fallen und blickte auf die Uhr. Die Schicht im Ashland Town Restaurant, wo Mom als Kellnerin arbeitete, würde erst in ein paar Stunden beginnen, sie hatten also noch jede Menge Zeit.
Ein Donnerschlag krachte, und die Fenster im Haus klirrten. Über den Maisfeldern und den Bäumen in der Ferne hingen finstere Wolken. Windböen fuhren in die Eichen und ließen ihre Blätter flattern, sodass es aussah, als würden sie silbern glitzern. Der Sturm drang mit Macht nach Osten vor. Bald würde er direkt über ihnen sein.
»Mom?«
Keine Antwort.
Aus dem Radio in der Küche wehte California Dreamin’ von The Mamas & The Papas herüber, der Lieblingssong ihrer Mutter. Lindsay musste lächeln, als ihr einfiel, wie sie vor einigen Wochen zusammen zu dem Lied getanzt hatten. Mom träumte davon, nach Kalifornien zu gehen, den Pazifik zu sehen und die Universal Studios in Hollywood zu besuchen. Lindsay hatte ihr versprochen, nächstes Jahr mit ihr dorthin zu fahren, sobald sie ihren Highschoolabschluss in der Tasche hatte. Seither verbrachten sie ihre Freizeit damit, den Trip nach Westen zu planen.
»Mom! Ich bin da!«
Im Song begann die zweite Strophe. Stepped into a church … Lindsay begann mitzusummen und nahm eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank.
Als sie sie öffnete, fiel ihr Blick auf die abgetragenen Arbeitshandschuhe ihres Vaters, die auf dem Küchentisch lagen. Ihr Magen zog sich zusammen. Was hatte er hier zu suchen?
In den zurückliegenden Wochen hatte er Mom ein paarmal angerufen. Die Anrufe hatten Lindsay beunruhigt, doch ihre Mutter hatte alles heruntergespielt. Sie solle sich keine Sorgen machen.
Alles sah aus wie immer. Der Linoleumboden war sauber aufgewischt. Gespülte Teller standen zum Trocknen im Abtropfkorb. Weiße Spitzenvorhänge flatterten im Fenster. Auf dem PVC-Tisch lagen zwei Gedecke einander gegenüber. Ihr Vater konnte charmant sein, wenn er wollte, und meistens hatte er ihre Mutter überreden können, ihm etwas zu kochen.
Ein kühler Luftzug streifte Lindsays Nacken. Das Haus fühlte sich plötzlich anders an. Falsch. Eine schreckliche Ahnung drückte ihr die Brust zusammen.
Lindsay sah sich um. »Mom!«
Sie durchquerte die Küche, stieß die Tür zum Garten auf und blickte auf die Schaukel neben dem Geräteschuppen. Dunkle Wolken verhingen den Horizont.
»Mom, wo bist –«
Lindsay wandte sich nach rechts und hielt abrupt inne. Neben den Mülltonnen am Zaun lag ihre Mutter auf dem Rücken.
Mit wenigen Schritten war Lindsay bei ihr, blieb aber Zentimeter von ihr entfernt stehen. Das Gesicht ihrer Mutter war durch Prügel fast bis zur Unkenntlichkeit verschwollen. Ihr Kopf ruhte in einer Blutlache. Neben ihr lag ein blutiger Hammer, der aussah, als hätte ihn jemand eilig fallen gelassen.
Lindsay ging neben ihrer Mutter auf die Knie und streckte die Hand aus, zögerte dann jedoch. Sie hatte Angst, sie zu berühren.
Angst, die Frau zu berühren, die sie geliebt und umsorgt hatte und die sie niemals, unter keinen Umständen, im Stich gelassen hätte.
Eine Hupe riss Lindsay aus ihren Erinnerungen. Sie sah auf und blickte auf eine grüne Ampel. Schweiß trat auf ihre Stirn, und ihre Hände zitterten. Fluchend gab sie Gas.
Zwölf Jahre waren vergangen, und noch immer zitterten ihr die Hände, wenn sie an jenen Tag zurückdachte. Zwölf Jahre, und noch immer litt sie unter Albträumen. Zwölf Jahre, und noch immer hatte sie das Gefühl, ihr Leben würde ihr sofort entgleiten, sobald sie sich auch nur im Mindesten gehen ließe.
»Hör auf, Lindsay!«, beschwor sie sich selbst. »Es ist lange her und vorbei.«
Bewusst lenkte sie ihre Gedanken weg von der Vergangenheit hin zu der langen Liste anstehender Aufgaben, die sie nie abreißen ließ. Als Erstes musste sie ihre Chefin Dana anrufen und sich dafür entschuldigen, dass sie die Telefonkonferenz verpasst hatte. Dann musste sie die Kalkulation für einen Förderantrag abschließen, der ihnen, falls er angenommen wurde, eine Vollzeitpsychologin finanzieren würde. Außerdem musste sie sich Gedanken machen, wie sie an neue Spendengelder kamen, sie musste sich auf ein Gespräch mit einer örtlichen Kirchengruppe vorbereiten, und dann war da noch ein Seminar zum Thema Interventionsbedarf, das sie im örtlichen Krankenhaus halten wollte.
Ein Psychotherapeut hatte Lindsays vollgepackten Stundenplan einmal als Vermeidungsstrategie bezeichnet. Es sei einfacher für sie, Tag und Nacht zu arbeiten, als über ihre Verluste nachzudenken. Lindsay hatte ihm nicht widersprochen, weil ihr vollkommen klar war, dass er recht hatte. Doch sie wusste nicht, wie sie das Tempo drosseln sollte, ohne dass die bösen Erinnerungen sofort wieder hochkamen.
In der Wohnstraße, in der das Sanctuary-Frauenhaus lag, galt ein Tempolimit von vierzig Stundenkilometern, und sie hielt sich streng daran. Sie war so weit hinter ihrem Zeitplan, dass sie ohnehin bis spätabends bleiben musste, um ihr Pensum halbwegs zu bewältigen. Da kam es auf zwei Minuten nicht an.
Lindsay rollte langsam auf das Haus zu, als sie in der Einfahrt zwei Polizeiwagen und einen zivilen Chevrolet Impala stehen sah.
Ihre Finger klammerten sich fester um das Lenkrad, und die Anspannung raubte ihr beinahe den Atem. »Oh Gott, was ist jetzt schon wieder passiert?«
Die Polizei war kürzlich schon einmal hier gewesen. Eine der Bewohnerinnen, Pam Rogers, hatte gegen die strengen Regeln des Hauses verstoßen und ihren gewalttätigen Mann angerufen. Sie hatte ihm die geheime Adresse des Frauenhauses verraten und ihn gebeten, zu kommen und sie abzuholen. Fünfzehn Minuten später war er da gewesen. Sie war zu ihm hinausgerannt und hatte ihn angefleht, sie wieder aufzunehmen. Doch statt sie zu begrüßen, hatte er auf sie eingedroschen und sie in sein Auto gezwungen. Von der völlig überforderten Nachtaufsicht telefonisch informiert, hatte Lindsay sofort den Bruder angerufen, den Pam erwähnt hatte. Da er nicht wusste, wo seine Schwester war, hatte Lindsay die Polizei eingeschaltet.
Die Frau war am nächsten Tag tot hinter einem Lebensmittelladen gefunden worden, brutal geprügelt und erdrosselt. Die Cops hatten Jack, den Ehemann, zwei Wochen später verhaftet. Er hatte keinerlei Reue gezeigt, sondern immer nur auf seine Rechte als Ehemann gepocht.
Seine Rechte. Aber was war mit den Rechten seiner Frau? Ihr Recht auf ein Leben ohne Angst?
Lindsay parkte ihren Jeep in der gepflasterten Einfahrt. Sie zog heftig die Handbremse, griff nach ihrer Aktenmappe und eilte über den betonierten Gehsteig auf die verglaste Eingangstür zu.
Das Frauenhaus, das auf einem Eckgrundstück lag, war von außen nicht als solches zu erkennen. Was auffiel, war die große Veranda mit den verwitterten weißen Schaukelstühlen und die roten Geranien, die Lindsay über das lange Nationalfeiertagswochenende in Kübel gesetzt hatte. Der Vorgarten war sauber und gepflegt und die Beete frisch gemulcht. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass Anwohner wenig auf ihre Nachbarn achteten, solange diese ihren Garten pflegten. Und unbeachtet zu bleiben, war eine Grundvoraussetzung für die Arbeit des Frauenhauses.
Im Erdgeschoss gab es vier Zimmer, die durch einen zentralen Flur getrennt wurden. Das erste Zimmer rechter Hand diente Lindsay als Büro; es hatte eine Glastür und war voll mit Akten, Fachbüchern und Säcken voller unsortierter Sachspenden.
Daran angrenzend – dort, wo in einem Wohnhaus das Esszimmer gewesen wäre – lag ein Besprechungsraum. In der Mitte standen im Kreis angeordnete Stühle, die sie an das Gruppentreffen erinnerten, das sie heute Morgen verschlafen hatte. An den Wänden hingen Poster, die häusliche Gewalt anprangerten.
Gegenüber auf dem Flur befand sich der Aufenthaltsraum mit einem großen Fernseher, ein paar alten Sofas, die mit weißen Laken überzogen waren, und großen Sitzkissen auf dem Boden. Dahinter schloss sich die Küche an, die Lindsay erst letzten Monat in freundlichem Gelb gestrichen hatte. Im ersten Stock gab es fünf Zimmer, die jeweils mit vier Betten ausgestattet waren. Oft kamen Frauen mit ihren Kindern hierher, und sie versuchte, möglichst immer die ganze Familie gemeinsam unterzubringen. Es standen sogar Kinderbettchen und Stubenwagen zur Verfügung.
Normalerweise wimmelte es im Sanctuary von Frauen und Kindern, die hier vorübergehend Zuflucht gesucht hatten, und die Stimmen der Bewohner vermischten sich meist mit den Geräuschen des Fernsehers und gelegentlichem Telefonläuten.
Doch im Augenblick schien es vollkommen still und menschenleer zu sein.
Die Silberkettchen an Lindsays schmalem Handgelenk klimperten, als sie das Gummi von dem viel zu engen Pferdeschwanz löste, der ihr allmählich Kopfschmerzen verursachte. Stumpf und glanzlos fiel ihr das vernachlässigte blonde Haar auf die Schultern herab.
Lindsay steuerte auf die Küche zu, wo sie die Aufsicht der letzten Nacht vermutete, und konnte eine aufsteigende Panik nicht unterdrücken. »Ruby!«, rief sie ihr entgegen.
Ein Telefon in der Hand haltend stürmte eine schwergewichtige Schwarze aus der Küchentür. Ruby Dillon war tagsüber in einem Pflegeheim tätig und half gelegentlich nachts im Frauenhaus aus. Sie war um die fünfzig, trug das Haar kurz und verhüllte ihre Rundungen mit extraweiten Hosen und Pullis. Dass sie kein Geheimnis aus ihrer Vergangenheit machte und auch ihre Knast- und Drogenkarriere nicht unter den Teppich kehrte, brachte ihr bei den wechselnden Bewohnerinnen immer wieder höchsten Respekt ein.
»Wird aber auch Zeit, dass du kommst. Ich versuche schon seit einer Stunde, dich zu erreichen«, sagte Ruby und hielt ihr das Telefon entgegen.
»Ich hatte heute Nacht einen Stromausfall. Das Festnetztelefon ging nicht, und mein Handyakku hat nicht aufgeladen. Warum ist die Polizei hier? Was ist passiert?«
»Sie sind wegen der Leiche da.«
Bilder ihrer Mutter, die tot im Garten lag, schossen ihr durch den Kopf. »Leiche? Bitte sag jetzt nicht, eine von unseren Frauen.«
Ruby berührte Lindsay sanft am Arm. »Nein, nein, Liebes. Keine von unseren Frauen. Die sind alle wohlbehalten bei der Arbeit oder in der Schule.«
Erleichtert schloss Lindsay die Augen. Um ein Haar wäre sie in Tränen ausgebrochen. »Und – wer ist es?«
Ruby zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht. Ein Mann jedenfalls. Ich hab ihn entdeckt, als ich heute Morgen den Müll rausgebracht habe. Er lehnte an den Müllcontainern hinter dem Geräteschuppen, richtig geschniegelt und gebügelt, als wollte er zum Sonntagsgottesdienst.«
Lindsay ging durch den Flur in die Küche und sah aus dem Fenster über der Spüle. Im Garten standen ein halbes Dutzend Polizisten um das gelbe Absperrband. Die meisten trugen Uniform, nur der Kripobeamte in der Mitte war in Zivil. Er wandte ihr den Rücken zu.
Die Cops blockierten Lindsays Blick auf die Leiche. »Kennst du ihn?«
Ruby verschränkte die Arme über der Brust. »Wen? Den Toten? Nein. Und ich hab ihm auch nicht ins Gesicht geschaut. Der Teufel kann deine Seele holen, wenn du einem Toten ins Gesicht schaust.«
Lindsay ließ ihre Tasche auf den ramponierten Küchentisch fallen, dessen Farbkleckse und Kerben davon zeugten, dass am Wochenende Kinder hier gebastelt hatten. »Ich habe genug vom Tod gesehen. Vielleicht hat er ja meine Seele schon gestohlen.«
»Darüber macht man keine Witze«, sagte Ruby missbilligend.
»Weiß die Polizei, wer der Typ ist?«
»Mir haben sie jedenfalls nichts gesagt. Ich habe dem Detective alles erzählt, was ich weiß, aber als ich anfing, Fragen zu stellen, war er ziemlich einsilbig. Stattdessen hat er mir aufgetragen, alles stehen und liegen zu lassen und meine Chefin ausfindig zu machen.« Ruby ließ ihren Adlerblick über Lindsay wandern. »Sind das die Klamotten von gestern?«
Lindsay blickte an sich hinunter auf die ausgebleichten Jeans und das rosa Baumwoll-T-Shirt und strich eine Falte glatt. »Ja, und?«
Ruby hob ihre dunkle Braue. »Wo bist du denn gewesen? Na, hoffentlich bei einem Mann.«
Bei der Vorstellung errötete Lindsay. »Nein.«
»Schade! Du könntest mal einen Kerl im Bett brauchen. Dein nichtsnutziger Ehemann hat dich das ganze letzte Jahr über nicht beachtet.«
»Wir leben getrennt, schon vergessen?«
»Kein Mann, der halbwegs bei Trost ist, würde sich von dir trennen.«
Lindsay hatte keine Lust, sich wieder einmal auf eine Diskussion über ihre gescheiterte Ehe oder ihr klösterliches Workaholic-Dasein einzulassen. »Ich habe gestern Nachmittag eine Yogastunde gegeben und bin dann nach Hause gefahren, um an dem Antrag zu arbeiten. Dann bin ich in den Klamotten auf dem Sofa eingeschlafen. Irgendwann in der Nacht gab es einen Stromausfall, und deswegen ist heute Morgen mein Wecker nicht angesprungen.« Wenn ihre Mitbewohnerin Nicole nicht von Hundegebell wach geworden wäre, hätte sie wahrscheinlich noch ein paar Stunden weitergeschlafen.
Ruby seufzte. »Du arbeitest zu viel, auf Dauer wird dich das kaputtmachen. Aber na ja, wenn du schon keinen Mann hattest, hast du wenigstens gut geschlafen.«
Nachdem Lindsay sich vor einem Jahr von ihrem Mann getrennt hatte, hatte sie sich erst recht in die Arbeit gestürzt. »Gut geschlafen, so kann man sagen.« Ohne nachzudenken, fügte sie hinzu: »Wie eine Tote.«
Ruby zog eine Grimasse und hob den Blick himmelwärts. »Mach keine Witze über die Toten«, sagte sie beschwörend. »Sonst kommt der Teufel und holt dich.«
Lindsay fuhr sich mit der Hand durch das Haar. »Tut mir leid. Mein Hang zu morbiden Scherzen ist ein Überbleibsel aus meiner Ehe mit einem Cop.«
Ruby runzelte die Stirn. »Dein Mann ist Polizist?«
»Ja«, erwiderte sie einsilbig. Auch dieses Thema würde sie jetzt nicht weiter vertiefen. »Ich werde mit der Polizei reden«, fuhr sie fort. »Die Einsatzwagen vor dem Haus müssen verschwinden, bevor jemand merkt, dass wir ein Frauenhaus sind.«
Rubys schwere Füße schlurften hinter Lindsay her. »Spar dir das lieber! Ich habe ein paarmal versucht, mit dem Detective zu reden.« Sie betonte das Wort, als wäre es eine Beleidigung. »Aber er hat mir nur verboten, den Tatort zu betreten. Er hat sogar die Hintertür abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen, damit niemand rein- oder rausgehen kann.«
Das war zu viel für Lindsay. Das Sanctuary war ihr Werk. »Dieser Cop spaziert auf meinem Grundstück herum und erzählt den Leuten, was sie zu tun und zu lassen haben?«
Grinsend schüttelte Ruby den Kopf. »Manchmal denke ich, kämpfen ist dir wichtiger als essen.«
Lindsay lächelte. »Jemand muss eben die Verantwortung übernehmen.«
Ruby schnaubte. »Liebes, du tust zu viel für andere. Wird Zeit, dass sich auch mal jemand um dich kümmert.«
»Ich kann mich ganz gut um mich selbst kümmern.« Lindsay hatte diesen Satz im letzten Jahr so oft gesagt, dass sie fast selbst daran glaubte.
Sie trat aus dem Vordereingang und ging seitlich um das Haus herum auf den hohen Zaun mit den losen Brettern zu. Sie verschob ein paar Bretter und schlüpfte unbemerkt durch das Loch.
Der erste Uniformierte, den sie sah, war ein Streifenpolizist, der mit dem Rücken zu ihr direkt hinter dem gelben Absperrband stand und den Tatort betrachtete. Ein schlanker junger Mann, der noch etwas unbeholfen wirkte, als käme er geradewegs von der Polizeiakademie, kaum älter als einundzwanzig.
Eine feuchte Brise fuhr durch die stehende heiße Luft im Garten und trug eine Mischung von Gerüchen an Lindsays Nase heran: Blut, Müll, Schießpulver, Tod.
Von ihrem Standort aus konnte sie die Leiche nicht sehen, da sechs Cops im Halbkreis um sie herumstanden.
Sie trat auf den Streifenpolizisten zu und räusperte sich. »Weiß man schon etwas über das Opfer?«
Der junge Mann fuhr herum und starrte sie an. »Wo kommen Sie denn her?«
»Aus dem Haus.« Sie nickte in Richtung des Frauenhauses und dann zu den Cops hinüber. »Weiß man, wer ermordet wurde? Ich habe gehört, es ist eine männliche Leiche.«
Der junge Mann wollte schon antworten, hielt dann aber inne und warf sich in die Brust. »Ma’am, das hier ist ein Tatort. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten.«
Sein Einschüchterungsversuch ging bei Lindsay ins Leere. Sie hatte sich schon gegen ganz andere Kaliber als dieses Milchgesicht behauptet. »Hören Sie, Officer …« Sie blickte auf das bronzene Namensschild auf seiner Uniform. »… Bennett. Dieses Haus ist ein Frauenhaus, und ich bin die Leiterin.«
»Mir ist egal, wer Sie sind. Sie dürfen sich hier nicht aufhalten.«
Sie hatte ein wenig gereizt geklungen. Ruby riet ihr oft, dass sie sich im Ton etwas mäßigen sollte. Okay, es hieß ja auch, mit Honig fing man Fliegen, nicht mit Essig.
Also setzte sie ganz bewusst ein Lächeln auf und nahm eine entspannte Haltung ein. »Ich muss wirklich wissen, wer da ermordet wurde, falls irgendeine von unseren Frauen hier betroffen ist. Es ist meine Aufgabe, die Sicherheit der Frauen zu gewährleisten.«
Der junge Polizist runzelte die Stirn. »Selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen.«
Seine Reaktion verärgerte sie, hielt sie aber nicht davon ab weiterzufragen. »Wie ist der Typ gestorben?«
»Kann ich nicht sagen.«
»Weiß man schon etwas über den genauen Todeszeitpunkt?« Sie versuchte, sich unauffällig an ihm vorbeizuschieben. Wenn sie etwas näher herankam, würde sie vielleicht selbst etwas über das Opfer herausfinden.
Doch er trat ein Stück zur Seite und blockierte ihr den Weg. »Niemand betritt den Tatort.«
Sie neigte sich zur Seite, um an ihm vorbeizuspähen, doch selbst von dieser Stelle aus blieb ein Großteil des Tatorts vom breiten Rücken des Detectives verdeckt. Er hatte inzwischen sein Jackett abgelegt und die Ärmel hochgerollt, um in Gummihandschuhe und -stiefel zu schlüpfen. Sein Gesicht konnte sie nicht sehen, nur das militärisch kurze Haar und das blütenweiße Hemd. Seine Hände ruhten jetzt auf seinen schmalen Hüften.
Das musste der arrogante Detective sein, von dem Ruby gesprochen hatte. Lindsay brauchte keine Sekunde, um zu wissen, dass sie ein egoistisches, rücksichtsloses Alphatier vor sich hatte.
Plötzlich fühlte sie sich sehr müde. Viel zu lange hatte sie sich mit solchen Typen herumgeärgert. Aber wenn er derjenige war, mit dem sie reden musste, dann war es nicht zu ändern.
Als könnte er ihre Gedanken lesen, sagte der Officer: »Der zuständige Detective wird sich mit Ihnen unterhalten, sobald er so weit ist.«
Sie strich sich mit der Hand durch das Haar. »Hat dieser Detective auch einen Namen?«
»Detective Kier.«
Sie schluckte. »Zack Kier?«
Ein süffisantes Lächeln umspielte die Lippen des jungen Mannes. »Genau.«
Zack Kier. Ihr Mann, mit dem sie seit fast einem Jahr kein Wort gesprochen hatte.
Sie musterte den Kriminalbeamten genauer. Wann war Zack von der Drogenfahndung zur Kripo gegangen? Wann hatte er sich die Haare kurzgeschnitten und den Bart abrasiert? Seit wann trug er Anzüge? Früher hatte er sein dichtes, langes Haar im Nacken zusammengebunden und war in verwaschenen Jeans, T-Shirt, abgetragenen Stiefeln und einer ebensolchen schwarzen Lederjacke herumgelaufen.
Alles an ihm war in diesem vergangenen Jahr anders geworden. Und doch hatte sich offenbar nichts verändert.
Sie hätte sofort diese aufrechte, beherrschte Haltung erkennen müssen, die schon immer seine unerschütterliche Liebe für den Polizeidienst zum Ausdruck gebracht hatte. Außerdem berührte er immer noch die Gürtelschnalle mit dem Zeigefinger, wenn er die Arme in die Seiten stemmte.
All die heftigen Emotionen, die sie im letzten Jahr mit viel Mühe unter Kontrolle gebracht hatte, brachen wieder über sie herein: Liebe, Hass, Angst, Enttäuschung. Sie war so erschüttert, dass es ihr einen Moment lang die Sprache verschlug.
Am liebsten hätte sie sich jetzt einfach umgedreht und wäre weggegangen. Wenn sie nur um diese Begegnung mit Zack und das ganze daraus entstehende Gefühlschaos herumkommen könnte.
Doch dann gab sie sich einen Ruck. Ihr Therapeut hatte ihr erklärt, dass sie gerne vor schmerzhaften Gefühlen floh. Er hatte ihr geraten, sich ihren Gefühlen für Zack zu stellen. Als sie anzweifelte, dass ihr das gelingen würde, hatte er sie daran erinnert, dass sie auch über ihren gewalttätigen Vater und die Ermordung ihrer Mutter hinweggekommen sei.
Trotzdem musste Lindsay allen Mut zusammennehmen, um seinen Namen zu rufen. »Zack!«
Die Cops um ihn drehten sich zu ihr um und sahen sie an, doch Zack verkrampfte sich sichtlich. Einen Augenblick lang schien er wie gelähmt zu sein, doch dann wandte er sich ebenfalls langsam um und sah sie durch seine Pilotenbrille hindurch an.
Ihr Bauch schrie: Nichts wie weg! Doch sie rührte sich nicht von der Stelle.
Die Sonnenbrille verdeckte Zacks stahlblaue Augen, doch sie wusste, dass seine Miene auch ohne die dunklen Gläser unergründlich gewesen wäre. Er hatte seine Gefühle immer gut verbergen können. Deshalb war er auch ein großartiger Undercoverermittler und ein lausiger Ehemann gewesen.
»Zack, kannst du mir sagen, wessen Leiche das ist?« Ihre Stimme klang überraschend beherrscht – ein kleines, aber willkommenes Wunder.
Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde Zack auf sie zukommen. Ihr Verhältnis war alles andere als gesund, aber nichtsdestotrotz hatten sie eine gemeinsame Vergangenheit. Das musste doch etwas bedeuten.
Er holte tief Luft, blieb aber, wo er war. »Ich befrage dich später, Lindsay. Geh bitte rein und warte auf mich!«
Zack klang so beherrscht, so gefasst. Er hatte gewusst, dass er sie hier treffen würde.
Die Erkenntnis machte sie wütend. Er hätte sie kurz anrufen und vorwarnen können. Obwohl – ihr Handy war ebenso tot wie ihr Telefon zu Hause. Vielleicht hatte er es sogar versucht.
Doch der Gedanke milderte nicht ihren Unmut. »Nun, ich möchte lieber jetzt mit Ihnen sprechen, Detective.« Sie gab sich betont zickig, weil sie wusste, dass er das hasste.
Zacks linke Hand krümmte sich leicht. Diese Geste kannte sie. Sie bedeutete, dass er verärgert war. Das war gut.
An den jungen Polizisten gewandt, sagte Zack: »Officer Bennett, begleiten Sie Ms O’Neil bitte vom Tatort weg.«
Lindsay straffte die Schultern bei der knappen Abfuhr. »Dieses Grundstück gehört dem Sanctuary-Frauenhaus, Detective Kier. Sie können mich nicht rausschmeißen. Was auch immer hier passiert ist, betrifft auch meine Schutzbefohlenen.«
Statt zu antworten, wandte sich Zack wieder der Leiche zu.
Mühsam atmete Lindsay durch und dämpfte ihren Ton. Es hatte keinen Sinn, auf Konfrontation zu gehen. »Hör zu, Zack, meine Assistentin hat die Leiche gefunden, und der Mann liegt in unserem Garten. Kannst du mir nicht ein paar Einzelheiten sagen?«
»Nicht jetzt, Lindsay«, erwiderte Zack. Er kniete sich neben den Toten, zog die Sonnenbrille ab und betrachtete, am Bügel nagend, die Leiche.
Kaum waren sie ein paar Minuten zusammen, und schon war wieder klar, dass der emotionale Graben zwischen ihnen genauso tief war wie vor einem Jahr. Es war schwer zu glauben, dass sie einander jemals nahe gewesen waren.
Lindsay hatte sich immer besonders einsam gefühlt, wenn sie seine Nähe gesucht und er sie zurückgewiesen hatte. »Könntest du vielleicht wenigstens die Polizeiwagen wegfahren lassen?«, bat sie. »Das Frauenhaus kann wirklich nicht noch mehr schlechte Publicity brauchen.«
Er reagierte nicht.
Officer Bennett nahm Lindsay am Arm. »Ma’am, Sie müssen den Tatort jetzt verlassen.«
Sie riss sich los. »Ja, ja, schon gut, ich gehe schon.«
3
Montag, 7. Juli, 9:25 Uhr
In den letzten beiden Tagen war Detective Zack Kier einem mutmaßlichen Mord im Osten des County nachgegangen. Er hatte genügend Informationen gesammelt, um zu beweisen, dass es sich nicht um eine Tötung durch Fremdeinwirkung gehandelt, sondern dass die Frau Selbstmord begangen hatte. Eigentlich hatte er sich die nächsten drei Tage endlich einmal freinehmen wollen, doch dann hatte die Leitstelle einen Mord im Sanctuary-Frauenhaus gemeldet.
Er hatte den Fall, ohne zu zögern, übernommen, und ohne mit seinem Vorgesetzten Rücksprache zu halten. Wahrscheinlich würde ihn das am Ende teuer zu stehen kommen, würde er sich doch dem Vorwurf der Befangenheit aussetzen. Doch er hatte unbedingt selbst sehen wollen, ob mit Lindsay alles okay war.
Und kaum waren sie sich begegnet, hatte er sie auch schon wieder in Rage versetzt.
Es war noch nicht einmal zehn Uhr an diesem Vormittag, und Zack hatte nicht nur einen potenziellen Promimord, sondern auch noch Lindsay am Hals. Shit!
Zack beschloss, sich zunächst mit dem kleineren Übel zu befassen – dem Tatort.
Der zuständige Polizeibeamte hatte das Gebiet um die Leiche großzügig mit Polizeiband abgeriegelt und bis zu Zacks Eintreffen niemanden durchgelassen.
Nach monatelanger Dürre war der Boden knochentrocken – es würde also nicht schwierig sein, Fußabdrücke, DNA-Spuren, Waffen und alles andere sicherzustellen, was der Täter möglicherweise zurückgelassen hatte. Aber sie mussten sich beeilen, denn am Himmel ballten sich bereits dicke Regenwolken zusammen.
»Officer Watt«, sagte Zack zu dem älteren Polizisten, der hinter ihm stand. »Was haben wir bis jetzt?«
Watt war Mitte fünfzig und trug einen grauen Bürstenschnitt, der sein grimmiges Aussehen noch verstärkte. Er redete nicht viel, aber wenn er etwas sagte, hörten ihm die Detectives zu – jedenfalls, wenn sie klug waren. »Es gab einen Anruf von einer gewissen Ruby Dillon. Sie hat die Leiche kurz nach acht gefunden. Ms Dillon hatte die Nachtschicht. Am Morgen hat sie sich darum gekümmert, dass die vier zurzeit hier untergebrachten weiblichen Bewohner rechtzeitig zur Arbeit und die beiden männlichen Kinder in die Summerschool kamen. Als sie in den Garten ging, um den Müll wegzubringen, war sonst niemand mehr hier. Und da hat sie die Leiche entdeckt.«
Zack klopfte seine Hemdtasche nach Zigaretten ab, doch die Tasche war leer. Es war neun Monate her, dass er das Rauchen aufgegeben hatte, aber die Entzugserscheinungen plagten ihn immer noch. »Hat sie in der Nacht irgendwas gehört oder gesehen?«
»Nichts. Auch keine von den Bewohnerinnen hat ihr gegenüber etwas Ungewöhnliches erwähnt, ehe sie das Haus verließen. Es muss eine erstaunlich ruhige Nacht gewesen sein.«
Zack betrachtete die verschwollenen Züge des Leichnams. Er musste ihn nicht erst identifizieren lassen, um zu wissen, dass es sich um Strafverteidiger Harold Turner handelte.
Turner war bei der Polizei ebenso berühmt wie berüchtigt, weil er sich seine Mandanten gerne nach dem Gesichtspunkt aussuchte, welches Medieninteresse sie erzielten und wie lukrativ sie für ihn waren. Erst letzte Woche war in den Nachrichten über ihn berichtet worden, im Zusammenhang mit seinem Mandanten Ronnie T., einem Drogendealer, gegen den nach langem Hin und Her ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eröffnet worden war. Nachdem Turner nun tot war, stand Ronnie T.s Prozess möglicherweise wieder zur Disposition. Und das war keine gute Entwicklung, wie Zack fand. Er selbst war vor anderthalb Jahren unter den verdeckten Ermittlern gewesen, die Beweismaterial gegen den Drogenboss gesammelt hatten.
Zack stand auf und zog einen Block aus der Brusttasche, um sich Notizen zu machen: Harolds Kanzleipartner Quinton Barlow befragen, Turners Mandanten überprüfen, mit Mrs Turner reden.
Er ließ seine Augen links und rechts über die Nachbarhäuser wandern. Da sein Partner in Urlaub war, würde er wohl heute an ziemlich viele Türen klopfen müssen. »Weitere Zeugen?«
Officer Watt schüttelte den Kopf. »Noch nicht.«
Zack achtete darauf, nicht auf den blutverschmierten Rasen um den verstümmelten Arm der Leiche zu treten. Der Gestank nach verwesendem Fleisch drehte ihm beinahe den Magen um. Er war seit dreizehn Jahren bei der Polizei und konnte sich die grausigsten Dinge ansehen, doch dieser Gestank setzte ihm immer noch zu.
»Was ist mit dem Erkennungsdienst?«, erkundigte sich Zack bei Watt.
»Die wurden schon zweimal angerufen und dürften jeden Augenblick hier sein.«
»Je eher, desto besser. Uns bleibt hier nicht mehr viel Zeit, und ich will auf keinen Fall, dass uns durch Wetter, neugierige Cops oder Reporter Spuren durch die Lappen gehen.«
»Verstanden.«
Zack blickte zum Frauenhaus. »Stellen Sie außerdem sicher, dass Ms Dillon und Ms O’Neil das Haus nicht ohne mein Wissen verlassen. Ich will mit beiden noch reden.«
»Klar.«
Ms O’Neil. Lindsay.
Zack hatte seine Frau seit dem Termin beim Anwalt vor fast einem Jahr nicht mehr gesehen, als sie ihm die Scheidungspapiere vor die Nase geknallt hatte. Sie hatte den Rechtsanwalt an ihrer Stelle reden lassen und sich geweigert, seine Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen, mit dem Argument, dass er betrunken sei.
Tja, wozu sich etwas vormachen? Er war betrunken gewesen. Shit!
Bevor er Lindsay kennenlernte, hatte Zack bereits drei Jahre als verdeckter Ermittler bei der Drogenfahndung gearbeitet, und Drogen waren ein Teil dieser Welt. Er hatte zwar immer versucht, sich vom harten Stoff fernzuhalten, weil er wusste, dass die Mitarbeiter des Dezernats regelmäßig getestet wurden. Allerdings hatte er mit der Zeit angefangen, mehr und mehr zu trinken – in der festen Überzeugung, den Alkohol im Griff zu haben. Doch das war ein Trugschluss gewesen.
Als er Lindsay kennenlernte, reduzierte er das Trinken auf ein Minimum. Doch dann übernahm er zusätzliche Undercover-Jobs, und der Stress, sein Privatleben aus dem Drogenmilieu herauszuhalten, verschärfte sich zusammen mit seiner Sucht. Bald stieg er von Bier auf Whiskey um.
Lindsay fand sehr schnell heraus, was los war. Sie flehte ihn an, mit dem Trinken aufzuhören und zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen. Er versicherte ihr, dass es keine Probleme gebe, und er sah die Hoffnung in ihren Augen. Sie wollte ihm glauben, doch als er weiterhin keine Anstalten machte, trocken zu werden, setzte sie ihn vor die Tür. Er fühlte sich betrogen, und in seiner Wut tat er das Dümmste, was er machen konnte: Er ging mit einer anderen Frau ins Bett. Lindsay fand es heraus, und danach war nichts mehr zu kitten gewesen.
An dem Tag beim Anwalt war er stinksauer gewesen, weil sie keinen seiner Anrufe erwidert hatte. Er hatte ihr schreckliche Dinge an den Kopf geworfen, weil er sie so verletzen wollte, wie ihr Rauswurf ihn verletzt hatte. Und seine Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Mit Tränen in den Augen war sie aus der Kanzlei gestürmt.
Nach diesem Termin hätte Zack ihr am liebsten gesagt, dass er sich den Anonymen Alkoholikern anschließen würde. Aber er tat es nicht. Er trank immer weiter, bis sein Bruder Malcolm nach einem weiteren Monat drohte, ihn bei seinen Vorgesetzten anzuzeigen. Dann erst hatte Zack sich gefügt. Mit der Hilfe seiner Familie hatte er schließlich den Entzug geschafft.
Nachdem er drei Monate lang durchgehalten hatte, war ihm klar geworden, dass er das Drogendezernat verlassen musste. Und so hatte er beschlossen, den Kreis seiner Verbrecherklientel zu erweitern, und sich um eine Stelle bei der Mordkommission beworben, die er nun seit acht Monaten innehatte.
Zack hatte Lindsay immer anrufen wollen, um sich für alles zu entschuldigen. Doch er hatte Angst gehabt, dass sie ihn zurückweisen würde, und er hatte seiner neuen Nüchternheit in den ersten Wochen noch nicht recht getraut. Tage wurden zu Wochen, Wochen zu Monaten, er wurde stärker und lernte immer besser, die Sucht zu kontrollieren, die er nie wieder richtig loswerden würde. Jetzt war fast ein Jahr vergangen seit dem Termin beim Anwalt – und sie standen sich als Fremde gegenüber, Fremde mit Trauschein.
Er war nicht sicher, was er sich von einer Begegnung mit Lindsay erwartete, klar war nur, dass es nicht einfach werden würde – nichts mit ihr war jemals einfach gewesen. Mitten in einen Tatort hineinzuplatzen war typisch für Lindsay.
Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass sie so blass und abgemagert aussah und dass es mit ihrer Selbstsicherheit auch nicht weit her war.
Das letzte Jahr musste auch für sie schwer gewesen sein.
Zacks Kopf pochte. Er atmete tief durch und verdrängte seine Gewissensbisse. Schließlich hatte er hier einen Job zu erledigen.
Als er Gummihandschuhe schnalzen hörte, drehte sich Zack um und sah Sara Martin vor sich, die Kollegin vom Erkennungsdienst. Groß, schlank, Anfang dreißig, trug sie ihr langes kastanienbraunes Haar in einem strengen Pferdeschwanz im Nacken. Sie hatte sich einen leuchtend blauen Papieroverall über ihre Kleidung und Stulpen über ihre Schuhe gezogen. In den drei Jahren, die er sie kannte, war sie immer wie aus dem Ei gepellt und in jeder Situation ruhig und gefasst gewesen.
»Tut mir leid, dass ich so spät bin.« Saras süßes Parfum schwebte über dem durchdringenden Rostgeruch des Blutes. »Als mein Piepser loslegte, stand ich noch unter der Dusche. Wen haben wir da?«
»Harold Turner.«
Sie wirkte nicht sehr überrascht. »Ein Wunder, dass er überhaupt so lange gelebt hat, so viele Feinde, wie er hatte.« Eine Digitalkamera baumelte von ihrem Hals, die sie jetzt einschaltete. »Puh, seine linke Hand ist weg«, sagte sie und knipste los.
Zack nickte nur.
»Was kannst du mir zum Tathergang sagen?«, fragte Sara.
»Ich bin selbst gerade erst gekommen. Aber so, wie es aussieht, wurde Turner aus kurzer Entfernung in die Brust geschossen, und die linke Hand wurde ihm abgetrennt. In welcher Reihenfolge, weiß ich nicht. Das sollte die Pathologie aber herausfinden.«
Sara nickte und senkte die Kamera. »Die Blutspritzer deuten darauf hin, dass er genau dort erschossen wurde, wo er liegt. Die Kugel in die Brust dürfte tödlich gewesen sein.«
Sie ging in die Hocke und betrachtete die Leiche. »Auf den ersten Blick keine Kratzer, keine Blutergüsse, kein Hinweis auf ein Trauma. Wenn der Täter zuerst die Hand abgeschnitten hätte, hätten wir von allem etwas.«
»Turner kam von der Straße und war alles andere als vertrauensselig. Es sieht aber so aus, als wäre er aus freiem Willen mit dem Täter hierhergekommen. Sein Wagen steht nirgends in der Nähe.«
Das schien sie in Erstaunen zu versetzen. »Er ist mit seinem Mörder hierhergekommen?«
»Ich denke schon. Aber dann bleiben immer noch etwa eine Million potenzielle Verdächtige«, erwiderte Zack.
»Was könnte ihn bewogen haben, in das Auto seines Mörders zu steigen?«
»Schau dir seinen linken Arm an!«
Sie runzelte die Stirn. »Einstichspuren. Du meinst, es hatte was mit Drogen zu tun?«
Zack kannte die Macht der Sucht. »Würde mich nicht wundern.«
Sara fuhr fort zu fotografieren. »Bei der Menge Blut wäre es ein Wunder, wenn der Täter nicht etwas davon an den Schuhen hätte. Ich werde mich nach Fußspuren umsehen.« Sara blickte zum Himmel hoch und richtete dann mit gerunzelter Stirn ihr Objektiv auf Turners Hand. »Irgendein Hinweis auf den Verbleib der Hand?«
»Noch nicht. Ich habe ein paar Beamte in den Garten geschickt, um danach zu suchen.«
»Warum hat der Täter die Hand mitgenommen? Als eine Art Trophäe?«
»Schon möglich.«
Sie ließ den Blick über die benachbarten Häuser schweifen. »Ich schätze, er hat einen Schalldämpfer verwendet. Und die Schmauchspuren werden verraten, aus welcher Entfernung er geschossen hat.«
»Sieh zu, dass du rasch fertig wirst. Das Wetter wird nicht mehr lange halten.«
Sara nickte. »In den Morgennachrichten hieß es, dass am späteren Vormittag mit Gewitterstürmen von Westen zu rechnen ist.«
Das war gar nicht gut. Ein Tatort wie dieser konnte Tage in Anspruch nehmen. So, wie es aussah, blieben ihnen aber nur wenige Stunden.
»Ich überlass dich deiner Arbeit, Sara. Schon mal vielen Dank!« Zack machte einen Schritt zurück. Sein Rücken verspannte sich zunehmend. Ein Bier, das wäre jetzt das Richtige. Aber das kam überhaupt nicht infrage. Er würde sich stattdessen wohl mit einem langen Lauf am Fluss entlang begnügen müssen.
»Zack?«
»Ja?«
Sara warf mit einem eleganten Ruck ihres Kopfes die Ponyfransen aus dem Gesicht und strahlte ihn an. »Ich gebe dieses Wochenende eine Party, um meine Beförderung zu feiern. Hast du Lust zu kommen?«
In den letzten Monaten hatte Sara ihn immer wieder gefragt, ob er mit ihr ausgehen wolle. Es war ein Jahr her, da hatte er den Fehler gemacht, mit ihr zu schlafen. Seither hatte er sich darum bemüht, ihr Verhältnis auf das Berufliche zu beschränken und private Treffen mit ihr zu vermeiden. Er konnte nicht sagen, warum, aber er hatte das Gefühl, dass er Lindsay Treue schuldete, solange die Scheidungspapiere nicht unterzeichnet waren. »Danke, Sara, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe.«
Sie verbarg ihre Enttäuschung nicht. »Sicher, dass du nicht kommen kannst? Die Kollegen vom Präsidium werden alle da sein. Das wird bestimmt ein super Abend.«
»Tut mir leid, aber ich muss passen, Sara.« Er lächelte sie matt an und trat einen Schritt zurück.
Sara nickte bedächtig und sah zum Haus hinüber. »Wenn du Lindsay siehst, grüß sie von mir!«
4
Montag, 7. Juli, 9:45 Uhr
Lindsay lehnte sich über die Spüle und beobachtete den Tatort durch das Fenster. Zack hatte den abgesperrten Bereich auf den ganzen Garten erweitert, wahrscheinlich für die nächsten Tage oder gar Monate. Gründlich war er, das musste man ihm lassen.
Nachdem sie mit ihm gesprochen hatte, war ihr klar gewesen, dass sie die Anonymität des Frauenhauses nicht würde wahren können. Er würde sich bei seinen Ermittlungen nicht im Mindesten beschränken lassen. Sie musste Ruby bitten, in anderen Frauenhäusern nach Plätzen für ihre Bewohnerinnen und deren Kinder zu fragen.
Lindsay beobachtete, wie sich die Frau vom Erkennungsdienst kokett den Pony aus dem Gesicht warf und sich mit leichtem, aber eindeutigem Lächeln etwas näher zu Zack beugte. Hundert Dollar darauf, dass die Tussi Parfum trug.
In Lindsays Bauch meldete sich der vertraute brennende Klumpen. War das die Frau, mit der Zack geschlafen hatte, in der Nacht, als sie ihn vor die Tür gesetzt hatte? Schmerzliche Erinnerungen machten ihr das Herz schwer, und sie wandte sich vom Fenster ab. Es dauerte einen Augenblick, ehe sie wieder frei atmen konnte.
Lindsay ballte ihre Hände zu Fäusten. Soll er doch ins Bett gehen, mit wem er will, dachte sie trotzig.
Telefonklingeln riss sie aus ihren Grübeleien. An dem Apparat an der Küchenwand blinkten alle drei Leitungen gleichzeitig.
Lindsay schob die Kassettentür zum Besprechungsraum auf. Ruby saß an einem kleinen Schreibtisch, ein Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt. »Leitung zwei«, gab sie ihr lautlos zu verstehen.
»Okay.« Lindsay drückte den entsprechenden Knopf am Küchentelefon. »Sanctuary-Frauenhaus, hallo?«
»Lindsay?«
Es war Dr. Sam Begley, Leiter der Notfallambulanz des Mercy Hospital. Schlagartig entspannten sich ihre Schultern. Sie hatte ihn vor sechs Monaten kennengelernt, als sie dort vor den Krankenhausmitarbeitern einen Vortrag über häusliche Gewalt gehalten hatte.
»Sam! Was gibt’s?« Sie lehnte sich an die Spüle, mit dem Rücken zum Fenster.
»Du solltest herkommen«, erwiderte er in ernstem Ton. »Ich habe hier eine Frau, die schwer misshandelt wurde. Ihre Erklärungen sind widersprüchlich. Ich denke, es war ihr Mann.«
Sofort spürte sie, wie der Drang zu helfen in ihr aufstieg. »Wie schwer sind die Verletzungen?«
»Gebrochene Rippen, Hämatome an den Armen, Handgelenke gestaucht.«
Lindsay rieb sich mit den Fingerspitzen die Schläfe. Hinter ihren Augen begann es zu pulsieren. »Hat sie erklärt, wie es passiert ist?«
»Nun, sie hat etwas von einem Unfall erzählt. Aber Tatsache ist, sie zeigt alle Symptome, die du als typisch für häusliche Gewalt beschrieben hast. Und sie hat keine Spuren im Gesicht. Wer auch immer das war, er wollte nicht, dass man sieht, dass sie verprügelt wurde.«
»Wie hat sie erklärt, was passiert ist?«
»Sie hat gesagt, sie sei eine Treppe heruntergefallen. Ich hatte gehofft, dass das Sanctuary vielleicht ein Bett für sie hat.«
Lindsay drehte sich zum Fenster um und sah auf den Haufen Polizisten, der ihren Garten bevölkerte. »In den nächsten Tagen geht bei uns leider gar nichts. Aber ich könnte mit ihr reden und einen anderen Platz für sie finden.«
Er seufzte in den Hörer. »Gut. Sie braucht auf jeden Fall jemanden, der ihr gut zuredet.«
»Du klingst müde. Hast du wieder mal eine Achtzehnstundenschicht hinter dir?«
Er grinste. »Du weißt ja: Kein Friede den Gottlosen.«
Lindsay bewunderte Sam. Niemand konnte so hart arbeiten wie er. Sie sah auf die Uhr. Es war allerdings besser, wenn sie erst noch mit Zack redete. »Ich brauche hier noch etwa eine Stunde. Kannst du sie so lange aufhalten?«
»Sie ist über achtzehn und darf jederzeit rausspazieren.« Er senkte seine Stimme. »Aber du weißt ja, wie lange sich das hier manchmal mit dem Papierkram hinzieht. Es könnte locker noch eine Stunde dauern, bis sie entlassen wird.«
Lindsay musste unwillkürlich lächeln. Mit Sam war das Leben so einfach. »Ich komme, sobald ich kann.«
»Gut.«
»Du bist einer von den Guten, Dr. Sam Begley.« Sie stellte sich vor, wie er errötete.
»Du bist diejenige von uns beiden, die die echte Arbeit macht.« Er zögerte. »Ich fand’s schön letzte Woche im Kino. Wir sollten das gelegentlich wiederholen.«
»Gute Idee.« Sie hatte sich bei ihrem kleinen Ausflug nichts weiter gedacht – bis Sam sie geküsst hatte. In jenem unbehaglichen Moment war ihr erst richtig klar geworden, dass sie seit Zack mit keinem anderen Mann ausgegangen war.
»Wie wär’s mit heute Abend?«, schob er rasch nach. »Ich spendier dir ein Stück Geburtstagskuchen.«
Dass sie in zwei Tagen Geburtstag hatte, hätte sie fast vergessen. Gut, dass wenigstens andere daran dachten.
»Ich muss arbeiten.« Sie war dankbar, dass sie sich keine Ausrede einfallen lassen musste. »Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – wie wär’s nächste Woche? Und bitte Karottenkuchen.«
Er lachte. »Wird gemacht.«
Sie blickte auf ihre Telefonanlage, wo zwei weitere Lämpchen blinkten. »Hör zu, es kommen gerade noch ein paar Anrufe rein. Hier ist heute die Hölle los.«
»Alles in Ordnung?«
»Eine lange Geschichte. Erzähl ich dir, wenn wir uns sehen.«
»Kein Problem. Dann bis in einer Stunde.«
»Danke!« Lindsay hängte ein und fing Rubys Blick auf.
Ruby legte ihre Hand auf die Hörmuschel. »Leitung drei. Dana Miller.«
Lindsays Magen zog sich zusammen. »Danke!«
Als Vorstandsvorsitzende des Sanctuary-Frauenhauses war Dana ihre Chefin. Ob sie schon von dem Mord gehört hatte, oder ging es um die verpasste Telefonkonferenz? Weder das eine noch das andere war ein angenehmes Thema.
Sie drückte den Knopf. »Hallo, Dana!«
»Was ist los da drüben?«, legte Dana los. »Erst verpassen Sie unser Meeting, und dann ruft mich die Leiterin vom Riverside-Frauenhaus an, um mir zu erzählen, dass Ruby Plätze für Frauen von uns sucht.«
Lindsay seufzte. Bei Dana um den heißen Brei herumzureden hatte keinen Sinn. »Bei uns im Garten ist eine Leiche gefunden worden.«
»Was?!«
»Keine von unseren Frauen«, beeilte sie sich anzufügen.
»Wer um alles in der Welt ist es?«
»Ich weiß nicht. Die Polizei hält sich bedeckt.«
»Verdammt noch mal, Lindsay! Das ist gar nicht gut.«
Lindsay stellte sich vor, wie Dana in ihrem Hochhausbüro saß, in ihrem edlen roten Business-Hosenanzug, vor sich auf dem Schreibtisch eine halb volle Tasse Kaffee und eine Zigarette im Kristallaschenbecher. Dana hatte mit Immobilien Millionen verdient und außerdem einen Ruf als echte Amazone, die keinerlei Verständnis für Gefühlsduselei hatte. Lindsay hatte nie herausgefunden, wie sie darauf gekommen war, sich für misshandelte Frauen einzusetzen.
»Ich weiß, dass das Opfer männlich ist. Sobald ich mehr weiß, melde ich mich wieder«, schlug Lindsay vor.
»Weiß man, wie der Typ umgekommen ist?«
»Nein.«
Dana stieß einen lauten Seufzer aus. »Schlechte Presse können wir uns nicht leisten, Lindsay. Nicht nach dem, was mit dieser anderen Frau passiert ist.«
»Pam Rogers.« Dana mochte den Namen der Frau vergessen haben. Lindsay würde ihn niemals vergessen.
Dana pustete eine Lunge voll Rauch in den Hörer. »Regeln Sie das, Lindsay. Ich habe keine Lust, das Frauenhaus in den Medien verteidigen zu müssen. Das wäre für uns beide nicht gut, nicht für Sie, nicht für mich.«
»Wird gemacht.«
Damit war die Leitung tot.
Regeln Sie das!
Ruby steckte ihren Kopf durch die Küchentür. Ganz offensichtlich hatte sie das Telefonat mit angehört. »Das tut mir leid. Ich wollte Riverside unbedingt als Erstes anrufen. Wenn wir Aisha Greenland dort unterbringen könnten, müssten ihre Jungs nicht die Schule wechseln.«
»Das Wohl der Kinder ist auf jeden Fall wichtiger als die Politik. Du hast absolut richtig gehandelt. Haben sie denn dort Plätze frei?«
»Ja. Ich habe außerdem bei Michelle Franklin drüben in Haydon House angerufen.« Das Frauenhaus lag am östlichen Rand des County. »Die haben zwei Plätze.«
»Im Augenblick haben wir sechs Frauen hier.« Lindsay ging im Geiste die Liste der Bewohnerinnen durch. »Greenland geht nach Riverside. Tracy und Cindy nach Haydon House. Und ruf Yand an, ob die einen Platz für Barbara haben.«
»Ich kümmere mich darum.«
»Ich werde die Frauen auf der Arbeit anrufen und ihnen sagen, was los ist. Sie dürfen das auf keinen Fall aus dem Fernsehen erfahren.«
Ruby schüttelte den Kopf. »Was für ein Desaster!«
»Allerdings.«
Lindsay rief die Frauen eine nach der anderen an und bemühte sich nach Kräften, die Situation herunterzuspielen. Sie versprach, ihre Habseligkeiten an die neue Adresse bringen zu lassen, sodass sie nicht mehr zum Sanctuary zurückmüssten. Ruby würde die Greenland-Jungs von der Schule abholen und direkt mit ihnen zum Riverside fahren.
Als Lindsay auflegte, pochte ihr Kopf heftig. Eine Dosis Koffein musste her.
Sie wusch die Glaskanne mit dem abgestandenen Kaffee in der Spüle aus und füllte sie mit Leitungswasser, das sie in das Reservoir der Kaffeemaschine goss. Sie ersetzte den gebrauchten Filter durch einen neuen mit frischem Pulver und drückte den Schalter.
In dem Moment bewegte sich etwas in ihrem Augenwinkel. Sie drehte sich um und sah Zack durch die Eingangstür treten, ein Handy am Ohr. Er hatte seine Krawatte gelockert. Dichte Stoppeln bedeckten sein Kinn, und er sah aus, als hätte er die Nacht durchgemacht. An seiner Hüfte baumelte seine Waffe.
Er sprach in sein Handy. »Ayden, Sie und Warwick müssen sich das ansehen.« Kurze Pause. »Na ja, dann sagen Sie ihm eben, dass sein Urlaub jetzt vorbei ist.«
Zacks tiefe Stimme wand sich in Lindsays Gehörgänge und bürstete über ihre ohnehin gereizten Nerven. Allein seine Nähe machte sie nervös.
Er hatte ein markantes Profil. Das kurze Haar stand ihm gut. Er sah richtig gut aus, fand Lindsay. Unerwartetes Verlangen meldete sich in ihr. Im Grunde wollte sie Zack immer noch, wahrscheinlich würde sich das auch nie ändern. Verdammt, ihre launische Libido war das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte!
»Ich muss erst noch mit der Leiterin reden«, fügte er hinzu.
In dem unvermittelten Drang, etwas zu tun, wandte sie sich der fauchenden Kaffeemaschine zu und zog die halb volle Kanne heraus. Heißer Kaffee tropfte zischend auf die Warmhalteplatte, während sie sich rasch eine Tasse einschenkte. Als sie die Kanne zurückstellte, lief Kaffee über den Rand der Platte.
Sie nahm eine Handvoll Papiertücher und wischte die Sauerei auf. »So ein Mist!«, schimpfte sie leise.
Hinter ihr erklangen Schritte. »Geduld war noch nie deine Stärke«, sagte Zack.
Lindsay ignorierte die Anspielung und verkniff sich eine bissige Antwort. »Nein, das wohl nicht.« Sei nett, beschwor sie sich, drehte sich um und hielt ihm die Tasse entgegen. »Auch einen?«
»Das wäre toll.«
Sie füllte einen Styroporbecher mit heißem Kaffee und reichte ihn Zack, der sich höflich bedankte. Was war das nur plötzlich für eine aufgesetzte Artigkeit in ihrem Umgang? Früher war ihre Beziehung zügellos und laut gewesen, heftig und wild wie ein Gewittersturm, ganz gleich, ob sie gestritten, gelacht oder sich geliebt hatten. Lindsay war auf diese leidenschaftliche Intensität immer stolz gewesen. Leider hatte ebendiese Leidenschaftlichkeit sie beide am Ende auseinandergetrieben.
Lindsay nickte in Richtung ihrer Tür. »Gehen wir in mein Büro.«
Zunehmend nervös ging sie an ihm vorbei durch den Flur auf ihr Arbeitszimmer zu. Wie die meisten Räume im Haus diente auch ihr Büro mehr als einem Zweck. Die Krankenschwester vom Gesundheitsamt nutzte den Raum, wenn sie vorbeikam, Bewohnerinnen empfingen hier private Besucher, und die Sachspenden wurden hier deponiert, ehe sie sortiert und verteilt wurden.
Auf dem Schreibtisch stapelten sich Berge von Unterlagen, doch Lindsay hatte ihr Chaos im Griff und fand jederzeit sofort, was sie suchte.
Sie wuchtete einen Sack mit Kleiderspenden von einem Stuhl und stellte ihn hinter dem Schreibtisch ab. Mit einer Handbewegung bedeutete sie Zack, sich zu setzen, während sie auf ihrem Drehstuhl Platz nahm. Hinter dem Tisch fühlte sie sich wieder sicher.
Zack nahm Platz und klappte sein Notizbuch auf.
»Sagst du mir jetzt, wer der Ermordete ist?«
Ohne Eile trank Zack einen Schluck von seinem Kaffee und stellte dann den Becher an den Rand des Schreibtischs. Sein Blick war durchdringend. »Gab es in letzter Zeit irgendwelche Probleme hier im Frauenhaus?«