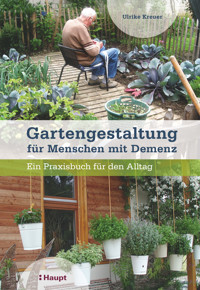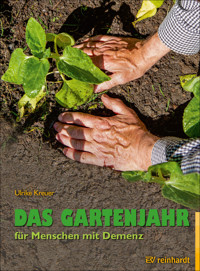
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Reinhardts Gerontologische Reihe
- Sprache: Deutsch
Fußstapfen im Schnee, zarte Knospen im Frühjahr und der Duft frisch gezupfter Kräuter von der Küchenbank. All das kann wertvolle Erinnerungen bei Menschen mit Demenz wachrufen und eine kostbare Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart bauen. Die meisten an Demenz erkrankten Menschen werden zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt und betreut. Eine anspruchsvolle und oft kräftezehrende Aufgabe. Beiden Seiten tut es daher gut, in kreative, unbeschwerte Aktivitäten rund um das Thema Garten einzutauchen, denn: Der Garten ist für viele Erkrankte ein Ort mit positiven Erinnerungen. Die Monate bilden das Grundgerüst des Buchs und führen durch die Jahreszeiten des Gartenjahrs. Angehörige oder BetreuerInnen können aus einer Fülle an kleinen und großen Gartenideen wählen. Die gesundheitsfördernden Wirkungen sind klar benannt - ein wichtiger Aspekt für Fachpflegekräfte und BetreuerInnen in Pflegeeinrichtungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Reinhardts Gerontologische ReiheBand 63
Ulrike Kreuer
Das Gartenjahr für Menschen mit Demenz
Für draußen und drinnen
Mit 45 farbigen Abbildungen
Ernst Reinhardt Verlag München
Ulrike Kreuer ist langjährig erfahrene Gartenbauingenieurin und Gartentherapeutin nach der Internationalen Gesellschaft für Gartentherapie (IGGT). Seit 2003 gestaltet sie Gärten für Menschen mit Demenz und bietet vor Ort passende Angebote zur Aktivierung an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-03095-8 (Print)
ISBN 978-3-497-61555-1 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61556-8 (EPUB)
© 2022 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und straf bar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S.v. § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Hinweis
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Printed in EU
Covermotiv: ©istock.com/Riley Shot
Satz: FELSBERG Satz & Layout, Göttingen
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Einführung
Januar
Gemeinsam in die Natur eintauchen
Auf Spurensuche
Taktgeber Tageslicht
Altbekannte Pflanzennamen
Vom Werden und Vergehen
Mein Freund, der Baum
Geschichten erzählen
Eisblumen
Klirrend kalte Tage
Den Bäumen helfen
Februar
Feste, Bräuche, Traditionen
Kleine Knospen, große Wirkung
Nichts geht über Vorratshaltung
Gelb ist die Farbe des Lichts
Bewegliche Finger, bewegliche Gedanken
Mit den Amseln in der Sonne sitzen
März
Krokusse locken nach draußen
Einen Blick in den Himmel werfen
Die Bäume glucksen hören
Im Märzen der Bauer
Pferde hautnah
Du bist, was du isst
Die ersten Arbeiten im Garten
Gärtnern leicht gemacht
April
Der April, der macht, was er will
Der Frühjahrsmüdigkeit trotzen
Frühjahrsputz für die Seele
Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln
Augenschmaus am Wegesrand
Alles beginnt mit einem Samenkorn
Ein Zuhause für die Wildbienen
Frohe Ostern
Mai
Der Mai ist gekommen
Tanzend in den Mai
Die Natur hat viel zu bieten
Den Gartenvögeln helfen
Ehret die Mütter
Bohnen wachsen in den Himmel
Die kalte Sophie kann noch kommen
Juni
Der erste Duft nach Sommer
Den Schafen wird es zu kalt
Die Königin hat ihren Auftritt
Kartoffelkäfer sammeln
Wir fahren ins Heu
Lindenblütentee kennen alle
Erdbeeren mögen keinen Regen
Die Schnecken kommen
Der längste Tag
Siebenschläfertag
Juli
Wenn der Klatschmohn blüht
Es riecht nach Regen
Kleine Lichter fliegen durch die Nacht
Vom Korn zum Brot
Der Juli gehört dem Getreide
Die Ernte ist das Allerschönste
Lavendel, Rosmarin und Co.
Hundstage
Kartoffeln anhäufeln
August
Die Früchte der Saison
Blumen soweit das Auge reicht
Gießen, gießen und nochmals gießen
Gartenarbeit für zwischendurch
Raus aus den Schuhen
Kräuter geben die richtige Würze
Es juckt und zwickt
Erdbeeren für das kommende Jahr
September
Pflaumenzeit
Immer Richtung Süden
Reif für die Ernte
Die Natur kündigt ihren Rückzug an
Den Garten in den Herbst schicken
In die Pilze gehen
Thymian und Co.
Wein ist ein Genuss
Rasen muss sein
Zuckerrüben
Oktober
Bunt sind schon die Wälder
Äpfel mögen wir am liebsten
Dem Herbstwind trotzen
Tulpen gehören in jeden Garten
Vitamine aussäen
Bienen zittern gegen die Kälte
Überall Kürbis
Tomaten für alle
Trockenbohnen für den Winter
November
Wenn das Licht fehlt
Der Frost kommt
Gärtnern auf der Fensterbank
Die Blätter fallen
Von Löwenzahn und falschem Kaffee
Spaten, Schaufel, Hacke und Co.
Auch Pflanzen wird es manchmal kalt
Vögel füttern alle gern
Saatgut für das nächste Jahr
Fische in der Winterstarre
Dezember
Da blüht noch was
Traditionen und Bräuche
Die Fichte sticht, die Tanne nicht
Zeit des Bastelns
Rosen mögen alle
Wühlmäuse ade
Weiße Weihnacht
365 Tage sind geschafft
Literaturverzeichnis
Sachregister
Einführung
Aktuell sind in Deutschland ca. 1,7 Millionen Menschen an Demenz erkrankt und täglich erkranken 900 Menschen neu. Zwei Drittel der an Demenz erkrankten Menschen werden zu Hause von Angehörigen oder Freund*innen gepflegt und betreut. Für die pflegenden Familien heißt das, sie sind rund um die Uhr gefordert, die alltäglichen Herausforderungen zu meistern, die diese Krankheit mit sich bringt. Gleiches gilt für die Mitarbeitenden aus Pflege und Betreuung, die ununterbrochen Sorge dafür tragen, dass pflegebedürftige Menschen ein Leben entsprechend ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten leben können – trotz der Folgen einer Demenz.
Der Garten in seinem natürlichen Rhythmus kann sie dabei unterstützen. Er hat für jeden Tag eine sinnstiftende Erfahrung und gesundheitsfördernde Betätigung anzubieten, die Menschen mit Demenz in ihrem Wohlbefinden stärkt und Lebenserinnerungen aufleben lässt. Nichts ist einfacher als sich dabei an den Jahreszeiten zu orientieren. Januar, Februar, März, … alle zwölf Monate sind uns in ihrer Unterschiedlichkeit von Kindesbeinen an wohl vertraut. Sie sind das Ordnungssystem, mit dem wir groß geworden sind und das uns ein Leben lang begleitet. Das gilt auch für Menschen mit Demenz. Jeder Monat präsentiert sich in einem anderen Gewand, die Düfte und Geräusche verändern sich und auch die Tätigkeiten im Garten sind auf die Monate abgestimmt. Genießen Sie auch die besondere Stille des Januars und haben im März den Duft des Frühlings in der Nase? Für Menschen mit Demenz sind die zwölf Monate ein Ordnungssystem, in dem sie nicht verloren gehen, denn die Natur vermag es stets, wertvolle Erinnerungen wachzurufen und eine kostbare Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu bauen.
In diesem Buch werden die jahreszeitlichen Veränderungen in der Natur und im Garten anschaulich beschrieben und Monat für Monat können Angehörige und Betreuer*innen aus einer Fülle an kleinen und großen Gartenideen wählen, die ohne Vorkenntnisse leicht umgesetzt werden können. Zudem beschreibt es kreativ und unbeschwert einen Weg, in das Thema Garten einzutauchen, und benennt klar die gesundheitsfördernden Wirkungen der jeweiligen Gartenidee.
Ein Buch, das beiden Seiten gut tut, den Betreuenden und den Pflegebedürftigen, denn: Der Garten ist für alle ein Ort zum Wohlfühlen.
Januar
Gemeinsam in die Natur eintauchen
Der Januar ist für viele Menschen der friedlichste Monat, nicht nur weil die Arbeit der Gärtnerin ruht, sondern weil auch in den Seniorenheimen nach dem Weihnachtsfest und dem lauten Jahreswechsel Ruhe einkehrt. Lediglich ein Fest hat der Wintermonat noch zu bieten: das Dreikönigsfest am 6. Januar. In vielen katholischen Seniorenheimen werden die Sternsinger begrüßt und die Buchstaben C–M–B bleiben als Zeichen an den Türen zurück. Dann wird es wieder still.
Gemeinsam Stille zu erfahren, ohne sie als Sprachlosigkeit zu erleben, ist etwas Besonderes. Da saß zum Beispiel ein alter Herr am Fenster seines Zimmers und lauschte der Stille, die sich draußen über den Garten gelegt hatte. Er lebte schon seit einigen Jahren im Seniorenheim und ist dort eingezogen, weil seine Frau ihn zu Hause nicht mehr versorgen konnte. Sie kam ihn jeden Tag besuchen und zusammen saßen sie schweigend im Garten. Dicht an dicht, im vertrauten Duft des anderen schienen sie gemeinsam durch das Blütenmeer zu tauchen. Als seine Frau plötzlich verstarb, wollte er vom Garten nichts mehr wissen. Das änderte sich durch einen Zufall, denn als der erste Schnee fiel, wollte ich von seinem Zimmer aus Fotos vom schneebedeckten Garten machen. Sein Zimmer bot dazu die beste Aussicht und an einem wunderbaren Wintertag, die Sonne glitzerte im Schnee und die Sträucher trugen weiße Mützen, saß er mit dabei, schaute ebenfalls aus dem Fenster und es schien, als würde er durch die Winterlandschaft tauchen. Und plötzlich war sie wieder da, die gemeinsame Stille, Seite an Seite.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Beziehungen und Begegnung
Es sind oft die kleinen Begegnungen, die eine Möglichkeit bieten, um gemeinsam für ein paar Minuten in Stille zu sein. Einige Minuten nebeneinander auf einer Bank im Garten sitzen oder gemütlichen Schrittes durch den Garten gehen und in die Natur eintauchen, sie betrachten, ihr lauschen, sie erschnuppern und auf der Zunge zergehen lassen. Mehr braucht es nicht, um Natur gemeinsam zu erleben.
Zeitbedarf: 10 bis 20 Minuten
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –HINTERGRUND –
Gemeinsam zu schweigen ermöglicht es, einen anderen Weg der Kommunikation zu finden. Studien zeigen, dass die Fähigkeit, auf nonverbale Signale zu reagieren, bis in die schwere Demenz hinein, ja, sogar bis in die Sterbephase, wenigstens in Grundzügen erhalten zu bleiben scheint. Und dass sogar die Wahrnehmungsfähigkeit, also die Sensibilität für körpersprachliche Signale anderer, zunimmt(Hoffman / Platt 2016).
Auf Spurensuche
Es ist ein frostiger Januartag. Der Winter hat sich tief in die Natur eingenistet und der Frost klammert sich an jedes Blatt. Draußen im Garten steht eine alte Dame und betrachtet jeden noch so kleinen Grashalm, der leise in der Kälte zittert. Sie hat ihre Mütze tief ins Gesicht gezogen und steht still, lauscht. Vielleicht kann sie die Äste jauchzen hören, wenn sie mit ihren schweren Schneeauflagen auf und nieder tanzen. Oder sie liebt, wie so viele Menschen es tun, das Knirschen des Schnees unter den Füßen. Die ersten Schneeflocken im Winter wecken bei jedem Menschen, egal welchen Alters, eine kindliche Freude, das gilt auch für Menschen mit Demenz. Gerade in städtischen Regionen ist es inzwischen etwas Besonderes, wenn der Schnee liegen bleibt. An einem dieser schneereichen Tage „ging“ ein Bewohner im Neuschnee auf Spurensuche, obwohl er nicht wirklich nach draußen gehen konnte. Für ihn wurde ein Stuhl vor das große Fenster im Gemeinschaftsraum gestellt, sodass er die Terrasse gut überblicken konnte. Nun war Spurenlesen gefragt: „Karnickel, Vögel, Igel, Marder oder Füchse hinterlassen alle ihre Fährten und Spuren“, weiß der alte Herr zu berichten.
Gewiss gibt es in jedem Seniorenheim „Expert*innen“ für Tierspuren und wir brauchen lediglich dieses Wissen kreativ zu fördern und die Fantasie anzuregen, identitätsstiftend ist es allemal.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Erinnerungen und Biografie
Am schönsten ist das Spurenlesen, wenn der Schnee frisch gefallen ist und die Tiere die Ersten sind, die ihre Spuren hinterlassen. Während eines Spaziergangs oder vom Fenster aus kann in der Gruppe oder alleine nach den Spuren Ausschau gehalten werden. Die Abdrücke können zum Gespräch oder Erzählen einladen: Wer hat Spuren gefunden? Welche Tiere könnten es sein, die ihre Spuren hinterlassen haben? Vögel, Mäuse oder eine Katze? Vielleicht ist ein Fuchs dabei? Ob die Tiere es eilig hatten? Ob sie nur durch den Garten gelaufen sind oder waren sie auf Futtersuche? Tierspuren erzählen immer eine Geschichte. Vielleicht möchten eigene Spuren und Fußabdrücke hinterlassen werden? Oder Spuren von verschiedenen Tieren in den Schnee oder auf Papier gemalt werden – wie beispielsweise von Eichhörnchen oder Mäusen – und gemeinsam bestimmt oder erraten? Wenn es keinen Schnee gibt, können auch Fotos oder Abbildungen von Abdrücken zum Fährtenlesen animieren. Tierspuren gibt es übrigens auch in feuchter Erde zu entdecken. Und für alle, die sich mit Fährtenlesen nicht auskennen: Es gibt eine Fülle an guten Büchern über Tierspuren im Schnee.
Zeitbedarf: 10 bis 45 Minuten
Abb. 1: Tierspuren im Schnee. Quelle: Pitsch / pixabay
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –HINTERGRUND –
Bei Demenz lässt das Gefühl von Identität, das darauf beruht, eine Lebensgeschichte zu erzählen zu haben, unter Umständen allmählich nach. Hier gewinnt biografisches Wissen über eine Person entscheidende Bedeutung, wenn die Identität gehalten werden soll. Die Art, in der jeder Mensch seine Identität konstruiert, ist einzigartig und je mehr Details über seine Lebensgeschichte bekannt sind, desto besser kann man angesichts kognitiver Beeinträchtigungen auf ihn eingehen. Selbst wenn Senior*innen nicht mehr selbst in der Lage sind, an ihrer narrativen Identität festzuhalten, so können dies immer noch andere für sie tun (Kitwood 2008).
Taktgeber Tageslicht
„Im Januar ist es immer frostig, da kommt der Winter knackig kalt daher, so war es immer schon.“ Ähnliches erzählen alte Menschen oft. Auch wenn wir heutzutage im Januar nicht immer und überall mit tiefem Frost zu tun haben, auf eins ist in jedem Fall Verlass: Die Hälfte der dunklen Jahreszeit liegt hinter uns. Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Von nun an mit es wieder zu mit dem Licht und die Tage werden länger. Für viele ist es eine beruhigende Nachricht, wenn sie hören, dass die dunkle Jahreszeit bald vorüber ist. Man kann es gar nicht oft genug sagen: Es wird langsam wieder heller!
Immerhin gibt es Ende Januar in den nördlichen Breiten zirka eine Stunde mehr Tageslicht als zu Beginn des Monats. So wird Anfang Januar beispielsweise ein gemeinsamer Spaziergang spätestens nach dem Kaffeetrinken starten müssen, um ihn noch im Hellen zu beenden. Ende Januar kann auch kurz vor dem Abendessen noch eine Runde bei Tageslicht gedreht werden.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Jahreszeitliche Orientierung
Die Jahreszeiten lassen sich an ihrer Dämmerung erkennen, dazu eignet sich am besten ein regelmäßiger gemeinsamer Spaziergang zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang während der langen Winterzeit. Die Sonne geht ja meist schon sehr früh unter und da ist immer genug Zeit, um vor dem Abendessen einen kleinen Gang durch den Garten zu machen. Wer den Lauf der Sonne genauer unter die Lupe nehmen möchte, beobachtet den Schattenwurf. Probieren Sie es aus, die Sonne steht im Winter am tiefsten und alles und jeder wirft lange Schatten im Garten. Wer wirft die längsten Schatten? Wer die dicksten? Das ändert sich mit der Jahreszeit, und ab Januar klettert die Sonne jeden Tag ein Stückchen höher, die Schatten werden kürzer und die Tage länger. Die Veränderung der Tageslängen können anhand des Schattenwurfs sichtbar gemacht werden, indem im Garten eine Markierung angebracht wird. Dazu einfach einen dicken Stock in den Boden stecken und jeden Tag um die gleiche Zeit, zum Beispiel vor dem Mittagessen, die Länge des Schattenwurfs von diesem Stock messen und mit einem Stein oder Kreide am Boden markieren. Am Ende des Monats ist gut sichtbar, wie der Schatten Tag für Tag kürzer wird. In Zeit umgerechnet heißt das, Ende Januar steht uns das Tageslicht eine Stunde länger zur Verfügung als zu Beginn des Jahres.
Zeitbedarf: 10 Minuten
Altbekannte Pflanzennamen
Der Januar kommt als ein schier endlos langer Monat daher. So, als würde er mehr Zeit zur Verfügung stellen, als die anderen Monate. Vielleicht liegt es am Klang des Wortes Januar? Es ruft andere Bilder hervor als die agilen und verheißungsvoll klingenden Monate April, Mai, Juni, Juli.
Worte haben das Zeug dazu, alleine durch ihren Klang jemandem ein Lächeln zu entlocken – wie beispielsweise die Worte „Blütenzauber“ oder „Edelweiß“ bei einer alten Dame, die meist teilnahmslos in ihrem Rollstuhl sitzt. In der Kommunikation mit Menschen, die den Inhalt von Sprache nicht mehr erfassen können, ist es wichtig, auf den Klang zu achten und darauf, dass der Klang das Gesagte unterstützt. Leider verschwinden immer mehr von diesen schönen Worten. Die Auszeichnung „Schönstes deutsches Wort“ ging 2004 im Rahmen eines internationalen Wettbewerbes an das Wort „Habseligkeiten“.
Das Lieblingswort einer alten Dame, die einst Mathematik und Musik unterrichtete, lautet „Lichtspielhaus“ und das einer anderen Frau, die als Heimbeiratsvorsitzende aktiv ist, „Dreikäsehoch“. Die Alten sind Hüter unserer Sprachgeschichte. Man macht durch sie auch Bekanntschaft mit wohlklingenden Pflanzennamen wie zum Beispiel Usambaraveilchen, Vergissmeinnicht, Jasmin oder Wegwarte. Alte Menschen wissen vieles zu erzählen über die verschiedenen Namen von beispielsweise Kartoffeln, die in manchen Regionen Grumbeeren in anderen Gebieten Erdäpfel genannt werden. Oder über die alten Sortennamen von Kartoffeln wie „Granola“, „Bamberger Hörnchen“, „Augsburger Gold“, die alten Apfelsorten „Geheimrat Oldenburg“ oder die Birne „Gute Luise“. Es bleibt zu hoffen, dass sie möglichst vielen jungen Menschen davon erzählen können.
Übrigens, am 21. Februar ist internationaler Tag der Muttersprache.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Erinnerungen und Biografie
In der Kommunikation mit Menschen, die den Inhalt von Sprache nicht mehr erfassen können, ist es wichtig, auf den Klang zu achten und darauf, dass der Klang das Gesagte unterstützt. Um der Wirkung von klangvollen Worten Raum zu geben, können in der Gruppe oder mit einzelnen Personen Lieblingsworte gesammelt oder eine Auswahl schön klingender Worte vorgelesen werden. Auch dem Klang der Worte zu lauschen, ist eine Möglichkeit, an Erinnerungen anzuknüpfen. Dabei treffen wir auf ein Phänomen, dass sich der Klang von Worten oft mit deren Inhalt deckt. Als Gesprächsimpuls können Fragen nach dem Lieblingswort oder nach unterschiedliche Namen für Blumen, Bäume, alte Sorten von Äpfel, Kartoffeln etc. gestellt werden. Um das Erzählte direkt anschaulich und – im wahrsten Sinn des Wortes – begreifbar zu machen, am besten ein Auswahl verschiedener Apfel- oder Birnensorten bzw. alte Kartoffelsorten mitbringen. Den 2004 einmalig durchgeführten Wettbewerb „Schönstes deutsches Wort“, an dem Interessierte aus 111 Ländern beteiligt waren, gewann übrigens das Wort Habseligkeiten. In der Wertung war es gefolgt von den Wörtern Geborgenheit auf Platz zwei, lieben, Augenblick und schließlich auf Platz fünf Rhabarbermarmelade.
Zeitbedarf: 10 bis 30 Minuten
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –HINTERGRUND –
Menschen mit Demenz verlieren zwar die Fähigkeit, Sprache zu verstehen. Sie verlernen aber nicht, die Botschaften wahrzunehmen, die im Klang der menschlichen Stimme mitschwingen (Strauss 2002), und sie reagieren sensibel darauf (Santo Pietro / Ostuni 2003): Eine sanfte, warme, empathische, nicht zu laute Sprechweise gefällt (Grond 1984; Hoffman et al.1985) und kann trösten; eine kalte und harsche Stimme kann sie verärgern oder ängstigen (Hoffman et al. 1985). Der Klang einer sogenannten Babysprache hingegen, empört viele Betroffene in den anfänglichen Krankheitsstadien (Cunningham / Williams 2007; Hoffman / Platt 2016), kann aber im sehr späten Demenzstadium auch trösten und beruhigen (Hoffman / Platt 2016).
Vom Werden und Vergehen
Der Januar ist ein Neubeginn. Eine Seniorin sagte einmal treffend: „Endlich beschäftigen wir uns mit dem Werden und nicht nur mit dem Vergehen.“ In der Natur und im Garten ist alles diesem Kreislauf von Werden und Vergehen untergeordnet und in dem Wechsel der Jahreszeiten zeigt es sich besonders. In den Knospen, die sich zum Blatt entwickeln und nach ein paar Monaten als Laub von den Bäumen fallen. Auch die vielen Blüten zeigen uns deutlich den Kreislauf der Natur. Vom Aufblühen bis zur Frucht, die reif zu Boden fällt, erkennen wir den steten Wechsel der Jahreszeiten.
Abb. 2: Erica carnea, Schneeheide. Quelle: U. Kreuer
Wir sprechen davon, dass die Pflanzen schon blühen. Wir nennen sie Frühblüher oder Frühjahrsboten, wohingegen wir im Dezember von der letzten Blüte sprechen – obwohl es sich oftmals um ein und dieselbe Blüte handelt. In keinem Altenheimgarten dürfen sie fehlen, diese ersten Blüten des Jahres wie zum Beispiel die bekannte Schneeheide Erica carnea. Unermüdlich blüht sie von Dezember bis in den Mai hinein in den verschiedensten Farben. Das Besondere an der Schneeheide ist, dass sie für Bienen und Hummeln eine sehr wichtige frühe Nahrungsquelle darstellt, da sie reich an Nektar und Pollen ist und das zu einer Jahreszeit, wo es für die Insekten in der Natur noch nicht allzu viel zu holen gibt. Die Blütenpracht wirkt regelrecht magnetisierend auf die Tiere. Das lässt sich besonders schön beobachten, wenn es im zeitigen Frühjahr bereits ein paar milde Tage gibt, dann werden die Bienen von den bunten Blüten magisch angezogen. Die Schneeheide ist übrigens für viele Senior*innen eine alte Bekannte, die sie sicherlich auch als Kübelpflanze kennen.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Mobilität und Koordination
Für winterblühende Pflanzen wie die Schneeheide (Erica carnea) kann eine Winterpflege hilfreich sein, denn das Ausputzen der verwelkten Blüten gewährt eine lange Blütezeit. Dabei handelt es sich um eine leicht umzusetzende Tätigkeit, die die Bewegung fördert, kurzfristig geplant werden kann und regelmäßig auf dem Programm steht. Ausgeputzt werden entweder die getopften Pflanzen, die auf Balkon und Terrasse stehen oder es wird direkt im Beet gearbeitet, was etwas mehr Koordination und Beweglichkeit fordert.
Die Pflege der Topfpflanzen ist leichter, da sie bequem im Sitzen ausgeführt werden kann. Dazu stellen Sie die Töpfe auf den Tisch, sodass die Pflanzen für jede teilnehmende Person gut erreichbar sind. Nun muss lediglich mit der Hand kurz durch die Pflanze gefahren werden und die verwelkten kleinen Blüten rieseln ab. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis keine Blüten mehr rieseln, mit dem Ergebnis, dass man mit wenigen Handgriffen dafür gesorgt hat, dass die Pflanzen ihr attraktives Aussehen behalten.
Das Ausputzen im Beet kann mit einem Besen oder einem anderen leicht zu handhabenden Gartenwerkzeug getätigt werden. Dazu mit dem Besen leicht durch die Pflanze streifen und es rieselt verwelkte Blüten. Nach der Blütezeit sollte direkt im Frühjahr die Pflanze zurückgeschnitten werden. Dazu einfach mit einer Garten- oder Heckenschere die verblühten Zweige kräftig zurückschneiden. So kann sie im nächsten Jahr wieder kräftig blühen.
Zum Schluss noch ein paar Beispiele für verschiedene Schneeheidesorten: „December Red“ mit tiefrosa Blüten von Dezember bis März oder die rosaroten Blüten der Sorte „Antje“, die ebenfalls von Dezember bis März blüht. Etwas später blüht die Sorte „Schneekuppe“ mit weißen Blüten von Februar bis Anfang Mai.
Zeitbedarf: 10 bis 30 Minuten
Mein Freund, der Baum
Bei einem Neujahrsspaziergang steuerte eine alte Dame zielsicher die schwefelgelben Blüten einer Zaubernuss (Hamamelis x intermedia Pallida) an. Sie freute sich so sehr über die duftenden, gelb leuchtenden Blüten, dass sie sanft darüber streichelte. Die ersten Blüten im Jahr sind ein wunderbares Zeichen der Natur. Sie scheinen zu sagen: Es geht immer weiter, egal wie dunkel und kalt die Zeit gerade ist.
Frühe Blüher finden in jedem Demenzgarten einen geeigneten Platz. Die farbigen Flecken können dazu verführen, den warmen Platz im Haus zu verlassen und einen Winterspaziergang anzutreten. Denn Tageslicht und Bewegung an der frischen Luft sind Grundvoraussetzungen für eine gute Gesundheit und das Tageslicht als sogenannter Taktgeber verhilft zu einem größeren Antrieb und einem besseren Schlaf in der Nacht. Ein begleiteter Spaziergang, sei er auch noch so kurz, ist für die Tageslichtbilanz von Menschen in Pflegeeinrichtungen äußerst zuträglich. Selbst wenn die Tage trüb und grau sind, machen sich mitunter auch Bewohner*innen von Pflegeeinrichtungen selbstständig auf den Weg, um etwa die leuchtend gelben Blüten eines Winterjasmins anzusteuern.
Auf die Betreuenden hat das frische Gelb der Blüten ebenso eine aufmunternde Wirkung wie auf die alten Menschen. Hinzu kommt, dass sie die leuchtenden Blüten als ein attraktives Ziel für einen Spaziergang anbieten können und somit um eine Handlungsressource reicher sind.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Struktur und Rituale
Jeder Garten bietet die Möglichkeit kleine oder große Ziele zu gestalten oder sogar zu pflanzen. Ein sogenannter Hausbaum ist beispielweise solch ein Ziel, besonders dann, wenn er gemeinsam ausgewählt und gepflanzt wurde. Machen Sie eine kleine Umfrage im Haus: Welcher Baum wird als zukünftiger Hausbaum favorisiert? Vielleicht steht schon ein alter Baum auf dem Gelände und wird zum Hausbaum ernannt oder Sie pflanzen einen Baum. Besonders die Laubbäume ragen mit ihrem Blätterdach bis auf Balkonhöhe hinauf und locken selbst in den oberen Etagen die Senior*innen nach draußen auf die Balkone. Nicht nur die bunten Blätter sind verlockend, auch die Eichhörnchen und Vögel sind plötzlich auf Augenhöhe. Hausbäume sind meist auffällige und markante Bäume mit einem Symbolwert für einzelne Personen oder eine Gruppe. Sie werden zu einem besonderen Anlass gepflanzt und bewahren zum Beispiel die Erinnerung an eine Hochzeit oder eine Geburt oder wurden zu Ehren von jemandem gepflanzt.
Sind sie dann zu kräftige Bäumen herangewachsen, verkörpern sie Sicherheit und Schutz. Und vor allem: Bäume haut so schnell nichts um, sie sind fest verwurzelt und stehen in tiefer Gelassenheit an ihrem Platz, selbst dem größten Sturm halten sie stand und wiegen sich im Wind. Hausbäume sind wunderbare Anziehungspunkte für regelmäßige Besuche, ob alleine oder in der Gruppe und können auch vom Balkon aus genossen werden. Sie sind zu jeder Jahreszeit ein verlässliches Ziel.
Zeitbedarf: 10 bis 30 Minuten für einen Baumbesuch
Geschichten erzählen
Wenn auch mit weniger Tageslicht, dafür aber mit geballter Gemütlichkeit, kann der Winter dazu einladen, seine eigene Geschichte zu erzählen. Unzählig sind die Anekdoten vom Rodeln oder vom Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen oder Flüssen. Oftmals reicht der Anblick von Schlittschuhen aus, um Lebensgeschichten zu bergen. Wie sahen die Schlittschuhe früher aus? Wer kann alles Schlittschuh fahren oder heißt es Eislaufen?
Manchmal stockt einem der Atem, wenn Erlebnisse aus dem Nachkriegswinter 1946 / 47 erzählt werden. Selten geht es in diesen Erinnerungen um Blüten, die unter einer weißen Schneedecke auf die Wärme warten. Viel zu bedrohlich war die Kälte damals. Manch einem alten Menschen ist es ein Bedürfnis, von den damaligen Schrecken und Entbehrungen zu berichten. Der Winter kann ein hilfreicher Partner sein, um solche Lebenserinnerungen in geschütztem Rahmen aufleben zu lassen und behutsam aufzufangen.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Sinnliches Erleben – Fühlen und Tasten
Der Winter lädt dazu ein, es sich mit einer Gruppe oder einer Einzelperson an einem gemütlichen Ort mit behaglichem Licht (kein Neonlicht mit zu hohem Blauanteil) niederzulassen. Mitgebrachte Gegenständen wie Schlittschuhe, Ski oder ein Schlitten sind eine Einladung, eigene Wintergeschichten zu erzählen. Sollte draußen Schnee liegen, kann dieser in Eimern oder Schüsseln mit in die Räume gebracht und dort zu Schneebällen geformt oder einfach in den Händen zum Schmelzen gebracht werden. Wichtig ist natürlich, dass nach dem kalten Schnee eine wärmende Quelle für die Hände zur Verfügung steht wie beispielsweise eine Wärmeflasche oder vorgewärmte dicke Handschuhe. Jede*r kennt das wunderbare Körpergefühl, wenn wohlige Wärme die Hände sanft umschließt.
Zeitbedarf: 30 Minuten
Eisblumen
Im Winter wissen viele Senior*innen von einer Blume zu berichten, die heutzutage wohl für immer abhandengekommen ist: die Eisblume. Sie entsteht, wenn wir im Winter sehr kalte Fensterscheiben haben und im Raum etwas wärmere und leicht feuchte Luft. Berührt die Luft die unter null Grad kalte Fensterscheibe, kühlt sie dort ab und es wachsen Eisblumen. Heutzutage haben die Häuser alle Doppel- oder Dreifachverglasung und deshalb auch in den Innenräumen keine kalten Fensterscheiben mehr.
Nicht nur um diese Erfahrung sind die Senior*innen reicher als junge Menschen. Auch das Wissen um den Gemüseanbau ist bei alten Menschen tief verankert. Fragen Sie einmal nach dem Erntezeitpunkt von Grünkohl oder Rosenkohl. Darüber können gewiss einige Damen und Herren berichten, dass erst der Frost über den Kohl kommen muss, bevor er nicht mehr bitter schmeckt und geerntet werden kann. Denn der Kohl produziert sein eigenes Frostschutzmittel, damit er nicht erfriert. Das macht er, indem er bei einem starken Kältereiz die in den Zellen gelagerte Pflanzenstärke in Zucker umwandelt. Der wohlschmeckende Zucker macht den Kohl bekömmlich und setzt den Gefrierpunkt in den Zellen herunter, sodass keine Eiskristalle entstehen. Denn spitze Kristalle würden die Pflanzenzelle platzen lassen. Nur der Rotkohl verträgt den tiefen Frost nicht. Aber auch das wissen die Hausfrauen von damals sicherlich noch sehr genau.
Abb. 3: Eisblumen am Fenster. Quelle: U. Kreuer
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Aktivität
Ein Eisbild lässt sich auch selbst herstellen. Als Hilfsmittel benötigt man lediglich ein tiefes Backblech und Naturmaterialien wie liegen gebliebene Herbstblätter oder kleine Äste, die bei einem gemeinsamen Spaziergang gesammelt werden können. Nun wählt man ein hohes Backblech aus und stellt es auf einen Tisch, um den die Teilnehmenden sitzen. Das gesammelte Material liegt ebenfalls auf dem Tisch, sodass alle gut dran kommen. Ist alles vorbereitet, wird das Backblech mit Wasser gefüllt und die Materialien werden in das Wasser gelegt. Anschließend wird das Backblech ins Freie gestellt, damit das Wasser gefrieren kann. Schwerere Materialien erst auflegen, wenn sich bereits eine dünne Eisschicht gebildet hat. Wird auf die Materialien erneut Wasser gegeben, sind Blätter und Co. später ganz im Eis eingeschlossen. Das Backblech braucht jetzt nur noch über Nacht draußen zu gefrieren und das viereckige Eisgebilde kann aus dem Backblech gehoben werden. Fertig ist das Eisbild, das natürlich nur draußen im Garten seinen Platz findet.
Zeitbedarf: ab 30 Minuten
Klirrend kalte Tage
Neulich erzählte mir eine Dame von noch etwas, das heutzutage ebenfalls nicht mehr anzutreffen ist: dass sie früher im Winter bei Minusgraden die Wäsche zum Trocknen draußen aufgehängt hat. Angenehm war es sicherlich nicht, die Wäsche auf-, geschweige denn abzuhängen. An einem klirrend kalten Tag im Januar können Sie einmal ausprobieren, ob es klappt, ob nach kurzer Zeit das flüssige Wasser zu Eis geworden ist und die Wäsche tiefgefroren und bretthart wird. Es wird einen Moment dauern, bis sie wieder weich und trocken ist. Hört sich komisch an, ist aber so, denn Wasser hat die besondere Eigenschaft, dass es auch unterhalb des Gefrierpunktes gasförmig werden kann. So können gleichzeitig Eis und Wasserdampf entstehen. Also die Wäsche kann trocknen, selbst wenn sie gefroren ist.
Das Trocknen bei großer Kälte hat sogar den Vorteil, dass die Wäschestücke besonders weich werden. Doch Achtung: Die Wäsche bloß nicht abnehmen und reinholen, solange sie noch bretthart gefroren ist – dann wird sie nämlich wieder nass. Lassen Sie sie wirklich so lange hängen, bis sie getrocknet ist. Vor allem Frotteehandtücher werden im Winter herrlich kuschelig, ganz ohne Weichspüler, und dabei auch noch viel saugfähiger.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Sinnliches Erleben – Fühlen und Tasten
Wäsche trocknet auch bei Minustemperaturen. Probieren Sie es aus, es wird sicherlich von allen Beteiligten mit Spannung beobachtet. Dazu einen Wäscheständer aufstellen oder direkt eine Wäscheleine aufhängen. Wäscheleinen sind übrigens etwas Altbekanntes, früher gab es in jedem Garten eine Wäscheleine. Sollte es eine Leine geben, dann kann sie das ganze Jahr als solche genutzt werden, denn es gibt zum Beispiel immer feuchte Küchentücher, die zum Trocknen aufgehängt werden können. Für das Experiment hängen Sie gemeinsam nasse Küchenhandtücher bei frostigem Wetter auf die Leine und warten was passiert. Vielleicht hat jemand auch schon mal Wäsche bei Frost nach draußen gehängt oder jemand anderes glaubt nicht daran, dass die Wäsche trocknet. Vielleicht übernimmt eine Person die Aufgabe, in Abständen zum Fühlen und Testen nach draußen zu gehen oder sie gehen gemeinsam nachschauen und die Handtücher fühlen? Neugier weckt das Experiment sicherlich.
Zeitbedarf: ab 15 Minuten zuzüglich Trockenzeit
Den Bäumen helfen
Wenn es ordentlich geschneit hat, dann biegen sich die Äste der Bäume und Sträucher unter der Last des Schnees nach unten. Sicher kennen Sie das winterliche Bild, wo auf jedem noch so kleinen Zweig der Schnee zentimeterdick liegen bleibt. Brechen die Äste vor lauter Schneelast ab oder reißen ein, können Krankheitserreger oder Frost in den Baum gelangen und ihn nachhaltig schädigen. Aus diesem Grund ist es ratsam, die Bäume und Sträucher regelmäßig von der Schneelast zu befreien.
Abb. 4: Schnee abschütteln. Quelle: C. Hörmann
Bei jedem Spaziergang durch den weißen winterlichen Garten, kann an allen erreichbaren Ästen vorsichtig geschüttelt werden. Nach meinen Erfahrungen dauert es nie lange bis sich hilfreiche Unterstützung anschließt. Dann wird mit allen möglichen Hilfsmitteln gemeinsam versucht, auch noch den höchsten Ast vom Gewicht des Schnees zu befreien. Mit Gehstöcken, Schneeschaufeln und allem, was zur Verfügung steht, hangeln sich die Pflanzenretter*innen mitunter durchs Geäst. Dass noch niemand auf einen Rollator gestiegen ist, um an die hohen Zweige zu kommen, wundert sehr.
– – – – – – – – – – – – – – – – – –PRAXIS –
Aktivität
Bäume von der Schneelast befreien. Ein normaler Schneefall mit tanzenden Flocken löst bei Bäumen und Sträuchern noch keinen Stress aus. Aber beobachten Sie das Wetter genau, dann wenn die dicken Flocken schnell zu Boden fallen und der Boden klebrig wird, dann ist der Schnee nass. Sind die Sträucher und Bäume mit einer dicken Schneeschicht bedeckt oder neigen sich Richtung Boden, wird es Zeit, die wichtige Aufgabe gemeinsam in Angriff zu nehmen und die Äste und Zweige von der Schneelast zu befreien. Wichtig dabei ist, dass Sie nicht an den Zweigen rupfen und reißen, sondern lediglich vorsichtig schütteln oder die Zweige mit einem Besen abkehren. Übrigens: Wenn der Schnee ordentlich nass ist, kann man die besten Schneebälle daraus formen oder sogar einen Schneemann bauen.
Zeitbedarf: ab 20 Minuten, je nach Größe des Gartens
Februar
Feste, Bräuche, Traditionen
Im Februar ist der Frühling bereits zu ahnen. Die Kraniche kündigen es lautstark an, wenn sie in ihrer typischen Flugformation wie langgezogene Ketten den Himmel bedecken. Auch in den Seniorenheimen nimmt das Leben langsam wieder an Fahrt auf und in vielen Regionen wird im Februar das Ende der kalten und dunklen Jahreszeit gefeiert.