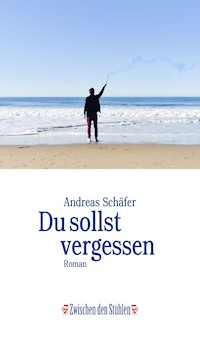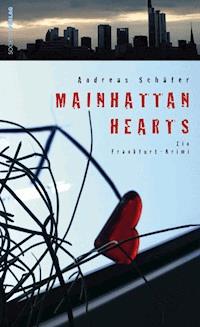9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Villa Rosen, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der Neunzigerjahre das leer stehende Haus am Rande des Berliner Grunewalds entdecken, erliegen sie seinem verwunschenen Charme. In einer aufwendigen Restaurierung stellen die Lekebuschs den Originalzustand des Hauses wieder her, und schnell wird die neu erstrahlende Dahlemer Villa als »Kleinod der Vormoderne« zum Pilgerort für Taubert-Fans, Künstler und einflussreiche Journalisten. Und – wie schon in der Weimarer Republik und zur NS-Zeit – zum Spielball der Interessen. Sie wollten den alten Geist des Hauses wiedererwecken, doch mit den Auswirkungen des Ruhms und dem langen Schatten der Vergangenheit haben die Lekebuschs nicht gerechnet. Kunst, Moral, privates Glück und Politik: ›Das Gartenzimmer‹ spannt einen Bogen von der Aufbruchsstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Weimarer Republik und die Herrschaft der Nationalsozialisten bis in die Gegenwart. Andreas Schäfer erzählt klug, feinfühlig und fesselnd vom Schicksal eines Hauses in Berlin-Dahlem und dem Leben derer, die sich seiner sirenenhaften Wirkung nicht entziehen können. »Als Leser ziehe ich ein in dieses besondere Haus, das Andreas Schäfer in diesem Buch erbaut. Am Ende möchte ich es nicht verlassen.« David Wagner »Andreas Schäfer ist der Meister des Subtilen. Er variiert, bis wir merken, dass wir uns längst mit etwas beschäftigen, das über den Raum des Romans hinausweist: mitten hinein ins Leben.« WDR 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DIE VILLA ROSEN, ein neoklassizistisches Landhaus, wird 1909 von dem später zu Weltruhm gelangenden Architekten Max Taubert für einen Professor Adam Rosen und seine Frau Elsa entworfen. Als Frieder und Hannah Lekebusch Mitte der Neunzigerjahre das leer stehende Haus am Rande des Berliner Grunewalds entdecken, erliegen sie seinem verwunschenen Charme. In einer aufwendigen Restaurierung stellen die Lekebuschs den Originalzustand des Hauses wieder her, und schnell wird die neu erstrahlende Dahlemer Villa als »Kleinod der Vormoderne« zum Pilgerort für Taubert-Fans, Künstler und einflussreiche Journalisten. Und – wie schon in der Weimarer Republik und zur NS-Zeit – zum Spielball der Interessen. Sie wollten den alten Geist des Hauses wiedererwecken, doch mit den Auswirkungen des Ruhms und dem langen Schatten der Vergangenheit haben die Lekebuschs nicht gerechnet.
Kunst, Moral, privates Glück und Politik: ›Das Gartenzimmer‹ spannt einen Bogen von der Aufbruchsstimmung zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die Weimarer Republik und die Herrschaft der Nationalsozialisten bis in die Gegenwart. Andreas Schäfer erzählt klug, feinfühlig und fesselnd vom Schicksal eines Hauses in Berlin-Dahlem und dem Leben derer, die sich seiner sirenenhaften Wirkung nicht entziehen können.
© Mirella Weingarten
ANDREAS SCHÄFER, 1969 in Hamburg geboren, wuchs in Frankfurt/Main auf und lebt heute als Schriftsteller und Journalist mit seiner Familie in Berlin. Bisher veröffentlichte er die Romane ›Auf dem Weg nach Messara‹ (2002), wofür er u. a. den Bremer Literaturförderpreis erhielt, ›Wir vier‹ (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, und zuletzt ›Gesichter‹ (DuMont 2013).
Andreas Schäfer
DAS GARTENZIMMER
Roman
Von Andreas Schäfer sind bei DuMont außerdem erschienen:
Wir vier
Gesichter
Die Arbeit am vorliegenden Buch wurde gefördert durch
den Berliner Senat (Arbeitsstipendium) und das Auswärtige Amt (Stipendium Villa Aurora).
eBook 2020
© 2020 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Das Sommerhaus – Tagesbild 3900 von Edward B. Gordon
Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers www.gordon.de
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7026-4
www.dumont-buchverlag.de
meinen Eltern
Eine Dorfschreinerei in Vorpommern. Früher Abend. Das rötliche Licht auf Werkbänken, Sägen und Fräsen, Staub schwebt über der Drechselbank, und in der Nähe der Tür trocknen frisch gehobelte Lärchendielen. Dem Jungen schwindelt von ihrem Duft, während er in einem Berg aus Holzabfällen kramt. Der Vater bringt schweigend die Zapfenbänder einer Kommode ein, und der Junge setzt sich auf einen Schemel und schnitzt und schleift, bis die Seiten der Quader glatt an seiner Wange liegen. Für seine Eltern sind die Klötze nichts als Spielzeug, für den Jungen sind sie Häuser, die er dort einsetzt, wo sie fehlen. Nicht weit von der Werkstatt führt ein Weg eine Anhöhe hinauf. Von hier lässt sich das Dorf mit seinen versprengten Höfen, den Äckern und Waldungen überblicken. Dort steht der Junge jetzt und schaut über die Ebene. Die Ställe, Scheunen und Bauernkaten wirken wie urzeitliche Bestandteile der Landschaft, und er kneift ein Auge zusammen und bewegt einen Quader am gestreckten Arm, bis er zwischen Erlen auf eine Wiese oder an das Ufer eines Weihers oder an den Rand eines Gehöftes passt. Wenn ein Klotz in seiner Lücke einrastet, durchrieselt ihn ein Schauer, und eine Sehnsucht trägt ihn fort, hinunter in die Senke. Er will im Schatten der Birken von der Anhöhe verfolgen, wie das Licht verschwindet, und dort unten zugleich die Hand an die Mauer des erträumten Hauses legen, dessen kalten, rauen Backstein er schon an den Fingerspitzen spürt. Die Sehnsucht, die Unerfüllbarkeit seines Wunsches erschöpfen ihn, und er sinkt zu Boden und schläft ein. Bis der Vater ihn findet.
2001
An den Pfeilern der Loggia brannten noch die Fackeln, die seine Mutter mit der einsetzenden Dämmerung entzündet hatte. In ihrem flackernden Schein lehnten letzte Gäste an der Brüstung. Der Wind trug Lachen und Musik in abreißenden, seltsam hallenden Fetzen zu ihnen hinunter. Luis sah Glutpunkte vor schwankenden Silhouetten.
»Komm«, sagte er.
Ana war näher an den Zaun getreten und blickte nach oben. Sie trug das schulterfreie Kleid und schien nicht zu frieren, obwohl aus den Bäumen eine empfindliche Kühle strömte. Er stellte sich vor, was sie sah – den Hang mit dem Serpentinenweg, die Stützen auf der Mauer und darüber die monumentale Giebelfront des Hauses als breiten, spitz zulaufenden Pfeil, der in den wolkenlosen Nachthimmel zeigte. Die Stimme Gloria Gaynors kam plötzlich von überall, von oben und aus dem menschenleeren, angrenzenden Garten und als flatterndes Echo aus der Tiefe des Waldes.
Er war noch einmal zurückgegangen, um seinen Schlüssel zu suchen, und hatte, im Dunkeln auf der Bank unter den Fenstern liegend, über den Boden getastet, als er die Stimme seines Vaters und das helle, auffällige Lachen der Sängerin von der Treppe her hörte. Sie waren näher gekommen, und dann war es für einen Moment still geworden. Luis hatte kaum zu atmen gewagt. Er hatte nichts vernommen bis auf ein leises Kleiderrascheln, und nach zwei oder drei endlosen Minuten waren die beiden schweigend wieder nach oben gegangen.
»Hinterm Zaun, hat deine Mutter gesagt. Ich sehe aber nichts.«
Ana ging hin und her, als suchte sie nach der richtigen Stelle.
»Schau erst in die Kiefern und zieh den Blick dann auf Höhe des Mauerrands zur Loggia«, sagte er.
Sie stand einfach da, den Kopf in den Nacken gelegt, als verfolgte sie eine Mondfinsternis.
»Unglaublich«, sagte sie. »Jetzt schwebt das Haus. Es schwebt tatsächlich!«
In diesem Moment ging das Licht im runden Fenster des Giebels an. Der Kreis leuchtete in einem warmen Gelb, und als Luis kurz darauf seinen Vater hinter der Scheibe des Taubert-Zimmers sah und den Umriss der Sängerin neben ihm erkannte, sagte er: »Lass uns endlich fahren.«
Ana wandte sich um. Die schmale Nase mit der knochigen Ausbuchtung, ihre hohen Wangenknochen und die gleichmäßige Stirn. Ihr lockiges Haar war dicht, mit versteckten hellen Strähnen, wie von der Sonne gebleicht. Sie kam auf ihn zu, einen ruhigen, erhabenen Spott im Blick.
1908
Max Taubert saß am Zeichentisch eines Ateliers in Berlin-Schöneberg und kratzte mit einem Rasiermesser gezeichnete Bänke aus dem Grundriss einer Wartehalle, als Wagner, die Hände im Rücken verschränkt, an seinen Tisch trat.
»Da ist ein Ehepaar, das Sie gern kennenlernen möchte.« Vergnügt wippte er auf den Fußballen. »Professor Adam Rosen«, fügte er nach einer Pause hinzu. Max wischte die Splitter vom Zeichenpapier und tilgte mit schabenden Bewegungen die letzten Spuren der Bank, bis die Stelle kaum noch von ihrer Umgebung zu unterscheiden war. Dann blickte er auf. »Sie haben ein Grundstück in Dahlem erworben«, sagte Wagner. »Sie möchten ein Landhaus bauen und suchen nach einem Architekten.«
»Warum übernehmen Sie den Auftrag nicht?«, fragte Max.
Wagner schwieg. Er hatte die Stirn eines Dichters und einen großen Mund, dessen Lippen einen mehlig-weißen Ton annahmen, wenn er lächelte.
Max schloss sein Jackett und folgte ihm ins Empfangszimmer, das auch als Ausstellungsraum für Wagners Entwürfe diente. Hier präsentierte er die Mahagonistühle mit dem Rohrgeflecht an einem Tisch aus schimmerndem Kirschholz; hier stand auch das wuchtige Buffet mit dem eingearbeiteten Elfenbein, das erst kürzlich bei einem Wettbewerb ausgezeichnet worden war. Frau Rosen, eine schlanke Frau um die vierzig mit großen, neugierigen, aber unruhigen Augen, reichte Max sofort die Hand, während der Professor die Karikaturen von Bankdirektoren oder breitschädeligen Kirchgängern an der Wand betrachtete, die Wagner in übermütigen Studententagen veröffentlicht hatte. Herr Rosen war groß und schlank, und das nach hinten gelegte weiße Haar und der hohe Hemdkragen gaben seiner Gestalt etwas Abweisendes.
»Herr Rosen, darf ich vorstellen: Max Taubert. Der Mitarbeiter, von dem …«
»Der junge Mann!« Die Stimme des Professors klang amüsiert, doch als er sich umwandte, betrachtete er Max aus zusammengekniffenen Augen und mit zurückgeschobenem Kopf, als wollte er ihm nicht zu nahe kommen. Dann nahm sein Gesicht eine freundliche Milde an. »Sie kommen vom Land, sagt Wagner.«
»Aus Blumenhagen bei Pasewalk, ja. Ich habe in der Schreinerei meines Vaters gelernt.« Max ließ eine kurze Pause. »Seit ich in Berlin bin, besuche ich die Kunstgewerbeschule.«
»Pasewalk? Dann kennen Sie sicher die Feldsteinkirche in Lübbersdorf. Herrlich, wenn die Sonne durch die Fenstergruppen ins Schiff fällt! Wir machen im Frühling gern Ausfahrten in die Gegend, nicht wahr?« Er wandte sich kurz seiner Frau zu, bevor er Max wieder ansah. »Warum übernehmen Sie nicht das familiäre Geschäft?«
»Nach dem Tod unseres Vaters war es uns nicht möglich, den Betrieb zu erhalten.«
»Warum nicht?«
»Uns fehlte das Geld für eine Dampfmaschine.«
»Dampfmaschine«, wiederholte der Professor und zog überrascht die Brauen in die Höhe. »Und – sagen Sie mir: Sie sind Architekt? Schreiner? Oder von beidem ein bisschen?«
»Architekt.«
Rosen lächelte belustigt, während seine Frau Max wie ein faszinierendes Bild betrachtete. Wagner wippte zufrieden in seinen Schuhen und ließ die Dielen knarzen, bevor er das Paar in den Zeichenraum bat und zu Max’ Arbeitsplatz führte. Gegen die blendende Sonne hatte Max ein Stück Stoff am Fensterrahmen befestigt, sein kleines Reich, eine schattige Höhle, in der er, tief über das Papier gebeugt, die Zeit vergaß. Neugierig begutachtete Frau Rosen die Kohlestifte, die Winkel und Lineale, berührte einen der flachen Kiesel, mit denen er die Ecken des Transparentpapiers beschwerte, bevor sie die Zeichnung in Augenschein nahm. Doch im nächsten Moment zog Wagner mit einer schnellen Bewegung die Mappe, in der Max seine privaten Entwürfe und Skizzen verwahrte, aus einem Fach unter der Zeichenplatte hervor und verteilte die Blätter auf dem Tisch. Es versetzte Max einen Stich, seine Fantasien, die Brücken, Häuser und Türme ungeschützt ausgebreitet zu sehen, doch weder protestierte er noch sagte er etwas Erklärendes, während der Professor eine Zeichnung nach der anderen in die Hand nahm. Niemand sagte etwas, während der Blick des Professors die Formen nachgerade aus den Blättern zu ziehen schien.
»Sie hatten recht«, sagte er nach einer Weile. Seine gespreizten Finger lagen auf dem Entwurf eines Speichers, den Max noch als Schüler in Pasewalk gezeichnet hatte. »Meine Frau und ich möchten ein Landhaus bauen.« Ein vages Lächeln erschien auf seinen Zügen. »Wollen Sie uns nicht dabei helfen?« Bevor Max antworten konnte, wandte sich Herr Rosen zum Gehen. Auf dem Weg zurück warf seine Frau Max einen aufmunternden Blick zu. Als der Professor Max für die nächste Woche in ihre Charlottenburger Wohnung bat, nickte sie nur und gab ihm zum Abschied schweigend die Hand.
»Ich glaube, Sie haben Eindruck hinterlassen.« Wagner stand an seinem Schreibtisch und blätterte schon wieder in Papieren. »Übrigens gibt es einen Grund dafür, warum ich den Entwurf nicht ausführe – abgesehen davon, dass Rosen meine Arbeit nicht schätzt. Die Rosens wollen partout einen jungen Architekten. Sie haben vor einigen Jahren ihren Sohn verloren. Ich glaube, er wäre heute in Ihrem Alter, wenn Sie verstehen.« Als Max dazu nichts sagte, schaute er auf. »Seien Sie nicht empfindlich. Sie hatten es doch darauf abgesehen, dass ich die Mappe entdecke. Sie wollten, dass genau so etwas passiert.«
Erst als Max am frühen Abend das Atelier verließ, fiel die Spannung von ihm ab. Es wunderte ihn, dass niemand auf ihn zustürzte, um ihm zu seinem ersten Auftrag zu gratulieren. Es war ein kühler Herbsttag, und die Menschen beeilten sich, nach Hause oder zum Bus zu kommen, oder verschwanden so schnell wie möglich in einem der erleuchteten Restaurants. Auf dem Weg zur Haltestelle sah er das hagere Gesicht des Professors mit dem Spitzbart und Frau Rosens Lächeln wieder vor sich. Sie war wesentlich jünger als ihr Mann und auch einen Kopf kleiner. Sie hatte ein offenes Gesicht, und ihr dunkles, dichtes Haar war selbst mit einer Spange am Hinterkopf kaum zu bändigen. Ihre Züge waren unablässig in Bewegung gewesen und ihre Augen waren zwischen ihrem Mann, Wagner und ihm hin und her gesprungen. Ihre Wangen hatten gezuckt, als hätte sich jede Wendung des Gesprächs auf ihrem Antlitz gespiegelt.
Ich baue ein Haus, dachte er. Eingekeilt zwischen den anderen schaukelte er im Bus die Straße entlang, erst als er am Nollendorfplatz aus dem Wagen gedrängt wurde, nahm er seine Umgebung wieder wahr, die eiligen Schritte, den Verkehrslärm, die kreischenden Bremsen der Busse. Als gewaltiges Insekt lag der Bahnhof der Hochbahn auf dem Platz, ein steinernes Tier, dessen Rüssel die eilig auf ihn zustrebenden Passanten gierig aufnahm und sie hoch in seinen durchsichtigen Kopf sog, wo Max sie hinter den Rundbogenfenstern winzig klein auf die Einfahrt des nächsten Zuges warten sah. Seine Kopfhaut brannte, sein gesamter Körper begann zu kribbeln.
Die ersten Berliner Wochen hatte Max zusammen mit einem ehemaligen Gesellen aus der väterlichen Werkstatt in dessen Moabiter Zimmer gehaust, Nähe Westhafen, wo der Gestank nach Unrat und Brack sich mit frischer Seeluft mischte. Das ebenerdige Zimmer war feucht und so klein, dass Max auf der Strohmatte neben dem Bett mit dem Kopf unterm Tisch lag. Von Sonnenaufgang bis spät in den Abend hinein hallten die Schläge eines Kupferschmieds durch den Hof – danach hörte man Kindergeschrei, und wenn auch das Gezeter der Frauen irgendwann nachließ, begannen die immer gleichen Geschichten des betrunkenen Gesellen. Er arbeitete in einer Fabrik am Ufer der Panke, die Mobiliar für die Borsig-Waggons zimmerte, verbrachte die Abende in Kaschemmen und wankte, nach Schweiß, Alkohol und einem widerlichen Leimsud stinkend, gegen Mitternacht ins Zimmer.
»Meide das Schlesische Tor: nur fünfzig Pfennige und die Krätze noch dazu«, lautete seine Begrüßung, bevor er die Schuhe von den Füßen stieß und stöhnend in den Bettkasten kippte. »Warst du endlich an der Friedrichstraße? Federboa und immer Schnütchen, aber keinen Schlüpfer zum Unterrock. Hör auf den Rat eines erfahrenen Mannes: Bei den Kontrollmädchen aus Vorpommern weiß man, was man hat.«
Max verabscheute das Gerede, aber er musste es ertragen, wollte er nicht unter einer Brücke schlafen; bis zum nächsten Ziehtag wäre er nirgendwo sonst untergekommen. Der Geselle genoss seine Macht. Es war seine Rache dafür, dass Max selbst in diesem klammen Loch seine Überheblichkeit nicht ablegte, statt zu arbeiten, das Ersparte der Mutter aufbrauchte und, sobald er von der Gewerbeschule kam, im funzeligen Schein einer Petroleumlampe Bücher über italienische Architektur oder die Baukunst um 1800 las.
Der Geselle rülpste und schmatzte über ihm, er röchelte, als wäre er eingeschlafen, doch plötzlich erschien seine fettig glänzende Visage zwischen Bettkante und Tischplatte.
»He, Künstler! Du kannst den Rock bürsten und deinen Scheitel kleben, so viel wie du willst. Wirst doch kein Bürgerjüngel.« Sein Schnapsatem waberte auf Max hinunter. »Ich kenne eine, nicht weit von der Kaiserpassage: Da vergeht dir Hören und Sehen!« Und sein Lachen ging in einen Husten über, der nicht enden wollte.
Zum nächsten Oktober fand Max ein Zimmer in der Invalidenstraße bei der Witwe eines Glasers, doch das hämische Lachen konnte er nicht vergessen. Berlin war nicht so laut und überfüllt, wie sie im Dorf behauptet hatten; solange er Bahnhöfe und die Alleen mied, gab es Stille, viel mehr Stille als erwartet. Aber die Mädchen und Frauen, die auf jedem Platz zwischen vorbeihastenden Passanten flanierten und in den Nebenstraßen mit diesem speziellen Blick ihre Dienste anboten, ihr Pfeifen und Zischen aus den schattigen Hauseingängen – das verstörte ihn jeden Tag aufs Neue.
»Na, Jüngelchen, willste schnuppern?«
»Echter altdeutscher Napfkuchen. Koste doch mal!«
»Brauchst nicht so tun – man liest dir die Wünsche doch von der Stirn.«
Er blickte starr geradeaus, ging wie ein aufgezogener Automat, doch am Abend, in der Dunkelheit seines Zimmers, kamen die Stimmen zurück, umflatterten ihn in immer höherer Tonlage, als wollten sie seine Mutlosigkeit verhöhnen, als verlachten sie seine Sturheit, mit der er glaubte, sich den Gesetzen der Stadt widersetzen zu können.
Als Max jetzt die Motzstraße erreichte, trieb er sich eine Weile in der Nähe der »Restauration zum gemütlichen Westpreußen« herum, bevor er den verrauchten und nur von Männern bevölkerten Raum betrat. Ein langer Tresen, runde Tische, an denen Karten gespielt wurde. Niemand beachtete ihn. Er saß bei einem Bier am Tresen und beobachtete jeden, der zu den Toiletten torkelte. Die Ausrufe, das Geschrei der Kartenspieler wogte heran und verebbte wieder. Max kamen die breiten Lippen Wagners in den Sinn. Schon nach der dritten Kursstunde hatte Wagner ihm mit eben diesem amüsierten Lächeln eine Arbeit als Zeichner angetragen; inzwischen hatte Max immer stärker das Bedürfnis, sich vor Wagners herablassender Erwartung zu schützen. Für ihn war alles ein Spiel. Er baute für Bankiers, Gardeoffiziere und Fabrikanten, obwohl er sie verachtete. Vergnügt summend machte er seine Runden durch den Zeichensaal, und Max zog unwillkürlich die Schultern hoch, wenn er seinen Tisch erreichte und sich über Max’ Zeichnungen beugte, um das Fenster aufzureißen. Wagners Spott war Gift. Es machte alles verächtlich und wertlos, mit dem es in Berührung kam. Max bestellte ein weiteres Bier, blickte sich um. Neben ihm thronte ein Mann mit blankem Schädel und einfältigem, aber freundlichem Gesicht. Er hatte die ruhigen Bewegungen des Handwerkers, die Selbstgenügsamkeit nach getaner Arbeit und trank stumm ein Bier nach dem anderen. Nachdem Max sein drittes Glas geleert hatte, beugte er sich zu ihm und fragte. Der Mann drehte sein fleischiges Antlitz und sah ihn für einen Moment aus trüben Augen an, bevor er schallend lachte und ihm eine Adresse nannte, nur einen Steinwurf entfernt.
In der kommenden Woche besuchte Max die Rosens in Charlottenburg. Ihre Wohnung war eine endlose Flucht von Zimmern, eine riesige Bibliothek, die hinter jeder Flügeltür ihre Fortsetzung fand. Sie saßen in Sesseln unter den Wedeln einer großen Palme. Ein Dienstmädchen in seinem Alter brachte Tee und Gebäck. Der Professor sprach in klaren, abgezirkelten Sätzen: keinerlei Details, die an den Jugendstil erinnerten. Jegliche Form von Hedonismus und ornamentalem Selbstzweck sei aus der Kunst, also auch aus der Architektur zu verbannen; Kunst sei, wie alle großen Dinge, nicht zu unserem Vergnügen da.
»Ach, bloß keinen Tempel, auch kein Kloster, nicht wahr?«, sagte Frau Rosen. »Mein Mann möchte dort draußen endlich seine Bücher schreiben, aber Geselligkeit muss doch sein.« Sie saß leger auf der Armlehne des Sessels ihres Mannes.
»Natürlich.« Der Professor legte seine Hand auf ihren Unterarm. »Wer nicht tanzt, versteht nichts von der Welt. Das predige ich meinen Studenten. Vor dem Wort war der Rhythmus.«
Das Grundstück gehörte zum Gelände der ehemaligen Domäne; die Stadt hatte es für eine Villenkolonie in Parzellen unterteilt. Zweitausend Quadratmeter. Sie hätten drei Jahre Zeit, um das Haus fertigzustellen, sonst drohe eine Konventionalstrafe. Ein Landhaus, nicht zu groß, in dem sie leben wollten, jeden Tag, das ganze Jahr über, nicht nur an den Wochenenden. Genaueres erfuhr Max nicht. Sein Blick wanderte zu den schweren Kommoden mit den gedrechselten Beinen, zu dem ausladenden Sofa und den dunklen Ölporträts an der Wand. Er konnte sich schwer vorstellen, ein Haus für solche opulenten Möbel zu entwerfen. Was wollten sie? Hatten die Rosens überhaupt eine Vorstellung? Max wartete, betrachtete aufmerksam den Professor, als ließen sich seine Vorlieben vom Gesicht ablesen.
»Sie müssen natürlich erst das Grundstück sehen. Die schöne Lage am Hang«, sagte er nur.
Als Frau Rosen Max später durch den Flur zur Tür geleitete, hakte sie sich bei ihm ein.
»Ich bin froh, dass wir Sie gefunden haben. Ihre Zeichnungen haben meinen Mann beeindruckt.« Sie drückte seinen Arm. »Und mich auch. Geht es Ihnen gut?«
»Natürlich.«
»Sie wirkten etwas angestrengt. Keine Sorge. Er ist nur am Anfang so.«
Sie schlenderten langsam über den Läufer, als promenierten sie draußen. Max besänftigten ihre Worte, etwas in ihm gab nach, auch der Druck zwischen den Schulterblättern verschwand.
»Was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten, Herr Taubert? Berlin ist groß, nicht wahr? Gehen Sie ins Theater? Oder zum Tanz?«
»Ich studiere viel und besichtige Häuser.«
»Schinkel?«, fragte sie mit ironischem Unterton.
»Nicht nur.«
»So gewissenhaft!« Sie schwiegen, bis sie das großzügige Entree erreichten.
»Die Möbel.« Er räusperte sich. »Wissen Sie schon, was Sie von hier mit ins Haus nehmen möchten?«
»Möbel?« Sie warf einen belustigten Blick auf den mächtigen Spiegel und die Anrichte. »An Möbel habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Von einigem werden wir uns wohl trennen müssen«, sagte sie gleichgültig.
Es existierte noch nicht, das Haus in ihrem Kopf – er hatte tatsächlich freie Hand. Draußen auf dem Treppenabsatz entfaltete er den Zettel mit der Adresse: »Am Forststeig. Parzelle 3. Ich freue mich sehr.« Das Wort »sehr« hatte sie unterstrichen und den Stift dabei fest ins Papier gepresst, sodass sich der Abdruck auf der Rückseite ertasten ließ.
Nur wenige Tage darauf nahm er am Nachmittag die Wannseebahn und verließ am Bahnhof Beerenstraße den Zug. Er ging die Grunewaldallee gen Norden. An ihrer östlichen Seite reihten sich die Zuckerbäckervillen mit Türmchen oder korinthischen Säulen, mit denen Textilfabrikanten oder Bankdirektoren sich ihr Denkmal gesetzt hatten, doch nach Westen zu den Seen hin erstreckte sich ein dichter Mischwald auf welligem Boden. Wolken zogen niedrig über ihn hinweg, aber er benötigte keine Sonne, um zu wissen, wie das Licht fallen und die Schatten sich im Laufe des Tages verschieben, wie sie schrumpfen und wieder wachsen würden. Der Boden gab bei jedem Schritt federnd nach, und Max nahm seine Unregelmäßigkeiten wie Töne wahr, deren feine Vibrationen in ihm nachhallten. Je weiter er kam, desto spärlicher wurde die Bebauung, und obwohl er dem Zentrum zustrebte, war ihm, als würde er die Stadt hinter sich lassen. Bald ging der Wald in ein merkwürdig unbestimmtes Gelände aus vertrockneten Brachen und Wiesen über, auf denen einsame Schafe grasten. Nach einer halben Stunde sah er schließlich die Gestalt des Professors am Fuße eines Hangs auf ihn warten. Max’ Zuversicht war wie weggeblasen – Rosen war allein.
»Meine Frau ist leider verhindert. Sie lässt Sie herzlich grüßen.«
Ohne ihre Begleitung wirkte er verlegen, als wüsste er noch immer nicht, ob er mit Max wie mit einem Studenten oder doch eher wie mit einem Handwerker reden sollte. Schweigend gingen sie auf einem Sandpfad, breit wie eine Straße, eine Anhöhe hinauf; nach etwa zweihundert Metern zeigte sich rechter Hand wie aus dem Nichts das erste Haus, eine zweigeschossige Villa im italienischen Stil, die erst kürzlich fertiggestellt worden sein konnte, die zarten Obstbäume im Garten erreichten kaum Brusthöhe. Auf der Nachbarparzelle standen schöne, alte Bäume, die das neogotische Schlösschen mit Erkern und Spitzgiebeln dahinter halb verdeckten. Es war ein bizarrer Anblick, unwirklich wie eine Fata Morgana: zwei prunkvolle Häuser mitten im Niemandsland. Der Professor sagte kein Wort, aber seine Miene hatte sich verändert, und kurz bevor sie das Ende des Pfades erreichten, breitete er die Arme aus.
»Was sagen Sie? Ist das nicht ein herrliches Versteck?«
Sie standen auf dem einzigen Hügel weit und breit. Max hatte angenommen, sich vom Grunewald entfernt zu haben, dabei war er die ganze Zeit in seiner Nähe geblieben. Das Grundstück stieß im Westen an eine dichte Kiefernwand des auslaufenden Grunewalds und bot zum Nordosten eine weite Aussicht über Felder und Wiesen bis zu den ersten Häusern Schmargendorfs. Doch für ein Gebäude war das Gelände ungünstig geschnitten. Ein Plateau erstreckte sich von der Straße über zwölf oder fünfzehn Schritte und stürzte dahinter steil bis zu einem Weiher in einer Senke hin ab. Dort unten verlief ein ähnlicher Weg wie hier oben. Verwirrt stapfte Max durch das Gras. Für ein Haus von der gewünschten Größe war die Ebene viel zu schmal. Er suchte nach dem richtigen Abstand, nach einer Stelle, von der aus er beginnen konnte, aber falls es ein solches Zentrum gab, befand es sich irgendwo dort unten in der Nähe des kleinen Tümpels. Sein Blick blieb an einer unscheinbaren Bank im Schatten einer Ulme hängen, vielleicht vierzig Meter entfernt. Erleichtert blieb er stehen. Ja. Alles strebte diesem Punkt zu. Wie eine gewaltige Theaterbühne öffnete sich das Grundstück zu dieser Bank hin. Er stellte sich vor, dort unten zu sitzen und hochzuschauen, dorthin, wo sie standen, zwei Männer in gedeckten Anzügen unter einem tiefen, grauen Himmel. Da sah er es – die Stützmauer, die Giebelfront, das runde Fenster in der Höhe. Sein Herz begann heftig zu schlagen, während die Beine für einen Moment schwer wurden, wie verwachsen mit dem Boden.
»Es gefällt Ihnen nicht.« Der Professor klang enttäuscht.
»Zwei Ebenen«, sagte Max. Aufgeregt begann er hin und her zu gehen. »Die Terrasse ist zu schmal – aber ich mache aus der Schwäche eine Stärke. Ich werde das Grundstück teilen, über seine gesamte Längsseite. Hier oben schütte ich Erde auf und stütze das Plateau mit einer Mauer.«
»Eine Mauer?«, fragte der Professor erstaunt.
Max wurde ungeduldig. »Stellen Sie sich eine quadratische Fläche vor, die bis zur einen Kante reicht.« Er stand dort, wo später der Haupteingang sein würde, und wies auf das Grundstück der Nachbarn. »Die Fassade des Hauses blickt auf diese Seite. Der obere Garten reicht von hier bis zu den alten Bäumen. Doch sobald man das Haus betritt, geht der Blick über den Hang zum Weiher und die Wiesen in der Ebene. Kein Mittelgrund. Nähe oder Weite.« Als er die Verwunderung im Blick des Professors bemerkte, fiel ihm auf, dass er »ich« und nicht »wir« gesagt hatte.
»Die Fassade zeigt nicht zur Straße?«
Der Zweifel in Rosens Stimme war nicht zu überhören.
Max’ Fantasie war längst woanders. Er erblickte schon die Stützen der Loggia, den eleganten Schwung der Treppe, doch in seine Euphorie mischte sich Verzweiflung, dass er sich kaum verständlich machen konnte, dass der Professor nicht sah, was er meinte. »Die zentralen Räume sind nach Norden ausgerichtet, den Hang hinunter – was man erst im Inneren des Hauses begreift«, wiederholte er. Max streckte Zeige- und Mittelfinger in die Luft. »Zwei Häuser in einem – um neunzig Grad versetzt.« Er formte mit Daumen und Zeigefinger seiner Hände zwei offene Us, die er ineinanderschob.
Rosen blickte ihn in einer Mischung aus Verwunderung und Belustigung an, bevor er seine Arme ein zweites Mal ausbreitete, als wollte er sagen: »Das Grundstück gehört Ihnen.«
Als sie mit der Bahn zurück in die Stadt rumpelten, kritzelte Max die Mauer, die das Gelände teilen würde, auf einen Zettel und schraffierte Tür und Fenster des Untergeschosses. Er deutete die Stützpfeiler der Loggia an und darüber die monumentale Giebelwand – doch der Professor betrachtete die Zeichnung nur flüchtig, nickte gefällig und stellte keine Fragen, als interessierte ihn nur das Ergebnis und nicht die Einzelteile, aus denen das Haus entstehen würde. Schweigend blickte er aus dem Abteilfenster in den Grunewald. Max ließ Stift und Zettel sinken und blickte ebenfalls hinaus. Der Himmel hatte aufgeklart, die Sonne warf Schattenmuster in die vorbeiziehenden Bäume. Hell aufscheinende Blätter, Lichtpfützen im Unterholz glitten vorüber und vermischten sich in seinem Kopf mit den aufblitzenden Details des zukünftigen Hauses. Als Max auf einem Hohlweg einen Reiter sah, dachte er an die Reiter auf den kargen Hügeln rund um ihr Dorf. Traurigkeit schnürte seinen Hals: dass sein Vater ihn nicht sehen konnte. Dass nichts von seiner Kinderwelt mehr existierte. Haus und Werkstatt waren verkauft, die Mutter lebte längst bei einer Tante auf dem Darß. Dann trieben plötzlich Bilder von der jungen Frau in der Kammer in ihm auf, und er hatte wieder ihr schweres Parfüm in der Nase. Im gewellten Glas des Wandspiegels hatten sich ihre in die Länge gezogenen Körper wie träge Wasserschlangen bewegt. Er war am nächsten Tag erneut hingegangen und genauso am Tag darauf, bis sie ihm verbot wiederzukommen, weil seine Gier ihr unheimlich wurde.
Der Professor blickte noch immer aus dem Fenster. Entspannt lag ein Bein über dem anderen. Der gestärkte Kragen seines Hemdes war an den Ecken abgerundet, im Vergleich zur Breite der schwarzen Seide wirkte der Krawattenknoten winzig. »Ein Verehrer Kants, wie so viele seiner Generation«, hatte Wagner gesagt, als Max sich nach Rosens Schriften erkundigt hatte. Er hatte angefangen, ein Buch von ihm zu lesen, und es nach wenigen Seiten verständnislos zur Seite gelegt, aber die Klarheit, die ihm aus den Sätzen entgegenkam, die natürliche Ordnung und ihr ruhiger Fluss hatten ihn auf eigentümliche Weise berührt. Im Dorf war Schweigen selbstverständlich gewesen, in Berlin galt es als einfältig, als Ausdruck gedanklicher Schwerfälligkeit. Der Professor aber schien Sprechen nicht nötig zu haben, als bildeten er und seine Gedanken eine von anderen unabhängige, eine abgeschlossene Einheit. Unauffällig studierte Max das lange, schmale Gesicht mit dem hellen Bart und versuchte, den Eindruck der Unnahbarkeit zu ergründen, der ihm schon bei der ersten Begegnung in Wagners Atelier aufgefallen war.
Mit dem kommenden Frühling begannen die Bauarbeiten. Rosen hatte die Ausführung in die Hände eines schlesischen Generalunternehmers gelegt, dessen Arbeiter die Wiese innerhalb weniger Tage in eine Brache verwandelten. Eisenträger wurden in die Erde getrieben, Planken eingezogen, um das Erdreich zu stützen. Max, der eine neue Anstellung gefunden hatte und inzwischen in einem Großbüro in Tempelhof Militärbaracken für die Eisenbahnregimenter zeichnete, kam, sooft er konnte, zum Bauplatz, an den Abenden, an den Wochenenden, manchmal selbst vor Sonnenaufgang. Er wollte nichts verpassen, jeden Schritt begleiten und konnte die schnellen Fortschritte kaum glauben, die Geschwindigkeit, mit der eine wilde Wiese die Form seiner Vorstellung annahm. Am Morgen, bevor das Bruchsteinfundament gelegt wurde, stapfte er durch die Baugrube, legte die Hand an die lehmige Erde, an der bald die ersten Mauern in die Höhe steigen würden. Aus der Tiefe schaute er staunend hinauf, in die Kronen der Kiefern weit über sich, und konnte diesen Blick auch nicht vergessen, als er am späten Nachmittag mit den Rosens in einem Biergarten am Bahnhof saß. Frau Rosen trank Schaumwein, erzählte von den Spaziergängen, die sie unternehmen werde, wenn sie erst einmal umgezogen seien. Dann blickte sie ihn erwartungsfroh an.
»Adam und ich fahren bald nach Frankfurt. Zur Eröffnung der Luftfahrtausstellung. Wir möchten Sie gern einladen. Ein Wochenende im Frankfurter Hof! Stellen Sie sich vor: Sie werden in einem Fesselballon in die Höhe steigen.« Frau Rosen sprach weiter, von den Ballonwettfahrten und den riesigen Ausstellungshallen mit den Zeppelinen, von der Festrede und dem Preis, den der Kaiser ausgelobt hatte.
»Das ist sehr großzügig«, stammelte Max endlich. »Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, aber …« Im Laufe des letzten Jahres hatte sie ihn einige Male mit ins Theater genommen; er hatte auch nichts dagegen, dass sie ihm, wie sie es nannte, »Bücher ans Herz« legte, um sich darüber mit ihm auszutauschen, doch jetzt empörte ihn, dass sie an diesem wichtigen Tag kaum ein Wort über den Fortschritt auf der Baustelle verlor und stattdessen nicht aufhören konnte, von dem Frankfurter Volksfest der Technik zu schwärmen. »Danke für das Angebot«, sagte er so freundlich es ihm möglich war. »Ich möchte hier nichts verpassen, ich möchte dabei sein, wenn die Mauern entstehen.«
»Sie wollen die neue Festhalle nicht sehen? Sie wollen nicht fliegen und die Welt aus der Luft betrachten?«
»Das Haus«, sagte er. »Ich bleibe lieber hier.«
Ihr Blick, erst erstaunt über Max’ Entschiedenheit, dann gekränkt, bevor sie ihn, das Lächeln einer Fürstin auf den Lippen, über die Menschen an den Nachbartischen schweifen ließ.
Am Abend, als die beiden in die Stadt fuhren, eilte er zum Bauplatz zurück. Das Gelände lag verlassen da. Um ihn herum schwankten Wiesenblumen im hoch stehenden Gras. Er schritt über die gestampfte Erde, setzte sich an den Rand der Grube. In der einsetzenden Dunkelheit schossen Fledermäuse durch die bläulich schillernde Luft, und mit dem schwindenden Licht traten die Geräusche des Waldes in kristalliner Klarheit hervor: das unergründliche Wühlen, Knistern und Knacken aus dem Unterholz. In der Ferne glaubte er sogar das Scharren der Wildschweine und ihr Grunzen zu hören, spürte ihre Gier, als wühlte sie in seiner Brust.
Mitte August, das Gras auf den umliegenden Wiesen war vertrocknet, der Boden vom lange erwarteten Regen aufgeweicht, näherte er sich eines Nachmittags über das matschige Gelände dem Rohbau. Die Mauern ragten beeindruckend aus der Erde, doch ohne Dach wirkte das Haus noch wie ein nicht eingelöstes Versprechen. Es war früher Nachmittag, trotzdem war nirgendwo ein Arbeiter zu sehen. Als er durch die Aussparung in die Halle trat, standen der Professor und seine Frau mit dem Vorarbeiter neben einem Berg geplatzter Zementsäcke. Schweigend blickten sie nach oben. In der Geschossdecke klaffte ein riesiges Loch. Der Anblick war furchterregend: die aufgerissene Decke zwischen zwei Holzbalken, die Lehmbrocken mit dem zerfetzten, in die Luft ragenden Stroh, darüber das helle Blau. Als wäre ein Fels vom Himmel gefallen. Die Arbeiter, erklärte der zerknirschte Vorarbeiter, hätten am Tag zuvor vergessen, den Zement abzudecken – während des nächtlichen Gewitters hätten die Säcke das Regenwasser aufgenommen und so stark an Gewicht zugenommen, dass sie die Geschossdecke durchbrochen hätten.
»Lieber jetzt als später, nicht wahr?« Der Professor klang erstaunlich ruhig. »So etwas kommt vor, meine Liebe.« Frau Rosen war totenbleich. Sie starrte hinauf, dann verließ sie schweigend das verletzte Gebäude. Max wurde den Eindruck nicht los, dass sie ihn für diesen Unfall verantwortlich machte, mehr noch: dass sie den Zwischenfall als schlechtes Omen für die gesamte Unternehmung sah. Selbst nachdem der Schaden lange behoben worden war, kam sie nur noch selten auf die Baustelle, und wenn doch, schritt sie widerwillig oder misstrauisch, die Arme vor der Brust verschränkt, durch die offenen Räume. Zum Richtfest im Herbst erschien sie herausgeputzt wie zu einem Opernbesuch, doch bis auf die Arbeiter hatten die Rosens niemanden eingeladen, keine Freunde oder Kollegen, als wollten sie ihr zukünftiges Heim verstecken, weil noch immer der Schatten des Unfalls auf der Unternehmung lag oder – und das fürchtete Max immer mehr – weil das nun klar zutage tretende Ergebnis nicht ihren Erwartungen entsprach.
Die Angst, sie enttäuscht haben zu können, trübte auch seinen Blick. Als die Arbeiten gegen Jahresende zum Abschluss kamen – die Fensterläden wurden als Letztes mintgrün gestrichen –, wirkte der Bau vor der hohen Wand aus Bäumen geradezu winzig, und die über der Mauer aufragende Giebelfront passte nicht zur biedermeierlich-intimen Fassade. Bis eine Woche vor Einzug Mitte Dezember war es auch nicht gelungen, die Heizung in Betrieb zu nehmen. Gleiches galt für den Speiseaufzug, der sich auf dem Weg von der Küche im Untergeschoss zur Anrichte jedes Mal mit einem hässlichen Knirschen im Schacht verkeilte.
»Versuchen wir es noch einmal«, rief Frau Rosen, als handelte es sich um ein Spiel, aber Max hörte sie direkt danach von unten »Herrgott, worauf haben wir uns eingelassen?« schimpfen.
Zur Abnahme erschien sie nicht. Max schritt an der Seite des Professors verlegen durch die Zimmer mit den unzähligen Einbauten, auf deren Planung er – so kam es ihm vor – die meiste Zeit verwendet hatte. Förmlich lobte Herr Rosen die gelungene Verkleidung, als sie in der leeren Halle standen, machte aber keine Anstalten, die Loggia zu betreten. Anerkennend wies er auf eine der Nischen wie auf ein gewitztes, aber letztlich völlig unerhebliches Detail. Er bemerkte die Weitläufigkeit der Galerie im oberen Stock, die unerwartete Helligkeit in den Zimmern zur Waldseite, doch seine Anerkennung klang in Max’ Ohren wie Hohn. Die Fenster waren verdreckt und schlammverkrustet, das ganze Haus wirkte feucht und zugig, und es roch nach kaltem Schweiß, als hätten Streuner die Räume als nächtlichen Unterschlupf genutzt. Als genauso trostlos erwies sich die Aussicht. Das Tauwetter der letzten Tage hatte den Schnee im Garten in eine bräunliche Matschlandschaft verwandelt, in ein unbelebtes Niemandsland fern jeder Gastlichkeit. Mit abwesendem Blick verabschiedete der Professor Max im Windfang, als wäre er mit seinen Gedanken längst woanders. Er sprach keine Einladung in eines der Lokale aus, schlug auch nicht vor, wie früher, gemeinsam die Bahn zu nehmen.
»Schade, dass Ihre Frau nicht dabei sein kann«, sagte Max. Er wollte sich nicht einfach aus dem Haus schieben lassen. »Der Schutt und die unverputzten Wände … Vor drei Wochen sah alles noch sehr unfertig aus.« Bei ihrer letzten Besichtigung hatte Frau Rosens Ungeduld ihn verunsichert, jetzt dachte er mit fast zärtlicher Traurigkeit an ihre letzten gemeinsamen Gänge zurück. »Ich hoffe, es ist nichts Ernstes«, sagte er, obwohl er ihre gelegentliche Unpässlichkeit kannte.
»Wolken, die vorüberziehen«, sagte Herr Rosen freundlich. Dabei schob er den Kopf zurück und betrachtete Max distanziert, wie bei ihrer ersten Begegnung in Wagners Atelier. Seit fast zwei Jahren kannten sie einander, doch Max hatte den Eindruck, einem Fremden gegenüberzustehen.
»Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, Sie werden sich wohlfühlen.«
Er wollte, er konnte noch nicht gehen.
»Danke«, sagte Herr Rosen. »Wir sind mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden. Das wissen Sie.«
Es beschämte Max, dass er den Professor genötigt hatte, ihn ein weiteres Mal zu loben. Dann schloss sich die Tür. Max verließ das Grundstück, ohne sich umzuwenden; niedergeschlagen ging er die Straße hinunter. Frau Rosens Begeisterung, als er die ersten Entwürfe auf dem Tisch in der Niebuhrstraße ausgerollt hatte, ihre Vorschläge zu den Einbauten und zur Aufteilung der Zimmer. Die Planung des Gartens. »Sie schulden uns noch einen Besuch in Foersters Gärtnerei, Herr Taubert.« Er sah ihr lebhaftes Gesicht vor sich, ihre aufmerksamen, unruhigen Augen. »Wir sollten die Idee eines Senkgartens nicht aus den Augen verlieren!« Und jetzt gewährte sie ihm nicht einmal einen persönlichen Abschied. Er konnte es nicht begreifen.
Zu Weihnachten – die Rosens wohnten seit zwei Wochen im Haus – erreichte ihn eine Karte mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. »Sie können stolz sein«, schrieb Frau Rosen. »Wir fühlen uns wohl!« Keine Einladung. Mehr hörte er nicht. Immerhin: Mit der Zeit zerstreuten sich seine Zweifel wieder, und er war davon überzeugt, dass ihm mit dem Haus etwas Würdevolles gelungen war. Über Jahre hatte es in einer Vorstellungswolke vor ihm geschwebt und sich wie ein Modell drehen und wenden, heranziehen oder in die Ferne schieben lassen; nun begannen die Bilder zu verblassen, trieben aus seinem inneren Blickfeld, bis er das Haus nur noch fühlte, hinter sich, in seinem Rücken, als etwas Nährendes, das ihm den Glauben gab, ein Architekt zu sein. Der Architekt zumindest eines Hauses. Denn wie sein kurzsichtiger Platznachbar im Tempelhofer Großbüro glaubte er selbst schon, sein Lebtag nichts anderes mehr als Baracken, Kasernen und Casinos zu zeichnen. Wohin Max seine Mappe auch schickte – sie kam postwendend zurück. In welchem Büro er auch vorsprach – niemand hatte Verwendung für einen jungen Architekten, obwohl er schon ein Haus vorzuweisen hatte. Das Bauamt Rixdorf suchte jemanden mit mehr Erfahrung; Peter Behrens hatte für den Abschluss der Kleinmotorenfabrik erst kürzlich einen Schwung junger Zeichner eingestellt. Oscar Kaufmann, seit Eröffnung des Hebbel-Theaters als Bühnenarchitekt im ganzen Land gefragt, ließ ihn nicht einmal vor.
»Weißt du, warum Zimmerlein sämtliche Militäraufträge einheimst?«, hatte kürzlich der Zeichner gefragt, mit dem er im Büro den Tisch teilte. »Er scharwenzelt täglich durchs Generalstabsgebäude und schickt Theaterkarten oder Blumen an die Gattinnen der Bauamtsassessoren.« Max gefiel der sarkastische Witz des ewigen Ärmelschoners, aber nie wäre er auf die Idee gekommen, mit ihm und den anderen Zeichnern nach der Arbeit auch nur eine Stunde in einem Biergarten zu verbringen. Er gehörte nicht zu ihnen. Er passte zu niemandem. Nicht zu den einfachen Leuten aus dem Dorf, nicht zu den bierseligen Kollegen und schon gar nicht in die feine Welt der Rosens. Nach der Arbeit zog es Max in die unwirtliche Gegend am Westhafen, wie in den Monaten nach seiner Ankunft in Berlin. Die Gerüche nach Kohle und Brack, die angenehme Feuchte der Luft. Auf der immer gleichen Bank an der Böschung sitzend, verfolgte er die Löschung der Frachter, das geschäftige Treiben am gegenüberliegenden Pier. Vielleicht sollte ich Berlin verlassen, dachte er. Vielleicht sollte er den erstbesten Zug am Anhalter Bahnhof besteigen und sehen, wohin er ihn tragen würde. Stattdessen saß er auch am nächsten Morgen um acht am Tisch und zeichnete Latrinen für die Kraftfahrtbataillone.
An einem schwülen Abend im April – er kam missmutig in sein Zimmer zurück – fand er einen mit zierlichen Buchstaben beschrifteten Umschlag vor. Ungeduldig riss er ihn auf und hielt die Einladung der Rosens zu einem »geselligen Empfang in unserem bescheidenen Hüttchen« in Händen, »entworfen von dem jungen Architekten Max Taubert«. Mit weichen Knien sank er aufs Bett.
Am Bahnhof der Stadtbahn kaufte Max einen viel zu großen Strauß gelber Tulpen. Es war ein strahlender Frühlingstag. Inzwischen wurde auf immer mehr Parzellen gebaut, Grundstücke waren planiert, Gruben ausgehoben, auf den Wiesen dazwischen standen hüfthoch Löwenzahn und Schlehdorn. Als er entfernt den Giebel des Hauses erblickte, wurde sein Mund trocken. Der Austritt, das Mäuerchen mit dem Zaun darauf und das zweiflügelige Tor – all das existierte tatsächlich.
Frau Rosen stand in der Tür, das dunkle Haar unter einem breitkrempigen Hut verborgen, während er über den Plattenweg auf sie zuschritt. Die Spaliere an der Mauer waren unberankt, aber auf den Terrassenbeeten blühten schon Anemonen und Narzissen. In der Pracht wirkte die Fassade wie eben erst gestrichen. Eine Holzbank stand unter einem der Fenster, sonst war alles nach seinen Vorstellungen: keine Vorhänge, keine Bepflanzung in unmittelbarer Nähe des Mauerwerks – der Eindruck von Klarheit wurde durch nichts gestört oder abgeschwächt. Die Fenster mit den Läden auf der rechten Seite, die tiefe, einladend intime Türlaibung, linker Hand das etwas breitere Fenster des Salons und im Dach darüber die eleganten Fledermausgauben. Im Windfang brannte die Deckenleuchte, und als Max diesen kleinen, warm beleuchteten Raum sah, hatte er für einen euphorischen Moment die Empfindung, dieses Licht brenne für ihn, für ihn ganz allein.
»Kommen Sie, kommen Sie, er ist in der Loggia.«
Ungeduldig zog sie ihn hinein. Ein Dienstmädchen nahm ihm Mantel und Blumen ab. Zwei junge Männer mit schütteren Backenbärten unterhielten sich unter dem Rundbogen, Frau Rosen schob Max einfach an ihnen vorbei.
Es war ein sanfter Schock, in die Halle zu treten. Das Eichenholz an den Wänden schimmerte matt und spiegelte die aufgereihten leeren Stühle. Die Mitte des Raumes dominierte ein runder Tisch mit einer großen Kristallschale voller gelber Schlüsselblumen, doch das, was ihn am meisten überraschte, war der Eindruck von Weitläufigkeit. Das Licht floss von allen Seiten herein, durch die Fensterreihe und die verglaste Tür zur Loggia, aber genauso durch die Fenster der Nischen rechts und links. Wie von ihm erhofft, wirkten die Nischen wie Durchgänge zu weiteren großen Zimmern, glaubte man – wie in der Belletage eines Stadthauses – eines von mehreren, über Flügeltüren verbundene Zimmer zu betreten; erst auf den zweiten Blick bemerkte man, dass es Kojen waren – doch dann schlug einen schon der Ausblick über den Hang in Bann und man strebte auf die Loggia zu. Und dort stand der Professor, umringt von jungen Männern in eng geschnittenen Zweireihern.
»Da sind Sie ja!« Er packte Max fest an den Schultern. »Hören Sie, hören Sie einfach nur zu.« Aufgeregt zog er ein Blatt Papier aus seiner Rocktasche und las vor: »›So wirkt das Haus geradezu bescheiden, denn das Obergeschoss ist als Mansardenebene schon Teil des Daches. Selbst die Apsis in der Giebelseite zur Straße erscheint als organischer Bestandteil des Baukörpers – und nicht übergehängt wie die girlandenhaften Effekte der älteren Generation. Diese jungen Architekten erstreben Reife, Ruhe, Ausgeglichenheit, sie verabscheuen jeden Radikalismus und suchen einen ›goldenen Mittelweg‹ zwischen Alt und Neu. Und so wirkt dieses bemerkenswerte Haus auch wie ein Vorwurf, wie eine Ansage an diejenigen, die vor ihnen bauten.‹« Er faltete die Zeitschriftenseite und ließ sie in der Anzugjacke verschwinden, obwohl Max die Hand ausgestreckt hatte, um das Gehörte mit eigenen Augen bestätigt zu sehen. »Taubert! Ich bin sehr froh über das, was Ihnen gelungen ist.«
Deshalb war die Einladung so spät gekommen. Frau Rosen hatte auf die Blüten im oberen Garten und der Professor auf die erste Kritik gewartet, als wäre das Haus erst vollendet, wenn seine Wirkung in Worte gefasst und gedruckt vorlag, wenn es in der Beschreibung verdoppelt und über seine Grenzen hinaus in die Welt getragen worden war. »Verstehen Sie? Taubert verwischt die Übergänge nicht, er unterstreicht sie …« Wie zum Beweis wies Rosen auf den abschüssigen Naturgarten mit den frisch gesetzten Obstbäumen, der sich unter ihnen bis zum Weiher zog. Max war wie berauscht davon, dass er »Taubert« gesagt hatte, als wäre er eine längst anerkannte Autorität.
»Ich frage mich nur, wogegen sich Tauberts Reife eigentlich stellt«, sagte eine Stimme hinter ihm, deren Singsang ihm unangenehm vertraut war. Wagner war an sie herangetreten, wie immer im tadellos sitzenden Anzug, aus dessen Brusttasche die Spitze eines mattweißen Tuchs ragte.
»Das ist wohl offensichtlich. Gegen die Verwirrungen des Jugendstils«, sagte Herr Rosen. »Gegen all die Schnörkel und Ornamente, gegen Zimmer, in denen wir lieber träumen statt klar denken sollen.« Herr Rosen schien über Wagners Auftritt verärgert, obwohl er ihn eingeladen haben musste. Unruhig tasteten seine Hände über die Taschen der Anzugjacke, als würde er etwas suchen, dann entschuldigte er sich, um einen eingetroffenen Gast zu begrüßen. Ohne ein weiteres Wort führte Wagner Max am Arm in die Halle zurück. Seine scharf geschnittenen Züge betonten den breiten Mund, dessen Winkel vor Angriffslust zitterten.
»Rosen hat auf der Einladung nicht zu erwähnen versäumt, dass ein Aufsatz erschienen ist. Du liebe Güte, jetzt werden Gefälligkeitsartikel schon Aufsätze genannt!«
Er nötigte Max auf eine Bank in eine der Nischen, setzte sich daneben und presste mehrere Male ein Taschentuch gegen seine Stirn. Danach schien er sich beruhigt zu haben. Schweigend beobachtete er die hereinströmenden Menschen.
»Selbst die Gästeliste stimmt, finden Sie nicht? Keine Blusenweiber – und nicht eine Uniform! Ich habe Sie übrigens auf der Eröffnung der Städtebauausstellung vermisst.«
»Ich war verhindert«, erwiderte Max.
»Na, Sie haben recht. Was interessiert Sie Groß-Berlin und die soziale Frage, wenn die Musik ohnehin hier unten spielt? Muthesius hat natürlich alle herumgeführt und von England geschwärmt. Kennen Sie ihn eigentlich?«
Max wusste nicht, worauf Wagner hinauswollte, wähnte sich aber auf alles vorbereitet.
»Nicht persönlich.«
»Aber Sie wissen, was er behauptet? Er entwerfe Häuser um Möbelstücke herum. Ein Sessel als Anlass für ein Haus! Unter uns: Muthesius ist kein Architekt, er predigt eine Lebensform. Hinaus aufs Land! Hausmusik, Gartenarbeit. Die Familie als Kunstwerk! Aber ich kann ihm nicht böse sein. Er zeichnet – wie ich! – noch Möbel in die Grundrisse.« Wagner warf ihm einen schnellen Blick zu. »Solche Sentimentalitäten hat Ihnen der Professor sicher ausgetrieben. Pflanzen nur aus Deutschland, nehme ich an?«
Wagner lächelte, ohne ihn anzusehen, aber die schmeichelnden Worte des Artikels schienen ihre immunisierende Wirkung erst jetzt voll in Max zu entfalten. Ruhig strichen seine Finger über das glatte Holz der Bank, auf der sie saßen, und er hatte plötzlich den Duft von Harz und Nadeln in der Nase. Wagner hatte recht. Der Raum an und für sich. Auf geradezu lächerliche Weise hatte der Professor sich gegen jeglichen englischen Einfluss verwahrt und sich vom Königlichen Gartenbauinspektor eine Liste mit einheimischen Pflanzen zusammenstellen lassen, eine Liste, die Frau Rosen als Anregung genommen hatte, ohne sich an sie gebunden zu fühlen.
»Möchten Sie wissen, was ich von dem Haus halte?«, fragte Wagner schließlich.
Max machte eine auffordernde Geste.
»Diese Koje, in der wir sitzen, wurde schon einmal entworfen, und zwar von mir für das Haus Siebert in Magdeburg. Den Kamin dort kenne ich auch und den Rundbogen und die Vertäfelungen – überhaupt kommt mir einiges bekannt vor. Sie haben wirklich eine Gabe, Taubert. Sie atmen die Ideen anderer wie Luft. Aber ich muss zugeben: von außen schlicht, innen geradezu erhaben. Und den Rosens wie auf den Leib geschnitten. Der Professor glaubt ja, durch seinen eigenen Kopf zu spazieren, und Frau Rosen schmeichelt die Halle wie ein Spiegelkabinett.«
Während Wagner sprach, traf Max’ Blick zufällig Frau Rosen. Ganz in der Nähe und dabei mit der Kette vor ihrer Brust spielend, stand sie fröhlich mit einem älteren Herrn zusammen, der ihren Redestrom wie ein bauchiges Gefäß stumm in sich aufnahm. Und Max beschloss, genau so auch die Anschuldigungen Wagners in sich verschwinden zu lassen.
»Es freut mich, dass Ihnen das Haus gefällt«, sagte er nur.
Wagners Mundwinkel hoben sich zu einem Lächeln, zu einem Lächeln, das ganz nach innen gerichtet blieb. Er erwiderte nichts, und für einen Moment entstand eine Pause. Max dachte daran, wie lange er über die Raumaufteilung, überhaupt über das Innere des Hauses gegrübelt hatte. Er hatte die Wünsche des Ehepaares einfach nicht in Einklang gebracht, in ihrer Widersprüchlichkeit waren sie ihm geradezu naiv erschienen, als wäre das Haus für sie vor allem ein Fantasiegebilde, ein irrealer Ort, den man mit allen Vorstellungen belegen konnte, weil er sowieso nie Realität werden würde. Der Professor träumte von einer bewohnbaren Bibliothek, von einem spartanisch klaren Denk- und Rückzugsraum fern von jeder gesellschaftlichen Ablenkung, bestand aber darauf, mit dem Haus die anerkannte, die herausgehobene Stellung seiner Bewohner zu unterstreichen. Er sah sich als Freigeist, als Ausnahmephilosophen in der Tradition Kants und Nietzsches und war doch ängstlich auf das Urteil anderer bedacht. Frau Rosen hatte Max noch weniger verstanden. Sie schwärmte von Geselligkeit und Festivitäten, sprach aber viel öfter davon, sich dem Haus einschmiegen zu wollen wie ein müdes Tier, das sich nach einer Höhle für den Winterschlaf sehnt. Ihre Heiterkeit war mitreißend und ermutigend, doch im nächsten Augenblick konnten ihre Züge gefrieren, und ihre Freundlichkeit bekam etwas Verächtliches. Ich muss die Wünsche hinter ihren Wünschen begreifen, beschwor er sich, doch jedes Mal, wenn er die Augen schloss, sah er keine Räume, sondern immer wieder nur Elsa Rosens melancholisches Gesicht: das schulterlange Haar, die großen Augen mit den hohen, schmalen, aber tiefschwarzen Augenbrauen. Damals arbeitete er noch bei Wagner und brütete an den Abenden verzweifelt über seinen Plänen, zu stolz, ihn um Hilfe zu bitten.
»War das Ihre oder Rosens Idee?«, hatte Wagner belustigt ausgerufen, als er bei einer seiner Runden einen Blick auf die Ansicht mit der Loggia erhaschte. »Da kann der Professor untertänig grüßen, wenn der Kaiser unten ins Jagdschloss fährt. Nur Menschen wie der Professor haben nicht verstanden, dass er verrückt ist.« Erstaunt hatte Max ihm hinterhergesehen. Im Vorbeigehen hatte Wagner jeden Arbeitstisch mit den Fingerspitzen berührt, zufrieden mit sich selbst und als lauschte er einer inneren Melodie. Erst nachdem Max gekündigt hatte, erst als er die versponnenen Vorstellungen der Rosens abgeschüttelt und seine Fantasie von allen Fesseln befreit hatte – erst als er sich erlaubte, die eigenen Wünsche im Haus zu verstecken, fanden die Räume, wie von Zauberhand geführt, zu ihrem Platz und zu ihrer Bestimmung.
»Sie enttäuschen mich«, sagte Max. »Aber da Sie die Kojen schon erwähnen – ist Ihnen nichts aufgefallen? Die Form, die sich ergibt, wenn Sie diese Nischen von Zimmer zu Zimmer mit einer Linie zu einer Gestalt verbinden? Die Wölbung im Holz hinter uns haben Sie nicht bemerkt?« Wagner berührte die Rückwand, und als er ihren leichten Schwung ertastete, schien er zu erbleichen. »Die Kojen in Salon und Bibliothek bilden das Heck, hinter uns haben Sie gerade die Seitenwand meines Schiffes ertastet, dessen Bug weit über die Loggia hinaus in die Luft ragt. Die Loggia als Kommandobrücke und das runde Fenster oben der Ausguck im Mast. Wir segeln, Herr Wagner! Wir balancieren auf dem Kamm der Welle. Sie sehen in diesem Haus meine Zukunft verewigt!«