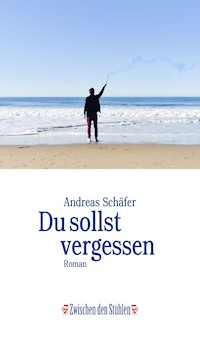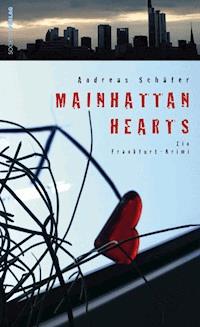10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Besuch nach Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass er an Krebs erkrankt ist, doch Beschwerden hat er keine. Er geht in die Oper, unternimmt einen Ausflug ans Meer, sitzt auf dem Sofa des Sohnes und sagt verwundert: »Dass da was ist!« Aber was? Was ist da im Kopf des Vaters? Er fährt nach Frankfurt zurück, wo er seit der Trennung von der griechischen Mutter allein lebt. Auch zur Biopsie geht er allein. Am Tag der Untersuchung meldet sich ein Arzt und teilt dem Sohn mit, dass der Vater eine Hirnblutung erlitten habe: »Ihr Vater wird sterben«, sagt er. »Er liegt im künstlichen Koma. Sie müssen entscheiden, wann wir die Maschinen abstellen.« Wie damit umgehen, wenn einem das Leben des eigenen Vaters in die Hände gelegt wird? ›Die Schuhe meines Vaters‹ ist ein ebenso erschütterndes wie zu Herzen gehendes Buch über Väter und Söhne und die unerwarteten Wege der Trauer. Aufrichtig, poetisch und einfühlsam erzählt Andreas Schäfer vom eigenen Schockzustand – vor allem aber nähert er sich dem Vater an, dem leidenschaftlich gern Reisenden, dem Kriegstraumatisierten, und ihrem besonderen, nicht immer einfachen Verhältnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Im Sommer 2018 kommt der Vater von Andreas Schäfer zu Besuch nach Berlin. Kurz zuvor hat er erfahren, dass ein vor langer Zeit überwundener Krebs zurückgekehrt ist, doch Beschwerden hat er keine. Er geht in die Oper, unternimmt einen Ausflug ans Meer, sitzt auf dem Sofa des Sohnes und sagt verwundert: »Dass da was ist!« Aber was? Was ist da im Kopf des Vaters? Er fährt nach Frankfurt zurück, wo er seit der Trennung von der griechischen Mutter vor Jahrzehnten allein lebt. Auch zur Biopsie geht er allein, als wollte er sein Einzelkämpferleben erst im letztmöglichen Moment aufgeben. Am Tag der Untersuchung meldet sich der Oberarzt der Neurochirurgie und teilt dem Sohn mit, dass der Vater eine Hirnblutung erlitten habe: »Ihr Vater wird sterben«, sagt er. »Er liegt im künstlichen Koma. Sie müssen entscheiden, wann wir die Maschinen abstellen.« Wie damit umgehen, wenn einem das Leben des eigenen Vaters in die Hände gelegt wird? Wie sich verabschieden, wenn man den Zeitpunkt selbst bestimmen soll? ›Die Schuhe meines Vaters‹ ist ein ebenso erschütterndes wie zu Herzen gehendes Buch über Väter und Söhne und die unerwarteten Wege der Trauer. Aufrichtig, poetisch und einfühlsam erzählt Andreas Schäfer vom eigenen Schockzustand – vor allem aber nähert er sich dem Vater an, dem leidenschaftlich gern Reisenden, dem Kriegstraumatisierten, glücksgewillt und verloren zugleich, und ihrem besonderen, nicht immer einfachen Verhältnis.
© Mirella Weingarten
Andreas Schäfer, 1969 in Hamburg geboren, wuchs bei Frankfurt/Main auf und lebt heute mit seiner Familie in Berlin. Bisher veröffentlichte er die Romane ›Auf dem Weg nach Messara‹ (2002), wofür er u.a. den Bremer Literaturförderpreis erhielt, ›Wir vier‹ (DuMont 2010), der für den Deutschen Buchpreis nominiert war und mit dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde, ›Gesichter‹ (DuMont 2013) und zuletzt den Spiegel-Bestseller ›Das Gartenzimmer‹ (DuMont 2020).
www.andreasschaefer.berlin
Andreas Schäfer
DIE SCHUHEMEINES VATERS
Von Andreas Schäfer sind bei DuMont außerdem erschienen:
Wir vier
Gesichter
Das Gartenzimmer
Die Arbeit an vorliegendem Buch wurde durch den Berliner Senat gefördert.
E-Book 2022
© 2022 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Ralph Fleck: Alpenstück 1/VII, 1991
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Satz: Fagott, Ffm
Druck und Verarbeitung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8258-8
www.dumont-buchverlag.de
I
An einem regnerischen Sonntagnachmittag verlor ich das Gesicht meines Vaters. Ich saß im Publikum eines Konzerts auf der Terrasse einer baufälligen Villa, und so sehr ich mich bemühte, es kamen nur versprengte Details, Bruchstücke, Erinnerungsfetzen, nach außen strebend, in die Leere des Vergessens: eine weiche, in die Stirn fallende Haarsträhne, rosafarbene Haut auf vortretenden Wangen und die klaren, ängstlich wirkenden und gleichsam ins Innere des Kopfes zurückweichenden Augen. Ein Ganzes war nirgends zu finden. Ich hatte das Bedürfnis, über diesen Verlust zu weinen, und wie in Zeitlupe wanderte ein kaltes Kribbeln meine Oberschenkel hinauf. Ich erhob mich, ging gebückt an meiner Frau und unserer Tochter und den anderen Zuhörern vorbei und über die Einfahrt bis zur Straße. Wo war ich? Ich stand irgendwo im Osten von Berlin, erleichtert, allein zu sein, und ratlos über meine Flucht. Die Straße war eine viel befahrene Ausfallstraße. Lastwagen donnerten vorüber, und ich blickte mich mit der Hoffnung der Untröstlichen um, als könnte ich das verlorene Gesicht des Vaters, wenn ich nur intensiv genug schaute, an einem Passanten, im Blattwerk eines Baumes oder im Widerschein des nassen Asphalts entdecken.
Dieses Bild: Sonntags lief der Vater seine Runden um den Fußballplatz in Zeppelinheim. Er trug dazu Adidas-Schuhe, blaue Hosen und ein weißes oder beiges Oberhemd. Er lief immer in getragenen Oberhemden, die zu verschwitzt fürs Büro, aber noch nicht getragen genug für die Wäsche waren. Von einer Bank aus verfolgte ich, wie die Gestalt aus der Ferne näher kam, an mir vorüberzog – »drei«, »vier« oder »fünf« rief ich ihm zu – und wieder kleiner wurde. Im Hintergrund die hohen, gleichförmigen Kiefern des Frankfurter Stadtwalds und das Verkehrsrauschen von der B44. Ich, sein stolzer Rundenzähler.
Während ich dies schreibe, trage ich meine dünne, noch immer feuchte Daunenjacke. Nach Hause gekommen, setzte ich mich sofort an den Tisch, um etwas festzuhalten, zu retten, nein, ans Licht zu bringen, noch weiß ich nicht, was und wie genau. [1]Will ich dem Vater also Anerkennung verschaffen – auch vor mir selbst?
Mein Vater war ein Reisender, und ich möchte mit seiner letzten Reise beginnen, im heißen Juni 2018. Es war keine große oder lange Reise, sie führte von Frankfurt am Main, wo er lebte, zu uns, nach Berlin, wo er im Dezember 1936 geboren worden war. Einundachtzig Jahre alt und ohne jegliche Beschwerden, hatte er wenige Wochen zuvor erfahren, dass ein vor über zwanzig Jahren überwundener Krebs zurückgekehrt war und Metastasen in den Knochen und im Kopf gebildet hatte. In den Telefonaten war es geradezu unmöglich, Genaueres zu erfahren, weil er die Diagnose angstvoll umschiffte (das Wort Tumor kam ihm nicht über die Lippen) und stattdessen ausgiebig über die Art seiner Ärzte sprach: ob sie freundlich, geduldig oder kurz angebunden waren und sich mitfühlend oder eher kühl gaben – als könne der Befund schon nicht so schlimm sein, solange die Ärzte sich menschlich verhielten und den Humor nicht verloren. Seine Erleichterung, als er an die Neurochirurgie der Frankfurter Uniklinik verwiesen wurde und sich dort gut aufgehoben fühlte. Junge Spezialisten, freundliche Pfleger. Weitere Untersuchungen folgten, Beratungen der Fachleute, schließlich ein Zeichen vorsichtiger Hoffnung. Möglicherweise hatte das Etwas im Kopf nichts mit dem zurückgekehrten Krebs zu tun, möglicherweise handelte es sich dabei um einen gutartigen Tumor (in Verbindung mit diesem Attribut durfte das schlimme Wort benutzt werden). Eine Biopsie im Kopf würde Klarheit schaffen. Und davor könne er wie geplant nach Berlin kommen. Wie geplant. Sein zufriedenes Glucksen in der Stimme, als hätte er den Ärzten diese Reise abgeluchst.
Ich erwartete ihn am späten Vormittag am Hauptbahnhof – für Züge, die Frankfurt im Morgengrauen verließen, gab es die günstigen Tickets. Als der erste Pulk Reisender an den Rolltreppen verschwunden war, sah ich seinen riesigen rosafarbenen Schalenkoffer auf dem Bahnsteig. Mein Vater stand daneben, kam schon auf mich zu, mit schnellen, kleinen Schritten. Wir umarmten uns, ein eingespieltes festes Umfassen des kompakten, eher harten Körpers, in dem sich das Bedürfnis nach Nähe und die Scheu vor ihr die Waage hielten. Ich war froh und verlegen, dass ihm nichts anzusehen war. Der Koffer wog schwer. Die Anzüge, natürlich! Die Anzüge für die Oper, das Theater, für die guten Gelegenheiten und die Wanderschuhe für die Tagestouren durch den Grunewald oder an die Potsdamer Seen. Wir brachten das Gepäck in sein Charlottenburger Hotel am Stuttgarter Platz, in dem er seit Jahren abstieg und in dem sonst gern Russen verkehrten – saßen danach auf der Terrasse eines Lokals am Karl-August-Platz. Er war aufgekratzt, fahrig, das konnte auch an der Vorfreude auf seine Enkeltochter liegen oder daran, dass er eine Woche nicht mit Ärzten, Diagnosen und Therapiemöglichkeiten zu tun haben würde. Sein Blick wanderte staunend umher, über die Grünflächen des Platzes, zur Kirche und den mit Säulen und Putten geschmückten Gründerzeitfassaden, als sei er verwundert, es mal wieder ans rettende Ufer in sein Berlin geschafft zu haben. Tatsächlich, er war da, in seinem Berlin.
»Wie geht es dir?«, fragte ich.
»Es geht mir gut. Das ist es ja. Ich spüre überhaupt nichts.«
Sein Blick rutschte an mir vorbei. Schon lag der in Kunstleder eingefasste Terminkalender auf dem Tisch, als sei das Thema Krankheit damit beendet. Wir besprachen Unternehmungen: Restaurantbesuche, Abende zu viert oder zu dritt, Ausflüge mit seiner Enkelin – und welche Tage er allein verbringen wolle. Er hatte viel vor, war gewillt, das Beste aus der kommenden Woche zu machen. Tief über den Tisch gebeugt, schrieb er Daten und Uhrzeiten auf einen Zettel und schob ihn zu den anderen in den Kalender. Vorsichtig versuchte ich es ein weiteres Mal, wollte wissen, was die Ärzte zuletzt gesagt hätten und wie es nach dem Eingriff weitergehe. Sein Gesicht verzog sich, das werde man sehen, sagte er, wurde vage, seine Augen begannen zu schwimmen, bis er, glücklich über den rettenden Einfall, lachend erzählte, was eine Ärztin ihm erst kürzlich auf dem Klinikgang zugerufen hatte: »Mit den Knochen werden sie hundert.«
Bestens gelaunt, in Berlin immer bestens gelaunt. Er schipperte mit seiner Enkelin auf einem Spreedampfer durch die frühsommerliche Stadt (und erzählte ihr und den Sitznachbarn, wie er als Kind auf der Jagd nach abgeworfenen Süßigkeiten der Rosinenbomber in Stacheldraht gegriffen und sich die Hand so schlimm aufgerissen hatte, dass die Narbe noch immer zu sehen war). Zu viert besuchten wir seinen Lieblingsitaliener in Steglitz, in dem jeder Gast wie ein Freund mit Handschlag begrüßt wird. Wir schlenderten auch über die Steglitzer Woche, einem Rummel wie aus vergangener Zeit am Ufer des Lankwitzer Teltowkanals, aßen Bratwurst im Gedudel der Automaten und dem vernuschelten »Wer will noch mal, wer hat noch nicht« aus dem Kassenhäuschen eines Kettenkarussells.
»Ah, da bist du, meine Junge«, sagte er, wenn wir uns, wie fast jeden Nachmittag, im türkischen Café am Platz vor unserem Haus trafen. Schon von der Straße hatte ich ihn durchs Fenster gesehen: Die Beine übereinandergeschlagen, löste er Sudoku in einem Rätselheft. Die Multifunktionsjacke, die Brille, deren Gläser bei Sonne dunkelten. Telefon, Wasserflasche, F.A.Z. Mein Vater inmitten seiner Siebensachen.
Und die Krankheit? Solange unsere Tochter in der Nähe war, wurde sie nicht erwähnt, aber auch sonst nur nebenbei, gleichsam am Rande der Gespräche und immer wie etwas, das zwar ernst zu nehmen war (er durfte nicht mehr Auto fahren), dem man aber, solange das Ergebnis der Biopsie nicht vorlag, nicht allzu viel Raum geben sollte, um die gemeinsame Zeit nicht unnötig zu beschweren. Früher oder später würden wir darüber sprechen, das wusste ich, doch da ich ihm nicht die Laune verderben wollte, wartete ich. Ich wartete auf die passende Gelegenheit, darauf, dass er selbst davon anfing. Mein Vater sprach viel und gern über sich, immer schon. Aufschießende Erinnerungen fanden einen unmittelbaren Weg auf seine Zunge, Einschätzungen, Meinungen mussten augenblicklich formuliert und zum Besten gegeben werden. Besonders bei guter Laune rissen ihn die Assoziationen vom Hölzchen aufs Stöckchen – doch manchmal erschien mir sein Reden wie das Pfeifen im Walde, eine Verlegenheitslösung, um von etwas anderem – seiner Angst, seiner Empfindlichkeit, einer nie geschlossenen Wunde – abzulenken. Es war etwas Wolkiges um ihn, die Nervosität des Verletzlichen, und die Art, in der er sein Herz auf der Zunge trug, war nicht frei von Perfidie. Seine Impulsivität nahm in Beschlag, nötigte das Gegenüber zu aufmerksamem Zuhören oder zu ebenfalls offenherzigen Bekenntnissen. Gab man etwas von sich preis, verlor er nicht selten die Konzentration, schweifte ab, und man konnte mit dem verdatterten Gefühl zurückbleiben, reingelegt oder gar bestohlen worden zu sein. Die Zeit, in der ich glaubte, gegen dieses In-Beschlag-genommen-Werden opponieren zu müssen, lag nahezu drei Jahrzehnte zurück. Auch wusste er von seinem Hang und versuchte sich, vor allem im Beisein seiner geliebten Enkeltochter, zu beherrschen. Ohnehin hatte ihn die Rolle des Großvaters beruhigt (als sei sie weniger unheimlich als die des Vaters), und mit ihr hatte sich auch zwischen uns eine andere Verbundenheit ergeben. Telefongespräche verliefen in herzlicher Ausgelassenheit, wir sprachen über Zeitungsartikel und Reisevorhaben, und als er begann, eigene Artikel zu veröffentlichen, fragte er mich gelegentlich um Rat. All das hieß aber nicht, dass unser Zusammensein frei war von Beklommenheit und der Angst vor unbeabsichtigter Kränkung.
Ich ahnte, warum er zögerte, über das zu sprechen, was ihn nach der Biopsie erwartete – Bestrahlung oder Chemotherapie. Er war ein Einzelkämpfer, seit der Trennung von meiner Mutter hatte er über Jahrzehnte allein gelebt. Es lag auf der Hand, dass sich mit dem Fortschreiten der Krankheit auch unser sorgsam austariertes Verhältnis wandeln würde. Wir würden die vorsichtige, aus Schutz vor Verletzung eingespielte Halbdistanz hinter uns lassen und aus der Deckung kommen müssen. Ich würde öfter nach Frankfurt fahren und ihn möglicherweise zu Untersuchungen begleiten, vielleicht für ihn einkaufen und zur Apotheke gehen. Er müsste Hilfe annehmen, mir nach und nach Einlass in seinen Alltag gewähren, und irgendwann würden die Ärzte vielleicht nicht mehr mit ihm, sondern mit mir sprechen, und er würde die Hoheit über seine Geschichte verlieren. Ich konnte mir seine Ängste nur vorstellen.
Erst am Abend vor seiner Rückreise – wir saßen zu zweit in unserem Wohnzimmer – sprach er die Sache an. Seine kleinen Füße steckten in Wollsocken (seine guten Wandersocken). Er trug Jeans und – wie meistens – einen roten Pullover mit V-Ausschnitt. Er hatte den Oberschenkel leger angewinkelt aufs Sofa gezogen, doch auf seinem Gesicht lag ein banges Lächeln. Mit einer fahrigen Bewegung strich er über seine glatte Stirn.
»Es ist verflixt. Ich habe keine Schmerzen. Ich spüre nichts. Nur manchmal so ein inneres Streifen. Aber da ist was!«, rief er. Dann, eher verwundert als verzweifelt: »Dass da was ist?«
Ich fragte ihn, wie die Sache entdeckt worden sei. Er hatte es mir erzählt, mehrere Male schon, aber ich wollte, dass er von der Freundlichkeit seiner Ärzte sprach, von seiner Hausärztin in Neu-Isenburg, die sich regelmäßig eine Stunde für ihn Zeit nahm, von seinem Orthopäden, von dem Neurologen, schließlich von den Ärzten der Neurochirurgie der Universitätsklinik, ich wollte, dass er von denen erzählte, die jetzt für ihn zählten und auf die er sich verlassen musste. Er habe sich erkundigt, sagte er, die Frankfurter Neurochirurgie sei für ihre fortschrittlichen Methoden international angesehen, da wirkten Koryphäen ihres Fachs. Ich schlug ein weiteres Mal vor, nach Frankfurt zu kommen und ihn zum Eingriff zu begleiten, ein weiteres Mal winkte er ab. »Nein, nein. Komm lieber, wenn es ernst werden sollte«, sagte er, als wollte er den Moment, in dem es mit seinem Alleinkämpfertum vorbei war, hinauszögern, so lange es ihm möglich war. Oder als stehe ihm nur ein begrenztes Maß an Sohnes-Zuwendung zu, das er nicht zu früh aufbrauchen wollte.
Worüber sprechen? Nicht länger über die Krankheit, nein, das ging nicht, genauso unpassend erschien es mir, über etwas anderes zu reden, schon gar nicht über meine Angelegenheiten (am Tag hatte ich erfahren, dass der Verlag einen Roman angenommen hatte). Da war ein seltsames Gefühl, ich weiß nicht, es wehte mich an, verengte mir die Kehle. Woher kam es? Die Seele ist nichts Innerliches, sie reicht von dir, von deiner Haut, bis zur Grenze des anderen. Ich hatte das beklemmende Gefühl, wir könnten zum letzten Mal hier sitzen, hier auf dem dunkelblauen Sofa mit diesem Blick in das Grün der Linden vor den großen Fenstern, mehr noch, zum letzten Mal gemeinsam in Berlin sein, in unserem Berlin, in das ich möglicherweise auch seinetwegen zum Studium gekommen war und in dem ich – wer kann das wissen? – vielleicht noch immer gerade für ihn die Stellung hielt. Hier in Berlin, wo er als Siebenjähriger im Januar 1944 die Ausbombung des elterlichen Geschäfts- und Wohnhauses erlebt hatte (und daraufhin wegen eines zurück gebliebenen Schock-Herzens im Amphitheater der Charité als interessanter Fall vorgeführt wurde); hier, wo er als Friedenauer Oberschüler die Liebe zum Theater und zum Reisen entdeckte (besonders die zum Trampen); hier in Berlin, wo ihm aber auch, als er Jahre später mit seiner Verlobten aus Hamburg anreiste, die tiefste Wunde zugefügt worden war: von den Eltern verstoßen und enterbt, weil er es gewagt hatte, eine Ausländerin, eine mittellose Griechin, meine spätere Mutter, mitzubringen.
Früher hat mich seine unerschöpfliche Wut, sein die Grenze zum Tötenwollen überschreitendes Außer-sich-Geraten, ein nie versiegendes, in mich hineinströmendes Gurgeln und Schäumen, unmittelbar mit den Schrecken des zwanzigsten Jahrhunderts verbunden. Mit der Angst vor dem Bombenalarm und dem Schock über den Verlust der Existenz, mit der Gewalt und der Unbarmherzigkeit seiner Eltern.
»Hättest du Lust, mir etwas aus deinem Leben zu erzählen?«, fragte ich.
»Natürlich«, erwiderte er überrascht. Er wusste, dass ich solch ein Wer-weiß-wofür-es-gut-ist-Gespräch vor Jahren mit meiner Mutter geführt hatte. »Natürlich«, wiederholte er erfreut.
Während ich mit zitternden Fingern den Batteriestatus des Aufnahmegeräts prüfte und ein altes Interview löschte, um Speicherplatz zu schaffen, löste sich der Knoten in meinem Hals. Als ich kurz darauf mit Aufnahmegerät, Wasser und Wein aus der Küche zurückkam, war der Knoten wieder da. Mein Vater saß dort, in seinem ausgeleierten Pullover, gespannt auf das, was der Sohn, was ich fragen würde.
»Was ich schon lange wissen wollte …«, begann ich.
»Das Geheimnis!«, unterbrach er mich.
»Ein Geheimnis?«, erwiderte ich verdutzt. »Gibt es denn eins?«
»Nicht dass ich wüsste«, sagte er belustigt. »Du klangst nur so, als käme nun die Frage nach: dem Geheimnis …« Sein Spott erleichterte mich. Selten hatte er sich so liebevoll über mich lustig gemacht.
»Na, schieß los, mein Junge. Was willst du wissen?«
Er fuhr nach Frankfurt zurück, und wir telefonierten täglich. Am Abend vor der Biopsie erreichte ich ihn, als er gerade aus der Klinik kam, wo er letzte Einzelheiten seines Aufenthaltes besprochen und die Einverständniserklärung für den Eingriff unterschrieben hatte. Er war aufgewühlt und verärgert, dass die Ärzte ihn zuvor nicht ausreichend auf die möglichen Komplikationen vorbereitet hatten. Geradezu entsetzt war er von der ellenlangen Liste zurückgeprallt.
»Solche Formulare muss man immer unterschreiben«, sagte ich, um ihn zu beruhigen. »Bei jedem Eingriff.«
»Ja, du hast recht, natürlich.«
Tatsächlich stieg seine Laune. Gerührt erzählte er, dass eine Pflegerin – »sie stammt aus Eritrea« – versprochen habe, seine Hand zu halten, wenn er aus der Narkose erwache. Er habe auch mit einem Schulfreund und seiner Patentochter in Leipzig gesprochen. »Du weißt gar nicht, wie sehr mich solche Dinge freuen.« Plötzlich rief er: »Ach, es ist schön, Freunde und Familie zu haben!« Ich wünschte ihm Alles Gute, dann verabschiedeten wir uns, er wollte noch mit meinem Bruder in Athen sprechen. Er melde sich morgen, sobald er nach der Narkose dazu in der Lage sei.
Als ich am folgenden Mittag in meinem Schreibzimmer seinen Anruf erwartete, blinkte eine unbekannte Nummer mit Frankfurter Vorwahl im Display auf. Eine weibliche Stimme sagte »Universitätsklinikum Frankfurt« und nuschelte atemlos einen Namen, den ich kaum hörte.
»Sind Sie der Sohn von Robert Schäfer?«
»Ja«.
»Ihr Vater hat mir diese Nummer hinterlassen.« Sie holte Luft. »Es gab eine Komplikation. Wäre es Ihnen möglich, in die Klinik zu kommen, um zu besprechen, wie wir weiter verfahren?«
Weiter verfahren? Mein Herz schlug mir bis zum Hals.
»Was ist passiert?«
»Das können wir Ihnen am Telefon nicht sagen.«
»Ich komme sofort, aber das wird einige Stunden dauern. Ich bin in Berlin.«
Angesichts meines späten Eintreffens schien sie abzuwägen, worüber sie sprechen durfte und was die Richtlinien ihr eindeutig verboten. War sie eine Ärztin oder Pflegerin, gar die Pflegerin aus Eritrea, die versprochen hatte, die Hand meines Vaters beim Aufwachen aus der Narkose zu halten?
»Ich spreche mit dem Oberarzt«, sagte sie schnell.
Wenige Minuten darauf meldete sich der Oberarzt und teilte mir mit ruhiger Stimme mit, dass die Biopsie zwar gut verlaufen sei, mein Vater im Vorfeld jedoch eine Hirnblutung erlitten hatte.
»Möglicherweise wurde die Blutung durch den hohen Blutdruck ausgelöst, er war sehr aufgeregt. Genau können wir das nicht sagen.« Mit dem Eingriff selbst habe die Blutung nichts zu tun, fuhr er fort, nicht direkt, denn sie sei an einer anderen Stelle im Hirn aufgetreten. »Im Stammhirn«, sagte er und ließ eine Pause. Ich verstand nicht, was er damit andeuten wollte. »Das Stammhirn regelt die wichtigsten Funktionen des Körpers, die Atmung und den Blutdruck. Mit einer Blutung in diesem Hirnbereich ist leider kein Leben mehr möglich.«
Er schwieg.
»Mein Vater wird sterben«, sagte ich nach einer Weile, verwundert über den Klang meiner Stimme.
»Es tut mir leid.«
»Wann?«
»Im Moment ist er stabil. Wir haben ihn ins künstliche Koma versetzt. Sobald die Maschinen abgestellt werden, wird er versterben.«
»Wird er noch einmal aufwachen?«
»Nein.« Als ich darauf nichts erwiderte, sagte er: »Sie sollten – ganz in Ruhe – kommen.«
»Um Abschied zu nehmen«, sagte ich, mehr zu mir als zu ihm. Er ließ erneut eine lange Pause.
»Und um zu entscheiden, wann wir die Maschinen abstellen.«
Das Gespräch ging weiter. Der Arzt erwähnte Uhrzeiten und Behandlungsschritte, um mir ein konkretes Bild von den Abläufen zu vermitteln. Er sagte, dass sie stutzig geworden seien, als mein Vater nicht aus der Narkose erwacht sei – woraufhin sie eine Computertomographie durchgeführt und die Hirnblutung entdeckt hätten. Er sagte, dass der Tumor, wie befürchtet, bösartig gewesen sei und die Prognose ohnehin nicht günstig. Ich betete, dass er weitersprach, nicht aufhören würde zu reden, denn solange ich seine Stimme hörte, war ich nicht allein mit meinem Entsetzen.
Und dann? Saß ich da, in meiner Schöneberger Schreibklause, die plötzlich anders erscheinenden Dinge im Blick? Die Teekanne, die Schale, die Bücher? Blickte ich in eine von einem auf den anderen Moment andersfarbige Welt, wie es eine Figur in einem Roman tun würde? Dies ist kein Roman, auch wenn das, was im Entstehen begriffen ist, zwangsläufig romanhafte Züge aufweist. Ich spüre schon die Muster und Bögen entstehen, Motive, Schlüsselmomente, Ankersätze. Und wie beim Romanschreiben zeichnen sich Fluchtpunkte ab, Anhöhen in der Ferne, auf die ich mit ansteigender Spannung zustrebe, weil ich nur eine ungefähre Vorstellung davon habe, wie es danach weitergeht. Einen ersten Fluchtpunkt bildete der Satz: Mein Vater wird sterben.
Ich darf nicht so tun, als lägen die Ereignisse nicht über zwei Jahre zurück. Vorhin habe ich meine Frau zum Zug in die Schweiz gebracht, eben kam unsere Tochter zwischen zwei Stunden Online-Unterricht ins Arbeitszimmer und sagte: »Wir haben nicht genug Parmesan!« Und doch scheint seit damals nichts vergangen, geht es nur und immer wieder um diesen Moment und die Unerschöpflichkeit dessen, was er immer in sich tragen wird: Jetzt ist es also so weit.
Ich weinte jämmerlich.
Habe ich damals wirklich auf dem Teppich gelegen und an die Decke gesehen, bevor ich das Fenster geöffnet und mich weit hinausgebeugt habe, immer weiter hinausgebeugt, um einen Blick in den schmalen Hof mit den Fahrrädern und den Mülltonen zu werfen? Wie durch Nebel erinnere ich mich dagegen genau, dass ich im Laufe der folgenden Telefonate auf und ab gegangen bin, immer die Längsseite des Schreibtisches entlang, während ich mit dem Arzt am Schreibtisch sitzend gesprochen hatte.
Meine Frau aß mit unserer Tochter gerade in einem Restaurant. Ich bat sie, das Lokal zu verlassen, damit unsere Tochter ihr die Nachricht nicht vom Gesicht würde ablesen können. Dann bat ich sie, ihr noch nichts zu sagen.
»Was?« Der sich in die Höhe schraubende Schrei meiner Mutter, die ich in ihrem Hotelzimmer erreichte. In Athen lebend, war sie mit einer Freundin zufällig (was hat das Wort hier verloren?) zwei Tage, nachdem mein Vater Berlin verlassen hatte, zu Besuch gekommen. Dankbar nahm ich zur Kenntnis, dass sie augenblicklich zu schluchzen begann.
Erst auf der Vespa mit den seit Ewigkeiten in Fleisch und Blut übergegangen Abläufen des Fahrens konfrontiert, merkte ich, dass meine Gefasstheit vorgeschützt war. Nicht ich bewegte mich, es war die Stadt, die in Gestalt kulissenhafter Häuserzeilen rechts und links an mir vorüberzog.
Wir saßen auf dem Sofa im Wohnzimmer und weinten, alle drei, auf dem gleichen Sofa, auf dem mein Vater vor wenigen Tagen gesessen und amüsiert »Schieß los, mein Junge. Was willst du wissen?« gesagt hatte. In der Stille fand unsere Tochter als Erstes die Sprache wieder. Fast trotzig sagte sie: »Er hat aber auch ein schönes Leben gehabt. Mit all seinen Reisen!« Sie ging in ihr Zimmer, um Abschiedsbriefe zu schreiben, einen, den ich nach Frankfurt mitnehmen sollte, und einen, den sie draußen auf die Fensterbank klebte, damit er ihn von oben lesen konnte.
In der Nacht träumte ich von ihm. Mein Vater stand auf der anderen Straßenseite an einem Fußgängerübergang. Er trug den roten Pullover mit V-Ausschnitt. Er wartete, ohne mich anzusehen. Er wartete darauf, dass ich die Straße überquerte und zu ihm kam. Der Sohn geht zum Vater. Der Sohn geht zum Vater zurück. Der Sohn geht ein letztes Mal zum Vater.
Meine Eltern hatten sich vor über dreißig Jahren getrennt, aber nie scheiden lassen. Mitte der Achtzigerjahre – ich war fünfzehn und mein Bruder zehn – war mein Vater aus dem Reihenhaus in Zeppelinheim, einer Ortschaft südlich von Frankfurt, ausgezogen. Die ersten Jahre hatte er in einem Hochhaus im benachbarten Neu-Isenburg gelebt, ab Mitte der Neunzigerjahre dann im vierzehnten Stock eines Wohnturms in Sachsenhausen mit Blick über die Frankfurter Skyline, während meine Mutter schon seit zwanzig Jahren wieder in Griechenland lebte. Neue Beziehungen waren entstanden und wieder in die Brüche gegangen. Die letzten Jahre, sie waren beide seit Langem wieder allein: freundschaftliche Annäherung, die Sorge umeinander, telefonischer Austausch über die Söhne und das Enkelkind, auch über finanzielle Dinge. Wenn meine Mutter, wie viele in ihr Land Zurückgekehrte, einmal im Jahr für Arztbesuche nach Deutschland kam, erwartete er sie am Frankfurter Flughafen und ließ es sich nicht nehmen, sie zu dem befreundeten griechischen Ehepaar nach Neu-Isenburg zu fahren, das sie über Wochen beherbergte. Seine Verbundenheit reichte tief: Sobald er etwas Schönes mit seiner Enkelin erlebte, wollte er die Freude mit meiner Mutter teilen. »Das Foto schicken wir Jiajiá nach Athen!« Wie weit wiederum ihr Verantwortungsgefühl ging, hatte sich erst Tage zuvor erwiesen. Sie wolle ihn, sollte sich sein Zustand verschlimmern, gern zu sich nach Athen nehmen, hatte sie mir gesagt. Sie würde in den vorderen Teil der Wohnung ziehen, sodass die hinteren zwei Zimmer frei würden – eines für meinen Vater, eines für eine Pflegerin.
Und nun saßen wir gemeinsam im ICE nach Frankfurt, um zu entscheiden, wann die Maschinen abgestellt würden.
Mein Bruder würde nicht dabei sein. Er leidet unter psychischen Problemen und starker Flugangst und fürchtete, durch die Aufregung aus seinem empfindlichen emotionalen Gleichgewicht zu geraten, das nur die Einnahme einer langwierig zusammengestellten Medikamentenkombination bewahrte. »Ihr macht schon das Richtige«, hatte er am Telefon mit einer Stimme gesagt, aus der ich gleichermaßen Angst und Erleichterung hörte.
Es war ein sonniger Mittwochvormittag, der Zug nur spärlich besetzt. Wir redeten kaum. Ich blickte auf die vorüberziehende Landschaft, versuchte nur an das zu denken, was ich sah, Häuser, Felder, Straßen, verfolgte Fahrradfahrer oder Autos auf Sandwegen, bis sie aus dem Blickfeld glitten. Solange ich die Konzentration hielt, öffnete sich in mir eine überwältigende Klarheit, eine geradezu abstrakte Erkenntnis seines Niemehrdaseins – als würde, während mein Blick an den Erscheinungen der Außenwelt haftete, ein inneres Auge staunend in die Leere des Universums blicken. Trieben die Gedanken zum letzten Telefongespräch – »Mach’s gut, mein Junge«– oder zum gemeinsamen Besuch auf der Steglitzer Woche, als er sich »Wo soll das nur enden?« murmelnd, erschöpft auf einer Bierbank niederließ: ein Bedauern, so allumfassend, dass ich hätte schreien können.
Als meine Mutter in leise geführten Telefonaten mit Verwandten eine erste Erzählung über das Unbegreifliche breitete – keine Schmerzen, kein Leiden und bis zum Schluss behielt er seine Eigenständigkeit –, erhob ich mich entsetzt, um ihr nicht über den Mund zu fahren.