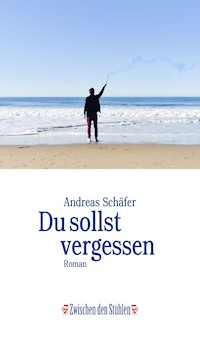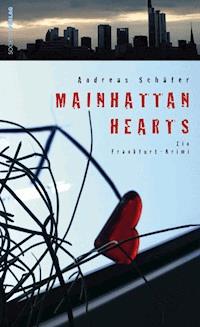7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lothar war Pilot – bevor es geschah. Seine Frau Ruth war damals Stewardess, nun hilft sie in der Telefonseelsorge, damit es wenigstens anderen besser geht. Ihr Sohn Merten glaubt, als Einziger zu wissen, warum sein Bruder ermordet wurde. In der Familie Wilber klafft eine Lücke. Man redet nicht über Jakob und über den Grund, warum er nicht mehr da ist. Am Tag der Verurteilung des Mörders zünden sie eine Kerze an und warten, bis der Anruf kommt: Lebenslänglich. Nachts liegen die Eltern nebeneinander, und die Mutter fragt: „Bist du erleichtert?“ - „Nein.“ Andreas Schäfer erzählt luzide und souverän die Geschichte eines Traumas und seiner Folgen. Sie lässt den Leser nicht mehr los.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Schäfer
Wir vier
Roman
eBook 2010
© 2010 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
ISBN eBook: 978-3-8321-8545-9
www.dumont-buchverlag.de
für Mirella
für Ava
Nichts – nur das Sirren des Windes in den Kiefern hinter dem Grundstück. Das Bett neben ihr war leer, und Lothars Decke bildete im Mondlicht einen bizarren Hügel, als sei sie wütend zurückgeschlagen worden. Ruth stützte sich auf. Sie sah sein Hemd über der Stuhllehne, auf der Sitzfläche die Zeitschrift, in der er geblättert hatte, als sie am Abend ins Zimmer gekommen war. Sie lauschte in die Stille hinein. Es dauerte, bis sie etwas vernahm, Schritte von unten aus der Küche und, kaum wahrnehmbar, Scheppern von Geschirr. Klirrende Flaschen in der Kühlschranktür. Dann, wesentlich lauter, ein Rumpeln aus dem Flur. Er trug die Schuhe, mit denen er im Garten arbeitete. Ihr aufgestützter Arm begann zu zittern, während sie hörte, wie ihr Mann die Kellertreppe hinunterstieg. In den letzten Monaten war es vorgekommen, dass er mitten in der Nacht Löcher für neue Rosenstöcke ausgehoben hatte, und bei der Vorstellung, dass er gleich die bemoosten Stufen zur hinteren Terrasse hinaufstapfen und im gelblichen Licht der Ballonlampen seinen Spaten in die Erde stoßen könnte, presste sie kurz die Augen zusammen und drehte sich ruckartig zur Tür, um das Bild zu vertreiben. Da stand er, in Boxershorts, und sah zu ihr hin. Sie brachte kein Wort heraus.
»Hab ich dich geweckt?«
»Ich dachte, du bist unten«, flüsterte sie und sank erleichtert ins Kissen zurück. Baumschatten huschten über die Dachschräge. Gestern hatte sie einen Spaziergang unternommen, während er über seinen großformatigen Bögen brütete. Der Wald war menschenleer gewesen, der Sand am Ufer der Kiesgrube hatte im Abendlicht geleuchtet wie Schnee. Und auf dem Weg zurück war sie so ruhig geworden, dass ihre Schritte jede Anstrengung verloren. Lothar stand noch immer in der Tür. Sein Körper wirkte massiger als sonst, der harte Zug um seinen Mund war fort, doch die Arme standen ab wie unter Spannung.
»Bist du schon lange wach?«, fragte sie. Er erwiderte nichts. »Alles in Ordnung?«
»Zu viele Zeichnungen im Kopf«, sagte er.
So weit sie es überblickte, hatte er seine Pläne kurzfristig über den Haufen geworfen. Statt Gebäude für Unterrichtsräume und Werkstatt wollte er nur noch einen kleinen Hangar auf das Gelände setzen. Sie wartete darauf, dass er ins Zimmer trat oder weitersprach, aber er blieb, wo er war, als hielte ihn etwas zurück. Schließlich sagte sie:
»Mein Fuchs war wieder da.«
Lothar kam nicht näher, lehnte sich aber an den Türrahmen und verschränkte die Arme vor der Brust. Sie konnte seine verschatteten Augen nicht erkennen, doch ein erwartungsvoller Ausdruck lag auf seinen Zügen. Sie wusste, dass er ihren Fuchs mochte, obwohl er ihm auf seinen Spaziergängen nie begegnete.
»Erst hab ich wieder das Knacken im Gehölz gehört«, sagte sie. »Dann brach er durchs Gebüsch und trabte zehn Meter vor mir her. Ich hab gehofft, er würde mich bis zur Holzbrücke begleiten, doch plötzlich blieb er stehen, hob die Schnauze und war – zack – wieder im Unterholz verschwunden.« Sie meinte etwas wie Enttäuschung in Lothars Gesicht auszumachen. Keine zögernde Annäherung, kein Umeinanderstreichen, dieses Mal gab es von keinem Tanz zwischen dem Tier und seiner leise flüsternden Frau zu berichten. »Ich dachte, ein anderer Spaziergänger auf dem Weg nach Blumenhagen hat ihn verschreckt, aber als ich zur Gabelung kam, war weit und breit niemand zu sehen. Da lag nur ein Heft, aufgeschlagen, genau in der Mitte des Weges.«
»Was für ein Heft?«
Die scharfen Linien hatten sich wieder in seine Wangen gegraben. Sie saß aufrecht, ein Kissen im Rücken, und während sie Lothar ansah, wusste sie schützend das Haus um sich – der leere Raum bis zu den Dachbalken, die Abgeschlossenheit der Zimmer, die Weite des Wohnbereichs unter ihnen –, ein verwinkeltes Gehäuse, in dem sie sicher war.
»Ein Heft mit Bildern«, sagte sie. »Ein blutüberströmter Körper mit verdrehten Gliedern, neben dem eine Autotür auf der Straße lag. Ein verbogenes Stück Leitplanke ragte in den Himmel. Und weißt du, was die nächste Seite zeigte?«
»Du hast das Heft aufgehoben?«, fragte er ungläubig.
»Ich hab mit dem Fuß geblättert. Die Überreste eines Busses, in dem offenbar gerade eine Bombe hochgegangen war. Und dann war da noch ein gefesselter Mann, auf einer ganzen Doppelseite, Mund und Augen mit Klebeband verschlossen, neben seinem Gesicht ein Gewehrkolben.« Sie füllte ihren Bauch mit Luft. »Das ganze Heft bestand aus Gewaltbildern. Jemand muss es dort hingelegt haben, um Spaziergänger zu erschrecken.«
Sie spürte seinen forschenden Blick.
»Was hättest du an meiner Stelle gemacht?«, fragte sie.
»Was? Nichts natürlich. Ich wäre weitergegangen. Vielleicht hätte ich es auch in den Graben getreten und mit Laub bedeckt, damit kein Kind es findet.«
Auch ihre erste Reaktion war gewesen: Weitergehen. Ignorieren. Doch dann war ihr die neugierige Abscheu desjenigen eingefallen, der das Heft als Nächstes finden würde, wenn sie es nicht aus dem Weg schaffte.
»Das habe ich auch gemacht«, sagte sie. »Ich habe es mit der Schuhspitze zur Seite befördert und Erde drübergeschoben. Aber dann dachte ich: Was ist, wenn ich beobachtet werde? Wenn einer von diesen Spannern, die tagsüber um die Kiesgrube schleichen, im Gebüsch hockt und jeden meiner Schritte verfolgt? Er könnte warten, bis ich weg wäre, und das Heft wieder hinlegen.«
»Du hast es angefasst!«
»Ich habe ein Blatt gesucht und es damit aufgehoben, und dann habe ich das Heft mitgenommen und entsorgt.«
Bei dem Gedanken an ihre Tat ergriff Ruth wieder das gestrige Hochgefühl, das umso erhebender gewesen war, weil sie es nicht erwartet hatte. Unschlüssig hatte sie auf das Häuflein Erde gestarrt, unter dem die zerknitterte Ecke des Heftes herausschaute. Entfernt war das Rauschen der Autobahn zu hören gewesen. Sie hatte keine Angst, aber ihr Herz pochte. Sie nahm ein Blatt vom Boden, zog das Heft mit spitzen Fingern unter dem Sand hervor und rollte es zusammen, peinlich darauf bedacht, das Papier nicht direkt zu berühren. Sobald sie die Rolle zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, war der Schauder verschwunden. Und niemand hatte sie verfolgt.
Sie strich Lothars Decke glatt, ließ die Hand darauf liegen und sah ihren Mann an – doch Lothar reagierte nicht.
»Was heißt entsorgt?«
»Ich habe es verbrannt.«
»Verbrannt?«
»Ich habe es in der Küchenspüle verbrannt.«
»Du hast diesen Dreck ins Haus gebracht?«
»Ich wollte es nicht wegschmeißen, ich wollte, dass es sich auflöst, dass es verschwindet, und weil ich keine Streichhölzer dabei hatte, musste ich es mitbringen.«
»Du stehst in der Küche und verbrennst ein Heft, das du aus dem Wald mitbringst? Das irgendein Perverser ausgelegt hat?«
»Genau«, sagte sie trotzig.
Lothars Augen schimmerten angriffslustig. Er würde sich auf jedes ihrer Worte stürzen, aber da sie schwieg, schüttelte er nach einer Weile nur den Kopf und ging ins Badezimmer. Sie hörte, wie der Strahl ins Waschbecken traf, wie Lothar schnaubte und sich Wasser ins Gesicht schaufelte. Sie hatte in der Küche gestanden und dabei zugesehen, wie die Glut sich durch das beschichtete Papier gefressen hatte. Vier Streichhölzer hatte sie entzünden müssen, bis auch der letzte bedruckte Rest zu weißlicher Asche geworden war, die an ihrer Haut klebte, als sie mit dem Finger hindurchfuhr. Als Lothar wieder in die Tür trat, schien sein Ärger verschwunden. Ein undefinierbares Lächeln lag auf seinem Gesicht, er hielt ihr ein Glas mit Wasser hin. Dann machte er die paar Schritte zu ihr, setzte sich auf die Matratze, reichte es ihr und beobachtete zufrieden, wie sie trank.
»Warum hast du mir gestern Abend nichts davon gesagt?«, fragte er, nachdem sie das Glas auf den Nachttisch gestellt hatte.
»Es hat mich glücklich gemacht. Du hättest dich nur aufgeregt.«
Er sah sie an. Dann wandte er sich zum Fenster. Sein drahtiges Haar hatte sich in all den Jahren kaum verändert, war weder grau geworden noch zurückgegangen. Er trug es noch immer kurz, so dass es energiegeladen vom Kopf stand und ihm etwas Altersloses gab, doch jetzt, im Halbdunkel, wirkte sein Schädel wie eine Last. Er wollte am Vormittag einen der Grundstückserben im Odenwald treffen, wo er während seiner ausgedehnten Fahrten ein Gelände entdeckt hatte, ideal für einen Segelflugplatz: auf einer terrassenartigen Fläche am Rande eines Berges gelegen, hoch über einer Ebene. Ein Schild, von der Serpentinenstraße aus leicht zu übersehen, hatte in fahrig hingeschriebenen Lettern darauf hingewiesen, dass es zum Verkauf stand, was – wie sich herausgestellt hatte – nicht ganz stimmte. Denn von den drei Brüdern der Erbengemeinschaft waren bisher nur zwei gewillt, sich von ihrem Besitz zu trennen.
»Was machst du, wenn er nicht verkaufen will?«, fragte sie.
Seine Züge blieben unbewegt, und sie bereute, so abrupt das Thema gewechselt zu haben, doch dann huschte ein triumphierendes Lächeln über seine Lippen, seine Augen verengten sich, Lothars ganzer Körper schien plötzlich alarmiert, obwohl er die Haltung kaum verändert hatte; allein sein flacher Atem und die Entschlossenheit des nach innen gerichteten Blicks zeigten seine Sprungbereitschaft an, seine Piratenkraft, und sie war von dieser Wandlung auch dieses Mal überrascht. Sie schob ihre Zehen unter der Decke hervor, schabte mit dem Ballen über die Tapete. Er betrachtete ihren Fuß.
»Er wird verkaufen«, sagte er, während er mit einer ruhigen Bewegung, die ihr Bein bis zum Schenkel entblößte, die Decke zurückschlug. Er nahm ihre Ferse in die Hand, wiegte sie wie einen Gegenstand und legte die andere Hand um ihren Spann, so dass ihr Fuß umschlossen war von einem pulsierenden warmen Verband, dessen Druck sich als Strom bis in ihre Leiste zog. »Er wird verkaufen«, wiederholte er.
Als sie am Morgen erwachte, war Lothar schon aufgestanden. Sie duschte und ging im Morgenmantel in Jakobs Zimmer, um die getrocknete Wäsche vom Ständer zu nehmen. Seit sie das Haus allein bewohnten, hatten Lothar und sie nach und nach wieder alle Räume in Besitz genommen. Sie hatte Jakobs Reich zum Bügelzimmer umfunktioniert, und Lothar hatte im Hobbykeller, wo Merten früher auf die Trommeln eines Schlagzeugs eingeprügelt hatte, sein Werkzeug und die Gartengeräte ausgebreitet. Merten, der seit dem Abitur vor gut einem Jahr in einer winzigen, fürchterlich stickigen Mansarde hinter der Alten Oper lebte, hatte sein Kinderzimmer zwar noch immer, aber selbst das betrat sie hin und wieder, um zu saugen oder ihm seine Post auf den Schreibtisch zu legen.
Als sie Jakobs Fenster öffnete, sah sie, dass Lothar in Badehose am Rand des Pools stand und mit dem Käscher die Oberfläche reinigte. Es war Ende August, die Tage noch heiß, aber über Nacht wurden schon Blätter von der Eiche aufs Wasser geweht. Seit Lothar vor acht Wochen von einem Wanderurlaub auf den Kykladen zurückgekehrt war, verbrachte jeder den Anfang des Tages für sich – er schwamm, machte ein paar Handgriffe im Garten, deckte den Tisch, sie drehte ihre Runde durchs Haus und verschwand in ihrem Arbeitszimmer, um sich einen Überblick über die eingegangenen E-Mails zu verschaffen. Sie hatten nie über diese Regelung gesprochen, es hatte sich einfach ergeben. Doch jetzt ging sie nicht nach unten, sondern blieb am Fenster und blickte über die gepflegten, durch Hainbuchen- und Ligusterhecken voneinander getrennten Gärten und Siedlungshäuser, von denen einige noch aus den dreißiger Jahren stammten, ursprünglich errichtet für die Besatzungen der Zeppeline, deren Landeplatz nur wenige Kilometer von Steinbach entfernt hinter dem Stadtwald gelegen hatte. Viele Bewohner dieses Viertels arbeiteten auch heute noch am Flughafen, doch die meisten Häuser waren inzwischen modernisiert oder abgerissen worden, um einem Bungalow oder einer in Pastelltönen gehaltenen Villa im Landhausstil zu weichen. Auch sie hatten überlegt, das zweigeschossige Häuschen mit dem Giebeldach durch ein neues zu ersetzen, als sie es vor über zwanzig Jahren von einer fidelen alten Dame übernahmen, deren Mann als Offizier auf der Hindenburg den Absturz in New York überlebt hatte. Sie hatten den Zuschlag nur erhalten, weil auch Lothar Pilot war – eher aus sentimentalen Gründen entschlossen sie sich zu einem aufwendigen Umbau. Damals bestand das Haus aus vier nahezu gleich großen Zimmern, zwei ebenerdig, zwei im Obergeschoss, und sie brachen durch Wände, erweiterten das Wohnzimmer zum Garten hin, fügten im Süden einen Kubus an, bauten Kellerzimmer und Dachgeschoss aus und ließen im vorderen Teil des Gartens eine Grube für den Pool ausheben, auf den ihre Söhne als Kinder erst stolz waren, um sich später vor ihren Klassenkameraden dafür zu schämen. Mit seinen Fensterfronten, offenen Durchgängen und dem Zwischengeschoss erinnerte so gut wie nichts mehr an das alte Gemäuer, aber manchmal, wenn sie hier am Fenster stand wie jetzt, spürte sie nicht nur Jakobs Anwesenheit so stark, als würde er noch hier leben, sondern auch den alten Pioniergeist, einen Hauch von Konzentration, Tatendurst und erhabener Rücksichtslosigkeit, von dem sie sich beruhigen ließ.
Lothar richtete die Schwimmbrille, und an der Genauigkeit, mit der er das Gummiband am Hinterkopf fixierte, las sie ab, dass er sie am Fenster entdeckt hatte. Er ließ die Schultern kreisen, ging in die Hocke – und richtete sich wieder auf, hob den Kopf und schaute zu ihr hin, und sie blickte auf die dunkelblau getönten Plastiktropfen über seinen unsichtbaren Augen. Sie lächelte, er schaute nur – dann glitt er kopfüber ins Wasser.
Ruth nahm die Handtücher vom Wäscheständer und legte sie zusammen, bis das Klingeln des Telefons sie aus den Gedanken riss. Barfuß lief sie die mit Teppichboden bezogenen Stufen der Wendeltreppe hinunter und blieb vor der Anrichte im Esszimmer stehen.
»Wilber.«
Es knisterte in der Leitung. Schließlich hörte sie Mertens Stimme.
»Hey, du klingst so gehetzt. Bist du unter die Morgenschwimmer gegangen?«
»Ich stand an Jakobs Fenster, einen Berg Wäsche auf dem Arm.«
»Und Papa schwimmt, die Sonne scheint, und die Jalousien bei Brücks sind unten, weil sie mal wieder im Urlaub sind.« Ihr Sohn stöhnte übertrieben: »Wie schön, dass man sich darauf verlassen kann.«
Die Küchenuhr zeigte kurz nach acht. Ruth hatte mit seinem Anruf nicht vor zehn gerechnet. Es war Mittwoch, also hatte er gestern Abend gearbeitet, mindestens bis halb zwei. Wahrscheinlich hat er noch gar nicht geschlafen, dachte sie. Das würde wenigstens seine launige Art erklären.
»Also«, sagte sie. »Wie ist es gelaufen?«
»Ach so. Ja. Nett. Ich würde sagen: Es war nett.«
»Nett?«
»Ja, das Gebäude ist interessant, es gibt eine Wiese, in der Skulpturen stehen, und eine Studentin saß in der Sonne und ließ sich von einer anderen porträtieren.«
»Aha.«
»Der Professor war auch nett. Eine Sekretärin zeigte mir den Raum, ich habe geklopft, und dann stand ich in einem großen Atelier, und der Professor gab mir die Hand. Ich habe die Mappe auf einen Tisch gelegt, und er hat sie aufgeschlagen und sie sich angeguckt.«
Als er nicht weitersprach, fragte sie:
»Was hat er gesagt?«
»Nichts, eigentlich. Er hat die Bilder durchgesehen, und als er zu dem Jungen vor dem Karussell kam, hat er gesagt: ›Das gefällt mir. Das gefällt mir gut.‹«
Sie kannte das Foto. Im Gegensatz zu den anderen, auf denen hauptsächlich diffuse Flächen zu sehen waren, zeigte es einen Menschen, einen vielleicht sechsjährigen Jungen, der zu den fliegenden Sitzen eines Kettenkarussells hochschaute und dabei in die Hände klatschte. Das meiste an dem Bild war verwischt, nur das Gesicht des Jungen trat scharf hervor. Sein Blick war von banger Begeisterung, voll Hingabe für den Rausch der Bewegung und gequält vom Ausgeliefertsein an das Chaos um ihn herum.
»Und sonst?«
»Sonst hat er nichts gesagt, ich meine, nicht zu den Fotos. Erst als wir uns später gegenübersaßen, hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, auch etwas anderes zu studieren.«
»Nein«, erwiderte sie. »Das hat er nicht!«
»Doch Mama«, sagte Merten kalt, mit einer Stimme, die sie an Lothars erinnerte. »Genau das waren seine Worte.«
»Ach Schatz«, sagte sie schnell. »Das ist nur eine Meinung.«
Danach wusste sie nicht, was sie noch sagen sollte. Sein rechthaberischer Groll machte sie müde. Durchs Fenster sah sie Lothar an der chromglänzenden Treppe aus dem Wasser steigen und sich nach einem Handtuch bücken. Kurz drückte er den blauen Stoff gegen das Gesicht, dann stand er regungslos im Gras, schwer atmend, den Mund vor Erschöpfung verzogen. Da hörte sie Vögel am anderen Ende der Leitung.
»Sind das Möwen?«, fragte sie.
»Was?«
»Ob das Möwen bei dir sind?«
»Kann sein«, sagte er, plötzlich wieder vergnügt. »Ja, eindeutig. Hier reiten ein paar Möwen auf dem Küstenwind.«
Sie presste den Hörer gegen ihr Ohr. Hamburg – Frankfurt plus die Strecke von der Nordsee. Das war niemals bis eins zu schaffen.
»Wo bist du, um Himmels willen?«, fragte sie, die weißlichen Flammensäume der Robinienblätter und den von Lothar gedeckten Tisch auf der Terrasse im Blick.
»Ich weiß auch nicht genau. Irgendwo an einem holländischen Strand. Wir wollten den Sonnenaufgang am Meer erleben. Hat aber nicht geklappt. Warte mal. Wie heißt das hier?« Es rauschte und knisterte. Sie hörte das Flüstern einer weiblichen Stimme, dann sagte Merten:
»Ostvorne. Ostervorne. So ähnlich. Südlich von Rotterdam. Überall scheußliche Fabrikanlagen. Ich hab mir das romantischer vorgestellt. Man kann hier übrigens tatsächlich in alle Häuser reingucken. Keine Vorhänge, gar nichts.«
»Aha«, machte sie wieder, die Augen vor Konzentration geweitet. Merten war empfindlich wie eine Schnecke. Ein falscher Ton, und er zog sich hinter absurde Sätze zurück oder verstummte für unbestimmte Zeit ganz. Lothar und er konnten deswegen kaum noch miteinander reden; wenn sie nicht aufpasste, zerstörte sie mit einem Satz die Früchte ihrer Wochen dauernden Telefonbemühungen. »Die Niederländer haben eben keine Geheimnisse. Weder vor Gott noch vor den Nachbarn.« Sie setzte eine Pause. »Es wäre schön, wenn du dich trotz deines Ausflugs um ein Uhr an der Alten Oper einfinden könntest. Wie verabredet.«
»Das war auch unser Plan. Kaffee trinken. Und dann zurück auf die Autobahn. Pünktlich um eins werden wir da sein.«
»Merten!«, entfuhr es ihr mit einem Drängen, das dramatisch in ihren Ohren nachklang. »Dieses Treffen war lange vereinbart. Zwischen dir und deinen Eltern.« Doch er ging nicht darauf ein.
»Keine Sorge. Für die Hinfahrt haben wir auch nur vier Stunden gebraucht.«
Die schreienden Möwen waren nicht mehr zu hören – wahrscheinlich hatte seine Begleitung das Fenster geschlossen. Es gab nichts mehr zu sagen. Sie versuchte, sich ihren Sohn in seinem alten weißen Peugeot auf einer Uferstraße vorzustellen, das Haar zerzaust, die Augen gerötet vor Müdigkeit, und neben sich ein Mädchen oder eine Frau, die sie wohl am Mittag kennenlernen würde.
»Fahrt vorsichtig«, sagte sie.
»Klar«, sagte Merten. »Mama?«
»Ja.«
»Bitte erzähl Papa nichts vom Treffen mit dem Professor.«
Sie lauschte auf den Atem ihres Sohnes, während sie das verschlossene Gesicht ihres Mannes sah, der – noch immer in Badehose – inzwischen am Tisch saß und mit kräftigen Bewegungen seines Kiefers Müsli zerkleinerte.
»Bis nachher«, sagte sie.
»Was sollte denn das?«, fragte Miriam, nachdem das Gespräch beendet war, das Merten ursprünglich begonnen hatte, um sein Kommen am Mittag abzusagen.
»Ich weiß es nicht.«
Die Verärgerung gab Miriams Gesicht scharfe Konturen, Wangenknochen und Nase wirkten wie geschnitzt.
»Du weißt es nicht?«
»Nein«, sagte er. »Ich weiß es nicht.« Ihre seegrünen Augen blickten ihn an. Dann stieg sie aus und verschwand in den Dünen. Merten beugte sich vor, um den Flug der Möwe besser bewundern zu können, doch als er sich der Scheibe näherte, fiel der Vogel mit einem gellenden Schrei zurück, aus seinem Blickfeld, und Merten drückte seinen verspannten Rücken wieder gegen die Lehne. Das Mobiltelefon lag noch immer in seiner Hand. Die Küste ist nicht schlecht, dachte er, während er den asphaltierten Fahrradweg entlangblickte, der die Sanddüne vom Wald trennte. Nur das Hinterland ist hässlich. Beim Blick in den Rückspiegel sah er wieder die riesigen Windräder, daneben die Silos und Förderanlagen des Euroports und, direkt hinter dem Parkplatz, die Kleingartensiedlung, in deren Gassen er sich im Morgengrauen hoffnungslos verfahren hatte. Drei Mal hatte er geglaubt, den Ausgang aus dem Labyrinth gefunden zu haben, drei Mal waren sie wieder an der Kreuzung gelandet, an der ein handgemaltes Schild vor spielenden Kindern warnte.
Sie waren plötzlich auf die Idee gekommen, bei einem Kelleritaliener in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zwei Minuten später hatten sie schon im Neonlicht der Nachtbars auf der Straße gestanden, johlend vor Freude, eine halbe Stunde darauf rauschten sie auf die Autobahn, ausgestattet mit Mineralwasser, Schokolade und pappigen Käsebrötchen von der Tankstelle. Kurz nach der holländischen Grenze begann der zähe Kampf gegen die Müdigkeit. Als Merten zwei Stunden später, den Kopf nah an der Windschutzscheibe, den Wagen über die dunklen Wege der Laubenkolonie steuerte, hatte Miriam verschlafen die Augen geöffnet und »Wo sind wir?« gefragt. Mit leisem Knirschen, erinnerte er sich, hatten die Räder auf einer sandigen Asphaltfläche angehalten. Das nahe Tosen der Wellen, würzige Seeluft, die durch die offenen Fenster ins Innere des Autos strömte. Doch als sie dann den Kamm der Düne erklommen, erhob sich vor ihnen eine undurchsichtige Nebelwand. Enttäuscht waren sie zum Auto zurückgetrottet und – die Hände auf der Ablage zwischen den Sitzen ineinander verschränkt – augenblicklich eingeschlafen.
Er rieb mit den Handflächen über sein Gesicht, dann stieg er aus, obwohl er nicht wusste, was er Miriam sagen sollte. Über ihre Familien hatten sie nur Andeutungen verloren, sie redeten ohnehin nicht viel, weder während ihrer gemeinsamen Arbeit im Café, noch nach den abendlichen Schichten, wenn sie stundenlang durch die Bars der Innenstadt trieben. Vor vier Wochen hatte er sie nach einem nächtlichen Sommergewitter, das sie auf einer Wiese am Main überraschte, die Stufen in sein Mansardenzimmer hochgeführt – und seitdem dauerte der Zustand an: Die Gegenwart weitete sich wie ein immer größer werdender Raum.
Auf verwitterten Holzlatten stieg Merten den Sandberg hinauf und blieb stehen, als er den Strand überblickte. Weißer Sand zog sich kilometerweit nach Süden bis zum Horizont, wo im Dunst eine Landzunge zu erahnen war. Das Meer hatte sich weit zurückgezogen; zwischen den Lachen und Seen, die es hinterließ, pickten Möwen im Schlick nach Krebsen. Ein einzelner Radfahrer fuhr am Rand des Watts entlang, in eine Windjacke gepackt, dabei war die Luft selbst zu dieser frühen Stunde schon warm. Miriam saß dreißig Meter entfernt, die Arme um die Knie geschlungen, die Segelschuhe neben sich im Sand, und die Art, mit der sie aufs Wasser schaute, erinnerte ihn daran, wie sie manchmal im Getränkeraum stand, still und geladen, um sich zu beruhigen, nachdem ein Gast sie provoziert hatte. Als er auf sie zukam, warf sie ihm einen düsteren Blick zu. Er ließ sich neben ihr in den Sand fallen. Sie sagten beide nichts. Merten kniff die Augen zusammen, bis der Fahrradfahrer nur noch ein dunkler Umriss war, der sich wie ein Insekt über eine helle Fläche bewegte.
»Ich rufe an und behaupte, wir haben eine Panne und können nicht kommen.«
Miriam schüttelte den Kopf.
»Redest du mit deiner Mutter eigentlich immer so?«
Statt zu antworten hob er die Schultern. Sie war sechs Jahre älter als er und hatte in Braunschweig Tanz studiert und in einer Kompanie getanzt, die sich aufgelöst hatte, doch ursprünglich kam ihre Familie aus Russland, immerhin das hatte sie ihm verraten. Einmal hatte er sie gefragt – mit vollen Tabletts waren sie sich im Mittelgang begegnet –, warum sie eigentlich nach Frankfurt gekommen sei. Miriam hatte gequält gelächelt und, als er ihr kurze Zeit später das dreckige Geschirr für den Küchenaufzug anreichte, mit vollem Ernst gesagt: »Um mich auszuruhen.«
»Stimmt es eigentlich, dass man in Russland seine Eltern siezt?«, fragte er.
Sie war so erstaunt, dass sie auflachte, hell und meckernd und, wie er verwundert feststellte, verletzt.