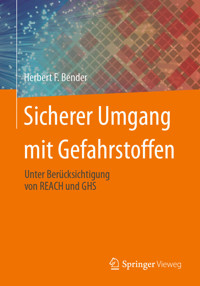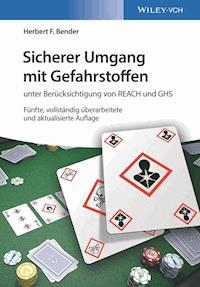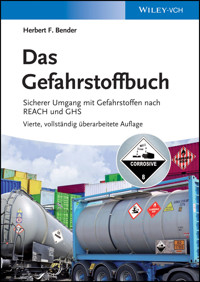
133,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Umgang mit Chemikalien und anderen gefährlichen Stoffen ist in Beruf und Gewerbe streng reglementiert – durch die EU und ergänzende nationale Gesetze. Vorschriften zu kennen reicht jedoch nicht aus, um Gefahren für Beschäftigte und Umwelt auszuschließen.
Was in den Gesetzeskommentaren nicht zu finden ist, wird mit der Expertise des weltweit größten Chemieunternehmens hier erklärt: die praktische Umsetzung jener Gesetze und Verordnungen, die für den täglichen Umgang mit Gefahrstoffen von Bedeutung sind. Alle Rechtsgrundlagen, einschließlich der neuen Einstufungen und Kennzeichnungen der CLPVerordnung sowie der wesentlichen Vorschriften der REACH-Verordnung, sind aktuell abgebildet. Bisherige Regelungen, die übergangsweise noch Anwendung finden, werden vergleichend gegenübergestellt.
Seit fast zwanzig Jahren das Standardwerk zum betrieblichen Umgang mit Gefahrstoffen
– für alle, die relevante Vorschriften umsetzen und überwachen müssen.
Jetzt mit Glossar!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 4. Auflage
1 Wissenschaftliche Grundlagen
1.1 Grundlagen der Toxikologie
1.2 Physikalisch-chemische Grundlagen
1.3 Biologische Arbeitsstoffe
2 Gefährliche Eigenschaften, Einstufung und Kennzeichnung
2.1 Einführung in die Einstufungssysteme
2.2 Gefährliche Eigenschaften: Physikalische Eigenschaften
2.3 Eigenschaften: Gesundheitsgefahren
2.4 Gefährliche Eigenschaften: Umweltgefahren
2.5 Einstufung von Stoffen und Gemischen / Zubereitungen
2.6 Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Gemische bzw. Zubereitungen
3 Gefährdungsbeurteilung und Beurteilungsgrundlagen
3.1 Rechtliche Grundlagen
3.2 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung
3.3 Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz
3.4 Methoden der Expositionsermittlung
4 Europäische Regelungen
4.1 REACH
4.2 Das Sicherheitsdatenblatt
4.3 Das erweiterte Sicherheitsdatenblatt und Expositionsszenarien
4.4 Verbote beim Inverkehrbringen
4.5 Stoffrichtlinie
4.6 Zubereitungsrichtlinie
4.7 Agenzienrichtlinie
4.8 Krebsrichtlinie
4.9 Verordnung 689/2008/EG
4.10 Verordnung 3677/90/EWG
4.11 Verordnung 2037/2000/EG
4.12 Die POP-Verordnung
5 Deutsche Regelungen
5.1 Das Chemikaliengesetz
5.2 Die Gefahrstoffverordnung
5.3 Chemikalien-Verbotsverordnung
5.4 Die Biostoffverordnung
5.5 Mutterschutzverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz
5.6 Die Arbeitsmittelverordnung / Betriebssicherheitsverordnung
5.7 Das Bundes-Immissionsschutzgesetz und seine Verordnungen
5.8 Das Wasserhaushaltsgesetz
6 Persönliche Schutzausrüstungen
6.1 Augen- und Gesichtsschutz
6.2 Schutzhandschuhe
6.3 Körperschutz
6.4 Atemschutz
7 Lagerung von Gefahrstoffen und Tätigkeiten mit ortsbeweglichen Druckgasbehältern
7.1 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern
7.2 Lagerung von Gefahrstoffen in ortsfesten Anlagen sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter
7.3 Lagerung von Gasen in ortsfesten Anlagen
7.4 Tätigkeiten mit ortsbeweglichen Druckgasbehältern
8 Transportvorschriften
8.1 Internationale Transportvorschriften
8.2 Klassifizierung gefährlicher Güter
8.3 Das ADR
8.4 Nationale Vorschriften
Literatur
Glossar
Anhang: H- und P-Sätze
Stichwortverzeichnis
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Reniers, G.L.L., Zamparini, L. (Hrsg.)
Security Aspects of Uni- and Multimodal Hazmat Transportation Systems
2012978-3-527-32990-8
Kamptmann, S.
REACH Compliance – The Great Challenge for Globally Acting Enterprises
2014978-3-527-33316-5
Richardt, A., Hülseweh, B., Niemeyer, B., Sabath, F. (Hrsg.)
CBRN ProtectionManaging the Threat of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Weapons
2013978-3-527-32413-2
Bender, H. F.
Sicherer Umgang mit Gefahrstoffenunter Berücksichtigung von REACH und GHSVierte, vollständig überarbeitete Auflage
2011978-3-527-32927-4
Vohr, H. (Hrsg.)
Toxikologie (Set)Band 1: Grundlagen der Toxikologie / Band 2: Toxikologie der Stoffe
2010978-3-527-32386-9
Autor
Herbert F. BenderBASF AG, Hazardous SubstancesManagement, Abt. GUS/TD – M94067056 LudwigshaferDeutschland
Print ISBN: 978-3-527-33397-4
ePDF ISBN: 978-3-527-67400-8
ePub ISBN: 978-3-527-67401-5
Mobi ISBN: 978-3-527-67402-2
oBook ISBN: 978-3-527-67399-5
1. Auflage 2013
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Satz Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Vorwort zur 4. Auflage
Das europäische sowie das nationale Gefahrstoffrecht haben sich in den letzten Jahren erwartungsgemäß stürmisch weiter entwickelt. Eine Überarbeitung war daher unabdingbar. Selbstverständlich konnten nicht alle Regelungen, Vorschriften oder technische Regeln mit der gleichen Ausführlichkeit dargestellt werden Die Auswahl gibt naturgemäß die Schwerpunkte basierend auf den Erfahrungen des Autors wieder.
Auf Grund der großen Bedeutung stehen die europäischen Verordnungen REACH und die CLP-Verordnung im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelungen.
Die Inhalte des bisherigen Kapitels 1 „Stoffrecht“ wird in Kapitel 4 bzw. 5 besprochen, auf Grund der limitierten Bedeutung wird ein eigenes Kapitel nicht mehr benötigt. Als Konsequenz enthält Kapitel 1 jetzt die wissenschaftlichen Grundlagen, aktualisiert und angepasst an die neueren wissenschaftlichen Erkenntnisse.
In Kapitel 2 werden sowohl die Einstufung- und Kennzeichnungssysteme der europäischen CLP-Verordnung als auch die bisherige Stoffrichtlinie 67/548/EWG beschrieben, da letztere für die Einstufung von Inhaltsstoffen von Zubereitungen noch bis zum 1.6.2015 herangezogen werden kann. In jedem Abschnitt werden zuerst die Einstufungsgrundsätze der CLP-VO behandelt, anschließend die Kriterien der Stoffrichtlinie. Desgleichen werden die Einstufungsprinzipien von Gemischen nach der CLP-VO ausführlicher als die der Zubereitungsrichtlinie erläutert.
Die Gefährdungsbeurteilung nimmt im Arbeitsschutz die zentrale Rolle ein. In einem eigenen Kapitel werden die grundlegenden Elemente für die praktische Durchführung beschrieben. Der Hilfestellung zur Durchführung der Substitutionsprüfung wird ein breiter Raum eingeräumt, zur Vermeidung einer vermeintlichen Reduzierung der Risiken bei tatsächlicher Gefährdungserhöhung. Als wesentlicher Beurteilungsmaßstab werden sowohl die inhalativen als auch die biologischen Grenzwerte vorgestellt. Neben den staatlichen Grenzwerten wird auch die grundlegende Vorgehensweise zur Ableitung der DNEL und der DMEL nach der REACH-VO behandelt. Die neuen Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen des neuen Risikokonzeptes finden sich ebenfalls bei den nationalen Arbeitsplatzgrenzwerten. Die Methoden der Expositionsermittlung wurden deutlich gestrafft und aktualisiert.
Im Zentrum der europäischen Vorschriften wird die REACH-Verordnung besprochen, ergänzt um die neueren Vorschriften, die Kandidatenliste sowie das Zulassungsverfahren. Ergänzend werden die Besonderheiten für Zwischenprodukte kurz diskutiert. Die Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter werden ausführlich unter Berücksichtigung der neuen ECHA-Leitlinie beschrieben. Die umfassenden Beschränkungen bei Herstellung und Verwendung nach Anhang XVII finden sich ebenfalls in Kapitel 4, neben einer kurzen Besprechung weiterer europäischer Vorschriften, u.a. die PIC- und POP-Verordnung.
Die Vorschriften zur Zulassung von Bioziden werden im Rahmen des Chemikaliengesetzes beschrieben. Das neue Konzept der Gefahrstoffverordnung nach „Abschaffung“ des Schutzstufenkonzeptes steht im Mittelpunkt von Kapitel 5. Ausführlich werden Betriebsanweisung, betriebliche Unterweisung und innerbetriebliche Kennzeichnung erläutert. Die Regelungen der Chemikalien-Verbotsverordnung beim Inverkehrbringen bestimmter Gefahrstoffe ergänzen die Beschränkungen von Anhang XVII REACH-Verordnung, ergänzt um die besonderen nationalen Vorschriften. Die Ausführungen zur Biostoffverordnung berücksichtigen weitgehend die zur Jahresmitte verabschiedete Novellierung, des gleichen wurden die wesentlichen Änderungen der Anlagen- und Betriebsmittelsicherheitsverordnung berücksichtigt. Im Rahmen der Störfallverordnung steht die neue Seveso Richtlinie der EU im Mittelpunkt.
Nur wenige grundlegende Änderungen hat Kapitel 6 „Persönliche Schutzausrüstung“ erfahren, ganz im Gegenteil zu den Vorschriften zur Lagerung von Gefahrstoffen in Kapitel 7, das vollkommen neu formuliert werden musste. Die Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern nach TRGS 510 berücksichtigt bereits die im Juni im Ministerialblatt veröffentlichte Fassung und beschreibt ausführlich sowohl die Grundanforderungen als auch die zusätzlichen Vorschriften spezieller Gefahrstoffe. Die für die Praxis wichtigen Zusammenlagerungsvorschriften werden ausführlich beschrieben. Die Vorschriften zur Lagerung von Gefahrstoffen in stationären Anlagen einschließlich der Regelungen für Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter nach der neuen TRGS 509 sind zwar noch nicht verabschiedet, größere Änderungen sind allerdings an der in Fachkreisen intensiv diskutierten Fassung nicht zu erwarten. Die neuen technischen Regeln für Gase, „Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung“ sowie „Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren“, wurden bereits vom AGS verabschiedet, die Veröffentlichung stand zu Redaktionsschluss allerdings noch aus. Die Regelungen zu Lagerung von Gasen in stationären Anlagen sind auf Basis der in den Fachkreisen zirkulierten Fassung kurz beschrieben.
Die Transportvorschriften von Kapitel 8 berücksichtigen die aktuelle Fassung, insbesondere des ADR. Aufgrund der zum Teil umfassenden Änderungen der letzten Jahre war eine komplette Überarbeitung unvermeidbar.
Bedingt durch die zahlreichen Änderungen, insbesondere europäischer aber auch nationaler Vorschriften, wurden viele neue Begriffe neu eingeführt. In einem ausführlichen Glossar werden diese sowie bereits existierende Fachtermini kurz und prägnant erklärt.
Die neue Auflage möchte in aktualisierter Fassung den Praktikern in Industrie, Gewerbe, Handel sowie in den Aufsichtsbehörden eine praxisgerechte Zusammenstellung der relevanten Vorschriften und Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Gefahrstoffen bieten.
Einen besonderen Dank gebührt meinen Kolleginnen und Kollegen der BASF. Ohne unsere intensiven Diskussionen und ihre Anregungen wären viele praxisrelevante Themen nicht in der gebührenden Form berücksichtigt worden. Desgleichen möchte ich mich bei Kolleginnen und Kollegen im AGS und insbesondere in den unterschiedlichen Arbeitskreisen bedanken. Nur durch das gemeinsame Bestreben nach praxisgerechten Lösungen können anwendungstaugliche Vorschriften entstehen.
Nicht zuletzt gebührt meiner Frau ein ausdrücklicher Dank für ihr Verständnis für unzählige Abende, Wochenende und Feiertage, in denen ich mich hartnäckig ins Arbeitszimmer zurückgezogen habe.
Ein umfassendes Buch über Gefahrstoffe muss zeitnah geschrieben werden, um sowohl der dynamischen Weiterentwicklung des Gefahrstoffrechtes als auch der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse gerecht werden zu können. Dies führt zwangsläufig zu einem hohen Zeitdruck; hierdurch begründete Unstimmig- und Unzulänglichkeiten bitte ich daher zu entschuldigen. Über zweckdienliche Korrekturen bin ich selbstverständlich sehr dankbar.
Böhl-Iggelheim, im Juni 2013
Herbert F. Bender
1
Wissenschaftliche Grundlagen
1.1 Grundlagen der Toxikologie
Im Abschnitt Grundlagen der Toxikologie können nur die zum Verständnis der wichtigsten Stoffeigenschaften benötigten toxikologischen Prinzipien dargestellt werden. Für ein intensiveres Studium wird auf die zahlreichen Lehrbücher verwiesen, z. B. auf die grundlegenden Ausführungen von Eisenbrand und Metzler [1], Dekant und Vamvakas [2], Birgersson et al. [3], Klaassen [4] oder Vohr [5]. Nicht dargestellt werden im Rahmen dieses Handbuches die Abbaureaktionen der unterschiedlichen Chemikalien; diese können der einschlägigen Fachliteratur entnommen werden.
Eine lokale Wirkung liegt vor, wenn sich die Wirkung der Stoffe auf den Einwirkungsort beschränkt. Verätzungen oder Reizungen sind typische Beispiele lokaler Stoffwirkungen. Neben der Haut als primär betroffenes Körperorgan sind lokale Effekte am Atemtrakt, am Auge oder im Magen-Darm-Trakt bekannt. Vertreter primär lokal wirkender Stoffe sind bei
dermaler Wirkung anorganische Säuren, Laugen sowie bei
inhalativer Wirkung Halogenwasserstoffe, Aldehyde, niedere Alkohole und Ketone.
Die meisten Chemikalien werden jedoch über das Blutsystem im ganzen Körper verteilt. Von diesen systemisch wirkenden Stoffen können grundsätzlich alle Organe erreicht werden. Typischerweise wirken Stoffe an spezifischen Organen, densogenannten Zielorganen. Abbildung 1.1 zeigt bekannte Zielorgane wichtiger Chemikalien.
Abb. 1.1 Bekannte Zielorgane einiger Stoffe
Zur Beschreibung der Giftigkeit ist die akute Toxizität von großer Bedeutung. Die akute Toxizität beschreibt die Wirkung bei einmaliger Einwirkung. In der Regel stellt sich die toxikologische Wirkung kurzfristig nach Exposition innerhalb weniger Minuten bis einiger Stunden ein. In sehr seltenen Fällen ist die Stoffwirkung durch Spätschäden erst nach Wochen oder Monaten erkennbar.
1.1.1 Aufnahmewege
Typischerweise können Stoffe auf drei verschiedenen Wegen in den Körper gelangen:
oral: Aufnahme über den Mund direkt in den Magen,
dermal: Aufnahme von Stoffen über die Haut und
inhalativ: Aufnahme von Stoffen über die Atemorgane.
Abbildung 1.2 zeigt schematisch die verschiedenen Aufnahmewege sowie wichtige Zielorgane.
Abb. 1.2 Aufnahmewege für Stoffe in den Körper
1.1.1.1 Orale Aufnahme
1.1.1.2 Dermale Aufnahme
Eine wesentliche Aufgabe der Haut besteht im Schutz des Körpers gegen Einwirkung von außen. Diese Schutzfunktion ist gegenüber ionischen, wasserlöslichen Stoffen oder Makromolekülen sehr effektiv. Fettlösliche (lipophile) Stoffe werden demgegenüber meist gut über die Haut aufgenommen und resorbiert.
In Abhängigkeit von der chemischen Struktur ist die dermale Aufnahme von Chemikalien sehr unterschiedlich. Während lipophile Stoffe mit einem Molekulargewicht unter 200 Dalton im Allgemeinen gut über die Haut aufgenommen werden, sind größere Moleküle in der Regel nicht mehr hautgängig. Bipolare Moleküle mit lipophilen und hydrophilen Gruppen werden äußerst effektiv resorbiert.
Bei Verwendung organischer Lösemittel muss deren gute Aufnahme über die Haut durch die Wahl geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung getragen werden. Die entfettende Wirkung der Lösemittel verstärkt durch Schädigung des Schutzmantels ihre dermale Aufnahme. Stoffe mit sowohl hautresorptiver als auch ätzender Wirkung werden äußerst schnell und wirkungsvoll über die Haut aufgenommen. Die ätzende Wirkung zerstört den Schutzmantel der Haut, infolgedessen können innerhalb kurzer Zeitspanne große Stoffmengen aufgenommen werden. Tödliche Unfälle durch Phenol oder Flusssäure sind hierfür bekannte Beispiele.
Die Bedeutung des dermalen Aufnahmeweges für Intoxikationen (Vergiftungen) wird in der Praxis häufig stark unterschätzt. Organische Lösemittel können gelöste Stoffe, die selbst nicht hautgängig sind, im Sinne eines „Carrier-Effektes“ durch die Haut transportieren. In der Medizin (Dermatologie) wird diese Tatsache ausgenutzt, um schlecht resorbierbare pharmakologische Wirkstoffe in tiefere Hautschichten zu transportieren.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!