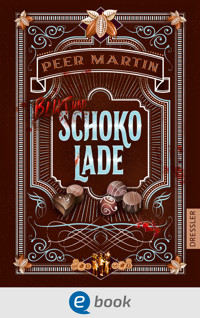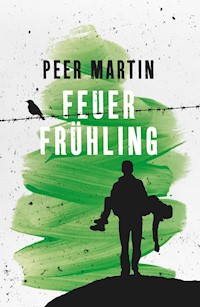9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Das geheime Leben der Tiere - Dschungel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In einer regnerischen Nacht wird das Bonobomädchen Mbola im afrikanischen Nationalpark Salonga geboren. Voller Neugier beobachtet Kongopapagei Muyi dieses Wunder und freundet sich mit dem Affen an. Zusammen erkunden sie den Dschungel und lernen, wie nah Schönheit und Gefahr in dem grünen Paradies beieinanderliegen. Als Mbola urplötzlich gefangen genommen wird, bricht für Muyi eine Welt zusammen. Er nimmt die Spur auf und tatsächlich gelingt dem Papagei die Rettung. Doch der Weg zurück nach Hause in den Regenwald ist gefährlich. Die Wunder des Regenwalds Aufregende Abenteuer, erstaunliche Wunder der Natur und das spannende Leben der Tiere – diese Kinderbuch-Reihe entführt Jungen und Mädchen ab 8 Jahren in die verschiedenen Lebensräume der Erde. Ob im tiefen Meer, in der weiten Savanne, im dichten Wald oder im wilden Dschungel: In diesen Geschichten erleben Tiere wunderschöne und zugleich bewegende Abenteuer. Die Kinder tauchen in die Welt der Tiere ein, werden für die Vielfalt der Natur begeistert und lernen viel Neues auf den Wissensseiten. Mit berührenden und coolen Schwarz-Weiß-Illustrationen. Lehrreich wie ein Sachbuch und berührend wie ein Disney-Klassiker! Für Fans von Peter Wohlleben und Karsten Brensing. Die Titel sind auf Antolin.de gelistet. Alle Bände dieser Reihe: Das geheime Leben der Tiere (Dschungel) - Freundschaft im Regenwald Das geheime Leben der Tiere (Dschungel) - Die schwarze Tigerin Das geheime Leben der Tiere (Dschungel) - folgt Die Titel sind auf Antolin.de gelistet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Ähnliche
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Erklärungen aus dem Regenwald
1
Das Erste, was sie hörte, war die Musik des Regens auf dem Blätterdach: ein Laut voller Sicherheit, voller Geborgenheit.
Und dann öffnete sie die Augen und sah die Welt. Die Welt war ganz grün.
Sie bestand aus Schatten und Blättern. Und aus dem Gesicht ihrer Mutter: einem breiten schwarzen Gesicht mit rötlichen Lippen und glänzenden Knopfaugen.
„Willkommen, mein Bonobokind“, sagte ihre Mutter. Es waren freundliche, kleine Laute. „Willkommen im Wald.“
Sie wiegte das winzige schwarz bepelzte Mädchen in ihren Armen. Die anderen Bonobos hatten bei der Geburt geholfen. Nur die Weibchen, die Männchen hatten sie weggejagt. Jetzt scharten sie sich alle um das Mädchen und wollten es streicheln und berühren.
So war es immer. Alles war schon immer so gewesen bei den Bonobos, den Zwergschimpansen im Herzen des Salonga-Parks. Im Herzen der Republik Kongo. Im Herzen von Afrika. Im Herzen der Welt.
Der Wald war grün und der Regen fiel auf die Blätter. Und nach dem Regen schien die Sonne und die riesigen Bäume wuchsen dem Licht entgegen und dann regnete es wieder.
„Aber es passieren Dinge in letzter Zeit“, sagte eines der älteren Bonoboweibchen mit ihren sanften Lauten. „Dinge, die nicht immer so waren. Du musst dein Kind schützen, neue Mutter, schütz es gut.“
„Sie erzählen, es waren Zweibeiner im Wald“, sagte eine andere. „Tiere ohne Fell. Sie haben kurze Arme, gehen nur auf dem Boden und sie suchen etwas. Sie waren früher nie so tief im Wald, aber jetzt kommen sie. Was suchen sie?“
Die neue Mutter, die nie zuvor ein Kind gehabt hatte, nahm das kleine Mädchen noch fester in ihre Arme. Dann ließ sie es Milch trinken.
„Trink, Mbula. Trink, Regenkind. Werde groß und stark. Hör den Alten nicht zu. Es gibt keinen Grund zur Sorge.“
Mbula trank und die Milch ihrer Mutter war süß und gut und warm. Alles war sicher. Aber sie spürte etwas Seltsames in ihrem winzig kleinen Herzen. Sie spürte, dass etwas geschehen würde. Etwas Großes und Abenteuerliches. Etwas, das mit dem Wald zu tun hatte und denen, die darin etwas suchten. Der ganze Wald, der große, grüne, riesige Wald mit seinen atmenden Bäumen, wartete darauf, dass es geschah.
Zur gleichen Zeit flog ein paar Meilen weiter südlich ein junger grüner Kongopapagei über dem Wald. Seine Flügelschläge waren langsam. Er gehörte nicht hierher. Etwas rief ihn nach Nordosten.
Er wusste, irgendwo dort waren die anderen. Der Regen hörte eben auf und seine nassen Federn funkelten in der Sonne wie Smaragde. Er fühlte noch die Enge des Käfigs, aus dem er geflohen war. Hörte noch das Geschnatter der anderen: Raus! Raus!
Er hatte nicht mit ihnen geschrien. Er hatte die Zweibeiner beobachtet. Dabei, wie sie die Käfigtür öffneten, wenn sie Futter brachten.
Da war ein längliches Ding gewesen, das man drehen musste. Aus Metall. Der Kongopapagei hatte seinen gekrümmten Schnabel durch die Gitterstäbe gesteckt und es gedreht.
Heute, im Morgengrauen.
Und er war in den heller werdenden Himmel gestiegen, in den Sonnenaufgang hinein, und geflogen: eine Explosion aus grünen Federn und Freude. Er hatte gerufen, laut gerufen, und einer der Zweibeiner hatte es gehört und war aufgewacht, aber zu spät.
„Bleib hier! Komm zurück!“
Der Papagei war bereits frei gewesen, hoch oben und frei, so wie vor seiner Zeit im Käfig.
Und dann hatte er den Wald wiedergefunden, er hatte einen inneren Kompass, der ihn leitete. Er kannte die Richtung, ohne zu wissen, weshalb. Er wusste nicht einmal, dass es „Richtung“ hieß, er wusste nur, wohin er fliegen musste.
Aber jetzt war er müde. Er flog schon zu lange.
Und etwas mit dem Wald unter ihm stimmte nicht.
Da waren neue Wege, Schneisen, die die Zweibeiner geschlagen hatten. Wie Wunden.
Da war ein Fahrzeug in einer der Schneisen, ein Fahrzeug mit Zweibeinern darauf. Sie konnten nicht fliegen, also brauchten sie Fahrzeuge mit Rädern, um schneller voranzukommen. Er war in so einem Fahrzeug gewesen, als sie ihn eingefangen hatten. Es war laut gewesen und hatte gestunken, schrecklich. Und jetzt fuhr eines dieser Fahrzeuge dort unten. Der Kongopapagei schwebte eine Weile darüber. Er sah die Zweibeiner anhalten und aussteigen. Sie hatten seltsame Geräte in den Händen. Sie suchten etwas. Er wusste nicht, was. Sie schienen sich für den Boden zu interessieren, für die Erde, und das war sehr merkwürdig. Zweibeiner, das wusste er, gruben keine Höhlen.
Schließlich verließ er sie, stieg wieder in den Himmel hinauf, doch ein eigenartiges Gefühl begleitete ihn.
Er war zu müde, um näher über die Zweibeiner nachzudenken. Er musste rasten. Er brauchte Ruhe und Nahrung.
Er wünschte, er hätte die anderen gefunden, die anderen grünen Papageien, die er vor so langer Zeit verlassen hatte.
Und dann sah er einen Schwarm roter Papageien in einer besonders hohen Baumkrone, die die anderen im Dschungel überragte. Er setzte sich auf einen Ast zwischen sie, ganz oben in die Krone. Sie wippten nur leicht auf ihren Plätzen.
„Guten Tag“, sagte der junge grün gefiederte Kongopapagei.
Die roten Papageien antworteten nicht. Sie wippten nur weiter.
„Ich muss mich ausruhen“, erklärte der grüne Kongo. „Ich war in einem engen Ding, mit vielen anderen. Das war nicht schön. Es war viele Tage lang nicht schön, es gab nicht genug Wasser und das Futter war verschimmelt. Die Zweibeiner wollen alle Papageien wegbringen. Weit, weit weg vom Wald. Ich habe begonnen, ihre Sprache zu verstehen. Sie sagen immer ‚Geld’. Das ist ein Zauberwort.“
Er legte den Kopf schief und sah die roten Papageien auf ihren Ästen an. Sie schwiegen noch immer.
Und da sah er, dass es keine Papageien waren. Es waren Blüten. Rote Blüten mit bizarren Formen, die der Baum ganz oben wachsen ließ, damit sie sich mit dem Licht der Sonne füllen konnten.
Der grüne Kongo war allein, allein und hungrig und durstig und erschöpft. Der Urwald unter ihm war schön, aber es war nicht sein Wald. Sein Wald war noch viele, viele Flugstunden weit fort.
Er erhob sich wieder, segelte ein Stück über den Baumkronen, sah die Schatten, die darin umherhuschten. Leben, überall war Leben und das war gut. Hier gab es keine Zweibeiner. Aber wenn sie ihre Schneisen weiter schlugen, wären sie eines Tages dann auch hier? Er dachte an den Tag, an dem sie ihn gefangen hatten …
Plötzlich war da ein Schatten. Ein Schatten am Himmel über ihm, riesig und unangenehm nah. Er war unaufmerksam gewesen.
Der Schatten senkte sich auf ihn herab. Der Papagei flog rascher, schlug einen Bogen, sah im Augenwinkel das Riesige, Dunkle, das das Sonnenlicht ausschloss: Ein Kronenadler, unterwegs auf enormen Schwingen, die scharfen Krallen bereit, Beute zu packen.
Er. Er war die Beute.
Der Adler würde ihn greifen. Der Kongopapagei tauchte ins Grün der Bäume ein, mitten zwischen die Blätter, streifte Äste, hörte das Rascheln, mit dem der Wald ihn verschluckte, er verschwand: ein fliegender grüner Juwel im Grün der Pflanzen. Er flog jetzt zwischen den Stämmen, im Schatten, doch der Adler blieb nicht über dem Blätterdach zurück. Er tauchte hinter ihm hinein, elegant, mit kurzzeitig angelegten Schwingen.
Der Kongopapagei landete auf einer dicken verholzten Liane und blieb reglos sitzen. Er sah, wie der Adler sich auf etwas stürzte, das sich in einem anderen Baum bewegte: Da waren Affen. Stummelaffen. Der Kongopapagei kannte sie. Schlanke, wendige Affen mit goldrotem Rücken, dunklen Köpfen und unglaublich langen Schwänzen. Sie waren schön. Sie hatten in den Bäumen gespielt, sie hatten Junge und jetzt sah er sie fliehen: Sah, wie sie hell aufkreischten und sich zerstreuten. Es war wie eine Explosion von rotem Goldfell in den Bäumen. Sie hatten den Adler gesehen.
Der Kronenadler fing nicht etwa einen der Jungen, die er leicht hätte greifen und mit sich forttragen können. Er fing einen großen, ausgewachsenen Affen. Griff ihn und saß gleich darauf mit seiner Beute auf dem Boden. Der Kongopapagei wandte den Kopf und sah nicht hin.
Er wusste, dass der Affe sich nicht mehr rührte. Die anderen Stummelaffen waren fort. Sie waren geflohen, hatten sich gerettet.
Das Herz des kleinen Kongos raste. Natürlich, ein Kronenadler reißt keinen Kongopapageien, er war dumm gewesen. Ein Kronenadler sucht größere Beute. Die jungen Stummelaffen würden am nächsten Morgen wieder spielen. Sie würden heranwachsen, die Alten ersetzen, neue Junge bekommen. Einer fehlte, einer kam, dies waren die Regeln. Alles lief im Kreis.
Trotzdem. Der Kongo war sehr froh, dass er an diesem Tag nicht der war, der ersetzt wurde. Tief in seiner grün gefiederten Brust fasste er den Entschluss, sich von nichts fressen zu lassen, bis er zu Hause war: zu Hause bei den anderen.
Es war noch ein weiter Weg.
Die Sonne sank.
Er stieg wieder auf durch das Blätterdach. Ein Stück noch, nur ein Stück in Richtung Nordosten … Aber er war zu erschöpft. Und mit seinen Flügeln stimmte etwas nicht. Der linke Flügel war müder als der rechte. Er hatte sich auf der hektischen Flucht vor dem Adler, bei seinem Sturz durch das Blätterdach, an etwas verletzt. An einem Zweig, einem Dorn, er wusste nicht, woran, er wusste nur: Es tat weh. So würde er nicht mehr lange fliegen können.
Dann sah er in den Ästen unter sich ein Nest aus grünen Blättern. Jemand war dabei, dieses Nest zu bauen, war beinahe fertig. Der Kongo setzte sich ganz oben in eine Astgabel und sah zu. Es war ein Affenweibchen einer anderen Art, ihr Fell schwarz und geschmeidig. Sie baute das Nest rasch und geschickt. Sie verwob die Blätter und Zweige immer dichter ineinander, während ein ganz kleines frisches Kind sich in ihrem Fell festklammerte, um nicht herunterzufallen. Es gab noch mehr von diesen schwarzen Affen, sie hatten lange, geschmeidige Gliedmaßen. Ein wenig ähnelten sie den Zweibeinern und sie bauten in einer Menge Baumkronen Nester.
Der grüne Kongo hatte diese Sorte Affen noch nie gesehen. Dort, wo seine Heimat war, gab es sie nicht.
„So, siehst du, das Nest ist fertig für die Nacht“, sagte das schwarze Affenweibchen unter ihm. Es sprach zu seinem winzig kleinen Kind. „Morgen Nacht bauen wir uns ein neues. Später wirst du das auch lernen. Nachtnester bauen. Sie sind immer frisch. Kein Ungeziefer. Kein Moder. Keine Krankheiten. Sehr gut.“ Der Kongopapagei ruckte verwundert mit dem Kopf. Diese Affen bauten ein Nest nur für eine einzige Nacht? Was für ein Aufwand.
Doch als er sah, wie gemütlich das Affenkind in dem frischen grünen Blätternest bei seiner Mutter lag, da wurde er selbst sehr, sehr, sehr müde. Und als er sah, wie die Affenmutter auf einer gelben Frucht herumlutschte, wurde er sehr, sehr hungrig.
Da geschah etwas Unerklärliches: Das kleine Bonobokind drehte den Kopf – und sah im Dämmerlicht des Abends den grünen Kongo an. Dann hob es seinen dünnen Arm und wedelte damit. Komm her.
Der junge grüne Kongo landete vorsichtig auf einem Ast weiter unten, hüpfte dann näher … und saß schließlich auf dem Rand des Nests.
Das Bonobokind krallte sich im Fell der Mutter fest und trank ihre Milch. Dabei ließ es den Papagei die ganze Zeit über nicht aus den Augen. Dann griff es nach einem Stück Frucht, das seine Mutter hatte fallen lassen und das in ihrem Fell klebte, und streckte den kleinen dünnen Arm aus. Es hielt die Frucht zwischen den Fingern. Es hatte gerade erst gelernt, Dinge zu halten, und jetzt hielt es dem grünen Kongopapagei die Frucht hin.
Es war ein Geschenk.
Der Papagei war so verblüfft, dass er erstarrte. Dann nahm er das Stückchen Frucht, ganz vorsichtig, mit seinem starken, gekrümmten Schnabel. Es stillte seinen Hunger. Es war ein Wunder.
„Mbula“, sagte die Bonobomutter plötzlich mit ihren freundlichen, ruhigen Affenlauten zu dem Papagei. „Mein Kind heißt wie der Regen. Mbula. Aber du kommst von oben, aus der Sonne, wie alle Papageien. Tiere wie du werden in der Sonne geboren, richtig? Und dann fallen sie herunter durch das Blätterdach. So erzählt man es sich bei uns. Ich werde dich Muyi nennen. Wie die Sonne. Du bist jung, du siehst einsam aus. Bleib bei uns. Du kannst unsere Augen sein über dem Dschungel und uns vor den Gefahren warnen. Mbula und Muyi, Regen und Sonne. Schlaf jetzt. Die Nacht ist dunkel und lang.“
Und der grüne Kongo, dem das Wort Muyi gefiel, faltete die Flügel und wusste, er würde hierbleiben, am Rand dieses Nestes, bis die Sonne aufging. Hier würde er sicher sein.
2
Als die Sonne zwei Monate später wie an jedem Morgen über dem Salonga-Park aufging, war der grüne Kongopapagei noch immer da.
Er schlief dicht an das Affenkind geschmiegt: ein ungewöhnliches Bild. Kongopapageien schlafen nicht in Bonobonestern. Niemals.
Oder zumindest hat das noch kein Zweibeiner gesehen und fotografiert.
„Mbula und Muyi“, sagte die Affenmutter und streichelte das schwarze Fell ihres Kindes und das grüne Gefieder des Papageien. Der grüne Sonnenjuwel hatte fortfliegen wollen, sie wusste es, aber einer seiner Flügel hatte nicht fliegen wollen und so war er geblieben. Mbula schlug die Augen auf und sah ihre Mutter an. Sie setzte sich im Nest aufrecht hin und streckte sich. Gähnte.
Muyi schüttelte sein Gefieder und reckte sich ebenfalls.
„Heute fliege ich nach Hause“, verkündete er.
„Heute gehen wir zum Fluss“, sagte die Affenmutter. „Ich habe gewartet, dass du aufwachst. Heute sollst du ihn zum ersten Mal sehen, den großen Salonga. Es gibt viel Wasser in unserem Wald, der Salonga ist nur eines dieser Wasser. Er ist schön. Ein Sonnenspiegel. Ein Glitzerwunder. Und es gibt eine gute Stelle mit Früchten. Kommt, kommt.“
Mbula trank ihre Milch, kletterte auf den Rücken ihrer Mutter und klammerte sich fest. Ihr kleines Herz schlug schnell.
Die anderen Affen der Gruppe drängten, wollten aufbrechen, waren ungeduldig.
„Sie sind nervös“, sagte Muyi und putzte sein Gefieder. „Da ist etwas.“
„Es ist nur ein Ausflug zum Fluss“, sagte die Affenmutter mit ihren sanften Augen und ihren freundlichen Lauten. „Nichts weiter. Alles ist wie immer.“
„Ich werde euch zum Fluss begleiten. Hinterher fliege ich nach Hause, hinterher ist immer noch früh genug.“
Mbula spürte, dass der Papagei recht hatte. Die Gruppe wollte fort. Als käme etwas auf sie zu. Sie streichelte den grünen Federsmaragd, Muyi, und er stieg hinauf über das Blätterdach: hinauf zur Sonne, nach der er benannt war.
Die Gruppe der Bonobos bewegte sich durch die Äste, doch weit oben flog der Sonnenpapagei und war Mbulas Augen. Sie wusste nicht viel von der Welt, aber der Papagei erzählte ihr Dinge. Wenn er von seinen Ausflügen zurückkam, rieb er seinen weichen Federkopf an ihrem kleinen schwarzen Gesicht und sie sah in seinen Augen die Welt von oben.
Etwas da draußen rief sie. Kommt, rief es, das Abenteuer wartet.
Und dann teilte Mbulas Mutter die Zweige und das Wasser des Salonga glitzerte in der Nachmittagssonne unter ihnen. Es geschah so plötzlich, dass Mbula die Augen zusammenkniff.
Sie sah, wie Muyi als grün schillernder Fleck auf einem umgestürzten Baum landete, der halb aus dem sumpfigen Ufer ragte. Runde grüne Blätter und gelbe Blüten wippten dort auf dem Wasser wie ein Teppich.
Auf einer Sandbank in der Mitte des Salonga jedoch entdeckte sie noch etwas anderes: Dort lagen große, graue Felsen mit kleinen Ohren und schliefen. Mbula hatte noch nie Felsen mit Ohren gesehen. Als sie genauer hinsah, bemerkte sie, dass die Felsen auch Beine hatten. Kurze, plumpe Beine, ganz und gar ungeeignet dazu, durch Äste zu klettern. Die Tiere, die Felsen waren, taten ihr leid.
„Hier ist es gut“, sagten die älteren Affen zueinander. „Hier werden wir bleiben. Wo Flusspferde sind, sind keine Krokodile.“
Und Mbula begriff, dass die Felsen Flusspferde waren. Als ihre Mutter mit ihr weiter hinabkletterte, um die Früchte eines Baumes nahe dem Ufer zu fressen, da sah sie, dass die Felsen auch Schnauzen hatten. Und Mäuler, die sie weit aufreißen konnten. Ein Flusspferd gähnte. Gewaltige Zähne sahen dem Affenkind entgegen und es erschrak.
„Sie fressen keine Affen“, murmelte Mbulas Mutter. „Sch, sch! Keine Sorge, mein Regenkind.“
Mbula kletterte aus dem Fell ihrer Mutter und ließ die Erwachsenen hinter sich. Sie überließ sie den Früchten, den jungen Blättern und ihrer gegenseitigen Fellpflege. Mbula turnte auf dem umgestürzten Baum ganz nach vorn, dorthin, wo die toten Äste über das Wasser ragten. Dorthin, wo auch Muyi saß.
„Sieh dir die Felsentiere an“, sagte sie. „Die sind lustig! Sie haben geschlafen, schau, aber jetzt wachen sie auf! Sie kommen ins Wasser, sie tauchen! Die, die draußen sind, haben etwas Rotes auf der Haut. Roten Saft. Wie Beeren. Das ist seltsam.“
„Flusspferde“, erklärte Muyi. „Ich habe schon viele Flusspferde gesehen von oben. Sie sind immer ein bisschen rot. Sie sollten am Rand des Waldes sein. In der Savanne. Nicht hier, im tiefen Wald. Sie brauchen Gras.“
„Vielleicht sind sie hierhergekommen, um mit uns zu spielen?“
„An der Waldgrenze sind Zweibeiner“, sagte Muyi. „Zweibeiner. Von oben kann man sie sehen. Sie sickern in den Wald wie Wasser. Vielleicht liegt es daran.“
„Du hast erzählt, die Zweibeiner haben solche wie dich gefangen“, sagte Mbula. „Vielleicht haben die Flusspferde Angst davor, dass die Zweibeiner sie auch fangen. Und sie in Käfige stecken und wollen, dass sie singen und reden.“
Sie stellte sich das lustig vor, doch Muyi schüttelte den grün gefiederten Kopf und flog in die Höhe. „Käfige sind nicht lustig.“
In diesem Moment glitt etwas von der Sandbank aus ins Wasser – etwas Kleines, das sich bis jetzt hinter einem größeren Flusspferd versteckt hatte. Ein Flusspferdkind. Es war kaum größer als ein ausgewachsener Bonobo. Es paddelte mit seinen kurzen Beinen und hielt Ohren, Augen und Nasenlöcher mühsam über Wasser … Und dann war es direkt unter dem toten Baum, auf dem Mbula saß.
Die Mutter des kleinen Flusspferdes kam ihm nachgeschwommen, besorgt.
Mbula streckte einen ihrer langen Arme aus und griff nach unten, um das Flusspferd anzufassen. Sie wollte wissen, wie es sich anfühlte.
Sie wollte alles auf der Welt wissen, einfach alles.