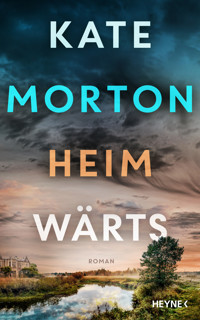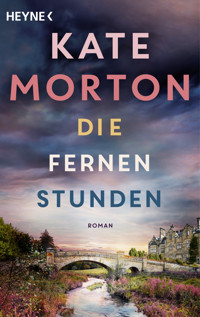9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Schwestern, ein geheimes Spiel und eine verbotene Liebe
Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kommt Grace Bradley als Dienstbotin nach Riverton Manor. Selbst noch nicht erwachsen, bewundert sie die Hartford-Mädchen Hannah und Emmeline, die mit ihrer unbeschwerten Fröhlichkeit für Leben auf dem Anwesen sorgen. Doch die Begegnung mit dem jungen Dichter Lord Robert Hunter wird Hannah und Emmeline für immer verändern. Als einzige Vertraute versucht Grace die beiden Schwestern vor Unheil zu bewahren – vergeblich …
Mehr als 75 Jahre bewahrt Grace das Geheimnis, bis sie endlich die Wahrheit über jene Tage preisgibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 878
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Das Buch
England 1924: Während einer rauschenden Party auf dem Landsitz Riverton Manor kommt der junge Dichter Lord Robert Hunter ums Leben. Einzige Zeuginnen sind die Hartford-Schwestern Emmeline und Hannah, die danach nie wieder ein Wort miteinander reden. Was genau geschah in jener Sommernacht? Und welche Rolle spielte Grace Reeves dabei, die als blutjunges Hausmädchen nach Riverton Manor kam und Hannah und Emmeline seitdem hingebungsvoll begleitete? Mehr als fünfundsiebzig Jahre lang hütet Grace das schreckliche Geheimnis. Dann wird sie von einer jungen Frau kontaktiert, die das Drama von damals verfilmen will. Die Gespräche mit ihr wühlen alte Erinnerungen wieder auf. Kann sich Grace endlich der großen Schuld stellen, die sie ihr Leben lang nicht mehr losgelassen hat?
Die Autorin
Kate Morton wuchs im australischen Queensland auf und studierte Theaterwissenschaften in London und Englische Literatur in Brisbane. Sie lebt mit ihrer Familie in Australien und England. Kate Mortons Romane erscheinen weltweit in 38 Sprachen und 45 Ländern und eroberten ein Millionenpublikum. Sie sind allesamt SPIEGEL-Bestseller:
Das geheime Spiel – Der verborgene Garten – Die fernen Stunden – Die verlorenen Spuren – Das Seehaus – Die Tochter des Uhrmachers – Heimwärts
Die Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel
The Shifting Fog bei Allen & Unwin, Crows Nest, Australien
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2006 by Kate Morton
Copyright © dieser Ausgabe 2007 by Diana Verlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion | Angelika Lieke
Herstellung | Helga Schörnig
Satz | Leingärtner, Nabburg
Covergestaltung | t.mutzenbach design
Covermotive | Shutterstock.com (bogumil, ZoranKrstic, NGarden21, naskopi)
ISBN 978-3-641-01630-2V006
www.diana-verlag.de
Für Davin, der mir in der Achterbahn die Hand hält
Inhaltsverzeichnis
Teil 1
Drehbuch
Endgültige Fassung, November 1998, Seiten 1 – 4
Nebelschwaden
Buch und Regie Ursula Ryan © 1998
Musik: Titelmelodie. Wehmütige Musik, wie sie um die Zeit des Ersten Weltkriegs populär war. Eine romantische Melodie, in der gleichzeitig etwas Unheilvolles mitschwingt.
1. Außenaufnahme: Eine Landstraße – Abenddämmerung
Eine Landstraße, die an endlosen grünen Feldern vorbeiführt. Es ist 20:00 Uhr. Die Sommersonne zögert noch am fernen Horizont, als sträubte sie sich dagegen unterzugehen. Wie ein glänzender schwarzer Käfer gleitet ein Automobil der Zwanzigerjahre über die schmale Landstraße, fährt an alten Brombeerhecken vorbei, die im Abendlicht blau schimmern und deren Ranken über die Straße hängen.
Die Lichtkegel der Scheinwerfer wackeln, während das Auto über die holprige Straße fährt. Wir holen langsam auf, bis wir neben dem Wagen herfahren. Die Sonne ist inzwischen untergegangen, es ist Nacht. Der Vollmond wirft weißes Licht auf die dunkle, glänzende Kühlerhaube.
Im dunklen Innern des Wagens erkennen wir die Profile der Insassen: ein MANN und eine FRAU in Abendgarderobe. Der Mann sitzt am Steuer. Die Pailletten auf dem Kleid der Frau schimmern, wenn das Mondlicht darauf fällt. Beide rauchen, die orangefarben glühenden Spitzen ihrer Zigaretten bewegen sich im Takt mit den Autoscheinwerfern. Die FRAU lacht über etwas, das der MANN gesagt hat, wirft den Kopf zurück, sodass ihr blasser, schlanker Hals unter der Federboa zum Vorschein kommt.
Sie halten vor einem großen, schmiedeeisernen Tor, hinter dem eine von hohen Bäumen überschattete Allee zu sehen ist. Der Wagen biegt in die Einfahrt ein und fährt durch den dunklen Korridor aus Baumkronen. Wir schauen durch die Windschutzscheibe, bis das dichte Laub sich teilt und den Blick auf unser Ziel freigibt.
Vor uns auf einem Hügel erhebt sich ein herrschaftliches englisches Herrenhaus: drei Stockwerke mit jeweils zwölf spiegelnden Fenstern; Gauben und Kamine ragen aus dem Schieferdach. Im Vordergrund, mitten auf einem perfekt gepflegten Rasen, prangt ein großer marmorner, von Laternen beleuchteter Springbrunnen: riesige Ameisen, mächtige Adler und gewaltige feuerspeiende Drachen, dazwischen Wasserfontänen, die fast dreißig Meter hoch in die Luft schießen.
Wir behalten unsere Position bei und verfolgen, wie der Wagen ohne uns um den runden Brunnen herumfährt. Als er vor dem Hauseingang hält, öffnet ein junger DIENER die Wagentür und hilft der FRAU beim Aussteigen.
Untertitel: Riverton Manor, England. Sommer 1924.
2. Innenaufnahme: Dienstbotentrakt – Abend
Der warme, schwach beleuchtete Dienstbotentrakt von Riverton Manor. Eine Atmosphäre emsiger Betriebsamkeit. Wir befinden uns auf Knöchelhöhe und sehen die Beine der Dienerschaft in alle Richtungen über den grauen Steinboden eilen. Im Hintergrund knallen Champagnerkorken, werden Befehle erteilt, Küchenmädchen gescholten. Eine Glocke läutet. Immer noch auf derselben Sichthöhe folgen wir dem DIENSTMÄDCHEN in Richtung Treppe.
3. Innenaufnahme: Treppenhaus – Abend
Wir folgen dem DIENSTMÄDCHEN die schwach beleuchtete Treppe hinauf; ein leises Klimpern verrät uns, dass ihr Tablett mit Champagnergläsern beladen ist. Mit jedem Schritt hebt sich unser Blick – von ihren schmalen Knöcheln zu ihrem schwarzen Rocksaum, weiter zu den weißen Spitzen der Schürzenschleife und hin zu den blonden Locken in ihrem Nacken – bis wir die Umgebung schließlich mit ihren Augen sehen.
Die Geräusche aus dem Dienstbotentrakt werden leiser, während die Musik und das Lachen der Gäste lauter werden. Am Ende der Treppe öffnet sich vor uns die Tür.
4. Innenaufnahme: Eingangshalle – Abend
Gleißendes Licht, als wir die imposante, mit Marmor geflieste Eingangshalle betreten. An der Decke ein glitzernder Kronleuchter. Der BUTLER öffnet die Haustür, um das elegant gekleidete Paar aus dem Auto zu begrüßen. Ohne innezuhalten durchqueren wir die Eingangshalle und gehen zu der breiten, doppelflügeligen Glastür, die auf die Terrasse führt.
5. Innenaufnahme: Terrasse – Abend
Die Glastüren öffnen sich. Musik und Lachen schwellen an: Wir befinden uns mitten in einer glamourösen Party. Eine Atmosphäre von Nachkriegsextravaganz: Pailletten, Federn, Seide, so weit das Auge reicht. Bunte chinesische Lampions schaukeln an einer über den Rasen gespannten Schnur im leichten Sommerabendwind. Eine Jazzband spielt, und Frauen tanzen Charleston. Wir bewegen uns durch die Menge lachender Gesichter. Sie wenden sich uns zu, nehmen ein Glas Champagner vom Tablett: eine Frau mit leuchtend roten Lippen; ein dicker Mann, dessen gerötetes Gesicht von Erregung und ausgiebigem Alkoholgenuss zeugt; eine magere alte Dame, über und über mit Schmuck behängt, eine lange Zigarettenspitze mit aufsteigenden Rauchkringeln in der knochigen Hand.
Plötzlich ertönt ein lauter KNALL, und alle Blicke richten sich nach oben, wo ein riesiges Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet. Freudenschreie und Applaus. Bunte Feuerräder spiegeln sich in den staunenden Gesichtern, die Kapelle spielt noch lauter, und die Frauen tanzen immer schneller.
Schnitt
6. Außenaufnahme: See – Abend
Einen halben Kilometer weit entfernt steht ein JUNGER MANN am dunklen Ufer des Riverton-Sees. Im Hintergrund sind Partygeräusche zu hören. Der JUNGE MANN schaut in den Himmel. Wir nähern uns und sehen, wie das rote Licht des Feuerwerks auf seinem schönen Gesicht spielt. Obwohl elegant gekleidet, strahlt er etwas Wildes, Ungezähmtes aus. Sein braunes Haar ist zerzaust, fällt ihm in die Stirn und verdeckt beinah seine dunklen Augen, mit denen er in panischer Angst in den Nachthimmel starrt. Er senkt den Blick und schaut an uns vorbei zu jemandem hinüber, der im Schatten nicht zu erkennen ist. Seine Augen sind feucht, er wirkt plötzlich entschlossen. Seine Lippen öffnen sich, als wollte er etwas sagen, aber er seufzt nur.
Wir hören ein KLICKEN. Unser Blick geht nach unten. Der JUNGE MANN hält eine Pistole in der zitternden Hand. Er bewegt die Pistole aus unserem Gesichtsfeld heraus. Wir hören einen Schuss. Seine andere Hand, die an seiner Seite herabhängt, zuckt plötzlich und erstarrt dann. Der JUNGE MANN stürzt auf den schlammigen Boden am Seeufer. Eine Frau schreit, während die Partymusik weiterspielt.
Ausblenden
Abspann: »Nebelschwaden«
Der Brief
Ursula RyanFocus Film Productions1264 N. Sierra Bonita Ave 32West Hollywood, CA90046 USA
Mrs Grace Bradley Heathview Pflegeheim 64 Willow Road Saffron Green Essex, CB10 IHQ UK
27. Januar 1999
Sehr geehrte Mrs Bradley,
bitte verzeihen Sie, dass ich mich erneut an Sie wende, aber ich habe leider keine Antwort erhalten auf meinen letzten Brief, in dem ich Ihnen mein Filmprojekt »Nebelschwaden« vorgestellt habe.
Bei dem Film handelt es sich um eine Liebesgeschichte, die Geschichte des Dichters R.S. Hunter, um sein Verhältnis mit den Hartford-Schwestern und seinen Selbstmord im Jahr 1924. Zwar haben wir die Genehmigung erhalten, die Außenaufnahmen vor Ort in Riverton Manor zu drehen, werden die Innenszenen jedoch im Studio aufnehmen.
Viele Sets konnten wir anhand von alten Fotos und Beschreibungen rekonstruieren, aber ich würde sie gern von jemandem beurteilen lassen, der sie aus erster Hand kennt. Der Film liegt mir sehr am Herzen, und ich möchte um jeden Preis historische Ungenauigkeiten vermeiden, seien sie auch noch so gering. Ich wäre Ihnen also sehr zu Dank verpflichtet, wenn Sie sich bereit erklärten, sich den Set einmal anzusehen.
Ich habe Ihren Namen (Ihren Mädchennamen) auf einer Liste in einem von mehreren Notizbüchern gefunden, die dem Museum of Essex geschenkt wurden. Auf die Verbindung zwischen Ihnen und Grace Reeves bin ich nur gekommen, weil ich im Spectator ein Interview mit Ihrem Enkel Marcus McCourt gelesen habe, in dem er kurz die weit zurückreichende Verbundenheit seiner Familie mit dem Dorf Saffron Green erwähnt.
Beiliegend finden Sie einen kurzen Artikel aus der Sunday Times über meine bisherigen Filme, damit Sie sich ein Bild von meiner Arbeit machen können, sowie einen Artikel aus der LA Film Weekly über »Nebelschwaden«. Sie werden feststellen, dass es uns gelungen ist, eine Reihe hervorragender Schauspieler für die Rollen von Hunter, Emmeline Hartford und Hannah Luxton unter Vertrag zu nehmen, unter anderen Gwyneth Paltrow, die kürzlich für ihre Rolle in »Shakespeare in Love« einen Golden Globe erhalten hat.
Bitte verzeihen Sie mir meine Aufdringlichkeit, aber wir werden bereits Ende Februar in den Shepperton Studios nördlich von London mit den Dreharbeiten beginnen, und ich brenne darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Ich hoffe sehr, Ihr Interesse für dieses Projekt geweckt zu haben, und würde mich freuen, wenn Sie uns Ihre Unterstützung zusagen könnten.
Sie erreichen mich unter folgender Adresse: Mrs Jan Ryan, 5/45 Lancaster Court, Fulham, London SW6.
Mit freundlichen Grüßen
Ursula Ryan
Geister regen sich
Letztes Jahr im November hatte ich einen Albtraum. Es war das Jahr 1924, und ich war wieder in Riverton. Alle Türen standen weit offen, seidene Vorhänge bauschten sich im Sommerwind. Ein Orchester spielte auf dem Hügel unter dem alten Ahornbaum. Schwungvolle Geigenmelodien, helles Lachen und das Klirren von Kristall erfüllten die warme Luft, und der Himmel erstrahlte in einem Blau, von dem wir alle geglaubt hatten, der Krieg hätte es für immer geraubt. Einer der Diener, adrett in Schwarz und Weiß gekleidet, goss Champagner in das oberste Glas eines Turms aus Sektflöten, und alle klatschten Beifall und amüsierten sich über diese köstliche Verschwendung.
Wie es oft in Träumen der Fall ist, konnte ich mich selbst zwischen den Gästen sehen. Ich bewegte mich sehr langsam, viel langsamer, als es in Wirklichkeit möglich ist, und nahm die anderen nur noch verschwommen als Meer aus Seide und Pailletten wahr.
Ich suchte jemanden.
Dann änderte sich das Bild, und ich befand mich in der Nähe des Sommerhauses, nur dass es nicht das Sommerhaus von Riverton war – das konnte es unmöglich sein. Es war nicht das nagelneue Haus, das Teddy selbst entworfen hatte, sondern ein alter Schuppen, umrankt von Efeu, das durch die Fenster hineinkroch und sich wie würgend um die stützenden Balken schlängelte.
Eine Frauenstimme, die ich erkannte, rief vom Seeufer hinter dem Haus meinen Namen. Als ich den Weg hinunterging, streiften meine Hände das Schilf. Am Ufer hockte eine Gestalt.
Es war Hannah in ihrem Hochzeitskleid, die am Oberteil applizierten Rosen waren mit Schlamm bespritzt. Sie blickte mit bleichem Gesicht zu mir auf. Als ich ihre Stimme hörte, lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. »Du kommst zu spät.« Sie zeigte auf meine Hände. »Du kommst zu spät.«
Ich betrachtete meine Hände, junge, mit dunklem Flussschlamm bedeckte Hände; sie hielten den kalten, steifen Körper eines toten Jagdhundes.
Natürlich weiß ich, was den Traum verursacht hat. Es war der Brief von dieser Filmemacherin. Ich bekomme schon lange kaum noch Post: hin und wieder mal eine Urlaubskarte von pflichtbewussten Freunden, einen nichtssagenden Brief von der Bank, bei der ich ein Sparkonto unterhalte, eine Einladung zur Taufe eines Kindes, dessen Eltern, wie mir dann plötzlich bewusst wird, inzwischen selbst keine Kinder mehr sind.
Ursulas Brief war an einem Dienstagmorgen Ende November eingetroffen, und Sylvia hatte ihn mir ans Bett gebracht. Mit hochgezogenen Brauen hatte sie mit dem Brief in der Luft gewedelt.
»Post für Sie. Irgendwas aus den Staaten, nach den Briefmarken zu urteilen. Vielleicht von Ihrem Enkel?« Ihre linke Braue krümmte sich zu einer Art Fragezeichen, und sie senkte die Stimme zu einem heiseren Flüstern. »Schreckliche Sache. Einfach schrecklich. Dabei ist er doch so ein netter junger Mann.«
Während Sylvia seufzend den Kopf schüttelte, bedankte ich mich für den Brief. Ich mag Sylvia. Sie gehört zu den Wenigen, die hinter meinem faltigen Gesicht die Zwanzigjährige erkennen können, die noch immer in mir lebendig ist. Aber in ein Gespräch über Marcus lasse ich mich deswegen noch lange nicht von ihr verwickeln.
Als ich sie bat, die Vorhänge aufzuziehen, schürzte sie einen Moment lang die Lippen, dann ging sie zu einem ihrer anderen Lieblingsthemen über: das Wetter. Sie überlegte, wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass wir zu Weihnachten Schnee bekämen, und was für eine Katastrophe das für die alten, gebrechlichen Leute wäre. Ich antwortete auf ihre Fragen, war jedoch eigentlich mit dem Umschlag auf meinem Schoß beschäftigt, wunderte mich über die krakelige Schrift, die ausländischen Briefmarken, die zerknitterten Ecken, die darauf schließen ließen, dass der Brief einen langen Weg hinter sich hatte.
»Kommen Sie, ich lese Ihnen den Brief vor«, sagte Sylvia, während sie meine Kissen noch einmal aufschüttelte. »Dann können Sie Ihre Augen ein bisschen ausruhen.«
»Nein danke. Aber würden Sie mir bitte meine Brille reichen?«
Nachdem sie sich mit dem Versprechen verabschiedet hatte, noch einmal zurückzukommen und mir beim Anziehen zu helfen, sobald sie ihre Runde gemacht hatte, nahm ich mit meinen ständig zitternden Händen den Brief aus dem Umschlag, in der vagen Hoffnung, dass Marcus endlich wieder nach Hause kommen würde.
Doch der Brief war nicht von ihm. Er kam von einer jungen Frau, die einen Film über die Vergangenheit drehte. Sie wollte, dass ich mir ihre Kulissen ansah, dass ich mich an Dinge und Ereignisse erinnerte, die lange zurückliegen. Als hätte ich mich nicht mein Leben lang bemüht, all das zu vergessen.
Ich schenkte dem Brief keine weitere Beachtung. Ich faltete ihn sorgfältig wieder zusammen und steckte ihn in ein Buch, das zu Ende zu lesen ich längst aufgegeben hatte. Und dann atmete ich tief durch. Es war nicht das erste Mal, dass ich an das erinnert wurde, was Robbie und den Hartford-Schwestern auf Riverton widerfahren war. Einmal hatte ich das Ende eines Dokumentarfilms im Fernsehen gesehen, eine Sendung über Soldatendichter, die Ruth sich gerade anschaute. Als Robbies Gesicht auf dem Bildschirm erschien, darunter sein Name in geraden Buchstaben, lief ein Prickeln über meine Haut. Aber nichts passierte. Ruth zuckte nicht zusammen, der Sprecher fuhr fort, und ich trocknete weiter die Teller ab.
Ein anderes Mal entdeckte ich beim Studieren der Fernsehzeitschrift einen vertrauten Namen in einer Filmbeschreibung. Es ging um eine Sendung mit dem Titel »Siebzig Jahre britischer Film«. Mit klopfendem Herzen notierte ich mir die Uhrzeit, überlegte, ob ich es wirklich wagen würde, mir das anzusehen. Am Ende schlief ich während der Sendung ein. Emmeline wurde nur flüchtig erwähnt. Ein paar Fotos, von denen keins ihre wahre Schönheit zeigte, und ein Ausschnitt aus einem ihrer Stummfilme, The Venus Affair, in dem sie einen recht merkwürdigen Eindruck machte, hohlwangig und mit ruckartigen Bewegungen wie eine Marionette. Es gab keine Hinweise auf ihre anderen Filme, die beinahe einen Skandal ausgelöst hätten. Wahrscheinlich ist so etwas heute, in Zeiten der sexuellen Freizügigkeit, nicht mehr der Rede wert.
Ich war also durchaus schon mit solchen Erinnerungen konfrontiert worden, aber Ursulas Brief war etwas anderes. Zum ersten Mal seit über siebzig Jahren brachte jemand mich in Verbindung mit den Ereignissen, zum ersten Mal erinnerte sich jemand daran, dass eine junge Frau namens Grace Reeves in jenem Sommer auf Riverton gewesen war. Ich fühlte mich irgendwie verwundbar, ertappt und – schuldig.
Nein. Ich würde diesen Brief auf keinen Fall beantworten.
Und dabei blieb ich.
Aber dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Erinnerungen, die lange in den dunkelsten Ecken meines Unterbewusstseins geschlummert hatten, begannen durch Ritzen zu sickern. Bilder tauchten vor meinem geistigen Auge auf, so klar und frisch, als wäre nicht inzwischen eine halbe Ewigkeit vergangen. Und dann, nach den ersten vereinzelten Rinnsalen, kam die Sintflut: ganze Gespräche, wortwörtlich, mit allen Einzelheiten, Szenen, die wie Kurzfilme vor mir abliefen.
Ich wundere mich über mich selbst. Während mein Gedächtnis mich schon seit einigen Jahren oft schmählich im Stich lässt, stehen meine Erinnerungen an diese längst vergangenen Ereignisse klar und deutlich vor mir. Sie kommen immer häufiger, die Geister der Vergangenheit, und zu meiner eigenen Überraschung beunruhigen sie mich gar nicht sonderlich. Längst nicht so sehr, wie ich befürchtet hatte. Im Gegenteil, die Gespenster, vor denen ich ein Leben lang davongelaufen bin, haben inzwischen beinahe etwas Tröstliches, ich freue mich auf sie wie auf eine von diesen Fernsehserien, von denen Sylvia dauernd schwärmt, wenn sie sich beeilt, um mit ihrer Runde pünktlich zum Sendebeginn fertig zu sein. Ich hatte wohl ganz vergessen, dass unter all den düsteren Erinnerungen auch einige heitere wiederzuentdecken sind.
Als vergangene Woche der zweite Brief kam, in derselben krakeligen Handschrift und auf dem gleichen weichen Papier, wusste ich, dass ich ja sagen würde. Ich würde mir die Kulissen ansehen. Ich war tatsächlich neugierig, ein Gefühl, das ich schon lange nicht mehr empfunden hatte. Wenn man achtundneunzig Jahre alt ist, gibt es nicht mehr viel, worauf man neugierig sein kann, aber diese Ursula Ryan wollte ich kennenlernen, die Frau, die sie alle zum Leben erwecken will, eine Frau, die sich so leidenschaftlich für ihre Geschichte einsetzt.
Also schrieb ich ihr einen Brief, bat Sylvia, ihn für mich zur Post zu bringen, und wir verabredeten ein Treffen.
Der Salon
Meine Haare, die früher einmal hellblond waren, sind jetzt schneeweiß und sehr, sehr lang. Und sie scheinen von Tag zu Tag feiner zu werden. Sie sind mein ganzer Stolz – und es gibt weiß Gott nicht mehr viel, worauf ich stolz sein kann. Seit 1989 habe ich keinen Friseur mehr an meinen Kopf gelassen. Zu meinem großen Glück macht es Sylvia Spaß, mir die Haare Tag für Tag zu bürsten – ganz sanft macht sie das – und zu flechten. Ich bin ihr umso dankbarer, weil das eigentlich gar nicht zu ihren Pflichten gehört. Das muss ich ihr unbedingt einmal sagen.
Heute Morgen habe ich es vor lauter Aufregung ganz vergessen. Als Sylvia mir meinen Saft brachte, konnte ich ihn kaum trinken. Die nervöse Energie, die mich die ganze Woche über begleitet hatte, war über Nacht zu einem Knoten in meinem Magen geworden. Sylvia half mir in mein neues pfirsichfarbenes Kleid – das Kleid, das Ruth mir zu Weihnachten geschenkt hat – und in die Straßenschuhe, die gewöhnlich unbenutzt in meinem Schrank stehen. Das Leder war ziemlich steif, und es war gar nicht so einfach, meine Füße hineinzuzwängen, aber die Eitelkeit hat ihren Preis. Ich bin zu alt, um meine Angewohnheiten noch zu ändern, und ich finde es fürchterlich, dass die jüngeren Bewohner dieses Hauses in Hausschuhen ausgehen.
Ein Hauch von Puder ließ meine Wangen etwas rosiger erscheinen, aber ich habe darauf geachtet, dass Sylvia es nicht übertrieb. Schließlich möchte ich nicht aussehen wie die Schaufensterpuppe eines Leichenbestatters. Ich bin so blass und so klein, dass schon ein kleines bisschen mehr zu viel sein kann.
Mit einiger Mühe legte ich mir das goldene Medaillon um den Hals, ein elegantes Schmuckstück aus dem neunzehnten Jahrhundert, das eigentlich nicht so recht zu meiner praktischen Kleidung passt. Ich rückte es zurecht, wunderte mich über meine Kühnheit, fragte mich, was Ruth dazu sagen würde.
Dann fiel mein Blick auf den kleinen silbernen Rahmen auf meinem Schminktisch. Ein Foto von meinem Hochzeitstag. Meinetwegen bräuchte es nicht da zu stehen – es ist schon so lange her, und die Ehe war sehr kurz; armer John –, aber ich räume es Ruth zuliebe nicht weg. Ich glaube, sie stellt sich gern vor, dass ich mich nach ihm sehne.
Sylvia führte mich in den Salon – es wurmt mich immer noch, den Raum so zu nennen –, wo gerade das Frühstück aufgetragen wurde und wo ich auf Ruth warten sollte, die sich (obwohl sie eigentlich dagegen war, wie sie behauptet) bereit erklärt hatte, mich zu den Shepperton Studios zu fahren. Ich ließ mich von Sylvia an einen einzelnen Tisch in der Ecke geleiten und bat sie, mir ein Glas Saft zu bringen. Dann las ich Ursulas Brief noch einmal.
Ruth kam um Punkt halb neun. Sie mag ihre Bedenken gehabt haben, was diesen Ausflug anging, aber sie ist schon immer ein Muster an Pünktlichkeit gewesen. Ich habe einmal gehört, dass Kinder, die in schweren Zeiten geboren werden, immer etwas Leidendes ausstrahlen, und Ruth, ein Kind des Zweiten Weltkriegs, ist der lebende Beweis für dieses Gesetz. Ganz anders als Sylvia, die nur fünfzehn Jahre jünger ist und in engen Röcken zur Arbeit erscheint, zu laut lacht und jedes Mal, wenn sie einen neuen Freund hat, die Haarfarbe wechselt.
Ruth kam auf meinen Tisch zu, makellos gekleidet und zurechtgemacht, aber steifer als ein Stock.
»Guten Morgen, Mum«, sagte sie und hauchte mir mit kalten Lippen einen Kuss auf die Wange. »Schon fertig gefrühstückt?« Sie warf einen prüfenden Blick auf das halb leere Glas vor mir. »Ich hoffe, das war nicht alles, was du zu dir genommen hast. Wir werden sicherlich in den Berufsverkehr geraten und keine Zeit haben, irgendwo anzuhalten.« Sie schaute auf ihre Uhr. »Musst du noch mal aufs Klo?«
Ich schüttelte den Kopf und fragte mich, wann wir die Rollen getauscht hatten und ich zur Tochter geworden war.
»Du trägst ja Vaters Medaillon; das hab ich schon ewig nicht mehr an dir gesehen.« Mit einem beifälligen Nicken rückte sie es zurecht. »Er hatte einen guten Geschmack, nicht wahr?«
Ich stimmte ihr zu, gerührt von der Vorbehaltlosigkeit, mit der Kinder einem kleine Lügen abkaufen. Eine Welle der Zuneigung für meine kratzbürstige Tochter überkam mich, und ich beeilte mich, die vertrauten elterlichen Schuldgefühle zu unterdrücken, die jedes Mal in mir hochkommen, wenn ich in ihr besorgtes Gesicht sehe.
Sie nahm meinen Arm, hakte sich bei mir unter und drückte mir meinen Spazierstock in die andere Hand. Die meisten anderen hier im Heim bevorzugen Gehhilfen auf Rollen oder sogar elektrische Rollstühle, aber ich komme immer noch ganz gut mit meinem Spazierstock zurecht und liebe meine alten Gewohnheiten zu sehr, um ihn gegen irgendetwas anderes einzutauschen.
Sie ist ein gutes Mädchen, meine Ruth – solide und zuverlässig. An diesem Tag war sie sehr förmlich gekleidet, wie für einen Besuch bei ihrem Anwalt oder ihrem Arzt. Aber damit hatte ich gerechnet. Sie wollte einen guten Eindruck machen, dieser Filmemacherin zeigen, dass Ruth Bradley McCourt, egal, was ihre Mutter in der Vergangenheit getan haben mochte, eine seriöse, respektable Angehörige der Mittelschicht war.
Nachdem wir eine Weile gefahren waren, schaltete Ruth das Radio ein. Sie hat die Finger einer alten Frau, die Knöchel geschwollen, weil sie am Morgen mit Gewalt ihre Ringe darübergezwängt hatte. Es ist verblüffend, die eigene Tochter altern zu sehen. Ich betrachtete meine auf dem Schoß verschränkten Hände. Hände, die früher einmal so agil gewesen waren, die einfache und komplexe Arbeiten verrichtet hatten, Hände, die jetzt grau, schlaff und träge dalagen. Endlich hatte Ruth sich für einen Sender entschieden, der klassische Musik spielte. Der Sprecher plauderte eine Weile über belanglose Dinge, dann legte er Chopin auf. Purer Zufall, dass ich ausgerechnet heute Chopins Walzer in Cis-Moll zu hören bekam.
Ruth hielt vor ein paar riesigen weißen Gebäuden, die so breit waren wie Flugzeughallen. Nachdem sie den Motor ausgeschaltet hatte, blieb sie noch einen Moment lang sitzen, den Blick nach vorn gerichtet. »Ich weiß nicht, warum du dir das antust«, sagte sie leise mit gespannten Lippen. »Du hast so viel aus deinem Leben gemacht, bist gereist, hast studiert, eine Tochter großgezogen … Warum willst du daran erinnert werden, was du einmal gewesen bist?«
Sie erwartete keine Antwort, und ich gab ihr auch keine. Plötzlich seufzte sie, sprang aus dem Wagen und nahm meinen Spazierstock aus dem Kofferraum. Wortlos half sie mir beim Aussteigen.
Eine junge Frau erwartete uns. Ein schmächtiges Mädchen mit sehr langen blonden Haaren, die ihr glatt über den Rücken fielen und über den Augen zu einem dichten Pony geschnitten waren. Der Typ Mädchen, den man als unscheinbar hätte bezeichnen können, wäre sie nicht mit so unglaublichen Augen gesegnet gewesen. Sie hätten in ein Ölgemälde gehört, rund, ausdrucksstark und so schimmernd dunkel wie nasse Farbe.
Sie kam lächelnd auf uns zu und nahm meine Hand von Ruths Arm. »Mrs Bradley, wie schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich bin Ursula.«
»Grace«, sagte ich, bevor Ruth dazu kam, sie auf meinen Doktortitel hinzuweisen. »Nennen Sie mich Grace.«
»Grace.« Ursula strahlte. »Sie glauben gar nicht, wie ich mich über Ihren Brief gefreut habe.« Sie sprach mit englischem Akzent, eine Überraschung, wo doch auf dem Brief ein amerikanischer Absender gestanden hatte. Sie wandte sich an Ruth. »Vielen Dank, dass Sie sich als Chauffeurin zur Verfügung gestellt haben.«
Ich spürte, wie Ruth neben mir ganz steif wurde. »Ich konnte meine Mutter ja wohl schlecht in einen Bus setzen, oder?«
Ursula lachte. Zum Glück sind junge Leute so schnell bereit, Unhöflichkeit als Ironie aufzufassen. »Kommen Sie rein, es ist ja eiskalt draußen. Tut mir leid, dass das alles so schnell gehen muss. Wir fangen nächste Woche an zu drehen, und im Moment wissen wir kaum noch, wo uns der Kopf steht vor lauter Stress. Ich hätte Sie gern unserer Bühnenbildnerin vorgestellt, leider musste sie nach London fahren, um Stoff zu kaufen. Aber falls Sie noch hier sind, wenn sie zurückkommt … Vorsicht an der Tür, da ist eine kleine Stufe.«
Ursula und Ruth bugsierten mich in ein Foyer und durch einen dunklen Gang mit einer Reihe von Türen rechts und links. Einige davon standen offen, und ich erkannte schattenhafte Gestalten vor leuchtenden Computerbildschirmen. Es war alles ganz anders als das Filmstudio, in das ich Hannah damals begleitet hatte, um Emmeline abzuholen.
»Da sind wir«, verkündete Ursula, als wir vor der letzten Tür angekommen waren. »Kommen Sie rein, ich besorge uns einen Tee.« Sie öffnete die Tür, und ich wurde über die Schwelle direkt in meine Vergangenheit geschoben.
Es war der Salon von Riverton Manor. Selbst die Tapete war die gleiche, eine burgunderrote Jugendstiltapete der Firma Silver Studios, Design »Flammende Tulpen«, so frisch wie an dem Tag, als die Tapezierer sie aus London mitgebracht hatten. In der Mitte, vor dem Kamin, stand ein Ledersofa, drapiert mit indischer Seide, genau wie die, die Lord Ashbury, Hannahs und Emmelines Großvater, als junger Marineoffizier aus Indien mitgebracht hatte. Die Schiffsuhr stand, wo sie immer gestanden hatte, auf dem Kaminsims neben dem Waterford-Kandelaber. Jemand hatte sich große Mühe gegeben, den Raum exakt nachzubilden, und doch verriet er sich in allen Details als Hochstapler. Selbst heute noch, nach achtzig Jahren, erinnere ich mich an das Ticken der Uhr im Salon. An die stille, beharrliche Art, mit der sie die Zeit maß: geduldig, unbeirrbar, kalt – als hätte sie damals schon gewusst, dass die Zeit denen, die in diesem Haus lebten, nicht wohlgesonnen war.
Ruth begleitete mich bis zu dem Ledersofa und platzierte mich dort in einer Ecke. Hinter mir nahm ich geschäftiges Treiben wahr, riesige Scheinwerfer auf insektenartigen Beinen wurden hin und her geschoben, irgendwo lachte jemand.
Ich musste an das letzte Mal denken, als ich in dem Salon gewesen war – dem echten, nicht diesem nachgestellten – , an den Tag, an dem ich begriffen hatte, dass ich Riverton verlassen und nie wieder zurückkehren würde.
Ich hatte es Teddy gesagt. Er war nicht gerade erfreut, aber er besaß längst nicht mehr seine frühere Autorität, die Ereignisse hatten sie ihm genommen. Er wirkte blass und leicht verwirrt wie ein Kapitän, der wusste, dass sein Schiff sank und dass er es nicht verhindern konnte. Er bat mich, nicht zu gehen, flehte mich an, wenn schon nicht seinetwegen, wenigstens Hannah zuliebe zu bleiben. Und ich hätte beinahe nachgegeben. Beinahe.
Ruth stieß mich an. »Mum? Ursula spricht mit dir.«
»Verzeihen Sie, ich habe Sie nicht gehört.«
»Meine Mutter ist ein bisschen schwerhörig«, erklärte Ruth. »Das ist in ihrem Alter nicht anders zu erwarten. Ich habe schon mehrmals versucht, sie zum Ohrenarzt zu bringen, aber sie ist ein bisschen starrsinnig.«
Dass ich starrsinnig bin, gebe ich zu. Aber ich bin nicht schwerhörig, und ich mag es nicht, dafür gehalten zu werden – ich sehe schlecht ohne Brille, ich werde schnell müde, trage ein Gebiss und überlebe nur mithilfe meines täglichen Pillencocktails, doch ich höre so gut wie eh und je. Im Alter habe ich allerdings gelernt, nur noch das zu hören, was ich wirklich hören will.
»Ich sagte gerade, Mrs Bradley, Grace, dass es ein seltsames Gefühl sein muss, an diesen Ort zurückzukehren. Na ja, mehr oder weniger zurückzukehren. Das weckt doch sicherlich eine Menge Erinnerungen?«
»Ja.« Ich räusperte mich. »Ja, das tut es.«
»Wie schön«, sagte Ursula lächelnd. »Dann darf ich wohl annehmen, dass wir alles richtig hinbekommen haben. «
»O ja.«
»Steht irgendetwas an der falschen Stelle? Haben wir etwas vergessen?«
Ich sah mich noch einmal auf dem Set um. Akribisch genau nachgebaut, mangelte es dem Raum dennoch auf seltsame Weise an Atmosphäre. Er wirkte wie ein Museum: interessant, aber ohne Leben.
Das war natürlich verständlich. Die Zwanzigerjahre, so lebendig in meiner Erinnerung, sind für die Bühnenbildner des Films die »alten Zeiten«. Eine historische Kulisse, deren Gestaltung eine ebenso intensive Recherche und einen ebenso genauen Blick fürs Detail erfordert wie die Nachbildung einer mittelalterlichen Burg.
Ich spürte, wie Ursula mich ansah und begierig auf eine Antwort wartete.
»Es ist perfekt«, erklärte ich. »Alles ist genau getroffen. «
Dann sagte sie etwas, das mich zusammenzucken ließ. »Bis auf die Familie.«
»Ja«, antwortete ich. »Bis auf die Familie.« Ich blinzelte, und einen Augenblick lang sah ich sie alle vor mir: Emmeline mit ihren langen Wimpern und schlanken Beinen wie hingegossen auf dem Sofa, Hannah stirnrunzelnd ein Buch im Regal betrachtend, Teddy, der auf dem türkischen Teppich auf und ab geht …
»Emmeline muss eine Frohnatur gewesen sein«, sagte Ursula.
»Ja.«
»Über sie etwas in Erfahrung zu bringen war ganz einfach – ihr Name taucht so ziemlich in jeder Klatschspalte auf, die je gedruckt wurde. Ganz zu schweigen von den Briefen und Tagebüchern zahlloser begehrter Junggesellen der damaligen Zeit!«
Ich nickte. »Sie war sehr beliebt.«
Sie schaute mich durch ihre Ponyfransen an. »Mir ein Bild von Hannah zu machen war nicht so einfach.«
Ich räusperte mich. »Ach?«
»Sie war eher mysteriös. Nicht dass wir in den Zeitungen vergeblich nach ihrem Namen gesucht hätten – im Gegenteil. Und sie hatte auch ihre Bewunderer. Aber es sieht so aus, als hätte kaum jemand sie wirklich gekannt. Die Leute bewunderten sie, ja, sie verehrten sie sogar, aber sie kannten sie nicht wirklich.«
Ich dachte an Hannah. An die schöne, kluge Hannah, die so voller Sehnsucht war. »Sie war eine komplexe Persönlichkeit. «
»Ja«, sagte Ursula, »den Eindruck hatte ich auch.«
Ruth, die die ganze Zeit zugehört hatte, bemerkte: »Eine der beiden hat doch einen Amerikaner geheiratet, nicht wahr?«
Ich sah sie überrascht an. Sie hatte stets betont, nichts über die Hartfords zu wissen.
Unsere Blicke trafen sich. »Ich hab ein bisschen nachgelesen. «
Wie typisch für Ruth, sich auf dieses Treffen vorzubereiten, egal, wie geschmacklos ihr das Thema erscheinen mochte.
Ruth wandte sich wieder Ursula zu und sagte zögernd, darauf bedacht, nur ja keinen Fehler zu machen: »Ich glaube, eine hat nach dem Krieg geheiratet. Welche von beiden war das noch?«
»Hannah.« So. Es war geschehen. Ich hatte ihren Namen laut ausgesprochen.
»Und was war mit der anderen Schwester?«, fuhr Ruth fort. »Emmeline. Hat sie je geheiratet?«
»Nein«, sagte ich. »Sie war verlobt.«
»Mehrmals«, sagte Ursula lächelnd. »Anscheinend konnte sie sich für keinen Mann entscheiden.«
O doch, das konnte sie. Am Ende hat sie ihre Entscheidung getroffen.
»Wahrscheinlich werden wir nie erfahren, was in jener Nacht passiert ist.« Das war Ursula.
»Nein.« Meine müden Füße begannen, gegen das harte Leder meiner Schuhe zu protestieren. Bis zum Abend würden sie geschwollen sein, und Sylvia würde stöhnen und darauf bestehen, mir ein Fußbad zu verpassen. »Wahrscheinlich nicht.«
Ruth richtete sich in ihrem Sessel auf. »Aber Sie müssen doch wissen, was passiert ist, Miss Ryan. Schließlich drehen Sie einen Film darüber.«
»Sicher«, sagte Ursula, »in groben Zügen weiß ich, was sich abgespielt hat. Meine Urgroßmutter war an dem Abend auf Riverton – sie war durch ihre Heirat mit den Schwestern verschwägert –, und die Geschichte ist zu einer Art Familienlegende geworden. Meine Urgroßmutter hat sie an meine Großmutter weitergegeben, meine Großmutter an meine Mutter und meine Mutter an mich. Meine Mutter hat sie mir immer wieder erzählt – ich war zutiefst beeindruckt. Ich habe schon immer gewusst, dass ich eines Tages einmal einen Film daraus machen würde.« Sie zuckte lächelnd die Achseln. »Aber Geschichte ist immer mit Lücken behaftet, nicht wahr? Ich habe ganze Aktenordner voll mit Unterlagen, die Polizeiberichte und Zeitungsartikel zählen alle Fakten auf, aber sämtliche Informationen stammen aus zweiter Hand. Und sie sind stark zensiert, fürchte ich. Leider sind die einzigen beiden Menschen, die Zeugen des Selbstmords wurden, schon seit Jahren tot.«
»Ein makabres Thema für einen Film, finde ich«, bemerkte Ruth.
»Aber nein, es ist faszinierend«, erwiderte Ursula. »Ein aufgehender Stern am englischen Dichterhimmel nimmt sich während eines großen Empfangs an einem dunklen Seeufer das Leben. Seine einzigen Zeugen sind zwei schöne Schwestern, die von da an nie wieder ein Wort miteinander sprechen. Die eine ist die Verlobte des jungen Mannes, die andere angeblich seine Geliebte. Das ist doch unglaublich romantisch.«
Der Knoten in meinem Magen löste sich ein wenig. Hannahs Geheimnis war also noch gewahrt. Ursula kannte die Wahrheit nicht. Ich fragte mich, warum ich etwas anderes erwartet hatte und was für eine falsch verstandene Loyalität mich veranlasst hatte, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Warum interessierte mich nach all den Jahren überhaupt noch, was die Leute dachten?
Ich wusste natürlich genau, warum. Ich war damit geboren. Mr Hamilton hatte es mir gesagt an dem Tag, als ich Riverton verließ. Ich stand mit meinem Lederkoffer, der vollgestopft war mit meinen wenigen Habseligkeiten, auf der Treppe zum Dienstboteneingang, während Mrs Townsend in der Küche weinte. Er hatte gesagt, ich hätte es im Blut, genau wie meine Mutter und deren Eltern, er hatte mir erklärt, es sei dumm wegzugehen, eine gute Stellung bei einer guten Familie einfach so aufzugeben. Er hatte sich bitter über den Verlust von Stolz und Treue beklagt, Werte, die der englischen Nation immer eigen gewesen seien, und er hatte geschworen, Riverton vor diesem Verlust zu bewahren. Schließlich habe man den Krieg nicht gewonnen, um die britischen Traditionen aufzugeben.
Damals hatte er mir leidgetan: so starr in seinen Prinzipien verhaftet, so überzeugt, dass ich, indem ich meine Stellung aufgab, den sicheren Weg in den finanziellen und moralischen Ruin einschlug. Erst viel später begriff ich, wie entsetzt er gewesen sein musste, wie gnadenlos ihm wohl der gesellschaftliche Umbruch erschienen war, der die Welt um ihn herum erfasst hatte und auch ihn einzuholen drohte. Wie verzweifelt er sich an die alten Traditionen und Gewissheiten klammerte.
Aber er hatte recht behalten. Nicht ganz, nicht, was meinen Ruin betraf – weder meine Finanzen noch meine Moral haben nach meinem Weggang gelitten –, aber ein Teil von mir ist in dem Haus zurückgeblieben. Oder, besser gesagt, ein Teil des Hauses hat mich nie verlassen. Noch Jahre später brauchte ich nur das Bienenwachs von Stubbins & Co. zu riechen, das Knirschen von Reifen auf Kies oder eine bestimmte Art von Glocke läuten zu hören, und ich war wieder vierzehn, erschöpft nach einem langen Arbeitstag, trank Kakao am Kamin des Dienstbotenzimmers, während Mr Hamilton ausgewählte Passagen aus der Times vorlas (die, die er als geeignet für unsere besonders empfindlichen Ohren erachtete), während Nancy über irgendeinen abfälligen Kommentar von Alfred die Stirn runzelte und Mrs Townsend leise in ihrem Schaukelstuhl schnarchte, das Strickzeug auf dem breiten Schoß …
»Ah, da kommt ja der Tee«, sagte Ursula. »Vielen Dank, Tony.«
Ein junger Mann mit einer Ansammlung unterschiedlicher Henkeltassen und einem Marmeladenglas voll Zucker auf einem behelfsmäßigen Tablett war neben mir aufgetaucht. Er stellte seine Last auf dem Beistelltisch ab, und Ursula verteilte die Tassen. Ruth reichte eine an mich weiter.
»Was ist los, Mum?« Sie zog ein Taschentuch heraus und betupfte mein Gesicht. »Geht es dir nicht gut?«
Da spürte ich, dass meine Wangen feucht waren.
Der Duft nach Tee war schuld. Dass ich dort in diesem Raum auf diesem Ledersofa saß. Das Gewicht von Erinnerungen an längst Vergangenes, das Wiedererwachen lange gehüteter Geheimnisse. Der Zusammenprall von Vergangenheit und Gegenwart.
»Grace? Kann ich etwas für Sie tun?«, fragte Ursula. »Möchten Sie vielleicht, dass ich die Heizung herunterdrehe? «
»Ich werde sie nach Hause bringen müssen.« Ruth schon wieder. »Ich habe ja gleich gewusst, dass das keine gute Idee ist. Das ist einfach zu viel für sie.«
Ja, ich wollte zurück nach Hause. Zu Hause sein. Ich spürte, wie ich aus dem Sofa gezogen wurde, wie man mir meinen Spazierstock in die Hand drückte. Stimmen umschwirrten mich.
»Es tut mir leid«, murmelte ich vor mich hin. »Ich bin nur müde.« So müde. Alles ist so lange her.
Meine Füße schmerzten, begehrten auf gegen das Eingesperrtsein. Jemand – vielleicht Ursula – stützte mich. Kalter Wind schlug mir ins feuchte Gesicht.
Dann war ich in Ruths Auto, Häuser, Bäume und Straßenschilder flogen vorüber.
»Keine Sorge, Mum, es ist schon vorbei«, sagte Ruth. »Ich mache mir große Vorwürfe. Ich hätte dich nie da hinbringen sollen.«
Ich legte eine Hand auf ihren Arm, spürte, wie sie sich anspannte.
»Ich hätte mich auf mein Gefühl verlassen sollen«, sagte sie. »Das war wirklich dumm von mir.«
Ich schloss die Augen, lauschte dem Summen der Heizung, dem Pulsieren der Scheibenwischer, dem Dröhnen des Straßenverkehrs.
»So ist es gut, ruh dich ein bisschen aus«, sagte Ruth. »Ich bringe dich nach Hause. Du brauchst da nicht noch mal hin.«
Ich lächelte, während ich eindöste.
Zu spät. Ich bin zu Hause. Ich bin wieder zurück.
The Braintree Daily Herald
17. Januar 1925
Unfallopfer identifiziert: Bekannte Schönheit tot
Die Frau, die gestern Vormittag bei einem Automobilunfall auf der Braintree Road ums Leben kam, wurde als die bekannte Schönheit und Filmschauspielerin Miss Emmeline Hartford, 21, identifiziert. Miss Hartford war zusammen mit drei weiteren Personen auf dem Weg von London nach Colchester gewesen, als das Fahrzeug von der Straße abkam und gegen eine alte Eiche prallte.
Miss Hartford ist die Einzige, die bei dem Unfall den Tod fand. Die anderen Insassen des Wagens wurden schwer verletzt ins Krankenhaus von Ipswich eingeliefert.
Die vier Personen wurden am Sonntagnachmittag im Godley House, dem Landsitz von Miss Hartfords Jugendfreundin Mrs Frances Vickers erwartet. Mrs Vickers verständigte die Polizei, als ihre Gäste nicht eintrafen.
Eine polizeiliche Untersuchung soll die Ursache des Unfalls ermitteln. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob gegen den Fahrer Anklage erhoben wird. Laut Aussage von Zeugen war der Unfall auf zu hohe Geschwindigkeit und eine vereiste Fahrbahn zurückzuführen.
Miss Hartford hinterlässt eine ältere Schwester, Mrs Hannah Luxton, die Ehefrau des konservativen Abgeordneten für Saffron Green, Mr Theodore Luxton. Weder Mr noch Mrs Luxton waren bereit, einen Kommentar abzugeben; Gifford & Jones jedoch, die Anwälte der Familie, erklärten, ihre Mandanten stünden unter Schock und wünschten momentan in dieser Angelegenheit nicht behelligt zu werden.
Dies ist nicht das erste Unglück, von dem die Familie in jüngster Zeit heimgesucht wurde. Im vergangenen Sommer wurden Miss Emmeline Hartford und Mrs Hannah Luxton auf dem Anwesen Riverton Manor Zeuginnen des tragischen Selbstmords von Lord Robert Hunter. Lord Hunter war ein bekannter Dichter. Er hat zwei Lyriksammlungen herausgegeben.
Das Kinderzimmer
Es ist ein milder Morgen, ein Vorbote des Frühlings, und ich sitze im Garten auf einer schmiedeeisernen Bank unter der Ulme. Die frische Luft tut mir gut, meint Sylvia, also sitze ich hier und genieße die scheue Wintersonne. Meine Wangen sind so kalt und schlaff wie zwei Pfirsiche, die zu lange im Kühlschrank gelegen haben.
Ich muss an den Tag denken, an dem ich auf Riverton Manor als Dienstmädchen angefangen habe. Ich sehe alles noch genau vor mir. Es ist Juni 1914. Ich bin wieder vierzehn: naiv und linkisch. Ängstlich folge ich Nancy Stufe um Stufe die Treppe aus poliertem Ulmenholz hinauf. Ihr Rock raschelt gebieterisch bei jedem Schritt, jedes Rascheln ein Tadel meiner Unerfahrenheit. Ich mühe mich hinter ihr her die Treppe hoch, der Koffergriff schneidet mir in die Hand. Als Nancy um die Ecke biegt, um die nächste Treppe zu erklimmen, verliere ich sie aus dem Blick und folge nur noch dem Rascheln …
Oben angekommen ging Nancy einen dunklen Flur hinunter und blieb schließlich mit einem harten Klappern ihrer Absätze vor einer kleinen Tür stehen. Sie drehte sich stirnrunzelnd um, als ich auf sie zugewankt kam, ihr Blick so dunkel wie ihr Haar.
»Was ist los mit dir?«, fragte sie in abgehacktem Englisch, unfähig, ihren irischen Akzent zu verbergen. »Ich wusste gar nicht, dass du so langsam bist. Mrs Townsend hat mir nichts davon gesagt, da bin ich mir sicher.«
»Ich bin nicht langsam. Es ist nur mein Koffer. Er ist so schwer.«
»Nun«, erwiderte sie, »so ein Theater hab ich noch nie erlebt. Ich möchte wissen, was für ein Dienstmädchen du abgeben willst, wenn du noch nicht mal einen Koffer tragen kannst, ohne zu wanken. Lass das bloß nicht Mr Hamilton sehen, wenn du den Teppichkehrer herumschleppst wie einen Sack Mehl.«
Sie drückte die Tür auf. Das Zimmer war klein und kärglich eingerichtet, und es roch unerklärlicherweise nach Kartoffeln. Die eine Hälfte davon – ein eisernes Bett, eine Kommode, ein Stuhl – sollte mir gehören.
»So. Das ist deine Seite«, sagte Nancy mit einem Kopfnicken in Richtung Bett. »Mir gehört die andere Seite, und ich wäre dir dankbar, wenn du nichts anrühren würdest. « Sie fuhr mit den Fingern über ihre Kommode, an einem Kreuz, einer Bibel und einer Haarbürste entlang. »Langfinger werden hier nicht geduldet. Und jetzt pack deine Sachen aus, zieh deine Arbeitskleidung an und komm nach unten, damit ich dich in deine Pflichten einweisen kann. Dass du mir ja nicht trödelst, verstanden? Und du darfst dich nur im Dienstbotenbereich aufhalten. Mittagessen gibt’s heute um zwölf, weil die Enkel des Hausherrn zu Besuch kommen und wir mit dem Herrichten der Zimmer jetzt schon im Hintertreffen sind. Dich suchen zu müssen, ist das Letzte, was ich noch brauchen kann. Ich hoffe bloß, dass du keine Trödlerin bist.«
»Nein, Nancy«, antwortete ich, immer noch gekränkt, dass sie mich für eine Diebin halten könnte.
»Na, das werden wir ja sehen«, erwiderte sie. Sie schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich sage ihnen, ich brauche ein neues Dienstmädchen, und was schicken sie mir? Ein Gör ohne Erfahrung, ohne Empfehlungen, und wie mir scheint, auch noch eine Trödlerin.«
»Ich bin keine …«
»Pah!« Sie schnaubte und stampfte mit ihrem schmalen Fuß auf. »Mrs Townsend sagt, dass deine Mutter flink und geschickt war und dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Ich kann nur für dich hoffen, dass sie recht hat. Bummelei von deinesgleichen wird von der Mistress nicht geduldet, und von mir ebenso wenig.« Dann warf sie ein letztes Mal missbilligend den Kopf in den Nacken und ließ mich allein in dem winzigen, dunklen Dachzimmer zurück.
Ich hielt den Atem an und lauschte auf das sich entfernende Rascheln.
Endlich allein mit dem ächzenden Haus schlich ich auf Zehenspitzen zur Tür, zog sie vorsichtig zu und drehte mich um, um mein neues Zuhause in Augenschein zu nehmen.
Es gab nicht viel zu sehen. Ich fuhr mit der Hand über den Bettrahmen, zog den Kopf unter der Dachschräge ein. Am Fußende der Matratze lag eine graue Decke, an einer Ecke von geschickten Händen geflickt. Ein kleines, gerahmtes Bild, die einzige Andeutung von Zimmerschmuck, hing an der Wand: eine typische Jagdszene mit einem verletzten Hirsch, aus dessen Flanke rotes Blut rann. Hastig wandte ich mich von dem sterbenden Tier ab.
Ganz vorsichtig setzte ich mich aufs Bett, darauf bedacht, das glatte Laken nicht zu zerknittern. Als die Federn im Sprungrahmen quietschten, sprang ich schuldbewusst auf und spürte, wie meine Wangen sich röteten.
Durch ein schmales Fenster fiel ein Streifen staubiges Licht ins Zimmer. Ich kniete mich auf den Stuhl und spähte nach draußen.
Das Zimmer befand sich im hinteren Teil des Hauses und war sehr hoch gelegen. Ich konnte über den Rosengarten hinweg bis zu den Gartenlauben und dem Brunnen im Süden sehen. Dahinter lag der See, das wusste ich, und auf der anderen Seite das Dorf, in dem ich die ersten vierzehn Jahre meines Lebens verbracht hatte. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter am Küchenfenster saß, wo das Licht am besten war, den Rücken über eine Flickarbeit gebeugt.
Ich fragte mich, wie sie allein zurechtkam. Mutter ging es in letzter Zeit nicht gut. Einmal hatte ich sie nachts im Bett stöhnen hören, als ihre kranken Knochen ihr unsägliche Schmerzen bereiteten. Manchmal waren ihre Finger morgens so steif, dass ich sie unter warmem Wasser massieren musste, ehe sie überhaupt eine Garnrolle aus ihrem Nähkorb nehmen konnte. Mrs Rodgers aus dem Dorf hatte sich bereit erklärt, täglich nach meiner Mutter zu sehen, und der Lumpenmann kam zweimal pro Woche, aber sie würde schrecklich viel allein sein. Es bestand kaum Hoffnung, dass sie ohne mich mit den Flickarbeiten weitermachen konnte. Aber womit würde sie dann Geld verdienen? Mit meinem mageren Lohn würde ich sie unterstützen können, aber hätte ich nicht lieber bei ihr bleiben sollen?
Andererseits war sie es gewesen, die darauf bestanden hatte, dass ich mich um die Stelle bewarb. Meine Einwände hatte sie gar nicht hören wollen, hatte nur den Kopf geschüttelt und erklärt, sie wisse besser, was gut für mich sei. Sie hatte gehört, dass ein Dienstmädchen gesucht wurde, und war davon überzeugt, dass ich genau die Richtige für diese Position war. Kein Wort darüber, von wem sie das gehört hatte. Typisch für meine geheimnistuerische Mutter.
»Es ist nicht weit weg«, sagte sie. »An deinen freien Tagen kannst du nach Hause kommen und mir helfen.«
Sie muss mir meine Bedenken angesehen haben, denn sie streichelte mir zärtlich die Wange. Eine ungewohnte Geste, mit der ich nicht gerechnet hatte. Ich zuckte unwillkürlich zusammen, als ich die raue Haut ihrer zerstochenen Fingerspitzen an meiner Wange spürte. »Es wird alles gut, meine Kleine. Du wusstest doch, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem du dir eine Stellung suchen musst. Es ist das Beste, eine gute Gelegenheit. Du wirst schon sehen. Nicht viele würden ein so junges Mädchen wie dich einstellen. Lord Ashbury und Lady Violet sind keine schlechten Herrschaften. Mr Hamilton mag dir streng erscheinen, aber er ist gerecht. Und Mrs Townsend auch. Arbeite fleißig, tu, was man dir sagt, dann wirst du keinen Ärger bekommen.« Sie kniff mich mit zitternden Fingern in die Wange. »Und Gracie! Dass du mir nicht vergisst, wo du herkommst. Viel zu viele junge Dinger bringen sich damit in Schwierigkeiten. «
Ich hatte ihr versprochen, ihren Rat zu befolgen, und am folgenden Samstag war ich in meinem Sonntagskleid zu dem großen Herrenhaus gestapft, um mich bei Lady Violet vorzustellen.
Es sei ein kleiner, ruhiger Haushalt, erklärte sie mir, nur ihr Mann, Lord Ashbury, der sich meist in seinen Clubs aufhalte, und sie selbst. Ihre beiden Söhne, Major Jonathan und Mr Frederick, seien beide erwachsen und lebten mit ihren Familien in der Nähe, kämen jedoch gelegentlich zu Besuch, und ich würde sie bestimmt kennenlernen, wenn ich ordentlich arbeitete und die Stellung behielt. Da sie nur zu zweit auf Riverton wohnten, kämen sie ohne Haushälterin aus, sagte sie, und verließen sich auf Mr Hamiltons langjährige Erfahrung, während die Köchin, Mrs Townsend, für alles zuständig sei, was mit der Küche zu tun hatte. Wenn die beiden mit mir zufrieden wären, würde ihr das als Empfehlung reichen, um mich anzustellen.
Dann hatte sie mich so durchdringend angesehen, dass ich mich gefühlt hatte wie eine Maus in der Falle. Ich musste an den hässlichen Rand an meinem Rocksaum denken, den meine Mutter mehrmals herausgelassen hatte, wenn ich wieder gewachsen war, an den kleinen Flicken auf meinem Strumpf, der in meinem Schuh drückte und immer dünner wurde, an meinen zu langen Hals und meine zu großen Ohren.
Schließlich ein Blinzeln und ein Lächeln – ein schmallippiges Lächeln, das ihre Augen in eisige Halbmonde verwandelte. »Nun, du wirkst sauber, und Mr Hamilton hat mir gesagt, dass du nähen kannst.« Ich nickte, und sie stand auf und ging hinter ihren Schreibtisch, wobei sie ihre Finger leicht über die Sessellehne gleiten ließ. »Wie geht es deiner Mutter?«, fragte sie, ohne sich umzudrehen. »Wusstest du, dass sie früher auch hier in Stellung war?« Ich antwortete, ja, ich wisse es, meiner Mutter gehe es gut, danke.
Ich muss das Richtige gesagt haben, denn gleich darauf bot sie mir fünfzehn Pfund pro Jahr an und verkündete, ich könne gleich am nächsten Tag anfangen. Dann läutete sie nach Nancy und bat sie, mich nach draußen zu begleiten.
Ich löste mich vom Fenster, wischte den feuchten Film ab, den mein Atem auf der Scheibe gebildet hatte, und kletterte vom Stuhl.
Mein Koffer lag da, wo ich ihn abgestellt hatte, neben Nancys Seite des Betts, und ich schleppte ihn auf die andere Seite bis zu der Kommode, die für mich vorgesehen war. Ich bemühte mich, den blutenden, im letzten, grauenvollen Moment seines Lebens dahingestreckten Hirsch nicht anzusehen, während ich meine Kleider in die oberste Schublade legte: zwei Röcke, zwei Blusen und ein Paar schwarze Strümpfe, die meine Mutter mich zu stopfen gebeten hatte, damit sie den nächsten Winter noch überdauern würden. Dann, nach einem kurzen Blick zur Tür und mit klopfendem Herzen, packte ich meinen geheimen Schatz aus.
Es waren drei Bücher. Eselsohrige grüne Einbände mit verblassten goldenen Lettern. Ich verstaute sie ganz hinten in der untersten Schublade und bedeckte sie mit meinem Halstuch, das ich so um sie herum drapierte, dass sie vollständig verborgen waren. Mr Hamilton hatte sich deutlich ausgedrückt. Die Bibel sei akzeptabel, aber alles andere an Lesestoff sei meist schädlich, müsse ihm zur Begutachtung vorgelegt werden und würde andernfalls konfisziert. Ich war keine Rebellin – im Gegenteil, damals war ich noch zutiefst pflichtbewusst –, aber ohne Holmes und Watson zu leben war undenkbar.
Den Koffer schob ich unters Bett.
An einem Haken hinter der Tür hing meine Arbeitskleidung: schwarzes Kleid, weiße Schürze, mit Rüschen besetzte Haube. Als ich sie anzog, kam ich mir vor wie ein Kind, das sich vom Kleiderschrank seiner Mutter bedient hat. Der Stoff des Kleids, das offenbar einmal von einer kräftigeren Person getragen worden war, fühlte sich steif an, und der Kragen kratzte am Hals. Während ich mir die Schürze umband, flatterte eine winzige weiße Motte auf und flog auf der Suche nach einem neuen Versteck in die Dachbalken hinauf. Am liebsten wäre ich ihr gefolgt.
Die Haube war aus weißem Baumwollstoff und gestärkt, sodass die vordere Rüsche hochstand. Vor dem Spiegel vergewisserte ich mich, dass sie ordentlich saß, und schob mein helles Haar hinter die Ohren, so wie meine Mutter es mir gezeigt hatte. Als mein Blick kurz auf das Mädchen im Spiegel fiel, dachte ich: Was für ein ernstes Gesicht sie hat. Es passiert nur ganz selten, dass man sich selbst ganz entspannt im Spiegel sieht, und es ist ein bisschen unheimlich. Ein Augenblick der Unbefangenheit, ohne jede Verstellung, wenn man sogar vergisst, sich selbst etwas vorzumachen.
Sylvia hat mir eine Tasse dampfenden Tee und ein Stück Zitronenkuchen gebracht. Sie sitzt neben mir auf der schmiedeeisernen Bank, wirft einen kurzen Blick in Richtung Büro und zieht eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche. Seltsamerweise scheint sie immer gerade dann das Bedürfnis nach einer heimlichen Zigarette zu überkommen, wenn ich angeblich frische Luft brauche. Sie bietet mir eine an. Ich lehne wie immer ab, und sie sagt darauf wie immer: »Ist wahrscheinlich auch besser so in Ihrem Alter. Ich rauche halt eine für Sie mit, okay?«
Sylvia sieht heute gut aus – sie hat irgendetwas an ihrer Frisur verändert –, und ich mache ihr ein Kompliment. Sie nickt, bläst eine Rauchwolke aus und wirft mit einer Kopfbewegung einen langen Pferdeschwanz über die Schulter.
»Ich hab mir die Haare verlängern lassen«, sagt sie. »Davon hab ich schon ewig geträumt, und schließlich hab ich mir gesagt, Mädel, das Leben ist zu kurz, um auf Glamour zu verzichten. Sieht echt aus, stimmt’s?«
Ich zögere mit meiner Antwort, was sie als Zustimmung auffasst.
»Das liegt daran, dass es tatsächlich echt ist. Solches, wie die Filmstars verwenden. Hier. Fühlen Sie mal.«
»Meine Güte«, sage ich, während ich ihren Pferdeschwanz streichle. »Echtes Haar.«
»Heutzutage ist einfach alles möglich.« Sie wedelt mit ihrer Zigarette, an deren Filter ihre Lippen eine schmierige rote Spur hinterlassen haben. »Das kostet natürlich. Zum Glück hatte ich ein bisschen was für Notfälle beiseitegelegt. «
Sie lächelt, glüht vor Stolz wie eine reife Pflaume, und allmählich dämmert mir, was hinter dieser Rundumerneuerung steckt. Und siehe da, aus ihrer Brusttasche zaubert sie ein Foto hervor.
»Anthony«, sagt sie strahlend.
Betont umständlich setze ich mir die Brille auf und betrachte das Bild eines Mannes in reiferem Alter mit grauem Schnurrbart. »Er sieht gut aus.«
»Ach, Grace«, sagt sie mit einem glücklichen Seufzer. »Er ist wunderbar. Wir haben uns erst ein paarmal zum Tee getroffen, aber ich habe so ein gutes Gefühl bei ihm. Er ist ein echter Gentleman, wissen Sie. Nicht wie diese Tagediebe, die ich früher hatte. Er hält mir die Tür auf, schenkt mir Blumen, rückt mir im Restaurant den Stuhl zurecht. Ein richtiger, altmodischer Kavalier.«
Letzteres sagt sie extra meinetwegen, entsprechend der allgemeinen Annahme, dass alte Leute nur das Altmodische zu schätzen wissen. »Was macht er denn beruflich? «, erkundige ich mich.
»Er ist Lehrer an der örtlichen Oberschule. Heimatkunde und Englisch. Er ist unglaublich gebildet. Und Gemeinsinn hat er auch – er arbeitet ehrenamtlich für den Heimatkundeverein. Das ist sein Hobby, sagt er, all die Ladys und Lords und Herzöge und Herzoginnen. Er weiß jede Menge über diese Familie, die früher in dem Herrenhaus drüben auf dem Hügel gewohnt hat …« Sie unterbricht sich und späht mit zusammengekniffenen Augen zum Büro hinüber. »O Gott, o Gott. Schwester Ratchet. Ich soll den Tee auftragen. Wahrscheinlich hat Bertie Sinclair sich mal wieder beschwert. Wenn Sie mich fragen, täte es ihm ganz gut, wenn er sich das eine oder andere Stück Kuchen verkneifen würde.« Sie drückt ihre Zigarette aus und stopft die Kippe in die Streichholzschachtel. »Ach ja, die Gottlosen haben keinen Frieden. Kann ich Ihnen noch was bringen, bevor ich mich um die anderen kümmere, meine Liebe? Sie haben Ihren Tee ja kaum angerührt.«
Ich versichere ihr, dass ich nichts brauche, und sie eilt von dannen, Hüften und Pferdeschwanz im Gleichtakt schwingend.
Es ist angenehm, umsorgt zu werden und den Tee serviert zu bekommen. Ich finde, ich habe diesen Luxus verdient. Ich habe weiß Gott oft genug anderen Leuten den Tee aufgetragen. Manchmal stelle ich mir vor, wie Sylvia sich als Dienstmädchen auf Riverton gemacht hätte. Aber die stille Fügsamkeit der Dienstboten liegt ihr nicht. Sie hat zu viel Charakter, hat nicht oft genug zu hören bekommen, wo »ihr Platz« ist; wohlmeinende Zurechtweisungen, die verhindern sollten, dass man seine Erwartungen allzu hoch schraubt. Nein, Nancy hätte in Sylvia keine so willfährige Schülerin gehabt wie in mir.
Ich weiß, der Vergleich ist nicht fair. Die Menschen haben sich zu sehr verändert. Unser Jahrhundert hat seinen Tribut gefordert. Selbst die Jungen und Privilegierten tragen heute ihren Zynismus wie ein Ehrenabzeichen, die Augen leer und den Kopf voll mit Dingen, die sie nie wissen wollten.
Das ist einer der Gründe, warum ich nie über die Hartfords und Robbie Hunter und über das, was sich zwischen ihnen abgespielt hat, gesprochen habe. Denn es hat durchaus Zeiten gegeben, als ich drauf und dran war, mich von dieser Last zu befreien und alles zu erzählen. Ruth zum Beispiel. Oder Marcus. Aber irgendwie spürte ich jedes Mal schon im Voraus, dass sie es nicht begreifen würden. Sie würden nicht verstehen, wie es zu dem tragischen Ende kam. Warum es dazu kommen musste. Und wie sehr die Welt sich verändert hat.
Natürlich nahmen wir auch damals schon die Anzeichen des Fortschritts wahr. Der Erste Weltkrieg hatte alles verändert, bei denen da oben und bei uns hier unten. Wie schockiert wir alle waren, als nach dem Krieg die neuen Dienstboten eintrafen (und meist kurz darauf wieder verschwanden) und Mindestlöhne und bezahlte Urlaubstage verlangten. Vorher war die Welt noch in Ordnung gewesen, die gesellschaftlichen Unterschiede eindeutig und unerschütterlich.
An meinem ersten Tag auf Riverton rief Mr Hamilton mich in sein Anrichtezimmer im hinteren Ende des Dienstbotentrakts, wo er gerade die Times bügelte. Er richtete sich auf und rückte die runde Brille auf seiner langen Nase zurecht. Meine Einführung in »die Gepflogenheiten« war so wichtig, dass Mrs. Townsend, die gerade dabei war, die Galantine fürs Mittagessen zuzubereiten, ihre Arbeit unterbrach, um Zeugin des Vortrags zu werden. Nachdem Mr Hamilton sorgfältig meine Arbeitskleidung überprüft und offenbar nichts daran auszusetzen hatte, begann er, mir den Unterschied zwischen ihnen und uns zu erklären.
»Vergiss nie«, sagte er feierlich, »welches Glück dir widerfahren ist, dass du in einem so vornehmen Haus Dienst tun darfst. Aber das Glück bringt auch Verantwortung mit sich. Dein Betragen fällt immer auf die Familie zurück, und deswegen musst du stets dein Bestes geben, ihre Geheimnisse wahren und dir ihr Vertrauen verdienen. Denk daran, dass der Hausherr immer weiß, was das Richtige ist. Nimm dir ihn und seine Familie zum Vorbild. Diene ihnen still … willig … dankbar. Du wirst wissen, dass du deine Arbeit gut gemacht hast, wenn niemand davon Kenntnis nimmt, du wirst wissen, dass du eine gute Arbeitskraft bist, wenn niemand dich bemerkt. « Dann hob er den Kopf und blickte über mich hinweg, die Wangen vor Ergriffenheit gerötet. »Und Grace – vergiss nie, welche Ehre sie dir erweisen, indem sie dir gestatten, in ihrem Haus Dienst zu tun.«
Ich wage kaum, mir vorzustellen, was Sylvia wohl dazu gesagt hätte. Auf keinen Fall hätte sie sich diesen Vortrag so still angehört, wie ich es tat, ihr Gesicht hätte nicht geglüht vor Dankbarkeit und dem vagen Gefühl, im Gefüge der Welt eine Stufe emporgehoben worden zu sein.
Als mein Blick auf den Platz auf der Bank neben mir fällt, bemerke ich, dass sie das Foto hat liegen lassen, das Foto von diesem neuen Mann, der sie mit Plaudereien über Geschichte becirct und sich in seiner Freizeit mit der Aristokratie beschäftigt. Ich kenne diese Sorte. Sie sammeln Zeitungsausschnitte und Fotos und fertigen aufwendige Familienstammbäume an von Familien, zu denen sie nie gehören werden.
Meine Worte klingen verächtlich, aber das täuscht. Ich finde es höchst interessant, wie die Zeit Lebensläufe ausradiert und nur blasse Spuren übrig lässt. Blut und Geist verschwinden, und nur Namen und Daten bleiben übrig.
Ich schließe die Augen. Die Sonne steht inzwischen tiefer, und meine Wangen sind jetzt warm.
Die Leute von Riverton sind alle schon so lange tot. Mich hat die Zeit verwittern lassen, während sie ewig jung und schön bleiben.
Gott, ich werde schon wieder sentimental. Denn sie sind weder jung noch schön. Sie sind tot. Begraben. Nichts mehr. Existieren nur noch in der Erinnerung derer, die sie einmal gekannt haben.
Andererseits sind die, die in der Erinnerung weiterleben, unsterblich.