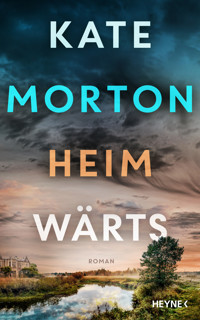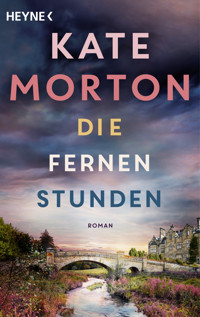5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Birchwood Manor 1862: Der talentierte Edward Radcliffe lädt Künstlerfreunde in sein Landhaus am Ufer der Themse ein. Doch der verheißungsvolle Sommer endet in einer Tragödie – eine Frau verschwindet, eine andere stirbt …
Über hundertfünfzig Jahre später entdeckt Elodie Winslow, eine junge Archivarin aus London, die Sepiafotografie einer atemberaubend schönen Frau und die Zeichnung eines Hauses an einer Flussbiegung. Warum kommt Elodie das Haus so bekannt vor? Und wird die faszinierende Frau auf dem Foto ihr Geheimnis jemals preisgeben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 823
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ein verzauberter Sommer voller Kunst und Poesie, bis ein Schuss in der Dunkelheit fällt
Birchwood Manor, 1862: Der talentierte Edward Radcliffe lädt Künstlerfreunde in sein Landhaus am Ufer der Themse ein. Doch der verheißungsvolle Sommer endet in einer Tragödie – eine Frau verschwindet, eine andere stirbt …
Über hundertfünfzig Jahre später entdeckt Elodie Winslow, eine junge Archivarin aus London, die Sepiafotografie einer atemberaubend schönen Frau und die Zeichnung eines Hauses an einer Flussbiegung. Warum kommt Elodie das Haus so bekannt vor? Und wird die faszinierende Frau auf dem Foto ihr Geheimnis jemals preisgeben?
»Kate Morton zu lesen ist wie ein Sog.« Freundin DONNA
Kate Morton
Die Tochter
des Uhrmachers
Roman
Aus dem Englischen
von Charlotte Breuer und
Norbert Möllemann
Für Didee, weil sie eine von den Müttern ist,
die uns ein Leben auf dem Gipfel des Berges hat führen lassen,
und weil sie mir den besten Rat für das Schreiben gegeben hat,
den ich je bekommen habe.
TEIL 1
DIE AKTENTASCHE
I
Wir waren nach Birchwood Manor gekommen, weil Edward gesagt hatte, dort spuke es. Das stimmte zwar nicht, aber nur ein Langweiler lässt sich von der Wahrheit eine gute Geschichte verderben, und ein Langweiler war Edward weiß Gott nicht. Seine Leidenschaft und sein ansteckender Glaube an alles, was er verkündete, hatten dazu geführt, dass ich mich in ihn verliebte. Er besaß den Feuereifer eines Predigers, der seine Meinungen in bare Münze verwandelt. Er zog die Menschen an, weckte in ihnen eine Begeisterung, von der sie gar nicht wussten, dass sie dazu fähig waren, und die alles außer ihm und seinen Überzeugungen in den Hintergrund treten ließ.
Aber Edward war kein Prediger.
Ich erinnere mich an ihn. Ich erinnere mich an alles.
Das Atelier mit dem Glasdach im Londoner Garten seiner Mutter, der Geruch der frisch angemischten Farben, das Scharren der Pinselborsten auf der Leinwand, während sein Blick über meine Haut strich. An dem Tag war ich ganz kribbelig vor Nervosität. Ich wollte ihn beeindrucken, wollte etwas darstellen, das ich gar nicht war, und während er mich betrachtete, gingen mir Mrs. Macks eindringliche Worte durch den Kopf: »Deine Mutter war eine anständige Frau, du stammst aus einer angesehenen Familie, vergiss das nicht. Wenn du deine Karten richtig ausspielst, haben wir am Ende alle etwas davon.«
Und so richtete ich mich noch ein bisschen gerader auf in dem mit Samt bezogenen Sessel, an jenem ersten Tag damals in dem weiß gestrichenen Atelier hinter den üppig blühenden Wicken.
Seine kleine Schwester brachte mir Tee und Kuchen, wenn ich Hunger hatte. Manchmal kam auch seine Mutter den schmalen Weg herunter, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. Sie bewunderte ihren Sohn. In ihm erfüllten sich die Hoffnungen der Familie. Er war ein angesehenes Mitglied der Royal Academy, verlobt mit einer Tochter aus reichem Hause, zukünftiger Vater einer Schar braunäugiger Erben.
Er war nichts für meinesgleichen.
Für das, was dann passierte, gab seine Mutter sich die Schuld, aber sie hätte eher den Tag daran hindern können, auf die Nacht zu folgen, als uns beide voneinander fernzuhalten. Er nannte mich seine Muse, seine Bestimmung. Er sagte, er habe es sofort gewusst, als er mich im schummrigen Licht der Gaslampen im Foyer des Theaters in der Drury Lane gesehen habe.
Ich war seine Muse. Ich war sein Schicksal. Und er war meins.
Es ist lange her; es war gestern.
Ach, ich erinnere mich an die Liebe.
Diese Ecke hier, auf halber Höhe der Treppe, ist meine Lieblingsstelle.
Es ist ein seltsames Haus, absichtlich so gebaut, dass es verwirrt. Treppen mit ungewöhnlichen Wendungen, Geländer mal niedrig, mal hoch, Fenster, die nicht auf gleicher Höhe sind, egal wie sehr man die Augen zusammenkneift, Holzböden und hölzerne Wandvertäfelungen mit raffinierten Geheimtüren.
Hier in dieser Ecke ist es immer warm, das ist fast übernatürlich. Es ist uns allen gleich aufgefallen, und den ganzen Frühsommer über haben wir gerätselt, wo die Wärme herkam.
Ich habe eine Weile gebraucht, aber schließlich habe ich es herausgefunden. Ich kenne diese Ecke in- und auswendig.
Es war nicht das Haus selbst, mit dem Edward die anderen geködert hat, sondern das Licht. An klaren Tagen kann man von den Dachfenstern aus über die Themse hinweg bis nach Wales sehen. Blassviolett und grün erheben sich die walisischen Hügel am Horizont, schroffe Kreidefelsen recken sich den Wolken entgegen, und die warme Luft lässt die ganze Landschaft schimmern.
Und das war sein Vorschlag: ein ganzer Sommermonat voller Malerei, Poesie und Picknicks, ein Monat voller Geschichten und Gespräche über Wissenschaft und die neuesten Erfindungen. Ein Monat voller himmlischem Licht. Weit weg von London, weit weg von neugierigen Augen. Kein Wunder, dass alle sofort mit Begeisterung dabei waren. Edward hätte den Teufel bekehren können, wenn er gewollt hätte.
Nur mir hat er gestanden, dass er noch einen weiteren Grund hatte hierherzukommen. Nicht allein das Licht zog ihn hierher, er hatte auch ein Geheimnis.
Vom Bahnhof gingen wir zu Fuß.
Es war ein perfekter Julitag. Eine leichte Brise zupfte an meinem Rocksaum. Jemand hatte Sandwiches mitgebracht, die wir unterwegs aßen. Wir müssen einen merkwürdigen Anblick geboten haben – Männer, die ihre Krawatten gelockert hatten, Frauen, die ihr Haar offen trugen. Gut gelaunt, ausgelassen.
Was für ein großartiger Anfang! Ich erinnere mich an das Plätschern eines Bachs und das Gurren einer Waldtaube. Ein Mann kam uns entgegen, der ein Pferd mit Wagen führte; auf den Strohballen hockte ein kleiner Junge, und überall duftete es nach frisch gemähtem Gras – ach, wie mir dieser Duft fehlt! Ein paar fette Gänse betrachteten uns mit ihren Knopfaugen, als wir uns der Themse näherten, und schrien hinter uns her, nachdem wir an ihnen vorbeigegangen waren.
Alles war hell und leicht, aber nicht sehr lange.
Aber das ist wohl überflüssig zu erwähnen, denn wenn alles so schön geblieben wäre, gäbe es keine Geschichte zu erzählen. Niemand interessiert sich für einen stillen, glücklichen Sommer, der so endet, wie er begonnen hat. Das habe ich von Edward gelernt.
Die Abgeschiedenheit spielte natürlich eine Rolle, dieses Haus, dort am Flussufer gestrandet wie ein Binnendampfer. Auch das Wetter trug seinen Teil dazu bei, die glühend heißen Tage, und dann das Sommergewitter, das uns an jenem Abend alle ins Haus trieb.
Der Wind heulte, und die Bäume ächzten, und der Donner rollte den Fluss herunter und rüttelte am Haus, während die Gespräche sich drinnen um Geister und Verzauberungen drehten. Im Kamin prasselte ein Feuer, und die Kerzenflammen flackerten, und in der Dunkelheit, in dieser Atmosphäre der heimeligen Angst und der heimlichen Geständnisse, wurde etwas Böses heraufbeschworen.
Kein Geist, nein, nein – die Tat, als sie begangen wurde, war ganz und gar menschlich.
Zwei unerwartete Gäste.
Zwei lange gehütete Geheimnisse.
Ein Schuss in der Dunkelheit.
Das Licht ging aus, und alles war pechschwarz.
Der Sommer war verdorben. Die ersten vorwitzigen Blätter fielen in die Pfützen unter den Hecken, und Edward begann, wie ein Gefangener durch die Flure des Hauses zu schleichen, das er liebte.
Schließlich hielt er es nicht länger aus. Er packte seine Sachen und reiste ab, und ich konnte ihn nicht aufhalten.
Die anderen folgten ihm, wie immer.
Und ich? Ich hatte keine Wahl. Ich bin geblieben.
KAPITEL 1
Sommer 2017
Es war Elodie Winslows liebste Tageszeit. Sommer in London, und an einem bestimmten Punkt schien die Spätnachmittagssonne auf ihrem Weg den Himmel entlang zu zögern, um ihre Strahlen durch die kleinen Glasfliesen im Gehweg über ihr direkt auf ihren Schreibtisch zu schicken. Und das Beste war: Da Margot und Mr. Pendleton schon Feierabend gemacht hatten, gehörte ihr dieser Moment ganz allein.
Das Kellergeschoss von Stratton, Cadwell & Co an der Straße The Strand war längst kein so ein romantischer Ort wie das Archiv im alten Gemäuer des New College in Oxford, wo Elodie nach ihrem Masterabschluss einen Ferienjob gehabt hatte. Hier war es nie warm, selbst während der gerade herrschenden Hitzewelle musste Elodie bei der Arbeit eine Strickjacke tragen. Aber hin und wieder, wenn auch ganz selten, hatte das Büro, in dem es nach Staub und Alter und der Feuchtigkeit der Themse roch, etwas Charmantes.
In der winzigen Teeküche hinter den Aktenschränken füllte Elodie ihre Henkeltasse mit kochendem Wasser und drehte die Sanduhr um. Margot fand das übertrieben, aber Elodie ließ ihren Tee gern genau dreieinhalb Minuten ziehen.
Während sie darauf wartete, dass die Sandkörner nach unten rieselten, musste sie an Pippas Nachricht denken. Sie hatte ihre Mailbox abgehört, als sie kurz über die Straße gelaufen war, um sich ein Sandwich zu kaufen: eine Einladung zu einer Modenschau, die Elodie sich etwa so interessant vorstellte wie eine Stunde im Wartezimmer eines Arztes. Zum Glück hatte sie bereits etwas vor – einen Besuch bei ihrem Vater in Hampstead, um die Videoaufzeichnungen abzuholen, die er für sie herausgesucht hatte – und brauchte sich keine Ausrede auszudenken, warum sie nicht mitgehen konnte.
Pippa etwas abzuschlagen war gar nicht so einfach. Sie war Elodies beste Freundin, und zwar seit dem ersten Tag des dritten Schuljahrs in der Pineoaks Primary School. Immer noch dankte Elodie im Stillen oft ihrer Lehrerin Miss Perry dafür, dass sie sie nebeneinandergesetzt hatte: Elodie, die Neue mit der ungewohnten Schuluniform und den schiefen Zöpfen, die ihr Vater mühsam geflochten hatte, und Pippa mit dem breiten Lächeln und den Grübchen und den Händen, die ständig in Bewegung waren, wenn sie redete.
Seit damals waren die beiden unzertrennlich. Während der Grundschule, während der Oberschule und selbst später, als Elodie in Oxford und Pippa am Central Saint Martins College in London studierte. Inzwischen sahen sie sich nicht mehr so oft, aber das war zu erwarten gewesen – die Welt der Kunst war ein geschäftiges Netzwerk, und Pippa schickte Elodie eine Einladung nach der anderen aufs Handy, während sie von einer Galerieeröffnung oder Vernissage zur nächsten hetzte.
Die Welt der Archivare dagegen war alles andere als geschäftig. Das heißt, sie war nicht auf die glamouröse Weise geschäftig wie Pippas Welt. Elodie hatte lange Arbeitstage, und sie hatte viel mit Menschen zu tun, wenn auch nicht mit lebenden. Die Gründer von Stratton und Cadwell hatten die Erde bereist, als sie gerade erst begann, immer kleiner zu werden, und als die Erfindung des Telefons die schriftliche Korrespondenz noch nicht obsolet gemacht hatte. Und so verbrachte Elodie ihre Tage mit den verstaubten, stockfleckigen Hinterlassenschaften der Toten, mit Berichten über Soireen im Orientexpress oder über die Abenteuer viktorianischer Entdecker auf der Suche nach der Nordwestpassage.
Diese Art sozialen Engagements über die Zeiten hinweg machte Elodie sehr glücklich. Gut, sie hatte nicht viele Freunde, jedenfalls nicht von der Sorte, die aus Fleisch und Blut waren, aber das störte sie nicht. Sie fand es ermüdend, sich lächelnd über die Wetteraussichten auszutauschen, und nach einem geselligen Abend fühlte sie sich, egal wie nett die Leute gewesen waren, immer völlig erschöpft, so als hätte sie dort einen Teil ihrer selbst verloren, den sie nie wieder zurückbekommen würde.
Elodie nahm den Teebeutel aus der Tasse, drückte die letzten Tropfen über der Spüle aus, bevor sie ihn in den Mülleimer warf, und goss einen winzigen Schuss Milch in den Tee.
Sie ging mit der Tasse zurück zu ihrem Schreibtisch, wo die Prismen des Sonnenlichts gerade ihre tägliche Wanderung begannen, und während der Dampf sich kräuselte und sie ihre Hände an der Tasse wärmte, überlegte sie, was sie an dem Tag noch zu tun hatte. Das Inhaltsverzeichnis zum Bericht von James Stratton jr. über seine Reise an die Westküste Afrikas im Jahr 1893 war zur Hälfte fertig, sie musste einen Artikel für die nächste Ausgabe des Monatshefts Stratton, Cadwell & Co Monthly schreiben, und Mr. Pendleton hatte ihr den Katalog für die bevorstehende Ausstellung dagelassen, den sie Korrektur lesen sollte, bevor er in den Druck ging.
Aber Elodie hatte sich heute schon so viel mit Texten beschäftigt, dass ihr davon der Kopf qualmte. Ihr Blick fiel auf den gewachsten Pappkarton unter ihrem Schreibtisch. Er stand da seit Montagnachmittag, als ein Rohrbruch im oberen Stockwerk es erfordert hatte, den alten Abstellraum auszuräumen, ein Raum mit niedriger Decke, den Elodie in den zehn Jahren, seit sie hier arbeitete, noch nie betreten hatte. Der Karton war unter einem Stapel eingestaubter Brokatvorhänge im untersten Fach einer Chiffonier-Kommode aufgetaucht, versehen mit einem von Hand beschrifteten Zettel »Inhalt des Schränkchens vom Dachboden, 1966 – nicht aufgelistet«.
Dass sich in dem alten, längst nicht mehr benutzten Raum Archivmaterial fand, das noch dazu bereits mehrere Jahrzehnte zuvor eingetroffen sein musste, war äußerst beunruhigend, und Mr. Pendleton hatte sich natürlich furchtbar aufgeregt. Mr. Pendleton war in solchen Dingen mehr als korrekt, und es war ein Glück, da waren sich Elodie und Margot einig, dass derjenige, der die Lieferung 1966 angenommen hatte, längst aus der Firma ausgeschieden war.
Der Zeitpunkt hätte nicht unpassender sein können: Seit ein Unternehmensberater da gewesen war, um »den Betrieb zu verschlanken«, war Mr. Pendleton außer sich. Dass man in seinen persönlichen Arbeitsbereich eingedrungen war, war schon schlimm genug, aber seine Effizienz infrage zu stellen war eine Beleidigung, die er nicht auf sich sitzen lassen konnte. »Das ist genauso, als würde sich jemand Ihre Uhr borgen, um Ihnen zu sagen, wie spät es ist«, hatte er frostig bemerkt, nachdem der Unternehmensberater gegangen war.
Und als dann plötzlich dieser Karton aufgetaucht war, hätte ihn beinahe der Schlag getroffen, und so hatte sich Elodie, die nicht nur ordnungs-, sondern auch harmoniesüchtig war, den Karton geschnappt und versprochen, sich darum zu kümmern.
Seitdem hielt sie ihn unter ihrem Schreibtisch versteckt, um Mr. Pendletons Nerven zu schonen, doch jetzt, allein im Büro, kniete sie sich auf den Teppichboden und zog den Karton unter dem Schreibtisch hervor …
Das plötzliche Licht traf sie wie ein Schlag, und die Aktentasche, tief unten im Karton verstaut, atmete auf. Sie hatte eine lange Reise hinter sich, und es verwunderte nicht, dass sie ziemlich mitgenommen war. Ihre Ränder waren abgewetzt, die Schnallen verrostet, und in ihrem Innern hatte sich ein strenger, modriger Geruch festgesetzt. Die ehemals edle Oberfläche war von einer matten Patina bedeckt und hatte die Tasche zu einem Gegenstand gemacht, den man am ausgestreckten Arm hochhielt und mit halb abgewandtem Kopf misstrauisch beäugte. Sie war zu alt, um noch von Nutzen zu sein, doch eine undefinierbare Geschichtsträchtigkeit verhinderte, dass man sie entsorgte.
Die Tasche war einmal geliebt worden, bewundert wegen ihrer Eleganz – und, noch wichtiger, wegen ihrer Funktion. Zu einer bestimmten Zeit, als Attribute wie sie hochgeschätzt wurden, war sie für eine bestimmte Person unverzichtbar gewesen. Seitdem war sie versteckt und ignoriert, gerettet und missachtet, verloren, wiedergefunden und vergessen worden.
Jetzt jedoch wurden all die Dinge, die jahrzehntelang auf ihr gelegen hatten, nacheinander weggenommen, bis schließlich auch sie selbst in diesem von schwachem elektrischem Summen, leisem Rohrgeklapper und dem Geruch nach Papier erfüllten Raum wieder ans Tageslicht gelangte. Weiche, weiße Handschuhe hoben sie aus der Dunkelheit des Kartons.
In den Handschuhen steckten die Hände einer Frau. Sie war jung, hatte zarte Rehkitzarme, einen grazilen Hals, ein von kurzem, schwarzem Haar eingerahmtes Gesicht. Sie hielt die Tasche am ausgestreckten Arm, aber nicht mit Abscheu.
Ihre Berührung war sanft. Ihre Lippen waren neugierig geschürzt, und ihre Augen weiteten sich, als sie die handgefertigten Nähte aus kostbarer indischer Baumwolle gewahrten.
Die Tasche überlief ein wohliger Schauder, als die Frau vorsichtig mit dem Daumen über die ausgeblichenen Initialen auf der Lasche fuhr. Die Aufmerksamkeit dieser jungen Frau konnte bedeuten, dass die unerwartet lange Reise der Tasche endlich zu Ende war.
Öffne mich, flehte die Tasche. Schau in mich hinein.
Vor langer Zeit war die Aktentasche einmal neu und glänzend gewesen. Von Mr. Simms persönlich in der Werkstatt der Hoflieferanten W. Simms & Son in der Bond Street hergestellt. Die vergoldeten Initialen waren mit großem Aufwand eingestanzt, die Messingnieten und -schnallen waren sorgsam ausgewählt und poliert, das wertvolle Leder war exakt geschnitten und genäht, liebevoll geölt und gewienert worden. Düfte von fernöstlichen Gewürzen – Nelke und Sandelholz und Safran – waren aus der Parfümerie nebenan in die Werkstatt gedrungen, sodass der Tasche ein Hauch von fernen Orten anhaftete. Öffne mich …
Die Frau mit den weißen Handschuhen öffnete die Messingschnalle. Die Tasche hielt den Atem an.
Öffne mich, öffne mich, öffne mich …
Die Frau zog das lederne Band aus der Schnalle, und zum ersten Mal seit mehr als hundert Jahren drang Licht in die dunklen Ecken der Tasche.
Mit dem Licht kam ein Ansturm aus bruchstückhaften, verworrenen Erinnerungen – das Klingeln eines Glöckchens über der Tür bei W. Simms & Son; das Rascheln der Röcke einer jungen Frau; Pferdegetrappel; der Geruch nach frischer Farbe und Terpentin; Leidenschaft, Wollust, Geflüster. Gaslicht in Bahnhöfen; ein langer, gewundener Fluss; der Duft sommerlicher Weizenfelder …
Die behandschuhten Hände zogen sich zurück und nahmen den Inhalt der Tasche mit.
Die alten Eindrücke, Stimmen, Mementos verschwanden, und endlich war alles leer und still.
Es war vorbei.
Elodie untersuchte die leere Tasche. Es war ein edles Teil, das gar nicht zu den anderen Sachen passte, die sich in dem Karton befunden hatten, lauter alltägliche Büroutensilien – ein Locher, ein Tintenfass, ein hölzerner Schubladeneinsatz zur Aufbewahrung von Stiften und Büroklammern und dergleichen – und ein Brillenetui aus Krokodilleder mit der Aufschrift »Eigentum von L. S-W« auf dem Herstelleretikett. Vermutlich hatten die Chiffonier-Kommode und sein Inhalt einmal Lesley Stratton-Wood gehört, einer Großnichte des Firmengründers James Stratton. Von der Jahresangabe her würde es hinkommen – Lesley Stratton-Wood war in den Sechzigerjahren gestorben –, und es würde auch erklären, warum der Karton bei Stratton, Cadwell & Co gelandet war.
Die Aktentasche jedoch war, wenn es sich nicht um eine perfekte Nachbildung handelte, viel zu alt, um Ms. Stratton-Wood gehört zu haben, sie stammte definitiv aus einer Zeit vor dem zwanzigsten Jahrhundert, ebenso wie ihr Inhalt: ein schwarzes Journal mit Monogramm (E. J. R.) und marmoriertem Vorderschnitt, ein Stifteetui aus Messing, spätviktorianisch, und eine mit ausgebleichtem dunkelgrünem Leder bezogene Dokumentenmappe. Auf den ersten Blick ließ sich unmöglich sagen, wem die Aktentasche gehört haben konnte, aber unter der Lasche der Dokumentenmappe befand sich ein eingestanztes, vergoldetes Etikett: »James W. Stratton, Esq. London, 1861«.
Die Mappe war so dünn, dass Elodie zuerst annahm, sie sei leer, doch als sie die Lasche anhob, kam ein filigraner silberner Bilderrahmen zum Vorschein, der ein Foto enthielt. Das Foto zeigte eine junge Frau; sie hatte hohe Wangenknochen und langes Haar, hell, aber nicht blond, das zu einem losen Knoten hochgesteckt war; ihr Blick war direkt und ihr Kinn vorgereckt. Ihre Lippen wirkten wie bereit zu einem intelligenten Gespräch, vielleicht sogar etwas herausfordernd.
Während sie das Sepia-Foto betrachtete, spürte Elodie, wie das vertraute Gefühl der Vorfreude sich einstellte, die Ahnung, dass sie auf etwas gestoßen war, das darauf wartete, wieder zum Leben erweckt zu werden. Das Kleid der Frau saß lockerer als zur damaligen Zeit üblich. Es hatte einen tiefen V-Ausschnitt, und der weiche, weiße Stoff umspielte sanft ihre Schultern. Die bauschigen Ärmel waren durchsichtig und an einem Arm bis zum Ellbogen hochgeschoben. Sie hatte zarte Handgelenke, eine in die Hüfte gestemmte Hand betonte ihre Taille.
Der Hintergrund war ebenso interessant, denn die Frau posierte nicht in einem geschlossenen Raum auf einer Chaiselongue oder vor einem Vorhang mit aufgemalter Szenerie, wie es für ein viktorianisches Porträt typisch gewesen wäre. Vielmehr befand sie sich unter freiem Himmel, umgeben von wucherndem Grün, eine sehr lebendige Kulisse. Das diffuse Licht schuf eine betörende Atmosphäre.
Elodie legte das Foto weg und nahm sich das Journal mit dem Monogramm vor. Die cremefarbenen Seiten waren aus dickem, teurem Baumwollpapier; in schöner Handschrift verfasste Zeilen rahmten Tuschezeichnungen von Personen, Gegenständen oder Landschaften ein. Es war also gar kein Journal, sondern ein Skizzenbuch.
Zwischen zwei Seiten rutschte ein Blatt Papier heraus, das irgendwo herausgerissen worden war. Darauf stand geschrieben: Ich liebe sie, ich liebe sie, ich liebe sie, und wenn ich sie nicht haben kann, werde ich verrückt, denn wenn ich nicht in ihrer Nähe bin, fürchte ich …
Die Worte sprangen Elodie entgegen, als wären sie laut ausgesprochen worden. Sie drehte das Blatt um, aber wer auch immer der Autor der Worte war, hatte seinen Satz nicht beendet.
Sie fuhr mit dem behandschuhten Finger über den Text. Als sie den Zettel gegen das letzte Sonnenlicht hielt, konnte sie die Fasern des Baumwollpapiers erkennen, und wo die spitze Feder über das Papier gekratzt war, fiel das Licht durch winzige Löcher.
Elodie schob das Blatt vorsichtig wieder zwischen die Seiten des Skizzenbuchs.
Die Worte, obwohl sie aus einer längst vergangenen Zeit stammten, waren ergreifend, sprachen sie doch auf kraftvolle Weise von einer unerledigten Angelegenheit.
Elodie blätterte in dem Skizzenbuch, ihr Blick wanderte über die saubere Schrift, die künstlerischen Studien und winzigen Porträts, die hier und da an den Rand gekritzelt waren.
Dann hielt sie inne.
Auf einer Seite befand sich eine Zeichnung, die sorgfältiger ausgeführt war als alle anderen, vollständiger. Es handelte sich um eine Landschaft an einem Fluss mit einem Baum im Vordergrund und einem Wald in der Ferne. Rechts hinter einem Wäldchen war ein Haus mit zwei Giebeln zu sehen, mit acht Kaminen auf dem Dach und einer aufwendig gestalteten Wetterfahne, die die Sonne, den Mond und andere Himmelskörper darstellte.
Es war eine sehr gelungene Zeichnung, aber das war nicht der Grund, warum Elodie den Blick nicht davon abwenden konnte. Sie hatte ein Déjà-vu, das so stark war, dass es ihr den Atem raubte.
Sie kannte diesen Ort. Die Erinnerung war so lebhaft, als sei sie selbst dort gewesen, und dennoch wusste Elodie, dass sie ihn nur in ihren Gedanken besucht hatte.
Die Worte kamen ihr in den Sinn wie Vogelgezwitscher bei Tagesanbruch: Die kurvenreiche Straße hinunter und über das weite Feld liefen sie zum Fluss, mit ihren Geheimnissen und ihrem Schwert.
Und dann erinnerte sie sich. Es war eine Kindergeschichte, die ihre Mutter ihr erzählt hatte. Eine Gutenachtgeschichte, romantisch und verwoben, mit Helden, Schurken und einer Feenkönigin, und sie spielte in einem Haus in einem dunklen Wald, an einem langen, gewundenen Fluss.
Aber ihre Mutter hatte gar kein Buch mit Bildern gehabt. Sie hatte ihr die Geschichte einfach nur erzählt, während sie neben ihr im Bett gelegen hatte, damals in dem Kinderzimmer mit der Dachschräge.
In Mr. Pendletons Büro schlug die Wanduhr, tief und warnend, und Elodie schaute auf ihre Armbanduhr. Sie war spät dran. Die Zeit hatte ihre Struktur verloren, die Zeiger hatten sich im Staub um sie herum aufgelöst. Sie warf einen letzten Blick auf die seltsam vertraute Landschaftsszene, klappte das Skizzenbuch zu, verstaute es zusammen mit den anderen Gegenständen wieder in dem Karton und schob ihn unter ihren Schreibtisch.
Elodie hatte ihre Tasche gepackt und wollte gerade die Bürotür abschließen, als ein unwiderstehlicher Drang sie überkam. Sie eilte zurück zu ihrem Schreibtisch, zog den Karton noch einmal hervor, nahm das Skizzenbuch heraus und ließ es in ihre Umhängetasche gleiten.
KAPITEL 2
Elodie fuhr mit dem 24-er Bus von Charing Cross nach Hampstead. Mit der U-Bahn wäre es schneller gegangen, aber die benutzte sie nicht gern. Zu viel Gedränge, zu stickig. In engen Räumen hielt Elodie es nur schwer aus. Das war schon seit ihrer Kindheit so, und sie war daran gewöhnt, aber in diesem Fall bedauerte sie es, denn die Untergrundbahn an sich faszinierte sie, diese beispielhafte Ingenieursleistung des neunzehnten Jahrhunderts mit all den historischen Hinweisschildern und viktorianischen Fliesen, dieser alte Staub und der Geruch.
Der Verkehr war zähflüssig, vor allem in der Nähe der Tottenham Court Road, wo die Ausschachtungen für die Crossrail-Trasse die Rückseiten einiger viktorianischer Backsteinhäuser freigelegt hatte. Elodie konnte sich gar nicht sattsehen an diesem Einblick in die Vergangenheit, der so real war, dass man ihn berühren konnte. Sie malte sich das Leben der Menschen aus, die einmal in diesen Häusern gewohnt hatten, damals, als der südliche Teil von St. Giles ein überfülltes Armenviertel war, mit von Abwassergräben gesäumten engen Gassen und Sickergruben, Schnapsläden und Glücksspielern, Prostituierten und Straßenkindern, als Charles Dickens seine täglichen Spaziergänge machte und Astrologen und Alchemisten in den Seven Dials von Covent Garden ihr Gewerbe ausübten.
James Stratton jr., wie viele seiner viktorianischen Zeitgenossen der Esoterik zugetan, berichtete in seinem Tagebuch von zahlreichen Besuchen bei einer bestimmten Spiritualistin und Seherin in Covent Garden, mit der ihn eine langjährige Liebschaft verbunden hatte. Für einen Bankier hatte James Stratton ein erstaunliches Schreibtalent besessen, und seine Tagebücher boten sehr lebhafte, teils amüsante Einblicke in das Leben im viktorianischen London. Er war ein sanfter Mann gewesen, ein guter Mensch, der sich darum bemüht hatte, das Leben der Armen und Mittellosen zu verbessern. Er war davon überzeugt, dass »ein anständiger Schlafplatz das Leben und die Zukunftsaussichten der Menschen deutlich verbessern würde«, wie er in Briefen an seine Freunde schrieb, die er von seinen philanthropischen Ideen zu überzeugen suchte.
In seinem Berufsleben hatte er großen Respekt genossen, ja, er war bei seinen Zeitgenossen sehr beliebt gewesen, ein gern gesehener Gast auf Empfängen, ein weit gereister, wohlhabender Mann der Viktorianischen Zeit, in jeder Hinsicht erfolgreich, nur sein Privatleben war von Einsamkeit gezeichnet. Nachdem er sich immer wieder unglücklich verliebt hatte – in eine Schauspielerin, die mit einem italienischen Erfinder durchgebrannt war, in eine Frau, die für Künstler Modell gestanden hatte und von einem anderen schwanger geworden war, und, er war bereits in seinen Vierzigern, in eine seiner Dienerinnen, eine stille junge Frau namens Molly, der er zahlreiche Freundschaftsdienste erwiesen hatte, ohne ihr seine Liebe je zu gestehen –, hatte er erst spät geheiratet. Es schien fast so, als hätte er sich absichtlich immer wieder Frauen gesucht, die ihn nicht glücklich machen konnten – oder wollten.
»Warum hätte er das tun sollen?«, hatte Pippa gefragt, als Elodie diesen Gedanken eines Abends bei Tapas und einem Glas Sangria laut ausgesprochen hatte.
Eine klare Antwort konnte Elodie auf diese Frage nicht geben, aber obwohl sich in James Strattons Korrespondenz keine Stelle fand, an der er offen eine unerwiderte Liebe oder eine tief sitzende Traurigkeit erwähnte, hatte sie immer das Gefühl, dass in seinen freundlichen Briefen etwas Melancholisches mitschwang, dass er ein Mann gewesen war, dem wahre Erfüllung immer versagt geblieben war.
Elodie war Pippas skeptischen Blick gewöhnt, der sich immer einstellte, wenn sie dergleichen sagte. Es war einfach unmöglich, die Vertrautheit zu beschreiben, die sich entwickelte, wenn man sich beruflich Tag für Tag mit den persönlichen Hinterlassenschaften anderer Menschen beschäftigte. Elodie hatte kein Verständnis für den modernen Drang, seine geheimsten Gefühle in der Öffentlichkeit auszubreiten; sie selbst war sehr verschwiegen und hielt sich an die französische Idee des droit à l’oubli, des Rechts, die Dinge der Vergangenheit zu vergessen und keinen Einfluss auf die Gegenwart haben zu lassen. Und gleichzeitig war es in ihrem Beruf ihre Aufgabe – mehr noch, ihre Leidenschaft –, das Leben von Menschen, die sich nicht mehr dagegen wehren konnten, zu bewahren und sogar zu reanimieren. Sie hatte James Strattons private Tagebücher gelesen, während er nicht einmal ihren Namen kannte.
»Du bist in ihn verliebt, ist doch klar«, sagte Pippa jedes Mal, wenn Elodie versuchte, sich ihr zu erklären.
Aber das war es nicht; Elodie bewunderte James Stratton und wollte sein Erbe schützen. Ihm gebührte angemessene Aufmerksamkeit über den Tod hinaus, und Elodie sah sich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das mit dem nötigen Respekt geschah.
Als Elodie das Wort »Respekt« in den Sinn kam, fiel ihr das Skizzenbuch ein, das sie in ihrer Tasche bei sich trug, und ihre Wangen wurden heiß.
Was hatte sie sich bloß dabei gedacht?
Eine Mischung aus Panik und köstlicher Vorfreude überkam sie. In all den zehn Jahren, seit sie im Archiv von Stratton, Cadwell & Co arbeitete, hatte sie nie so krass gegen Mr. Pendletons Anordnungen verstoßen. Seine Regeln waren kategorisch: Einen Gegenstand aus dem Archiv zu entfernen, schlimmer noch, ihn in die Tasche zu stopfen und in einen Londoner Bus des einundzwanzigsten Jahrhunderts mitzunehmen war mehr als respektlos. Es war unverzeihlich.
Als der 24-er Bus am Bahnhof Mornington Crescent vorbeifuhr und in die Camden High Street einbog, vergewisserte Elodie sich kurz, dass niemand sie beachtete, dann nahm sie das Skizzenbuch aus ihrer Tasche und schlug die Seite mit der Zeichnung von dem Haus am Flussufer auf.
Erneut überkam sie ein Gefühl absoluter Vertrautheit. Sie kannte diesen Ort. In der Geschichte, die ihre Mutter ihr als Kind erzählt hatte, hatte das Haus ein Tor zu einer anderen Welt dargestellt; für Elodie jedoch, die an ihre Mutter gekuschelt den exotischen Duft ihres Parfüms einatmete, war die Geschichte selbst das Tor gewesen, eine Zauberformel, die sie vom Hier und Jetzt in das Land der Fantasie trug. Nach dem Tod ihrer Mutter war die Welt dieser Geschichte zu ihrem geheimen Ort geworden. Ob in der Mittagspause in ihrer neuen Schule, an den langen, stillen Nachmittagen in ihrer Wohnung oder abends im Bett, wenn die Dunkelheit ihr die Luft zum Atmen raubte, brauchte sie nur die Augen zu schließen, und schon konnte sie den Fluss überqueren, durch den dunklen Wald laufen und sich in das verwunschene Haus zurückziehen …
Der Bus hielt in South End Green, und Elodie stieg aus. An einem Blumenstand kaufte sie eine Topfpflanze, dann eilte sie die Willow Road entlang in Richtung Gainsborough Gardens. Es war immer noch warm und schwül, und als sie vor dem kleinen Haus ihres Vaters stand – einem ehemaligen Gärtnerhäuschen –, fühlte sie sich, als wäre sie einen Marathon gelaufen.
»Hallo, Dad«, sagte sie, als er die Tür öffnete, und gab ihm einen Kuss. »Ich hab dir was mitgebracht.«
»Ach du je«, sagte er und beäugte die Pflanze. »Du weißt doch, was letztes Mal passiert ist …«
»Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die Frau, die sie mir verkauft hat, hat mir versichert, dass man sie nur zweimal im Jahr zu gießen braucht.«
»Lieber Himmel. Zweimal im Jahr?«
»Das hat sie gesagt.«
»Ein Wunder.«
Trotz der Hitze hatte er duck à l’orange gekocht, sein Lieblingsgericht, und sie aßen wie immer am Küchentisch. Sie waren nie eine Familie gewesen, die ihre Mahlzeiten im Esszimmer zu sich nahm, außer an Weihnachten oder an Geburtstagen und das eine Mal, als Elodies Mutter den amerikanischen Geiger und seine Frau, die zu einem Besuch in der Stadt waren, zu einem Abendessen eingeladen hatte.
Während des Essens unterhielt sich Elodie mit ihrem Vater über die Arbeit: die bevorstehende Ausstellung, die Elodie kuratieren sollte, den Chor ihres Vaters und den Musikunterricht, den er neuerdings in einer nahe gelegenen Grundschule gab. Seine Miene hellte sich auf, als er von einem kleinen Mädchen erzählte, dessen Geige fast so lang war wie sein Arm, und von dem kleinen Jungen, der ihn um Cellostunden angebettelt hatte. »Seine Eltern haben mit Musik nichts am Hut«, sagte er.
»Lass mich raten. Du hast Ja gesagt.«
»Ich hab’s nicht übers Herz gebracht, ihn abzuweisen.«
Elodie musste lächeln. Wenn es um Musik ging, konnte ihr Vater nie Nein sagen, und er würde nicht im Traum auf die Idee kommen, einem Kind, das seine Leidenschaft teilte, seine Unterstützung zu verweigern. Er war davon überzeugt, dass Musik das Leben der Menschen änderte – »ihre Seele, Elodie« –, und nichts konnte ihn derart begeistern wie eine Diskussion über neuronale Plastizität und MRT-Aufnahmen, an denen sich der Zusammenhang von Musik und Empathie ablesen ließ. Jedes Mal, wenn Elodie mit ihm in einem Konzert saß und miterlebte, wie die Musik ihn in Bann schlug, ging ihr das Herz über. Früher war er selbst einmal Profimusiker gewesen. »Aber nur zweite Geige«, sagte er immer, wenn das Thema aufkam, um dann voller Bewunderung hinzuzufügen: »Kein Vergleich damit, wie sie war.«
Sie. Elodies Blick wanderte zum Esszimmer am Ende des Flurs hinüber. Von ihrem Platz aus konnte sie zwar nur die Ränder einiger Bilderrahmen sehen, aber sie wusste auch so ganz genau, welches Bilder wo hing. Das war die Wand ihrer Mutter. Oder, besser gesagt, das war Lauren Adlers Wand. Beeindruckende Schwarz-Weiß-Aufnahmen von einer vor Leben sprühenden jungen Frau mit langem, glattem Haar und einem Cello in den Armen.
Als Kind hatte Elodie die Fotos abgezeichnet, und so waren sie unauslöschlich vor ihrem geistigen Auge abgebildet. Ihre Mutter in unterschiedlichen Momenten einer Aufführung; der durch die Konzentration immer wieder leicht veränderte Gesichtsausdruck; die hohen Wangenknochen, der fokussierte Blick; geschickte Fingersätze auf Saiten, die unter dem Licht der Scheinwerfer glänzten.
»Nachtisch?«
Ihr Vater hatte einen Erdbeerwackelpudding aus dem Kühlschrank genommen, und Elodie fiel plötzlich auf, wie alt er wirkte im Vergleich zu den Fotos von ihrer Mutter, deren Schönheit und Jugend im Bernstein der Aufnahmen eingeschlossen waren.
Da es ein herrlicher lauer Abend war, setzten sie sich mit ihrem Wein und ihrem Nachtisch auf die Dachterrasse, von wo aus man einen Blick auf den Park hatte.
Drei Brüder spielten Frisbee, der kleinste rannte auf dem Rasen zwischen den beiden anderen hin und her, während die Eltern ins Gespräch vertieft auf einer Bank saßen.
Das sommerliche Dämmerlicht verlieh der Szenerie eine angenehme Trägheit, und es widerstrebte Elodie, die Stimmung zu verderben. Aber nach einigen Minuten des vertrauten Schweigens sagte sie: »Weißt du, woran ich heute gedacht hab?«
»Woran denn?« Ihrem Vater klebte noch ein Klecks Pudding am Kinn.
»An die Gutenachtgeschichte, die Mum mir früher erzählt hat, die von dem Fluss und dem alten Haus mit der Wetterfahne aus Mond und Sternen. Erinnerst du dich?«
Er lachte. »Meine Güte! Das ist ja ewig her. Ja, natürlich erinnere ich mich, du warst ganz verrückt nach der Geschichte. Daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ich fand sie immer ein bisschen zu unheimlich für so ein kleines Mädchen, aber deine Mutter war der Meinung, dass Kinder viel mutiger sind, als man glaubt. Sie hat immer gesagt, die Kindheit ist eine Zeit der Angst, und wenn man Kindern Geschichten erzählt, in denen es um Angst geht, fühlen sie sich weniger allein. Anscheinend hatte sie recht. Wenn sie auf Tournee war, haben dir die Bücher, die ich dir vorgelesen habe, nie gefallen. Das hat mich ziemlich gekränkt. Du hast die Bücher unter deinem Bett versteckt und gesagt, ich soll dir lieber von der Lichtung in dem dunklen Wald und dem verwunschenen Haus am Fluss erzählen.«
Elodie lächelte.
»Ich hab’s versucht, aber du warst nicht zufrieden. Du hast vor Wut mit den Füßen aufgestampft und geschrien: ›Nein, nicht so!‹«
»Ach je.«
»Es war nicht deine Schuld. Deine Mutter war eine großartige Geschichtenerzählerin.«
Ihr Vater verfiel in nachdenkliches Schweigen, doch Elodie, die normalerweise sehr rücksichtsvoll mit der Trauer ihres Vaters umging, ließ nicht locker. »Sag mal, Dad, kann es sein, dass die Geschichte aus einem Buch stammt?«
»Schön wär’s. Es hätte mir viel Zeit erspart, in der ich vergeblich versucht habe, meine untröstliche Tochter zu trösten. Nein, es handelt sich um eine Familiengeschichte. Sie wurde deiner Mutter schon erzählt, als sie selbst noch klein war.«
»Hm, das dachte ich auch immer, aber vielleicht hat sie es ja falsch in Erinnerung behalten. Vielleicht hatte derjenige, der sie ihr damals erzählt hat, die Geschichte aus einem Buch. Aus einem von diesen viktorianischen Bilderbüchern.«
»Möglich.« Er runzelte die Stirn. »Aber wie kommst du jetzt darauf?«
Mit einem Mal ganz aufgeregt, nahm Elodie das Skizzenbuch aus ihrer Tasche, schlug es bei der Seite mit der Zeichnung auf und gab es ihrem Vater. »Das hab ich heute im Archiv gefunden. In einem alten Karton.«
»Sehr schöne Zeichnung … und offensichtlich von einem versierten Künstler …« Er betrachtete sie eine Weile, dann sah er Elodie fragend an.
»Siehst du es denn nicht, Dad? Das ist das Haus aus der Geschichte!«
Er schaute wieder auf die Zeichnung. »Na ja, es ist ein Haus. Und es steht an einem Fluss.«
»Und da ist der Wald, und da ist die Wetterfahne mit der Sonne und dem Mond.«
»Ja, aber … es gibt Dutzende Häuser, auf die diese Beschreibung passt, Liebes.«
»Aber so genau? Ich bitte dich, Dad. Es muss das Haus sein. Die Details stimmen alle. Mehr noch, der Künstler hat genau eingefangen, wie das Haus sich in der Geschichte anfühlt. Das siehst du doch, oder?« Plötzlich hatte Elodie das Gefühl, das Skizzenbuch schützen zu müssen, und sie nahm es ihrem Vater aus der Hand. Besser konnte sie es ihm nicht erklären: Sie wusste nicht, warum es so war und was es zu bedeuten hatte oder warum die Zeichnung im Archiv in einem alten Karton aufgetaucht war, aber sie wusste einfach, dass es sich um das Haus aus der Geschichte ihrer Mutter handelte.
»Tut mir leid, Liebes.«
»Es braucht dir nicht leidzutun.« Elodie spürte, wie ihr die Tränen kamen. So etwas Lächerliches! Wie ein Kind zu weinen wegen einer Meinungsverschiedenheit über die Herkunft einer Gutenachtgeschichte. Sie suchte krampfhaft nach einem anderen Thema. »Hast du schon von Tip gehört?«
»Nein, noch nicht. Aber du weißt ja, wie er ist. Er telefoniert nicht.«
»Ich fahre am Wochenende zu ihm.«
Wieder verfielen sie in Schweigen, aber diesmal fühlte es sich weder entspannt noch vertraut an. Elodie beobachtete das warme Licht, das in den Blättern der Bäume spielte. Sie wusste selbst nicht, warum sie so erregt war. Selbst wenn es sich um dasselbe Haus handelte, was spielte es für eine Rolle? Entweder hatte der Künstler ein Buch illustriert, das ihre Mutter gelesen hatte, oder er hatte ein reales Haus gezeichnet, um das herum sich irgendjemand eine Geschichte ausgedacht hatte. Sie sollte die Sache auf sich beruhen lassen, etwas Nettes sagen …
»Das schöne Wetter soll sich halten«, sagte ihr Vater im selben Moment, als sie ausrief: »Das Haus hat acht Kamine, Dad. Acht!«
»Ach, Liebes.«
»Es ist das Haus aus der Geschichte. Sieh dir doch mal die Giebel an …«
»Meine Kleine.«
»Dad!«
»Es ist verständlich.«
»Was?«
»Es liegt an der Hochzeit.«
»An welcher Hochzeit?«
»Deiner natürlich.« Er lächelte sie liebevoll an. »Große Ereignisse haben es so an sich, Erinnerungen aus der Vergangenheit hochkommen zu lassen. Und natürlich denkst du an deine Mutter. Ich hätte damit rechnen müssen, dass sie dir jetzt ganz besonders fehlt.«
»Nein, Dad, ich …«
»Da fällt mir ein, ich wollte dir schon die ganze Zeit etwas geben. Warte mal kurz.«
Nachdem ihr Vater die Metalltreppe ins Haus hinuntergegangen war, stieß Elodie einen Seufzer aus. Er war einfach rührend mit seiner Kochschürze um den Bauch und seinem duck à l’orange, das ihm wie immer zu süß geraten war.
Auf einem der Zwillingsschornsteine hockte eine Amsel und beobachtete sie aufmerksam. Sie flog plötzlich davon, offenbar hatte sie einen Ruf erhalten, den Elodie nicht hören konnte. Der kleine Junge auf dem Rasen im Park begann zu weinen. Es erinnerte sie an das, was ihr Vater über ihre Reaktion auf seine Bemühungen gesagt hatte, ihr eine Gutenachtgeschichte zu erzählen. So viele Jahre waren seitdem vergangen, die sie zu zweit verbracht hatten.
Ihr Vater hatte es sicher nicht leicht gehabt mit ihr.
»Das habe ich für dich aufgehoben«, sagte ihr Vater, zurück auf der Dachterrasse. Sie hatte angenommen, er hätte die Videos geholt, um die sie ihn gebeten hatte, aber dafür war die Schachtel, die er in den Händen hielt, zu klein. »Ich wusste, dass du ihn eines Tages – na ja, dass der Tag kommen würde …« Er bekam feuchte Augen und schüttelte den Kopf. »Hier«, sagte er und reichte ihr die Schachtel. »Du wirst schon sehen.«
Elodie hob den Deckel an. Zum Vorschein kam ein Streifen Seidenorganza, zart elfenbeinfarben, eingefasst mit einer Samtbordüre. Sie wusste sofort, was das war. Sie hatte das Foto in dem vergoldeten Rahmen oft genug betrachtet.
»Sie war so schön an dem Tag damals«, sagte ihr Vater. »Ich werde nie den Augenblick vergessen, als sie plötzlich in der Kirchentür stand. Ich war fast davon überzeugt, dass sie nicht kommen würde. Mein Bruder hatte mich seit Tagen gnadenlos damit aufgezogen. Er fand das total lustig, und ich hab’s ihm leicht gemacht. Ich konnte einfach nicht glauben, dass sie Ja gesagt hatte. Ich war mir sicher, dass es sich um einen Irrtum handeln musste, es war einfach zu gut, um wahr zu sein.«
Elodie nahm seine Hand. Ihre Mutter war seit fünfundzwanzig Jahren tot, aber für ihren Vater war es, als hätte er sie gestern geheiratet. Elodie war damals sechs gewesen, aber sie konnte sich noch gut erinnern, wie er ihre Mutter immer angesehen hatte, wie die beiden immer Hand in Hand gegangen waren. Und sie erinnerte sich an das Klopfen an der Tür, an die leisen Stimmen der Polizisten, an den schrecklichen Schrei ihres Vaters.
»Es wird spät«, sagte er und tätschelte ihr Handgelenk. »Du solltest dich auf den Heimweg machen, Liebes. Komm, lass uns nach unten gehen. Ich hab die Videos gefunden, die du haben wolltest.«
Elodie schloss die Schachtel wieder. Sie würde ihn mit seinen traurigen Erinnerungen allein lassen, aber er hatte recht; sie hatte einen langen Heimweg. Außerdem wusste Elodie seit Langem, dass sie seinen Schmerz nicht heilen konnte. »Danke, dass du den Schleier für mich aufgehoben hast«, sagte sie und hauchte ihm einen Kuss auf die Stirn.
»Sie wäre stolz auf dich.«
Elodie lächelte, aber als sie ihrem Vater die Treppe hinunterfolgte, fragte sie sich, ob das stimmte.
Sie wohnte im Dachgeschoss eines viktorianischen Hauses in Barnes. Zum Glück drang von dem Geruch nach Frittierfett, der aus dem Fish’n’Chips-Imbiss im Erdgeschoss ins Treppenhaus drang, kaum etwas bis ganz oben. Ihre Wohnung bestand nur aus einem Wohn-Esszimmer mit Kochnische und einem seltsam geschnittenen Schlafzimmer mit angrenzendem Bad, aber die Aussicht war genau nach Elodies Geschmack.
Von einem Schlafzimmerfenster aus blickte man auf eine Reihe viktorianischer Häuser: altes Backsteingemäuer, weiße Fensterrahmen und Dächer mit Terrakotta-Schornsteinen. Durch die schmalen Lücken zwischen den Häusern konnte sie das glitzernde Wasser der Themse ausmachen. Und wenn sie sich auf die Fensterbank setzte, konnte sie flussaufwärts bis zur Eisenbahnbrücke sehen.
Das Fenster auf der anderen Seite lag zur Straße hin, und von dort blickte man auf ein identisches Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Ehepaar, das dort wohnte, saß noch beim Essen, als Elodie nach Hause kam. Die Leute waren Schweden, wie Elodie erfahren hatte, was nicht nur ihre Größe und ihr gutes Aussehen erklärte, sondern auch ihre seltsame nordische Angewohnheit, nach zehn Uhr zu Abend zu essen. Über ihrem Küchentisch hing eine Lampe mit einem Schirm aus Krepp, die rosafarbenes Licht verströmte und die Wangen der beiden rötlich schimmern ließ.
Elodie zog die Vorhänge zu, schaltete das Licht an und nahm den Brautschleier aus der Schachtel. Im Gegensatz zu Pippa verstand sie nicht viel von Mode, aber dieser Schleier war etwas ganz Besonderes. Erlesen, schon aufgrund seines Alters, begehrenswert, weil er der berühmten Lauren Adler gehört hatte, und für Elodie kostbar, weil ihre Mutter ihn getragen hatte, die so erstaunlich wenig hinterlassen hatte. Zumindest erstaunlich wenig Privates.
Nach kurzem Zögern nahm sie den Schleier aus der Schachtel und hielt ihn sich vorsichtig an den Kopf. Sie steckte sich den Kamm ins Haar, sodass der Organza ihr über die Schultern fiel. Dann ließ sie die Hände sinken.
Elodie hatte sich geehrt gefühlt, als Alastair ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Das war an ihrem ersten Jahrestag gewesen (ein ehemaliger Schulkamerad Elodies, der in Alastairs Firma arbeitete, hatte sie einander vorgestellt). Alastair hatte sie zuerst ins Theater und anschließend zum Abendessen in ein elegantes Restaurant in Soho eingeladen, wo er ihr an der Garderobe, während ihnen die Mäntel abgenommen wurden, ins Ohr geflüstert hatte, dass man normalerweise Wochen im Voraus anrufen müsse, um einen Tisch zu reservieren. Nachdem sie den Nachtisch bestellt hatten, hatte er ihr den Ring in einer mit Samt bezogenen Schachtel überreicht. Es war wie eine Filmszene gewesen, und Elodie hatte sie wie von außen gesehen: Alastair mit seinem schönen Gesicht, den weißen Zähnen und dem erwartungsvollen Blick, sich selbst in dem neuen Kleid, das Pippa für sie genäht hatte, als sie im Vormonat anlässlich des hundertfünfzigjährigen Jubiläums der Stratton-Gruppe eine Ansprache gehalten hatte.
Eine ältere Frau am Nebentisch hatte ihrem Mann zugeflüstert: »Gott, wie romantisch! Sie wird ganz rot, weil sie so verliebt ist.« Und Elodie hatte gedacht: Ich werde rot, weil ich so verliebt bin, und als Alastair fragend die Brauen hob, sah sie, wie sie lächelte und Ja sagte.
Auf der dunklen Themse ließ ein Schiff sein Nebelhorn ertönen, und Elodie nahm den Schleier vom Kopf.
So lief das, dachte sie. So verlobte man sich. Bald würde die Hochzeit stattfinden – laut Datum auf den Einladungen in sechs Wochen, wenn die Gärten in Gloucestershire in ihrer ganzen »Spätsommerpracht« erstrahlten, wie Alastairs Mutter meinte –, und dann würden Elodie und Alastair zu den verheirateten Paaren gehören, die sich an Wochenenden trafen, um sich über Häuser und Kredite und Internate zu unterhalten. Denn natürlich würden sie Kinder bekommen. Sie würde Mutter werden. Sie würde nicht sein wie ihre Mutter, talentiert und strahlend, verführerisch und unnahbar, aber ihre Kinder würden bei ihr Rat und Trost suchen, und sie würde wissen, was zu tun und zu sagen war, weil das nun mal der Lauf der Dinge war. Oder nicht?
Elodie stellte die Schachtel auf dem mit braunem Samt bezogenen Sessel in der Zimmerecke ab.
Dann, nach kurzem Zögern, schob sie sie stattdessen unter den Sessel.
Der Koffer mit den Videobändern, den ihr Vater ihr mitgegeben hatte, stand noch neben der Tür, wo sie ihn abgestellt hatte.
Eigentlich hatte sie vorgehabt, sich noch am selben Abend mit den Bändern zu beschäftigen, aber plötzlich war sie hundemüde.
Sie duschte, dann schaltete sie das Licht aus und schlüpfte schuldbewusst ins Bett. Sie würde sich morgen um die Videos kümmern, auf jeden Fall. Penelope, Alastairs Mutter, hatte seit dem Vormittag schon dreimal angerufen. Elodie hatte die Anrufe auf die Mailbox gehen lassen, aber jeden Moment würde Alastair anrufen, um Bescheid zu sagen, dass »Mummy« sie für Sonntag zum Mittagessen erwarte, und ehe sie sichs versah, würde sie neben ihrem Verlobten in dem Rover sitzen, unterwegs zu dem riesigen Haus in Surrey, wo sie sich der Inquisition würde stellen müssen.
Eine Aufnahme auszuwählen war eine von drei Aufgaben, die ihr übertragen worden waren. Die zweite bestand darin, den Veranstaltungsort aufzusuchen, der einer Cousine von Penelopes bester Freundin gehörte – »nur um sich mal kurz vorzustellen, natürlich, den Rest können Sie mir überlassen«. Die dritte war ein Treffen mit Pippa, die sich erboten hatte, ihr Hochzeitskleid zu entwerfen. Bisher hatte Elodie noch keine der drei Aufgaben erledigt.
Morgen, nahm sie sich ganz fest vor und schob die Gedanken an die Hochzeit beiseite. Morgen.
Sie schloss die Augen. Vage hörte sie die Geräusche aus dem Imbiss, wo ein paar späte Gäste sich noch eine Portion Kabeljau im Teigmantel mit Fritten bestellten, dann wanderten ihre Gedanken ohne Vorwarnung zu dem Karton, der im Archiv unter ihrem Schreibtisch stand. Sie sah das gerahmte Foto von der jungen Frau mit dem direkten Blick vor sich. Die Zeichnung von dem Haus.
Und dann war das seltsame Gefühl wieder da, der Erinnerungsfetzen, den sie nicht zu fassen bekam und der sie beunruhigte. Sie sah die Zeichnung vor sich und hörte die Stimme ihrer Mutter, die zugleich die Stimme von jemand anderem war: Die kurvenreiche Straße hinunter und über das weite Feld liefen sie zum Fluss, mit ihren Geheimnissen und ihrem Schwert …
Und als sie endlich einschlief, erwachte die Tuschezeichnung zum Leben, das grüne Laub der Bäume leuchtete in der Sonne, das Wasser der Themse glitzerte, und eine sanfte Brise streichelte ihre Wangen an einem Ort, der ihr so vertraut war, als wäre es ihr Zuhause.
II
Es ist ein stilles Leben, hier in Birchwood. Viele Sommer sind vergangen seit dem unseren, und ich bin ein Gewohnheitsmensch geworden, für mich sieht ein Tag aus wie der andere. Es kommen nicht viele Besucher, und die, die sich hierher verirren, bleiben nicht lange. Ich bin keine gute Gastgeberin. Es ist nicht einfach, hier zu wohnen.
Die meisten Leute fürchten sich vor alten Gebäuden genauso wie vor alten Menschen. Der Themsepfad ist zu einem beliebten Wanderweg geworden, und manchmal bleiben Wanderer abends oder am frühen Morgen stehen und lugen über die Gartenmauer. Ich sehe sie, aber ich lasse mich nicht sehen.
Ich gehe nur selten aus dem Haus. Früher bin ich mit klopfendem Herzen über die Wiese gelaufen, mit roten Wangen und kräftigen Muskeln, aber diese Zeiten sind vorbei.
Die Leute auf dem Wanderweg haben Gerüchte über mich gehört, sie zeigen herüber und stecken die Köpfe zusammen, so wie alle Klatschbasen es tun. »Da ist es passiert«, sagen sie, »da hat er gewohnt.« Und: »Glaubst du, sie hat es getan?«
Aber wenn das Tor geschlossen ist, kommen sie nicht herein. Sie haben gehört, dass es hier spukt.
Ich muss gestehen, dass ich damals nicht darauf geachtet habe, als Clare und Adele von Geistern sprachen. Ich war beschäftigt, mit den Gedanken woanders. Das habe ich seitdem oft bereut. Solches Wissen wäre mir über die Jahre nützlich gewesen und wäre es auch heute, wenn meine »Besucher« hier sind.
Gerade ist wieder einer gekommen. Zuerst habe ich es gespürt, wie immer. Ein Gewahrwerden, eine leichte, aber deutliche Veränderung in der abgestandenen Luft, die sich nachts auf die Stufen der Treppe legt. Ich habe stillgehalten und gehofft, dass er mich nicht belästigen würde, während ich darauf wartete, dass die Stille zurückkehrte.
Aber die Stille kehrte nicht zurück. Auch nicht die Ruhe. Er macht keinen Lärm, wie manche seiner Vorgänger, aber ich habe zu lauschen gelernt, habe gelernt, worauf ich horchen muss, und als die Bewegungen einen regelmäßigen Rhythmus annahmen, wusste ich, dass er sich entschlossen hatte zu bleiben.
Ich habe schon lange keinen Besucher mehr gehabt. Früher gingen sie mir auf die Nerven mit ihrem Geflüster und ihren polternden Schritten, es gruselte mich zu denken, dass meine Sachen, meine Räume, nicht mehr mir gehörten. Ich habe mich zurückgehalten, aber ich habe sie beobachtet, einen nach dem anderen, genau wie Edward es getan hätte, und mit der Zeit habe ich gelernt, wie ich sie am besten loswerde. Letztendlich sind sie schlichte Gemüter, und inzwischen bin ich darin geübt, ihnen ihren Weg hinaus zu weisen.
Nicht alle, wohlgemerkt, denn für einige habe ich mich erwärmt. Für die Besonderen. Da war zum Beispiel der arme, traurige Soldat, der nachts im Schlaf schrie. Oder die Witwe, deren Tränen der Wut zwischen die Dielen sickerten. Und natürlich die Kinder – das einsame Schulmädchen, das so gern nach Hause wollte, der ernste kleine Junge, der versuchte, seine Mutter zu trösten. Ich mag Kinder. Sie sind viel intuitiver. Sie haben noch nicht wegzusehen gelernt.
Bei dem Neuen überlege ich noch, ob wir beide friedlich zusammenleben können, und wenn ja, wie lange. Er hat mich noch nicht bemerkt. Er hat zu viel zu tun. Jeden Tag geht er rüber in die Küche der Mälzerei, immer mit diesem braunen Stoffbeutel über der Schulter.
Anfangs sind sie alle so. Unachtsam, mit sich selbst beschäftigt, auf das konzentriert, von dem sie glauben, es erledigen zu müssen. Aber ich bin geduldig. Ich beobachte und warte, viel mehr habe ich sowieso nicht zu tun.
Gerade sehe ich ihn durchs Fenster. Er geht zu dem kleinen Friedhof am Dorfrand. Jetzt bleibt er stehen. Er scheint die Inschriften auf den Grabsteinen zu lesen, so als suchte er nach einem bestimmten Namen.
Nach welchem wohl? Dort liegen so viele begraben.
Ich war schon immer neugierig. Mein Vater sagte gern, ich sei schon neugierig auf die Welt gekommen. Mrs. Mack meinte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis ich mit meiner Neugier auf die Nase fiele.
Jetzt ist er weg. Über den Hügel verschwunden, sodass ich nicht mehr sehen kann, wohin er geht oder was er in seinem Beutel hat oder was er überhaupt hier vorhat.
Ich glaube, ich bin ziemlich aufgeregt. Wie gesagt, es war schon lange niemand mehr hier, und ein neuer Besucher ist immer erfrischend. Es lenkt meine Gedanken von den Knochen der Gewohnheit ab, an denen sie normalerweise nagen.
Knochen wie diesen …
Als sie alle ihre Sachen gepackt haben und die Kutschen losgejagt sind, als wäre der Teufel hinter ihnen her, hat Edward sich da noch einmal umgedreht und im von der Abendsonne erleuchteten Fenster etwas gesehen, das ihm seinen Albtraum hätte nehmen können?
Als er wieder in London an seiner Staffelei stand, hat er da ab und zu geblinzelt, um mein Bild vor seinem inneren Auge zu verscheuchen? Hat er in langen Nächten von mir geträumt, so wie ich von ihm?
Hat er sich damals an den Schein des flackernden Kerzenlichts auf der Maulbeerblütentapete erinnert, so wie ich es heute tue?
Es gibt auch noch andere. Knochen, die zu polieren ich mir versage. Es hat keinen Zweck, sich den Kopf zu zerbrechen, wenn man niemanden mehr fragen kann.
Sie sind alle tot. Sie sind alle schon lange tot. Aber meine Fragen bleiben. Knoten, die nie gelöst werden. Hin und her gedreht, von allen vergessen, nur nicht von mir. Denn ich vergesse nichts, sosehr ich mich auch bemühe.
KAPITEL 3
Sommer 2017
Das merkwürdige, beunruhigende Gefühl war am nächsten Morgen immer noch da, und Elodie nutzte die Fahrt zur Arbeit, um sich alles aufzuschreiben, was sie noch von der Gutenachtgeschichte in Erinnerung hatte. Während London an ihr vorüberflog und sich ein paar Schuljungen weiter hinten im Bus kichernd über ein Smartphone beugten, hatte sie ein Notizheft auf dem Schoß und blendete die Realität aus. Ihr Stift flog nur so über die Seiten des Hefts, aber als der Zug sich dem Bahnhof Waterloo näherte, schwand ihre Begeisterung, und der Stift wurde immer langsamer. Sie überflog noch einmal, was sie geschrieben hatte, die Geschichte von dem Haus mit seiner himmlischen Wetterfahne und dem Fluss mit dem quecksilberfarbenen Wasser und den wunderbaren, schrecklichen Dingen, die sich nachts im Wald zutrugen, und genierte sich ein bisschen. Schließlich war es eine Kindergeschichte und sie eine erwachsene Frau.
Der Zug hielt, und Elodie nahm ihre Tasche, die sie neben dem Sitz abgestellt hatte. Ihr Blick fiel auf das Skizzenbuch, das sie zu Hause in ein sauberes Geschirrtuch gewickelt hatte, und ein Gefühl der Verunsicherung überkam sie, als sie daran dachte, mit welcher Kühnheit sie das Heft am Nachmittag zuvor eingesteckt hatte und wie sie immer überzeugter davon gewesen war, dass der Zeichnung irgendein Geheimnis innewohnte. Sie hatte sogar den leisen Verdacht gehabt (was sie Gott sei Dank ihrem Vater gegenüber nicht erwähnt hatte), dass die Zeichnung all die Jahre auf sie gewartet hatte.
Elodies Handy klingelte, als sie an der Kirche St. Mary le Strand vorbeiging, und Penelopes Name erschien auf dem Display. Während sich ein Kribbeln in ihrem Bauch bemerkbar machte, kam ihr der Gedanke, dass ihr Vater womöglich recht gehabt hatte. Dass es vielleicht die bevorstehende Hochzeit war, die diese seltsamen Gefühle bei ihr auslöste, und nicht die Zeichnung von dem Haus. Sie ließ das Handy klingeln und steckte es wieder ein. Sie würde sich am Nachmittag mit ihrer dominanten zukünftigen Schwiegermutter in Verbindung setzen, nachdem sie sich mit Pippa getroffen und etwas Konkretes zu berichten hatte.
Wie schon so oft wünschte sich Elodie, ihre Mutter würde noch leben und für einen Kräfteausgleich sorgen. Sie wusste aus zuverlässiger Quelle – und nicht nur von ihrem Vater –, dass Lauren Adler eine außergewöhnliche Frau gewesen war. Mit siebzehn hatte Elodie alles, was sich in Erfahrung bringen ließ, über ihre Mutter recherchiert. Mit dem Internet hatte sie angefangen, dann hatte sie sich einen Leseausweis für die British Library besorgt. Sie hatte alles über Lauren Adlers schillernde Karriere gesammelt. Abends im Bett hatte sie jeden Artikel und jedes Interview gelesen und sich auf diese Weise ein Bild gemacht von einer quirligen jungen Frau mit einem verblüffenden Talent, einer virtuosen Musikerin, die ihr Instrument meisterhaft beherrschte. Am liebsten hatte sie die Interviews gelesen, denn dort, zwischen den Anführungszeichen, standen die Worte, die ihre Mutter selbst gesagt hatte. Sie enthielten die Gedanken ihrer Mutter, ihre Stimme, ihre persönliche Ausdrucksweise.
Elodie hatte mal ein Buch gelesen, das sie in Griechenland unter einem Hotelbett gefunden hatte. Es handelte von einer todkranken Frau, die ihren Kindern Briefe über das Leben schrieb in der Hoffnung, sie auch noch über den Tod hinaus mit gutem Rat begleiten zu können. Aber Elodies Mutter hatte nichts von ihrem bevorstehenden Tod geahnt und ihrer Tochter daher auch keine weisen Ratschläge hinterlassen. Also musste Elodie sich mit den Interviews begnügen, und die siebzehnjährige Elodie hatte sie gierig verschlungen und manche Sätze ihrem Spiegelbild in dem ovalen Spiegel über ihrer Frisierkommode zugeflüstert. Wie andere junge Mädchen in ihrem Alter Lieblingsgedichte lernte Elodie die Worte ihrer Mutter auswendig, sie wurden zu ihrer ganz persönlichen Sammlung von Lebensweisheiten. Denn im Gegensatz zu Elodie, die Pickel hatte und fürchterlich unsicher war, war die siebzehnjährige Lauren Adler beschwingt und lebenslustig gewesen: ebenso bescheiden wie talentiert, war sie bereits bei den Proms aufgetreten, den traditionellen Sommerkonzerten in der Royal Albert Hall, und hatte sich in die Herzen der Londoner gespielt.
Selbst Penelope, deren Selbstbewusstsein so unübersehbar war wie die Perlen, die sie um den Hals trug, sprach voller Bewunderung von Elodies Mutter. Sie sagte nie »deine Mutter«, sondern immer nur »Lauren Adler«: »Hatte Lauren Adler ein Lieblingsstück?« Oder: »Gab es einen Ort, an dem Lauren Adler am liebsten aufgetreten ist?« Solche Fragen beantwortete Elodie, so gut sie konnte. Dabei erwähnte sie nicht, dass sie ihr Wissen aus Quellen hatte, die letztlich für jeden frei zugänglich waren, der sich die Mühe machte nachzusehen, denn sie fühlte sich von Penelopes Interesse geschmeichelt. Angesichts Alastairs hoher sozialer Stellung, seines gigantischen Anwesens, seiner wohlhabenden Eltern und der Bedeutung von Tradition in einer Familie, in deren Haus zahllose Ahnenporträts hingen, konnte sie alles gebrauchen, was ihr selbst eine gewisse Geltung verschaffte.
Kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, hatte Alastair erwähnt, dass seine Mutter eine große Liebhaberin von klassischer Musik sei. Sie hatte als Mädchen selbst ein Instrument gespielt, das Musizieren jedoch später aufgegeben. Er hatte Elodie auf rührende Weise von Konzerten erzählt, zu denen seine Mutter ihn mitgenommen habe, als er noch klein gewesen sei, von der Aufregung vor dem Eröffnungskonzert des Londoner Symphony Orchestras in der Barbican Hall oder vor dem Eintreffen des Dirigenten auf der Bühne der Royal Albert Hall. Sie seien immer zu zweit hingegangen, es sei ein ganz be sonderes Mutter-Sohn-Ding gewesen. (»Mein Vater findet das alles ziemlich übertrieben. Sein Interesse an der Kultur beschränkt sich auf Rugby.«) Bis heute besuchten sie regelmäßig einmal im Monat gemeinsam ein Konzert und gingen anschließend essen.
Pippa hatte die Brauen gehoben, als sie davon hörte, vor allem, als Elodie ihr gestand, dass sie noch nie eingeladen worden sei, die beiden zu begleiten; aber Elodie hatte es heruntergespielt. Sie hatte irgendwo gelesen, dass Männer, die ihre Mütter gut behandelten, die besten Partner abgäben. Außerdem war es angenehm, dass jemand zur Abwechslung mal nicht automatisch davon ausging, dass sie auf klassische Musik stand. Seit sie denken konnte, war sie es gewohnt, dass wildfremde Menschen sie fragten, welches Instrument sie spiele, und sie verdattert ansahen, wenn sie antwortete, dass sie nicht musiziere. »Nicht mal ein bisschen?«, fragten sie dann.
Aber Alastair hatte es verstanden. »Das kann ich nachvollziehen«, hatte er gesagt. »Wer will schon mit Perfektion konkurrieren?« Auch darüber hatte Pippa sich aufgeregt (»Du bist perfekt, so wie du bist!«), aber Elodie wusste, dass Alastair etwas ganz anderes gemeint hatte.
Es war Penelopes Idee gewesen, eine Konzertaufzeichnung von Lauren Adler bei der Hochzeit abzuspielen. Als Elodie ihr erzählt hatte, dass ihr Vater jede Menge Videos von Lauren Adlers Auftritten besitze, die er sicherlich vom Dachboden holen würde, wenn sie ihn darum bitte, hatte Penelope sie regelrecht zärtlich angeschaut und ihre Hand berührt, was sie noch nie getan hatte. »Ich habe sie einmal spielen sehen. Sie war unglaublich, sie hat so hingebungsvoll gespielt. Ihre Spieltechnik allein war schon höchstes Niveau, aber in Verbindung mit dieser ganz besonderen Musikalität rangierte sie weit über allen anderen. Was dann passiert ist, war einfach schrecklich. Ich war am Boden zerstört.«