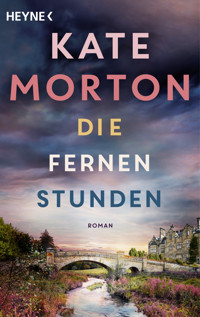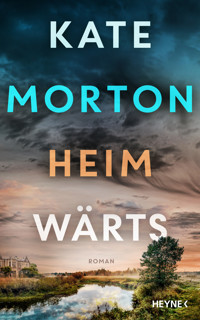
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine epische Geschichte über drei Generationen von Frauen - über tödliche Geheimnisse und Lügen, Liebe, Schuld und Vergebung
Adelaide Hills, Australien, 1959: Eine Familie picknickt gemütlich an einem Bach. Als etwas später ein Mann aus dem Nachbarort zufällig dort vorbeikommt, stößt er auf ein erschütterndes Todesszenario. Die Polizei beginnt zu ermitteln, doch der Fall bleibt ein einziges Rätsel.
Fast sechzig Jahre später wird die Journalistin Jess aus England zurück nach Australien gerufen. Ihre Großmutter Nora liegt nach einem Unfall im Sterben. Geschwächt und verwirrt, murmelt Nora Unverständliches vor sich hin. Der Sinn erschließt sich Jess erst, als sie eine überraschende Verbindung zu den tragischen Geschehnissen in den Adelaide Hills herstellt – und zu ihrer eigenen Familiengeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 895
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Ein glühend heißer Sommertag in den Adelaide Hills, Heiligabend 1959. Percy, der Gemischtwarenhändler des Örtchens Tambilla, liefert letzte Bestellungen aus. Sein Weg führt über das idyllische Gelände eines verwunschenen Herrenhauses. Am Bach macht er eine schreckliche Entdeckung. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen auf, aber der schockierende Fall wird nie gelöst.
Fast sechzig Jahre später steckt die Journalistin Jess in einer privaten wie beruflichen Krise. Da erhält sie einen alarmierenden Anruf aus ihrer alten Heimat Australien: Ihre geliebte Großmutter Nora, die sie als Kind aufgezogen hat, liegt nach einem Unfall im Krankenhaus. Jess kehrt sofort nach Sydney zurück. Nora ist nicht mehr ansprechbar, aber irgendetwas aus der Vergangenheit scheint sie schwer zu belasten. In Noras Haus findet Jess ein altes Buch – einen romanhaften Bericht über die Tragödie am Heiligabend 1959. Als Journalistin stürzt sie sich begeistert in die Recherche zum Fall. Bis sie einen erschütternden Zusammenhang mit ihrer eigenen Familiengeschichte entdeckt.
Die Autorin
Kate Morton wuchs im australischen Queensland auf und studierte Theaterwissenschaften in London und Englische Literatur in Brisbane. Ihre Romane erscheinen weltweit in 34 Sprachen und 42 Ländern und eroberten ein Millionenpublikum. Alle Romane sind SPIEGEL-Bestseller. Kate Morton lebt mit ihrer Familie in Australien und England.
KATE MORTON
HEIMWÄRTS
ROMAN
Aus dem Englischen von Stefanie Fahrner und Judith Schwaab
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel HOMECOMINGbei Allen & Unwin, Australia
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Kate Morton
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Übersetzung: Stefanie Fahrner (S. 1–340), Judith Schwaab (S. 341–687)
Redaktion: Angelika Lieke
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagfotos: Shutterstock.com
(INTREEGUE Photography, Paul shuang, TSN52,
Bernulius, Sofia Voronkova)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30875-9V003
www.heyne.de
Für meine Familie
PROLOG
Adelaide Hills, South Australia, Neujahrstag 1959
Und natürlich sollte es zum Jahreswechsel eine Lunchparty geben. Eigentlich keine große Sache, nur die Familie, aber Thomas wollte trotzdem das ganze Drum und Dran. Alles andere schien undenkbar. Die Turners legten großen Wert auf Tradition, und da Nora und Richard aus Sydney zu Besuch waren, sollte auf nichts von dem ganzen Firlefanz und Trara verzichtet werden.
Isabel hatte beschlossen, dieses Jahr einen anderen Teil des Gartens herzurichten. Normalerweise saßen sie unter dem Walnussbaum auf der östlichen Rasenfläche, aber jetzt hatte es ihr der Rasen im Schatten von Mr. Wentworths Zeder angetan. Sie war darüber geschlendert, als sie kurz zuvor die Blumen für den Tisch geschnitten hatte, und der schöne Blick nach Westen auf die Berge hatte sie beeindruckt. Ja, hatte sie zu sich selbst gesagt, das wird sehr gut passen. Dieser unerwartete Gedanke und ihre eigene Entschlossenheit fühlten sich berauschend an.
Sie redete sich ein, dass das alles zu ihrem Neujahrsvorsatz gehörte, das Jahr 1959 mit neuen Augen und Erwartungen anzugehen, aber da war auch eine kleine innere Stimme, die beharrlich fragte, ob sie ihren Mann mit dem plötzlichen Bruch des Protokolls nicht ein wenig quälte. Seit sie das sepiafarbene Foto von Mr. Wentworth und seinen Freunden – alle mit ähnlichen viktorianischen Bärten – entdeckt hatten, die in eleganten Holzliegen auf dem östlichen Rasen ruhten, war Thomas unerschütterlich davon überzeugt gewesen, dass sich dieser Ort am besten für eine Festlichkeit eignete.
Isabel wusste nicht mehr genau, wann sie begonnen hatte, mit schuldbewusstem Vergnügen diese kleine vertikale Stirnfalte zwischen den Augenbrauen ihres Mannes hervorzurufen.
Ein Windstoß drohte ihr die Wimpelkette aus den Händen zu reißen, und sie hielt sich an der höchsten Sprosse der Holzleiter fest. Sie hatte die Leiter am Vormittag selbst aus dem Gartenschuppen hergetragen und die Anstrengung dabei genossen. Als sie das erste Mal nach oben kletterte, kam ihr eine Kindheitserinnerung in den Sinn – ein Tagesausflug nach Hampstead Heath mit ihrer Mutter und ihrem Vater, wo sie auf einen der riesigen Mammutbäume geklettert war und Richtung Süden auf die Stadt London geblickt hatte. »Ich kann St. Paul’s sehen!«, hatte sie ihren Eltern zugerufen, als sie die vertraute Kuppel durch den Smog hindurch entdeckte.
»Nicht loslassen«, hatte ihr Vater zurückgerufen.
Erst in jenem Moment, als er das sagte, hatte Isabel das unerklärliche Verlangen verspürt, genau das zu tun. Dieses Empfinden hatte ihr für einen Moment den Atem geraubt.
Ein Schwarm Galahs flog aus dem Wipfel der dicksten Banksie auf, ein panisches Gewirr aus rosafarbenen und grauen Federn, und Isabel erstarrte. Da war jemand! Sie hatte schon immer einen ausgeprägten Instinkt für Gefahr gehabt. »Du hast wohl ein schlechtes Gewissen«, pflegte Thomas in London zu ihr zu sagen, als sie sich noch nicht so gut kannten, aber schon voneinander verzaubert waren. »Unsinn«, hatte sie erwidert. »Ich bin nur ungewöhnlich feinsinnig.« Isabel blieb regungslos am oberen Ende der Leiter stehen und lauschte.
»Da, schau doch!«, flüsterte jemand theatralisch. »Beeil dich und töte sie mit dem Stock.«
»Ich kann nicht!«
»Doch, du kannst – du musst! Du hast einen Schwur geleistet.«
Es waren nur die Kinder, Matilda und John! Was für eine Erleichterung, dachte Isabel. Trotzdem blieb sie still, um sich nicht zu verraten.
»Brich ihr einfach das Genick und bring es hinter dich.« Das war Evie, ihre Jüngste, neun Jahre alt.
»Ich kann nicht.«
»Ach, John«, sagte Matilda, vierzehn, die einem manchmal wie vierundzwanzig vorkam. »Gib her. Sei doch nicht so ein Spielverderber.«
Isabel wusste sofort, was vor sich ging. Seit Jahren spielten sie immer wieder Schlangenjagd. Ursprünglich hatten sie die Idee aus einem Buch, einem Sammelband mit Buschgedichten, den Nora geschickt hatte. Isabel hatte ihnen daraus vorgelesen, und die Kinder hatten großen Spaß daran gehabt. Wie so viele der Erzählungen aus dieser Gegend waren es warnende Geschichten. Es schien, als gäbe es an diesem Ort entsetzlich viel zu fürchten: Schlangen und Sonnenuntergänge und Gewitter und Dürren und Schwangerschaft und Fieber und Buschfeuer und Überschwemmungen und verrückte Stiere und Krähen und Adler und Fremde – »schurkische Gesellen«, die aus dem Busch kamen und Mord im Sinn hatten.
Isabel fand die schiere Anzahl der tödlichen Bedrohungen manchmal geradezu überwältigend, aber die Kinder waren richtige kleine Australier, freuten sich über solche Geschichten und genossen das Spiel. Es war eine der wenigen Aktivitäten, die alle gleichermaßen begeisterten, trotz des Altersunterschieds und ihrer unterschiedlichen Neigungen.
»Ich hab sie erledigt!«
»Gut gemacht.«
Schallendes Gelächter ertönte.
»Los jetzt!«
Sie liebte es, die Kinder fröhlich und ausgelassen zu erleben; dennoch hielt sie den Atem an und wartete darauf, dass das Spiel sie verschlucken würde. Manchmal ertappte sich Isabel bei der Vorstellung, dass sie alle Kinder verschwinden lassen könnte – auch wenn sie nie gewagt hätte, das laut auszusprechen. Natürlich nur für kurze Zeit, sonst würde sie sie schrecklich vermissen! Vielleicht eine Stunde lang oder einen Tag – aber allerhöchstens eine Woche. Gerade lange genug, damit sie etwas Zeit zum Nachdenken bekam. Davon gab es nie genug, schon gar nicht, um einen Gedanken bis zu seinem logischen Ende zu verfolgen.
Thomas sah sie an, als wäre sie verrückt, wenn sie solche Dinge ansprach. Er hatte ziemlich klare Vorstellungen davon, wie eine Mutter zu sein hatte. Und eine Ehefrau. In Australien waren die Frauen anscheinend häufig auf sich gestellt, wenn es darum ging, mit Schlangen, Bränden und wilden Hunden fertigzuwerden. Thomas bekam dieses gewisse Funkeln in den Augen, wenn er über das Thema sprach. Als romantischer Gefühlsmensch war er fasziniert von der Folklore seines Landes. Er stellte sie sich gern als Pionier-Ehefrau vor, die sämtliche Entbehrungen ertrug und das heimische Feuer am Brennen hielt, während er in der Welt herumreiste und sich vergnügte.
Diese Vorstellung hatte sie einmal amüsiert. Das war, als sie das Ganze noch für einen Scherz hielt. Aber er hatte recht, wenn er sie daran erinnerte, dass sie seinem großen Plan zugestimmt hatte – sie hatte sogar freudig die Gelegenheit ergriffen, sich auf etwas Neues einzulassen. Der Krieg war lang und grausam und furchtbar entbehrungsreich gewesen; er hatte London stark gezeichnet, und Isabel war erschöpft. Thomas hatte auch recht, als er darauf hinwies, dass das Leben in ihrem großen Haus keineswegs mit einem Pionierleben zu vergleichen war. Immerhin hatte sie ein Telefon, elektrisches Licht und ein Schloss an jeder Tür. Was allerdings nicht bedeutete, dass es nicht manchmal einsam und sehr dunkel wurde, nachdem die Kinder zu Bett gegangen waren. Sogar das Lesen, lange Zeit eine Quelle des Trostes, fühlte sich inzwischen wie eine ziemlich einsame Tätigkeit an.
Ohne die Leiter loszulassen, drehte sich Isabel um. Hing die Girlande hoch genug, um den Tisch darunterstellen zu können? Es genau richtig hinzubekommen, war schwieriger, als sie es sich vorgestellt hatte. Bei Henrik sah es immer so leicht aus. Sie hätte ihn bitten können – oder sollen –, ihr diese Aufgabe abzunehmen, bevor er am Vortag seine Arbeit beendet hatte. Es war kein Regen angesagt; die Fähnchen hätten über Nacht hängen bleiben können. Aber das ging nicht. Die Dinge hatten sich verändert zwischen ihnen, seit sie ihn an jenem Nachmittag im Büro angetroffen hatte, als er noch arbeitete, während Thomas in Sydney war. Sie fand es jetzt peinlich, ihn um niedere Arbeiten im Haus zu bitten, fühlte sich dann verlegen und bloßgestellt.
Sie musste es ganz einfach selbst machen. Der Wind hatte jedoch zugenommen. Sie hatte den Rasen auf der Westseite ausgewählt, bevor er aufkam, und vergessen, dass dies die weniger geschützte Seite des Gartens war. Aber Isabel hatte einen Hang zur Sturheit, schon ihr ganzes Leben lang. Eine weise Freundin hatte ihr einmal gesagt, dass sich die Menschen im Laufe ihres Lebens nicht änderten, sie wurden nur älter und trauriger. Gegen Ersteres, so hatte sie sich gedacht, konnte sie nicht viel ausrichten, aber Isabel nahm sich fest vor, Letzteres nicht zuzulassen. Zum Glück war sie von Natur aus ein sehr positiver Mensch.
Die windigen Tage brachten allerdings Unruhe mit sich, zumindest in letzter Zeit. Sie war sich sicher, dass sie diese Unruhe im Bauch nicht von jeher gespürt hatte. Früher, in einem anderen Leben, war sie dafür bekannt gewesen, über Nerven aus Stahl zu verfügen. Jetzt konnte es jederzeit passieren, dass sie aus dem Nichts heraus von einer plötzlichen Welle der Nervosität erfasst wurde. Sie hatte das Gefühl, allein auf der Oberfläche des Lebens zu stehen, die sich so zerbrechlich anfühlte wie Glas. Atmen half. Ob sie wohl eine Tinktur oder einen Tee brauchte? Etwas, das ihre Gedanken beruhigte, damit sie wenigstens einschlafen konnte. Sie hatte sogar an einen Arzt gedacht, aber nicht an Maud McKendrys Mann auf der Hauptstraße. Gott bewahre.
Wie auch immer sie es angehen würde, Isabel würde alles in Ordnung bringen. Das war der andere Neujahrsvorsatz, den sie gefasst hatte, doch sie hatte ihn für sich behalten. Sie gab sich ein weiteres Jahr, um ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen. Die Menschen verließen sich auf sie, und es war höchste Zeit.
An ihrem nächsten Geburtstag würde sie achtunddreißig Jahre alt werden. Praktisch vierzig! Weder ihr Vater noch ihre Mutter hatten dieses Alter erreicht. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie in letzter Zeit von Erinnerungen an ihre Kindheit überwältigt wurde. War nun der Moment gekommen, zurückzublicken und den weiten Ozean der Zeit mit Klarheit zu betrachten? Sie konnte sich kaum daran erinnern, dieses Meer überquert zu haben.
Es war lächerlich, sich einsam zu fühlen. Seit vierzehn Jahren lebte sie in diesem Haus. Sie war von mehr Familie umgeben, als sie je gehabt hatte – selbst wenn sie es versuchte, konnte sie den Kindern weiß Gott nicht entkommen. Und doch gab es Zeiten, in denen sie sich vor ihrer eigenen Verlassenheit fürchtete, vor dem nagenden Gefühl, etwas verloren zu haben, das sie nicht benennen und deshalb auch nicht finden konnte, sosehr sie darauf hoffte.
Unten, in der Kurve der Auffahrt, bewegte sich etwas. Sie kniff ein wenig die Augen zusammen, um es besser erkennen zu können. Ja, da kam tatsächlich jemand. Ein Fremder? Ein Bushranger, der auf seinem Pferd die Einfahrt hinauffegte, wie aus einem Gedicht von Banjo Paterson?
Es war der Postbote, das wurde ihr klar, als sie das braun eingewickelte Paket entdeckte, das er vor sich hertrug. Am Neujahrstag! Das Leben auf dem Lande, wo jeder jeden kannte, bot einige Vorzüge, zum Beispiel den Service außerhalb der üblichen Zeiten. Doch so etwas hatte sie noch nie erlebt. Sie verspürte ein aufgeregtes Kribbeln, und ihre Finger stellten sich plötzlich ungeschickt an, als sie versuchte, die Girlande festzubinden, damit sie rechtzeitig unten war, um die Lieferung abzufangen. Sie hoffte, dass es die Bestellung war, die sie vor einigen Wochen aufgegeben hatte. Ihre Befreiung! Sie hatte nicht erwartet, dass sie so bald eintreffen würde.
Aber es war zum Verrücktwerden. Die Schnur hatte sich verheddert, und der Wind schlug sie um die Fähnchen herum. Isabel mühte sich ab, fluchte leise vor sich hin und schaute immer wieder über ihre Schulter, um den Weg des Postboten zu verfolgen.
Sie wollte nicht, dass ihr Paket zum Haus geliefert wurde.
Als er die letzte Kurve der Auffahrt erreichte, wusste Isabel, dass sie die Schnur loslassen musste, um rechtzeitig unten anzukommen. Sie zögerte einen kurzen Moment, dann rief sie: »Hallo!«, und winkte ihm zu. »Ich bin hier drüben.«
Er schaute überrascht auf, und als ein weiterer Windstoß sie dazu zwang, sich an der Leiter festzuklammern, erkannte Isabel, dass sie sich geirrt hatte. Der Mann trug zwar ein Paket, aber der Fremde in der Einfahrt war nicht der Postbote.
Heiligabend 1959
Wenn man ihn später danach fragte – wie so oft im Laufe seines wahrlich langen Lebens –, sagte Percy Summers wahrheitsgemäß, er habe gedacht, sie schliefen. Es war ein heißer Tag gewesen. Den ganzen Dezember über war die Hitze von Westen her eingedrungen, hatte das Zentrum der Wüste durchquert und war dann nach Süden weitergezogen; dort hatte sie sich gesammelt, hing unbeeindruckt über ihnen und weigerte sich zu verschwinden. Jeden Abend hörten sie den Wetterbericht im Radio und warteten auf die Nachricht, dass die Hitze endlich nachließe, aber sie hofften vergebens auf Erleichterung. An den langen Nachmittagen standen sie am Zaun zum Nachbarn und blinzelten im goldenen Licht, während die schimmernde Sonne jenseits des Stadtrandes mit dem Horizont verschmolz. Sie schüttelten den Kopf und beklagten die Hitze, diese verdammte Hitze, und fragten sich gegenseitig, wann sie wohl endlich aufhören würde, doch niemand erwartete eine Antwort.
Währenddessen standen die blauen Eukalyptusbäume hoch und anmutig auf den Hügeln, die das Flusstal umgaben, schweigend und mit metallisch schimmernden, ledrigen Blättern. Sie waren alt und hatten schon viel gesehen. Sie waren schon vor den Häusern aus Stein, Holz und Eisen da gewesen, vor den Straßen, Autos und Zäunen, vor den langen Reihen von Reben und Apfelbäumen und vor dem Vieh auf den Koppeln. Die Eukalyptusbäume waren zuerst da gewesen und hatten der glühenden Hitze des Sommers und der kalten Nässe des Winters getrotzt. Dies war ein uralter Ort, ein Land der gewaltigen Extreme.
Auch wenn man die üblichen Maßstäbe anlegte, war der Sommer 1959 außergewöhnlich heiß. Die Temperaturrekorde fielen, und die Menschen in Tambilla spürten das in jeder Hinsicht. Percys Frau Meg hatte sich angewöhnt, noch vor dem Morgengrauen aufzustehen, um die Milchlieferung des Tages in den Laden zu bringen, bevor sie verderben konnte; Jimmy Riley sagte, dass selbst seine Tanten und Onkel sich an eine solche Trockenheit nicht erinnern konnten; und in allen Köpfen war die Brandgefahr präsent, vor allem, weil die Erinnerungen an 1955 noch so frisch waren.
»Schwarzer Sonntag« hatten die Zeitungen diesen Tag getauft. Es waren die schlimmsten Brände seit Bestehen der Kolonie gewesen. Am zweiten Januar vor vier Jahren hatten alle schon bei Tagesanbruch das Gefühl, dass sich eine Katastrophe zusammenbraute. Über Nacht war ein Staubsturm aufgezogen, der von den trockenen Ebenen im Norden kam und Windböen von hundert Stundenkilometern mit sich brachte. Die Bäume bogen sich, und ihre Blätter sausten durch die Schluchten. Wellblechplatten wurden von den Dächern der landwirtschaftlichen Gebäude gerissen. Stromleitungen brachen und entfachten zahlreiche Brände, die immer weiter wüteten und anwuchsen und sich schließlich zu einer großen, hungrigen Feuerwand vereinigten.
Stunde um Stunde kämpften die Einwohner gegen das Feuer, mit nassen Säcken, Schaufeln und allem, was sie finden konnten, bis es am Abend wie durch ein Wunder zu regnen begann und der Wind die Richtung änderte – aber erst, nachdem etwa vierzig Häuser zerstört worden und zwei bedauernswerte Menschen ums Leben gekommen waren. Seitdem hatten sie eine richtige Feuerwehr gefordert, aber die Entscheidungsträger in der Stadt zögerten zu lange; in diesem Jahr hatte die Freiwillige Feuerwehr angesichts der beängstigend ähnlichen Wetterbedingungen die Sache selbst in die Hand genommen.
Jimmy Riley, der als Fährtenleser für einige der Farmer in den Hills arbeitete, hatte schon seit Langem von einer Brandrodung gesprochen. Seit Tausenden von Jahren, so sagte er, hätten seine Vorfahren in der kühleren Jahreszeit regelmäßig kontrollierte Brände durchgeführt, um die Brandlast zu reduzieren. Auf diese Weise blieb nicht mehr genug übrig, um ein Feuer zu entfachen, wenn die Erde glühte, die Nordwestwinde heulten und der geringste Funke genügte. Percy hatte den Eindruck, dass Männern wie Jimmy Riley, die dieses Land bis in den letzten Winkel kannten, zu wenig Gehör geschenkt wurde.
Der letzte Anruf war in der Woche zuvor von Angus McNamara aus der Nähe von Meadows gekommen. Die milden, feuchten Jahre seit 1955 hatten zu üppigem Wachstum geführt, und der Wald von Kuitpo war dicht belaubt. Ein verirrter Blitz, ein fallen gelassenes Streichholz, und alles würde brennen wie Zunder. Sie hatten die ganze Woche über gearbeitet und waren rechtzeitig vor Weihnachten mit dem Fällen fertig geworden. Gut so: Für das Wochenende hatte der Wetterbericht zwar Sturm vorhergesagt, aber es bestand durchaus die Möglichkeit, dass der Regen an ihnen vorbeizog und sie stattdessen nur ein Trockengewitter abbekamen. Meg hatte sich vor Begeisterung nicht gerade überschlagen, als Percy ihr sagte, dass er während der arbeitsreichsten Zeit des Jahres nicht im Laden sein würde, aber sie wusste, dass es getan werden musste und dass Percy sich nicht drücken würde. Ihre Jungs waren zu Percys Stellvertretern ernannt worden, und Meg hatte ihm widerwillig beigepflichtet, dass die beiden ruhig ein wenig Verantwortung übernehmen konnten. Percy hatte ihnen den Ford Utility überlassen und war auf Blaze nach Meadows geritten.
Um ehrlich zu sein: Percy zog es vor, zu Pferd zu reisen. Er hatte es damals gehasst, den Utility während des Krieges einzumotten, aber Benzin konnte man weder für Geld noch für Liebe bekommen – das bisschen, das es noch gab, war von der Armee und anderen wichtigen Institutionen beschlagnahmt worden. Doch bis man wieder Treibstoff bekommen konnte, hatte er es sich abgewöhnt, mit dem Auto zu fahren. Den Utility hatten sie für größere Lieferungen behalten, aber wann immer er konnte, sattelte Percy Blaze auf. Sie war jetzt ein altes Mädchen, nicht mehr das wilde Fohlen, das sie 1941 gekauft hatten, aber sie liebte es immer noch zu galoppieren.
Das McNamara-Anwesen war ein großer Rinderhof in der Nähe von Meadows, den die meisten Leute einfach »die Farm« nannten. Darauf stand ein großes, flaches Haus mit einer breiten, umlaufenden Veranda und einem tiefen Vordach aus Eisen, das die Hitze abhielt. Man hatte Percy zum Schlafen einen Platz im Schuppen angeboten, aber er hatte sein Lager lieber unter dem Sternenhimmel aufgeschlagen. In letzter Zeit hatte er nicht oft die Gelegenheit gehabt, im Freien zu übernachten, denn der Laden forderte seine ganze Kraft, und die Jungen wuchsen heran. Sechzehn und vierzehn waren sie jetzt, ihm beide schon über den Kopf gewachsen und mit großen Stiefeln an den Füßen; inzwischen zogen sie es vor, ihre Zeit mit Freunden zu verbringen, anstatt mit dem Vater zelten zu gehen. Percy gönnte seinen Jungs ihre Unabhängigkeit, aber er vermisste sie. Er hatte die schönsten Erinnerungen daran, wie sie zusammen am Lagerfeuer saßen, einander Geschichten erzählten und sich gegenseitig zum Lachen brachten. Wie sie die Sterne am Nachthimmel zählten und er ihnen beibrachte, frisches Wasser zu finden und ihr eigenes Essen zu fangen.
Zu Weihnachten schenkte er jedem Jungen eine neue Angelrute. Meg hatte ihm Verschwendung vorgeworfen, als er ihr die Geschenke aus der Stadt zu Hause zeigte, aber sie hatte dabei gelächelt. Sie wusste, dass er etwas gesucht hatte, um den schrecklichen Verlust ihres alten Hundes Buddy im Frühjahr erträglicher zu machen. Percy hatte die Kosten gerechtfertigt, indem er sie daran erinnerte, dass sich vor allem Marcus zu einem guten Angler entwickelt hatte; es wäre sicherlich kein Unglück, wenn er es zu seinem Beruf machte. Kurt, der Ältere der beiden, würde nach seinem Schulabschluss auf die Universität gehen. Der Erste in der Familie! Obwohl Percy sich bemühte, nicht zu viel Aufhebens um seine glänzenden Schulzeugnisse zu machen, schon gar nicht vor Marcus, war er unbändig stolz – genau wie Meg. Kurt hatte es geschafft, seine guten Noten zu halten, trotz der Ablenkung durch Matilda Turner in letzter Zeit. Percy wünschte sich nur, seine eigene Mutter wäre noch am Leben und könnte lesen, was Kurts Lehrer über ihn schrieben.
Die Hitze pulsierte im Unterholz, knochentrockene Zweige knackten unter Blazes Hufen. Sie hatten die Farm am Morgen verlassen und waren den ganzen Tag unterwegs gewesen. Percy lenkte das alte Mädchen langsam und gleichmäßig den Weg entlang und hielt sich, wann immer er konnte, im Schatten auf. Vor ihnen lag die Ortsgrenze von Hahndorf; nicht mehr lange, und sie wären zu Hause.
Durch die Wärme des Tages auf dem Rücken und das monotone Summen der unsichtbaren Insekten war Percy schläfrig geworden. Die trockene Sommerluft weckte Erinnerungen an seine Kindheit: wie er in seinem Bett in dem kleinen Hinterzimmer des Hauses lag, das er mit seiner Mutter und seinem Vater teilte, und die Ohren auf die Geräusche von draußen richtete; wie er die Augen schloss, um sich besser in das Leben jenseits des Fensters hineinfühlen zu können.
Percy hatte fast sein ganzes zwölftes Lebensjahr in diesem Bett verbracht. Für einen Jungen, der so gerne im Freien herumtollte, war es nicht leicht gewesen, bettlägerig zu sein. Er konnte seine Freunde draußen auf der Straße hören, wie sie einander etwas zuriefen, wie sie lachten und johlten, während sie Fußball spielten. Er hatte sich danach gesehnt, bei ihnen zu sein, zu spüren, wie das Blut in seinen Beinen pulsierte, wie sein Herz gegen seinen Brustkorb schlug. Stattdessen hatte er gespürt, wie er schrumpfte, wie er immer schwächer wurde und sich langsam auflöste.
Seine Mutter jedoch stammte aus einer Familie, in der die anglikanischen Tugenden hochgehalten wurden, und sah nicht tatenlos dabei zu, wie das Selbstmitleid ihren Sohn zu verschlingen drohte. »Es ist nicht tragisch, dass dein Körper ans Haus gefesselt ist«, hatte sie in ihrer strengen, geradlinigen Art zu ihm gesagt. »Es gibt andere Möglichkeiten zu reisen.«
Sie hatte mit einem Kinderbuch angefangen, in dem es um einen Koala mit Spazierstock ging, um einen Seemann und einen Pinguin und um einen Pudding, der sich auf wundersame Weise jedes Mal neu bildete, nachdem man ihn gegessen hatte. Diese Erfahrung war eine Offenbarung gewesen, denn selbst als Kleinkind hatte man Percy nie vorgelesen. In der Schule hatte er Bücher auf dem Schreibtisch seiner Lehrerin gesehen, sie aber – vielleicht beeinflusst durch seinen Vater – für Objekte der Bestrafung und Mühsal gehalten. Er hatte nicht geahnt, dass sich zwischen den Buchdeckeln ganze Welten verbargen, voller Menschen und Orte, voller Scherze und Humor, die nur darauf warteten, von ihm entdeckt zu werden.
Als Percy die Kindergeschichten so oft gehört hatte, dass er jede einzelne auswendig kannte, wagte er es, seine Mutter um mehr zu bitten. Sie zögerte eine Weile. Zuerst befürchtete er, er hätte eine rote Linie überschritten, hatte Angst, dass die Geschichten sich verflüchtigen würden und er wieder allein mit seinem kaputten Körper wäre. Aber dann hatte seine Mutter vor sich hin gemurmelt: »Ich frage mich …«, und war tief im Wagenschuppen in der hinteren Ecke des Gartens verschwunden, dem Ort, den sein Vater nie betrat.
Ein seltsamer Gedanke, dass er Jane Austen vielleicht nie kennengelernt hätte, wäre er nicht an Kinderlähmung erkrankt. »Mein Lieblingsbuch«, flüsterte seine Mutter, als würde sie ihm ein Geheimnis anvertrauen. »Schon bevor ich deinen Vater kannte.« Sie habe keine Zeit, ihm daraus vorzulesen, sagte sie – »Die ganze Stadt wird verhungern, wenn ich ihnen nicht Milch und Eier verkaufe« –, aber sie hatte ihm das Buch in die Hand gedrückt und ihm stumm und ernst zugenickt. Percy verstand. Sie waren jetzt Verschworene.
Percy hatte eine Weile gebraucht, um sich an die Sprache zu gewöhnen, und einige Wörter waren ihm neu, aber er konnte nirgendwo anders hin, und einmal darin eingetaucht, gab es kein Zurück mehr. Stolz und Vorurteil, Verstand und Gefühl, Emma: Anfangs schienen sie eine Welt zu beschreiben, die seiner eigenen vollkommen unähnlich war, aber je mehr er las, desto mehr erkannte er die Menschen seiner Stadt in Austens Figuren wieder, ihre Selbstgefälligkeit und ihren Ehrgeiz, die Missverständnisse und die verpassten Chancen, die Geheimnisse und den schwelenden Groll. Er hatte mit ihnen gelacht, leise in sein Kopfkissen geweint, wenn sie litten, und sie angefeuert, wenn ihnen endlich ein Licht aufging. Er hatte sie lieb gewonnen, wie ihm klar wurde; irgendwie hatte er sie, obwohl es Fantasiegebilde einer in Raum und Zeit weit entfernten Schriftstellerin waren, mit der gleichen tiefen Zuneigung betrachtet, die er seinen Eltern und seinen allerbesten Freunden entgegenbrachte.
Als der kleine Vorrat an Büchern, den seine Mutter in ihrem Geheimfach im Schuppen aufbewahrte, erschöpft war, überredete Percy sie, ihm neue Bücher aus der Wanderbibliothek auszuleihen, jeweils drei auf einmal. Er las mit dem Rücken zur Tür, bereit, den verbotenen Roman unter der Bettdecke zu verstecken, sobald er die Schritte seines Vaters im Flur hörte. Sein Vater kam jeden Abend nach der Arbeit nach oben, um an Percys Bett zu stehen. Er war ein großer, hilfloser Mann, der mit ohnmächtiger Frustration die Stirn runzelte, wann immer er sich danach erkundigte, ob es Percy besser gehe, und den nutzlosen Beinen seines Sohnes im Stillen wünschte, dass sie wieder gesund würden.
Und vielleicht hatte dieses Wünschen tatsächlich geholfen, denn Percy gehörte zu denjenigen, die Glück hatten. Mit dem Fußball konnte er nicht mehr viel anfangen, und auf dem Cricketfeld lief er zu langsam, aber mithilfe einer Schiene lernte er, seine Beine langsam wieder zu gebrauchen, und in den folgenden Jahren hätte ein unwissender Beobachter kaum vermutet, dass der Junge, der sich als Schiedsrichter opferte, körperlich weniger fit war als die anderen Jungs.
Percy hörte nicht auf zu lesen, aber er machte auch kein Aufhebens darum. Romane, Sachbücher und, als er älter wurde und seine wechselhaften Gefühle ihn selbst verwirrten, auch Gedichte. Er verschlang Emily Dickinson, staunte über Wordsworth und fand in Keats einen Freund. Wie war es möglich, fragte er sich, dass T. S. Eliot, ein Mann, der in Amerika geboren war und in London lebte – der geschichtsträchtigen Stadt des englischen Nationalcharakters, eine Stadt, die Percy fremd war, in jeder Ecke Geheimnisse und Gebäude aus grauem Stein –, direkt in Percys Herz blicken und dort so deutlich seine Überlegungen über Zeit und Erinnerung sehen konnte, darüber, was es bedeutete, ein Mensch in der Welt zu sein?
Diese Gedanken behielt er für sich. Nicht, weil er sein Geheimnis irgendwie anrüchig fand, sondern weil er bereits wusste, dass die anderen Jungen in Tambilla seine Interessen nicht teilten. Sogar Meg hatte ihn merkwürdig angesehen, als er es beim Flirten gewagt hatte, sie nach ihrem Lieblingsbuch zu fragen. Sie hatte etwas gezögert, bevor sie antwortete: »Die Bibel natürlich.« Damals hatte er ihre Antwort für Frömmigkeit gehalten – was ihn verwunderte und auch überraschte angesichts einiger anderer Dinge, die sie zueinander gesagt hatten. Später jedoch, als sie schon ein oder zwei Jahre verheiratet waren, hatte er die Sache noch einmal angesprochen. Sie hatte verwirrt dreingeschaut, bevor sie in Gelächter ausbrach. »Ich dachte, du wolltest meine Tugendhaftigkeit prüfen«, hatte sie erwidert. »Ich wollte dich einfach nicht enttäuschen.«
Blaze war schweißnass. Percy hielt an der Tränke in der Hauptstraße von Hahndorf an, damit sie trinken und sich ausruhen konnte. Er stieg aus dem Sattel und band die Zügel des Pferdes an einen Pfosten.
Es war nach drei Uhr, und die Straße lag im Schatten, dank der riesigen Kastanien, Ulmen und Platanen, die man vor mehr als einem halben Jahrhundert gepflanzt hatte. Es waren Hunderte, die beide Seiten der Straße säumten. Einige der Geschäfte hatten noch geöffnet, und Percy fühlte sich vom Schaufenster einer nahe gelegenen Drechslerwerkstatt angezogen, in dem ein paar Regale mit handgefertigten Gegenständen aufgestellt waren: Schüsseln und Haushaltsgegenstände und auch einige dekorative Schnitzereien.
Percy ging hinein. »Da ist ein kleiner Vogel, ein Staffelschwanz, im Fenster«, sagte er zu der jungen Frau hinter dem Tresen. Der Klang seiner eigenen Stimme überraschte ihn; es war das erste Mal, dass er an jenem Tag mit einem anderen Menschen sprach. »Darf ich den mal näher sehen?«
Die Frau ging zum Schaufenster und holte die Miniaturfigur heraus.
Percy staunte, als er sie in der Hand hin und her drehte. Er hielt den kleinen Vogel ins Licht und bewunderte seinen zarten Hals, den kecken Schwung seiner Schwanzfedern. Die Ähnlichkeit war bemerkenswert.
»Soll es ein Geschenk sein?«, fragte die junge Frau.
Mit einem Nicken stellte er die Figur zurück auf den Tresen. »Sie sammelt solche Figuren.«
Die Verkäuferin bot ihm an, den Vogel einzupacken. Sie hatte einen Bogen Weihnachtspapier und ein Stück feines Silberband im Hinterzimmer, wo sie gerade ihre eigenen Geschenke vorbereitete, wie sie erzählte. Es traf sich gut, den Rest nun hierfür zu verbrauchen. »Morgen haben wir keine Verwendung mehr für die Sachen, nicht wahr?«
Nachdem er bezahlt hatte, steckte Percy das kleine, hübsch eingepackte Geschenk in die Tasche und wünschte der jungen Frau ein frohes Weihnachtsfest.
»Ihnen auch, Mr. Summers«, sagte sie. »Und grüßen Sie Mrs. Summers von mir.« Er musste überrascht ausgesehen haben, denn sie lachte. »Wir sind zusammen im Landfrauenbund. Mrs. Summers wird den kleinen Staffelschwanz lieben. Sie hat mir einmal erzählt, dass sie eine besondere Vorliebe für Vögel hat, schon seit ihrer Kindheit.«
Percy konnte sich nicht daran erinnern, wann er Meg zum ersten Mal getroffen hatte; es fühlte sich an, als wäre sie schon immer da gewesen. Lange Zeit war sie nur eines von vielen Kindern in seiner Clique gewesen. Nach dem Regen trafen sie sich auf den staubigen Koppeln oder am Ufer des Flusses, um etwas zu treiben, was als Sport durchgehen konnte. Sie war ein schmutziges kleines Ding gewesen, aber danach hatte er sie nicht beurteilt. Sie waren alle Landkinder, die keinen Sinn fürs Herausputzen hatten, es sei denn, für die sonntäglichen Kirchgänge, und selbst dann nur unter Androhung einer Tracht Prügel durch ihre Mütter.
Aber er war ihr eines Tages begegnet, als er an der stillgelegten Kupfermine vorbeikam, nicht weit entfernt von der Stelle, an der die Züge von Balhannah nach Mount Pleasant durchfuhren. Dorthin ging er, wenn er den gut gemeinten Bemühungen seines Vaters entgehen wollte, ihn »abzuhärten«. Sie saß auf der Fensterbank des alten Steinbrecherhauses, auf ihrem erhitzten Gesicht vermischten sich Tränen mit Rotz und Schmutz. Damals hatte er sich gefragt, wie um alles in der Welt es dieses kleine Mädchen da hinaufgeschafft hatte. Erst später, als er sie besser kennenlernte, merkte er, dass sich hinter ihrem engelsgleichen Gesicht ein knallharter Kampfgeist verbarg.
Percy hatte sie gefragt, was los sei, aber sie hatte sich zunächst geweigert, ihm zu antworten. Er hatte sie nicht gedrängt, sondern war einfach weitergegangen, hatte eine Weile im Schatten des großen runden Schornsteins gelesen, war dann ein bisschen herumgelaufen und hatte im überwucherten Gras nach flachen Steinen gesucht, um sie über den Stausee springen zu lassen. Er spürte, dass sie ihn beobachtete, aber er machte keine weiteren Annäherungsversuche. Anscheinend sah seine Beschäftigung ganz unterhaltsam aus, denn ohne ein Wort tauchte sie plötzlich an seiner Seite auf und begann, nach ihren eigenen Flitschsteinen zu suchen.
Sie verharrten in kameradschaftlichem Schweigen, das nur gelegentlich unterbrochen wurde, wenn er einem Stein, den sie über die Wasseroberfläche hatte springen lassen, anerkennend hinterherpfiff. Zur Mittagszeit teilte er sein Sandwich mit ihr. Auch während des Essens redeten sie nicht, außer wenn er einen interessanten Vogel entdeckte.
»Ein Götzenliest«, sagte er und deutete auf den Vogel mit der kräftigen, aufgeblähten Brust im untersten Ast einer nahe gelegenen Eiche.
»Falsch. Das ist ein Kookaburra.«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist dieselbe Familie, aber die Federn dieses Weibchens sind eher türkisfarben. Wenn sie eine Eidechse oder einen Käfer entdeckt, fliegt sie auf, und dann siehst du, wie sie in der Sonne glitzern.«
»Und was ist das für einer?«
»Ein Glanzlappenschnäpper.«
»Und das Vögelchen da drüben?«
Percy entdeckte das schwarz-weiße Weibchen mit dem strahlend gelben Schnabel. »Ein Weißstirn-Schwatzvogel. Der Name passt, oder? Sie hört nicht auf zu rufen.«
»Und was ist mit dem da?« Das Mädchen zeigte auf einen kleinen Vogel mit leuchtend blauer Brust und langen, geraden Schwanzfedern, die in den Himmel ragten.
»Das ist ein Staffelschwanz, sogar ein Prachtstaffelschwanz, um genau zu sein.«
»So eine Hübsche.«
»Das ist ein Männchen.«
»Woran kannst du das denn erkennen?«
»Die männlichen Vögel sind prächtiger. Das Weibchen ist braun und hat nur ein winziges Fleckchen Grün am Schwanz.«
»So wie die da drüben?«
Percy musste sich anstrengen, um zu erkennen, worauf sie zeigte. »Ja, genau.«
»Du weißt ganz schön viel.«
»So einiges«, stimmte er zu.
Als es Zeit war, nach Hause zu gehen, fragte er Meg, ob sie mit ihm kommen wolle. Er könne sie in die Stadt mitnehmen, sagte er. Es wurde dunkel, und er konnte riechen, dass Regen im Anzug war. Sie zögerte einen Moment, bevor sie ihm gestand, dass sie gar nicht heimwollte. Sie sei von zu Hause weggelaufen, und deswegen sei sie jetzt hier draußen.
Percy fiel erneut auf, wie klein sie war. Ihr Gesichtsausdruck war trotzig, die Arme hatte sie fest um den Körper geschlungen. Und doch – das spürte er – hoffte sie im Stillen, er würde sie zwingen, mit ihm zurückzukehren. Ihre Verletzlichkeit erfüllte ihn mit einem plötzlichen Gefühl von tiefer Traurigkeit. Und auch mit Wut. Alle im Ort wussten, dass ihrem Vater die Hand ausrutschte, wenn er sich aufregte. Er hatte schlimme Dinge im Krieg erlebt, das war alles, was Percys Mutter über ihn sagte. »Aber zeig mir einen Mann, der schöne Dinge im Krieg erlebt hat.«
Percy wusste, was sie meinte. Diese Generation von Männern hatte eins gelernt: Der einzige Weg, die Dinge zu vergessen, die sie gesehen und getan hatten, bestand darin, sich zu besaufen und ihre Albträume an den Daheimgebliebenen auszulassen. Percy hatte mehr Glück als die meisten anderen. Sein Vater war zwar streng, aber nicht gewalttätig. Gewalt hätte nämlich eine gewisse Nähe erfordert, und dafür war er viel zu distanziert.
Die ersten dicken Regentropfen fielen. »Na gut«, sagte Percy. »Aber es wird heute Nacht kalt werden hier draußen.«
»Ich habe eine Decke.«
»Das ist schlau. Und ich nehme an, du hast auch was zum Abendessen?«
»Ich habe ein bisschen Brot dabei.«
Er verstaute sein Buch wieder in seinem Rucksack. »Klingt, als hättest du an alles gedacht.« Er überprüfte Princes Sattel und zog vorsichtig an den Steigbügeln. »Sie haben aber im Radio gesagt, dass es heute Nacht stürmen soll. Und Brot ist in einer kalten, nassen Nacht nicht viel wert.«
Eine Wolke der Unsicherheit zog über ihre Stirn.
»Weißt du …«, fuhr er fort. »Meine Mutter hatte einen Eintopf auf dem Herd, als ich heute Morgen aufbrach. Sie lässt ihn den ganzen Tag lang köcheln, genau wie meine Nana früher, und sie macht immer zu viel davon.«
»Was für einen Eintopf?«
»Liverpooler Lammeintopf.«
Das Mädchen wippte von einem Fuß auf den anderen. Ihr Haar war jetzt ziemlich nass, und ihre Zöpfe hingen ihr wie zwei schlaffe Seile über die Schultern.
»Möchtest du vielleicht mitkommen und ein oder zwei Teller davon essen? Ich kann dich danach wieder hierherbringen.«
Sie hatte es nicht bei zwei Tellern belassen, sondern drei gegessen, während Percys Mutter mit stiller Freude zusah. Susan Summers nahm die Pflichten der christlichen Nächstenliebe sehr ernst, und wenn in einer stürmischen, nassen Winternacht ein heimatloses Kind vor ihrer Tür stand, musste sie die Gelegenheit nutzen. Sie hatte darauf bestanden, das Mädchen zu baden, und nachdem der Eintopf serviert und das Geschirr abgeräumt worden war, bettete sie Meg auf das Liegesofa neben dem knisternden Feuer, wo sie sofort in einen tiefen Schlaf fiel.
»Armes kleines Ding«, sagte Percys Mutter und betrachtete das Kind über ihre Lesebrille hinweg. »Wenn man sich vorstellt, dass sie die Nacht ganz allein dort draußen verbringen wollte …«
»Wirst du ihren Eltern sagen, wo sie ist?«
»Das muss ich«, erwiderte sie mit einem energischen, aber besorgten Seufzer. »Aber bevor sie wieder geht, sagen wir ihr, dass sie hier immer willkommen ist.«
Danach hatte Percy beschlossen, sich um Meg zu kümmern, und er brauchte nie lange nach ihr zu suchen. Mit der Zeit verbrachte sie immer mehr Nachmittage im Laden und unterhielt sich dabei mit Percys Mutter, und ehe er sichs versah, arbeitete sie an den Wochenenden hinter dem Tresen.
»Die Tochter, die ich nie hatte«, pflegte seine Mutter zu sagen. Oft lächelte sie Meg liebevoll an, während sie die Rechnungen der Kunden erstellte und sich um die Nachbestellungen kümmerte. »Freundlich und tüchtig und auch recht hübsch anzusehen.« Später, als Meg vom Kind zur Frau heranwuchs, sagte sie: »Eines Tages wird sie eine sehr gute Ehefrau abgeben.« Noch deutlicher wurde sie, als ihr Blick auf Percys steifes Bein fiel: »Ein Mann mit begrenzten Möglichkeiten könnte sich glücklich schätzen, ein solches Mädchen zu heiraten.«
Hahndorf lag nun hinter ihnen, und sie kamen in das vertraute Gebiet mit seinen sanften Hügeln, die sich zum Mount Lofty hin auftürmten. Endlose Reihen von belaubten Reben badeten in der späten Nachmittagssonne, und die warme Luft trug den schwachen Lavendelduft von Kretschmers Blumenfarm herüber.
Blaze beschleunigte ihr Tempo, als sie sich der Onkaparinga Valley Road näherten. Apfelplantagen wichen Olivenhainen, und als sie die Balhannah-Brücke überquerten, schüttelte sie ihre Mähne und zog sanft in Richtung Wasser. Percy nahm die Zügel fester in die Hand und drückte eine Handfläche gegen den Hals des Pferdes. »Schon verstanden, altes Mädchen.«
Meg würde eine Menge für ihn zu tun haben, wenn er zurückkam. An Heiligabend bekamen sie immer Bestellungen in letzter Minute, und die Teilnahme an Reverend Lawsons 18:30-Uhr-Gottesdienst war nicht verhandelbar. Aber es waren bereits zehn Stunden vergangen, seit sie von der Farm aufgebrochen waren, mit nur ein paar kurzen Pausen dazwischen. Sosehr er sich auch darauf freute, nach Hause zu kommen, erschien es ihm dennoch nicht richtig, Blaze ein kurzes Bad vorzuenthalten.
Er ritt weiter nach Westen in die Nachmittagssonne hinein, aber am Stadtrand von Tambilla trieb er Blaze weg von der Straße und eine steile Grasrinne hinunter. Der Bach war hier schmal, ein Nebenfluss des Onkaparinga River, der in den Ausläufern des Mount Lofty entsprang und sich durch das Tal schlängelte. Blaze ging freudig auf das Wasser zu und schnupperte flussabwärts am Schilf. Sie erreichte die Lücke, an der sich der Drahtzaun von seinem Pfosten gelöst hatte, und Percy zögerte kurz, bevor er ihr einen kleinen zustimmenden Stups gab. Er befand sich jetzt auf dem Land der Turners, aber das Haus selbst lag noch ein Stück entfernt.
Aus genau dieser Richtung hatte er sich dem Haus genähert, als er es zum ersten Mal gesehen hatte. Seltsam, er hatte seit Jahren nicht mehr an diesen Tag zurückgedacht. Er war dreizehn gewesen und auf dem Weg zurück zum Laden, nachdem er eine Bestellung ausgeliefert hatte. Die Kinderlähmung mochte seine Schnelligkeit auf dem Cricketfeld beeinträchtigt haben, aber auf Prince, dem Pferd seines Vaters, unterschied er sich nicht von allen anderen. Sein Vater sah es gern, denn alles war besser, als seinen Sohn mit einem Buch in der Hand im Haus vorzufinden. Er ging sogar noch einen Schritt weiter, indem er Percy einen Nachmittagsjob anbot.
Zu Pferd konnte er ganz Hahndorf abdecken, bis nach Nairne, und dann zurück nach Balhannah und Verdun. Der ganze Weg bis zum Piccadilly Valley hinaus war etwas anstrengend, aber sein Vater lehnte nie eine Bestellung ab, also lernte Percy einfach, schneller zu reiten. Eigentlich sollte er den direkten Weg nehmen, aber Percy ritt immer querfeldein. Dies hier war sein Platz, diese Hügel waren sein Zuhause, und er liebte sie.
An der Willner Road gab es kaum Häuser, und dort musste er nie etwas ausliefern, aber er machte oft einen Umweg in die Gegend, weil er den Geruch der Akazien so sehr mochte. Die Straße war gesäumt von großen, silbrig-grünen Büschen, die jeden August mit gelben Bommeln aufblühten. Die Saison war zwar schon weit fortgeschritten, aber an jenem Tag, in jenem Jahr gab es sie noch in Hülle und Fülle. Percy hatte tief eingeatmet, die Sonne auf seinem Hemd und den angenehmen, erdigen Duft von Eukalyptus und sonnengewärmten Blumen genossen, und er hatte sich nach vorne auf Princes breiten Rücken gelegt und sich vom Rhythmus der Pferdehufe einlullen lassen wie ein Baby in den Armen seiner Mutter. In dieser Stellung ritt er einige Zeit, bis ein Schrei über ihm seine Aufmerksamkeit erregte.
Er blinzelte hinauf in den weiten, hellen Himmel, wo ein Keilschwanzadlerpaar in den warmen Thermikströmen träge seine Runden zog. Er folgte den Vögeln mit den Augen, bevor er Prince durch die Lücke im Zaun und weiter in Richtung des Adlerpaares lenkte. Die Spitze des Hügels, über dem sie kreisten, war mit dichtem Laub bedeckt. Ob er wohl ihr Nest entdecken konnte? Er hatte gehört, dass in der Nähe des Cudlee Creek Adler gesichtet worden waren, aber er hatte noch nie erlebt, dass sie sich so weit südlich niederließen.
Während Prince tapfer durch die dünnen Eukalyptusbäume bergauf lief, suchte Percy die höchsten Äste ab. Er hielt Ausschau nach einer Plattform aus Stöcken, die mit Blättern bedeckt war. Während er zwischen dem Astgeflecht und dem Himmel hin und her blickte – entschlossen, die Adler nicht aus den Augen zu verlieren –, fiel ihm zunächst gar nicht auf, dass er eine unsichtbare Grenze überschritten hatte: Das Gelände hatte sich verändert. Zuerst bemerkte er es an der Geräuschkulisse. Es kam ihm vor, als hätte sich ein gewölbter Deckel über ihn gesenkt und das Blätterdach wäre plötzlich näher gerückt.
Auch das Blattwerk um ihn herum hatte sich grundlegend verändert, wie er jetzt feststellte. Die Eukalyptusbäume und das lange, vertrocknete Gras waren von anderer Vegetation unterwandert worden, sodass sich silberne Stämme mit dicken, holzigen Eichen, stark gefurchten Ulmen und Zedern abwechselten. Das Gestrüpp stachliger Brombeerbüsche bedeckte den Boden, und blättrige Schlingpflanzen kletterten zwischen den Bäumen empor. Percy musste lange suchen, um eine ausreichend große Lücke zu finden, durch die man den Himmel sehen konnte.
Die Temperatur in dieser schattigen Welt war um einige Grad gesunken. Über ihm zwitscherten Vögel: Graumantel-Brillenvögel und Loris, Schwalben, Honigfresser und Staffelschwänze. Der ganze Ort wimmelte von Leben, aber die Chance, das Adlernest zu entdecken, war gering.
Er wendete Prince, um zurück in die Stadt zu reiten, als ihm ein Licht auffiel. Die Nachmittagssonne war auf etwas jenseits der Bäume gefallen, das wie eine Taschenlampe durch eine Lücke leuchtete. Voller Neugier trieb Percy Prince weiter den dichten Waldhang hinauf. Er fühlte sich wie eine Figur in einem Buch, dachte an Mary Lennox, die ihren geheimen Garten entdeckte.
Die Brombeersträucher waren inzwischen zu dicht, um hindurchreiten zu können, darum stieg Percy ab und ließ Prince im Schatten einer mächtigen Eiche zurück. Er nahm einen dicken Stock und bahnte sich einen Weg durch die verknoteten Ranken. Er war nicht länger ein Junge, dessen Beine ihm nicht immer gehorchten; er war Sir Gawain auf der Suche nach dem Grünen Ritter, Lord Byron auf dem Weg zu einem Duell, Beowulf, der eine Armee gegen Grendel anführte. Er konzentrierte sich so sehr auf seinen Schwertkampf, dass er zunächst nicht bemerkte, dass der Wald aufgehört hatte und er nun auf einer Stelle stand, die früher einmal eine Kiesauffahrt gewesen sein musste.
Das Gebäude, das vor ihm aufragte, war eher ein Schloss als ein Haus. Zwei riesige Stockwerke mit enorm großen rechteckigen Fenstern an jeder Seite und einer kunstvollen Steinbalustrade aus korinthischen Säulen, die um alle vier Seiten des flachen Daches verlief. Er dachte sofort an Pemberley und erwartete schon, Mr. Darcy durch die großen Flügeltüren schreiten zu sehen, die Reitgerte unter den Arm geklemmt, während er die steinernen Stufen hinunterschlenderte, die sich in einem eleganten Schwung zu dem Wendekreis hin verbreiterten, in dem Percy stand.
Nun wusste er, wo er sich befand: Dies war das Haus, das Mr. Wentworth gebaut hatte. Die meisten Leute sagten, es sei eine lächerliche Torheit, ein so großes Steingebäude hier draußen in die Einöde zu stellen. Nur Liebe oder Wahnsinn, behaupteten sie, oder vielleicht eine ordentliche Menge von beidem, konnte einen Mann dazu bringen, ein solches Haus zu planen, geschweige denn zu bauen. Seit den ersten Tagen der Besiedlung von South Australia hatte der wohlhabende Adel Land gekauft, um darauf Landhäuser zu errichten, in denen man den Sommer in einem angenehmeren Klima verbringen konnte. Aber dieses Haus war anders als alles, was Percy bisher gesehen hatte.
Mr. Wentworth hatte die Pläne in London anfertigen lassen, und die Handwerker waren den ganzen Weg aus England herbeigeschafft worden. Die Kosten waren astronomisch – vierzigmal so hoch wie der Preis eines normalen Hauses in South Australia. Stell dir vor, du gibst so viel Geld aus, flüsterten die Leute ungläubig, nur um am Ende allein in einem riesigen Monstrum herumzuspazieren.
Percy fand auch, dass das Haus riesig war – niemand, der Augen im Kopf hatte, konnte das bestreiten –, hielt es aber nicht für ein Monstrum. Ganz im Gegenteil. Es erinnerte ihn an die Illustration auf dem Titelbild seines Lieblingsbuchs.
Von jenem Tag an kam er an diesen Ort zurück, sooft er konnte. Seinen Freunden erzählte er nichts von dem Haus. Jedenfalls nicht gleich. Immer, wenn er daran dachte, überkam ihn ein seltsames, besitzergreifendes Gefühl. Das Haus hatte sich dafür entschieden, sich ihm zu offenbaren. Aber die Tatsache, der alleinige Hüter eines so großen Geheimnisses zu sein, wurde ihm bald zu einer Last. Er wollte nicht länger allein sein, und sein Wissen brannte ihm so sehr unter den Nägeln, dass er schließlich schwach wurde. Als er seinen Freunden alles erzählt hatte, bereute er es im selben Moment. Sie wollten sofort zu dem Haus laufen, wollten es mit eigenen Augen sehen, sogar hineingehen. Als sie ein Fenster einschlugen, um sich Zutritt zu verschaffen, spürte Percy die Bruchstelle wie eine Wunde.
Ein- oder zweimal war er seinen Freunden ins Haus gefolgt. Die meisten der Möbel, die Wentworth aus England hatte kommen lassen, standen noch da, abgedeckt mit Tüchern. Ein großes Porträt des alten Mannes hing an der Wand über der Treppe. Percy hatte das Gefühl, die Augen des Gemäldes blickten anklagend auf ihn herab, und er hatte sich geschämt. Später, als er die Geschichte von Edward Wentworth erfuhr, wurde ihm klar, warum. Das Haus war der Liebe wegen gebaut worden, aber die junge Frau, der sie galt, war auf der Seereise nach Australien an einem Sonnenstich gestorben. Mr. Wentworth, der am Hafen von Adelaide auf sie gewartet hatte, als die Nachricht eintraf, kam nie darüber hinweg und verriegelte die Türen, um mit seinem Kummer allein zu sein. Das Haus wurde zu einem Schrein für sein gebrochenes Herz.
Irgendwann hatten Percys Freunde genug von dem Ort und zogen weiter zu neuen Abenteuern. Auch Percy hatte bald andere Interessen: Er heiratete Meg, sie übernahmen den Laden, und dann begann der Krieg. Schließlich kam ihm zu Ohren, dass ein Mann aus Sydney das Haus gekauft hatte. Er hieß Turner, und als der Krieg zu Ende war, sprach es sich in der Stadt herum, dass er und seine englische Frau im Frühjahr einziehen würden.
Inzwischen waren vierzehn Jahre vergangen. Seitdem hatte sich viel verändert an jenem Ort. Das Land war gerodet worden, und die Reste von Wentworths Garten waren in der Wildnis entdeckt und restauriert worden. Man hatte Handwerker aus der Umgebung und von anderswo engagiert und viel Geld ausgegeben (so erzählte man es sich wenigstens), um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen.
Percy hatte schon oft Lebensmittel dorthin geliefert und staunte immer wieder über die Verwandlung, wenn er die anmutigen Kurven der restaurierten Auffahrt hinaufritt. Manchmal, wenn er am westlichsten Punkt des Anstiegs anhielt, um Blaze verschnaufen zu lassen, blickte er durch die streng angelegten Gärten hinauf zum Haus und bewunderte die schwungvollen Flächen des sattgrünen Rasens und die Steinmauern darauf, die Zieräpfel und Chinarosen, und für den Bruchteil einer Sekunde sah er stattdessen – wie durch einen Schleier hindurch – die überwucherte, ursprüngliche Auffahrt, wie sie so lange ausgesehen hatte, bevor die Turners gekommen waren …
An jenem Tag jedoch kam er nicht in die Nähe des Hauses. Blaze hatte keine Lust, den Wentworth Hill hinaufzusteigen, und Percy hatte keine Zeit dafür. Er nahm die Zügel lockerer in die Hand und überließ dem Pferd die Führung. Er wusste genau, wohin Blaze wollte. Das alte Mädchen strebte nach Norden, zu einem Ort, den sie liebte. Dort wurde das mit Weiden gesäumte Ufer breiter, und das Bachbett war tief und bildete ein Wasserloch, das sich perfekt zum Schwimmen eignete.
Das Erste, was ihm merkwürdig vorkam, war die bunte Fahne, die an einem Ast des größten Weidenbaums hing.
Percy brachte Blaze zum Stehen und schirmte mit einer Hand seine Augen vor der Sonne ab. Die Szene rückte in sein Blickfeld. Er erkannte, dass unter dem Baum mehrere Leute auf Decken lagen und Körbe neben sich stehen hatten. Sie machten ein Picknick. Neben der Fahne hing eine Weihnachtskette aus Papier im Baum, die jemand sorgfältig von Ast zu Ast gezogen hatte.
Percy wunderte sich. Mitten im Sommer, um diese Uhrzeit, waren die meisten vernünftigen Menschen im Haus, um der Hitze zu entkommen; er hatte nicht erwartet, hier draußen jemanden anzutreffen. Er streichelte Blazes warmen Hals und überlegte. Percy befand sich auf einem fremden Grundstück. Obwohl er wusste, dass die Eigentümer nichts dagegen hatten – Mrs. Turner selbst hatte ihm erlaubt, die Koppeln zu überqueren, wenn er Bestellungen auslieferte –, wollte er nicht den Eindruck erwecken, ihre Freundlichkeit auszunutzen. Wie jeder Mann in der Stadt war auch er zunächst unsicher gewesen, als Mrs. Turner eintraf. Nur selten zogen neue Leute nach Tambilla, geschweige denn ins Haus der Wentworths, und sie war kultiviert, würdevoll und sehr englisch.
Es wäre wohl das Beste, einfach umzudrehen und wegzureiten. Aber wenn sie aufwachte und ihn wegschleichen sähe – wäre das nicht noch schlimmer? Irgendwie noch belastender?
Später – und er würde in den folgenden Tagen, Wochen und Jahren noch viele Male danach gefragt werden, auch in den kommenden Stunden von den Polizisten bei ihren Verhören – würde er sagen, dass ein sechster Sinn ihm gesagt habe, dass die Dinge nicht ganz so waren, wie sie zu sein schienen. Insgeheim fragte er sich, ob das tatsächlich stimmte. War ihm die Szene wirklich unheimlich vorgekommen, oder hatte er sie nur wegen der folgenden Ereignisse so in Erinnerung?
Mit Sicherheit wusste er nur, dass er Blaze einen sanften Stups gegeben und sich auf den Weg zu Familie Turner unter der Weide gemacht hatte.
Die schlafenden Kinder, so erinnerte er sich, sahen aus wie die Radierungen in der kostbaren Familienbibel seiner Mutter, einst mitgebracht von ihren Großeltern, die aus Liverpool eingewandert waren. Es waren wunderschöne Kinder, auch John, der Junge. Sie hatten blonde Locken, wie sie ihr Vater als Kind gehabt haben musste, und strahlend blaue Augen – mit Ausnahme der ältesten Tochter, Matilda, mit ihrem dunklen Haar und den grünen Augen das Ebenbild ihrer Mutter. Er kannte Matilda oberflächlich. Sie war von Anfang an in Kurts Klasse gewesen, und in letzter Zeit hatten sich die beiden ineinander verguckt. Sie lag im Schatten neben dem Baumstamm, ihr Strohhut neben ihr auf dem Boden. Der warme Wind kräuselte den Saum ihres Rocks. Ihre Füße waren nackt.
Die beiden anderen Kinder ruhten mit ihrer Mutter auf der Decke, sie trugen Turnhosen und hatten sich Handtücher um die Taillen geschlungen, als wollten sie sich abtrocknen. John lag auf dem Rücken, während seine Schwester Evie sich auf der Seite zusammengerollt hatte, den rechten Arm ausgestreckt. Percy erinnerte sich an die vielen Badeausflüge mit seinen Jungs – zu den Bächen und Seen der Hills, aber auch an den Strand, nach Port Willunga und Goolwa und an die anderen Orte, an die sein eigener Vater ihn als Kind zum Fischen und zur Jagd nach Neuseeländischen Herzmuscheln mitgenommen hatte. Er konnte beinahe die glückselige Schläfrigkeit nach dem Schwimmen spüren, die die Sonne auf der nassen Haut auslöste.
Von einem geraden Ast der Weide hing ein altmodischer Flechtkorb herab. Meg hatte ihm erzählt, dass Mrs. Turner endlich entbunden hatte. Vor ein oder zwei Monaten waren sie von der Kirche nach Hause gekommen, und Meg hatte sich vor den Spiegel im Flur gestellt, um ihren Hut abzunehmen und ihr Haar zu richten.
»Hast du gehört, dass Mrs. Turner ihr Baby bekommen hat?«, hatte sie Percy hinterhergerufen, der schon in der Küche stand und den Wasserkocher auffüllte. »Ein winzig kleines Ding mit einem ernsten Gesicht.«
»Ach ja?«, hatte Percy geantwortet.
»Jetzt sind es vier, und besser, es trifft sie als mich«, hatte Meg lachend gesagt. »Eltern müssen zusehen, dass sie zahlenmäßig nicht unterlegen sind. Das ist mein Motto.«
Kurz darauf hatte er Mrs. Turner in der Stadt gesehen. Sie hatte das Baby auf dem Arm getragen, und er hätte sie auf dem Weg aus dem Laden fast umgerannt. Vor Verlegenheit war er rot angelaufen, aber sie hatte ihn angelächelt, ganz so, als mache es ihr nichts aus, von ihm niedergetrampelt zu werden.
Percy hatte einen großen Sack Mehl getragen. Darum konnte er zur Begrüßung seinen Hut nicht lüften. Er musste sich stattdessen mit einem Nicken begnügen. »Guten Tag, Mrs. Turner, wie geht es Ihnen?«
»Mir geht es gut, danke – uns beiden geht es sehr gut.«
Seine Augen waren den ihren gefolgt und hatten das kleine Gesicht in der Decke betrachtet. Ein Paar tintenblaue Augen starrte ihn an. Die blasse Stirn war gerunzelt in jenem Ausdruck vermeintlicher Weisheit, den alle Neugeborenen zeigen und mit ihrem ersten Lächeln wieder ablegen.
»Wie winzig das Baby ist«, staunte er.
»Ja, aber sie wachsen so schnell. Das vergisst man oft.«
Meg gesellte sich zu ihnen, sprach sanft mit dem Baby und entschuldigte sich überschwänglich bei Mrs. Turner. »Mein Percy ist normalerweise nicht vergesslich, aber wenn ihm einmal ein Fehler unterläuft, macht er ihn wieder gut. Ich hoffe, Sie waren mit der Fischpaste zufrieden, die ich Ihnen geschickt habe?«
»Sie war köstlich, Mrs. Summers, wie großzügig von Ihnen. Ich war auf dem Weg zu Ihnen, um sicherzugehen, dass Sie mein Konto mit dem Betrag belasten. Eigentlich wollte ich Sie anrufen, aber ich war in letzter Zeit nicht ganz bei der Sache.«
»Nun, das verstehe ich gut«, gab Meg zurück und strich mit der Fingerspitze über die Wange des Babys. Ihre Abgeklärtheit stand so sehr im Gegensatz zu Percys Unbehagen, dass er sich noch unbeholfener fühlte. »Die Kleinen haben so ihre Art, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, nicht wahr? Was für ein reizendes Baby. Sie ist wirklich hübsch.«
Sie. Percy hatte keine Ahnung gehabt, dass Meg es wusste. Er hatte kurz ihren Gesichtsausdruck studiert, auf der Suche nach Anzeichen von Trauer oder Neid oder irgendetwas anderem. Aber sie lächelte nur das schlummernde Kind an.
Mrs. Turner jetzt dort auf der Decke liegen zu sehen, war Percy so unangenehm, als hätte er sich absichtlich an sie herangeschlichen. Die Szene unter der Weide hatte etwas Intimes, etwas Verletzliches: Hier schlief eine Familie, und auf der Decke zwischen ihnen befanden sich noch die Reste des Mittagessens – Teller und Tassen, Sandwichkrusten und Kuchenkrümel.
Da fiel ihm die Stille auf. Sie wirkte fast unnatürlich.
Er nahm den Hut ab. Im Nachhinein fragte er sich, was genau ihn dazu veranlasst hatte. Er wurde sich des Geräusches seines eigenen Atems bewusst: ein und aus, ein und aus.
Am Handgelenk des jüngeren Mädchens bewegte sich etwas, wie er bemerkte. Vorsichtig trat er einen Schritt näher. Und dann sah er die Ameisenstraße, die quer über ihren Körper, über ihren Arm und weiter zu den Resten des Picknicks führte.
Alles andere war statisch, still. Niemand zuckte im Schlaf. Niemand gähnte und bewegte sich, wenn die Brise die Haut streifte. Keine einzige Brust hob oder senkte sich.
Percy ging hinüber zu Mrs. Turner und kniete sich neben ihren Kopf. Er befeuchtete seinen Finger und hielt ihn an ihre Nase, hoffte, ihr Atem würde ihn kühlen. Dann bemerkte er, dass sein Finger zitterte. Er schaute in die Ferne, als würde ihm das irgendwie helfen, als könnte er sie durch äußerste Konzentration zum Atmen zwingen.
Nichts. Absolut nichts.
Percy wich zurück. Er stolperte über den Essenskorb und zuckte bei dem Geräusch von klapperndem Besteck und Geschirr zusammen. Immer noch rührte sich niemand. Keiner von ihnen bewegte auch nur einen Muskel.
Mit zitternden Händen setzte sich Percy den Hut wieder auf. Er versuchte, seine rasenden Gedanken davon abzuhalten, sich zu überschlagen, miteinander zu kollidieren. Erkenntnis, Schock, Angst – er versuchte, sie alle aus seinem Kopf zu verbannen, damit er sich überlegen konnte, was als Nächstes geschehen sollte.
Blaze war in der Nähe, und ohne einen weiteren Moment zu zögern, ergriff Percy ihre Zügel, schwang sich in den Sattel und trieb sie an, um Hilfe zu holen.
EINS
1
London, 7. Dezember 2018
Wenn Jess wütend oder traurig oder auch nur unerklärlich unruhig war, besuchte sie das Charles-Dickens-Museum in der Doughty Street. Es hatte etwas ungemein Beruhigendes, sich nach einem Rundgang durch die Museumsräume zu einer Kanne englischem Frühstückstee hinzusetzen. Manchmal hörte sie sich den Audioguide an, obwohl sie ihn schon auswendig kannte, einfach nur, weil sie die Stimme des Erzählers mochte.
Sie hatte das Museum während ihrer ersten Monate in London entdeckt. Damals war sie einundzwanzig gewesen, wohnte auf dem Dachboden bei der Verwandten einer Schulfreundin und arbeitete nebenbei in einem heruntergekommenen Pub in der Nähe von King’s Cross. Eines Tages, als sie zu früh zu ihrer Schicht kam, beschloss sie, einen Spaziergang durch die Gegend zu machen. Das war ihre Lieblingsbeschäftigung: spazieren gehen und sich umsehen, staunen, dass sie sich hier befand, an diesem Ort des Kopfsteinpflasters, der Pint-Biergläser und umgebauten Hinterhäuser, der Dichter, Maler und Dramatiker, der großen, trägen, alterslosen Themse.
In ihrer Entdeckerlaune hatte sie sich die Freiheit genommen, am Ende einer Straße willkürlich in eine beliebige Richtung abzubiegen, und so kam es, dass sie die Doughty Street entlanglief, vorbei an einer Reihe gepflegter Backsteinhäuser. Vor der Hausnummer 48 entdeckte sie eine Reklametafel, die das Gebäude als Charles-Dickens-Museum kennzeichnete. Tausende Stunden ihrer Kindheit, die sie mit einem Buch in der Hand im Garten ihrer Großmutter in Sydney verbracht hatte, waren in einem einzigen Augenblick zu ihr zurückgekehrt, und sie hatte eilig die Betontreppe erklommen und die glänzende schwarze Tür aufgestoßen. Die Zeit hatte sich aufgelöst. Der Reiz der neuen Lebenssituation war noch frisch: in England zu sein und festzustellen, dass die Namen und Orte, denen sie in den Romanen begegnet war, wirklich existierten. Jess empfand große Ehrfurcht bei dem Gedanken, dass Dickens höchstpersönlich einmal in diesen Räumen gewohnt, an diesem Tisch gegessen und seinen Wein unten im Keller gelagert hatte.
An jenem Tag war sie zu spät zur Arbeit gekommen und hatte sich eine Abmahnung eingehandelt, der kurz darauf eine zweite folgte, die wiederum zu ihrer Entlassung geführt hatte. Sie hatte jedoch Glück im Unglück gehabt, denn die Arbeitslosigkeit öffnete ihr eine neue Tür. Ihre nächste Stelle bekam sie bei einem kleinen Reiseunternehmen aus Victoria, das sie unter anderem als Redakteurin für seinen Newsletter einstellte. Seitdem hatte sie das Gefühl, sie hätte es Dickens zu verdanken, dass sie einen beruflichen Einstieg als Journalistin fand. Ein wirklich seltsamer, perfekter Zufall.
Ihr jeweils bevorzugter Raum im Museum wechselte häufig, je nach ihrer Stimmung und den Umständen. Zuletzt hatte sie viel Zeit im Arbeitszimmer verbracht. Sie stellte sich gern in die Nähe des Fensters und betrachtete das unvollendete Gemälde von Robert William Buss. Es zeigte Dickens schlafend in seinem alten Holzstuhl, während die Figuren, die er zum Leben erweckt hatte, den Raum um ihn herum ausfüllten. Es machte ihr Spaß, jede einzelne herauszupicken und an die erste Begegnung mit ihr zurückzudenken. Ein ungewöhnliches Aufeinandertreffen: Die Fantasie eines englischen Schriftstellers aus einem früheren Jahrhundert hatte sich mit der Lebenserfahrung eines kleinen Mädchens verwoben, das im fernen Sydney aufwuchs.
An diesem Tag jedoch war Jess beim Betrachten des Gemäldes aufgefallen, dass die Art und Weise, wie die Figuren ihren Autor zu verfolgen schienen, auch etwas Bedrohliches hatte. Sie umgaben ihn, hielten ihn gefangen und gönnten ihm nicht einmal im Schlaf ein wenig Ruhe. Jess kannte diesen Geisteszustand. Genau so war es ihr ergangen, seit sie die Idee