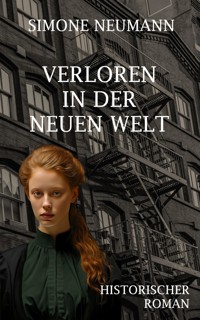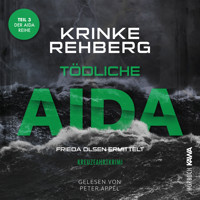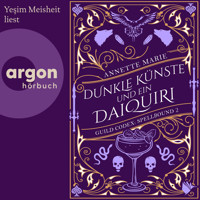Das Geheimnis der Gewürzhändlerin - bisher bekannt unter dem Titel "Das Geheimnis der Magd" E-Book
Simone Neumann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gefangen in einem Netz aus Gier und Intrigen: Der historische Roman »Das Geheimnis der Gewürzhändlerin« von Simone Neumann als eBook bei dotbooks. Das stolze Hameln im Jahre 1529: Johanna ist auf der Flucht – als einzige Zeugin des Mordes an ihrem früheren Dienstherrn hofft die junge Magd, sich in der Stadt an der Weser unerkannt ein neues Leben aufbauen zu können. Zunächst scheint sich tatsächlich alles zum Guten zu wenden, denn Johanna findet eine Anstellung im Haus der reichen Margarethe. Doch den Regenten der Stadt ist das allzu selbstbewusste Auftreten der Gewürzhändlerin schon lange ein Dorn im Auge – sie wollen Margarethe in eine Ehe zwingen, die sie mehr als nur ihr Vermögen und ihre Freiheit kosten könnte. In dieser dunklen Stunde müssen die beiden so unterschiedlichen Frauen lernen, einander zu vertrauen. Aber da gibt es dieses dunkle Geheimnis, das Margarethe hütet – und das mehr mit dem Schrecken zu tun hat, dem Johanna gerade erst entkommen ist, als beide für möglich halten … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der historische Roman »Das Geheimnis der Gewürzhändlerin« von Simone Neumann (vormals bekannt unter dem Titel »Das Geheimnis der Magd«) – spannend wie ein Krimi und so lebensecht geschrieben, dass man sich in die schillernde Epoche der Renaissance versetzt fühlt, in der Kunst und Kultur erblühten, aber auch brutale Machtkämpfe tobten. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Das stolze Hameln im Jahre 1529: Johanna ist auf der Flucht – als einzige Zeugin des Mordes an ihrem früheren Dienstherrn hofft die junge Magd, sich in der Stadt an der Weser unerkannt ein neues Leben aufbauen zu können. Zunächst scheint sich tatsächlich alles zum Guten zu wenden, denn Johanna findet eine Anstellung im Haus der reichen Margarethe. Doch den Regenten der Stadt ist das allzu selbstbewusste Auftreten der Gewürzhändlerin schon lange ein Dorn im Auge – sie wollen Margarethe in eine Ehe zwingen, die sie mehr als nur ihr Vermögen und ihre Freiheit kosten könnte. In dieser dunklen Stunde müssen die beiden so unterschiedlichen Frauen lernen, einander zu vertrauen. Aber da gibt es dieses dunkle Geheimnis, das Margarethe hütet – und das mehr mit dem Schrecken zu tun hat, dem Johanna gerade erst entkommen ist, als beide für möglich halten …
Über die Autorin:
Simone Neumann, geboren 1977 in Höxter, lebt heute in München. Nach ihrem Studium der Geschichte und Slavistik arbeitete sie zunächst bei einem Verlag als Lektorin und machte sich nach der Geburt ihrer Kinder als Redakteurin und Autorin selbstständig.
Bei dotbooks erschienen Simone Neumanns fundiert recherchierten historischen Romane, die sie stets mit einer fesselnden Spannungsnote würzt: »Des Teufels Sanduhr«, »Die Schlüsselträgerin« und »Die Flucht der Gauklerin«.
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Dieses Buch erschien bereits 2012 unter dem Titel »Das Geheimnis der Magd« bei Goldmann; der Titel musste für die eBook-Ausgabe geändert werden, da der Titelschutz zwischenzeitlich erloschen war und anderweitig neu vergeben wurde.
Copyright © der Originalausgabe Copyright © 2012 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung verschiedener Bildmotive von shutterstock/Martina Janina und shutterstock/Kachalkian Veronika sowie des Gemäldes »Bentheim« von Jacob van Ruisdael
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-923-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Geheimnis der Gewürzhändlerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Simone Neumann
Das Geheimnis der Gewürzhändlerin
Roman
dotbooks.
Für Leonard und Matilda
Prolog
In den Tiroler Bergen im Jahr 1505
Reinold Gänslein wusste nicht mehr weiter.
Nach drei Jahren harter Arbeit als Laufbursche in der Fondaco dei Tedeschi, dem Kauf- und Lagerhaus der deutschen Fernhändler in Venedig, hatte er sich zwar zahlreiche wertvolle Kenntnisse angeeignet, aber alles andere verloren. In seiner jetzigen Situation nutzte es ihm wenig, sämtliche Tücken des Gewürzhandels zu kennen und gewieft genug zu sein, um drei verschlagene Zwischenhändler gleichzeitig betrügen zu können. Denn um mit diesem Wissen etwas anfangen zu können, fehlte ihm nicht nur das Kapital – nein, ihm fehlte zum ersten Male in seinem Leben auch die Hoffnung. Er hatte alles in Venedig zurücklassen müssen, alles außer seinem Leben, welches unter diesen Umständen weniger wert schien als je zuvor.
Dabei hatte es so vielversprechend begonnen, als der mittellose Knabe sich vor wenigen Jahren allein und in schlechtem Schuhwerk über die verschneiten Bergpässe aufmachte, um im reichen Norden Italiens sein Glück zu suchen. Er hatte kein Empfehlungsschreiben eines wohlhabenden Oheims in der Tasche gehabt, er sprach kein Wort Italienisch und war nicht in der Lage, auch nur einen Groschen Lehrgeld zu zahlen, aber dennoch hatten Fleiß und Klugheit ausgereicht, um sich bei den deutschen Händlern in Venedig recht bald unentbehrlich zu machen.
Ja, die Zeiten hatten sich geändert, unmerklich für die meisten, wohlbemerkt für einen hellwachen Burschen wie Reinold Gänslein, seines Standes dritter Sohn eines bitterarmen Bauern aus dem Schwäbischen. Wo sich andere aus Tradition in ihr Schicksal fügten, hatte Reinold bald erkannt, dass es in diesem Erdenleben durchaus Möglichkeiten gab, seine Wünsche zu verwirklichen. Es bedurfte allein des Glaubens an die eigene Kraft. Wie sehr doch hatte es ihn fasziniert, als eines Tages ein Geschichtenerzähler in ihrem Dorfe erschienen war und gegen einen kleinen Obolus die wundersame Erzählung von einem Manne preisgab, einem genuesischen Seefahrer namens Kolumbus, der, im festen Glauben, die Erde sei eine Kugel, in Richtung Westen gesegelt war, um das östlich gelegene Indien zu erreichen. Verrückt, mochte man meinen, verwegen, von allen guten Geistern verlassen, aber dennoch – oder gerade deshalb – erfolgreich. Zwar hatte der Abenteurer sein eigentliches Ziel nicht erreicht, dafür jedoch war ihm dank seines Mutes etwas noch viel Größeres gelungen: Er hatte eine gänzlich neue, bis dato unbekannte Welt entdeckt.
Es war also möglich. Das war die Aussage dieser Geschichte gewesen, die den jungen Reinold Gänslein nicht mehr losließ. Und so war er nur wenig traurig gewesen, als er bald zu der Einsicht gezwungen war, dass es auf dem Hofe des Vaters keinen Platz mehr für ihn gab. Reinold hatte nicht etwa gehen müssen, weil der alte Gänslein zu viele gesunde Söhne gezeugt hatte, denen er unmöglich sein weniges Land in gleichen Teilen vererben konnte. Nein, Reinold war einst wegen des Hirtenjungen Sebastian Eberle gegangen.
Und nun hatte er wieder gehen müssen. Doch anders als damals, als er die schwäbische Heimat verließ, wusste er nun nicht, wohin es ihn zog. Wieder hatte er kopflos gehandelt, wieder hatte er sich von der Liebe zu etwas Gefährlichem hinreißen lassen, wieder stand er an einem Scheideweg. Aber dieses Mal führte der Weg ins Verderben. Das ahnte er.
Reinold Gänslein hatte Angst. Er hatte große Angst, Angst vor der Strafe und vor dem Tod, die ihn sehr bald ereilen würden. Sie würden ihn finden, das stand fest. Denn niemand anderes als der Herrgott selbst hatte es derartig schneien lassen, um ihn, den Brandstifter und Mörder, an seiner Flucht durch die Berge zu hindern, ihn in dieser Herberge festzusetzen und schlussendlich der gerechten Bestrafung durch seine Verfolger zuzuführen. Ja, Reinolds Angst war so groß, dass er sich in seiner Verzweiflung am gestrigen Abend zum ersten Male in seinem jungen Leben maßlos betrunken hatte.
Nun hockte er in der Stube des verräucherten Wirtshauses, eines Saumbetriebes, inmitten der Tiroler Alpen. Sein Schädel fühlte sich an wie ein mit brodelndem Brei gefüllter schwerer Klumpen, er wusste nicht, wie weit der Tag schon fortgeschritten war. Jedoch wusste er, dass er gestern im Rausch etwas getan hatte, was er nun bereute.
Er hatte geredet. Zu viel geredet. Und das ausgerechnet mit diesem linkischen Fuchs, einem anderen Gast, von dem heute in der düsteren Stube weit und breit keine Spur mehr zu sehen war.
Reinold rieb sich die Stirn und trank von der ranzigen Buttermilch, welche ihm der schweigsame Wirt mit der wettergegerbten Haut ohne ein Wort vorgesetzt hatte. Seit fünf Tagen war Reinold nun hier und ertrug die mürrische Einsilbigkeit seiner Wirtsleute. Er war der einzige Gast, er und dieser miese Bursche aus dem Norden Deutschlands. Dieser Taugenichts, den der Wirt offenbar noch weniger ausstehen konnte als ihn, den Flüchtling aus Italien.
Man konnte es dem Mann nicht verdenken, denn dieser andere – Peter Hasenstock war sein Name – war tatsächlich ein mehr als unangenehmer Zeitgenosse. Nicht dass er unfreundlich oder gar brutal gewesen wäre. Nein, ganz im Gegenteil, er war durchaus gesprächig und eher schmächtig von Wuchs. Was ihn so unerträglich machte, war die Tatsache, dass er sich für klüger hielt als er war und tatsächlich glaubte, man würde seine Verschlagenheit für Aufrichtigkeit halten können.
Reinold wusste, dass er nichts zu verlieren hatte, dass er längst verloren war, und es reute ihn nicht, mit jemandem über seine Sünden gesprochen zu haben, zumal sich weit und breit kein Priester fand, dem er hätte beichten können. Dennoch hatte ihn gleich heute Morgen, als er mit einem schalen Geschmack im Mund und dem schier zerspringenden Schädel in seiner schäbigen Kammer erwacht war, das ungute Gefühl übermannt, dass er sich in seiner Verzweiflung ausgerechnet dem Teufel zugewandt hatte. Er hoffte inständig, diesem Burschen nie wieder zu begegnen.
Doch diese Hoffnung löste sich nun in Luft auf. Denn soeben wurde ruckartig die Außentüre aufgestoßen, und mit dem Schneegestöber wehte auch die unverkennbare Gestalt des jungen Peter Hasenstock aus dem fernen Hameln in die verrauchte Stube.
Verwirrt wirkte er, trunken gar, und seine Miene verriet Erschöpfung und Seligkeit zugleich.
Offensichtlich war diesem eingebildeten Jüngling am heutigen Tage etwas äußerst Eigentümliches widerfahren, denn als er sich zu Reinold an den Tisch setzte, konnte dieser in Hasenstocks mädchenhaftem Gesicht eine lange blutige Kratzspur erkennen, die von einem wilden Tier stammen musste.
Mit einem Pfiff und einer flüchtigen Handbewegung bestellte er beim Wirt einen ganzen Krug Wein und zwei Becher, welche der missmutige Mann sich ganz und gar nicht herbeizubringen beeilte.
»Du musst mir helfen, mein Freund«, sagte Peter Hasenstock schließlich, noch völlig außer Atem, an Reinold Gänslein gewandt. »Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr?«
»Wie meinst du das?«, fragte Gänslein, nach wie vor benommen von dem Rausch der letzten Nacht.
»Nun, seit gestern weiß ich von dir, und gleich wirst du von mir wissen«, sprach der andere weiter und klopfte seinem Altersgenossen verschwörerisch auf die Schulter. »Es gilt mir einen Gefallen zu erweisen, mein neuer, aber teurer Freund. Verschwiegenheit muss man sich erkaufen. Sei jedoch getrost: Mein Schweigen wird dich nicht viel kosten. Es ist nur ein kleiner Dienst, den du mir erweisen sollst. Ein wenig schmutzig vielleicht, aber dennoch nicht der Rede wert.«
Dann erhob er seine Stimme und rief: »Wirt, wo bleibt der Wein für meinen Freund und mich? Wir wollen einen Pakt besiegeln.«
Kapitel I
Im Herbst des Jahres 1529 auf einem Rittergut in der Nähe der Stadt Hameln
Der Tag hatte begonnen wie jeder andere Tag im Leben der Amme Johanna. Jeder andere Tag in den letzten sechs Monaten, seitdem die Milch in ihrer Brust versiegt war und sie neue Tätigkeiten zugewiesen bekommen hatte. Johanna hätte Gott danken müssen, auf diesem ärmlichen, heruntergekommenen, vor Schmutz starrenden Rittergut als Magd verbleiben zu dürfen, nachdem ihre Dienste als Nähramme des kleinen Heinrich nicht mehr benötigt wurden.
Es gab keinen Ort, an den sie sonst hätte gehen können, die einsame Frau. Dennoch fühlte sie keine Dankbarkeit. Sie verspürte nach wie vor nur Wut und Hass. Hass insbesondere auf sich selbst; darüber, dass sie zuließ, was hier auf diesem Landadelshof mit ihr geschah. Doch von all diesen Gedanken und Gefühlen ließ sie sich nichts anmerken. Sie gehorchte, und sie arbeitete, so wie es ihr gottgewolltes Los zu sein schien.
Und so war sie auch an diesem Herbsttage pflichtbewusst mit dem ersten Hahnenschrei erwacht und aufgestanden, hatte das ihr zugewiesene Kämmerlein verlassen und zusammen mit der alten Magd in der dunklen Küche des uralten, schiefen Fachwerkhauses den Haferschleim zubereitet, der lediglich für die Bediensteten gedacht war. Die Herrschaften nämlich ruhten zu dieser Stunde noch, würden es drei weitere Stunden lang tun, und das war gut so. Denn Johanna war froh, ja geradezu selig, wenn sie nicht damit rechnen musste, ihm zu begegnen.
Er war der eigentliche Grund dafür, dass sie nicht hatte gehen müssen, nachdem der Sohn des Hauses von der Brust entwöhnt worden war. Er sah sich als ihr Gönner, ihr Wohltäter. Sie aber sah ihn nur als den Mörder ihres Gatten und zudem als einen Abscheu erregenden Lüstling, vor dem man zu keiner Stunde des Tages und an keinem Ort sicher war. Fast war Johanna erleichtert, bereits im Morgengrauen eine Gruppe von Reitern auf die Niederadelsburg zukommen zu sehen. Ein Anblick, der versprach, dass er wenigstens am heutigen Tage beschäftigt genug sein würde, um seine schmutzigen Finger von ihr zu lassen.
Johanna hatte, wie an jedem Morgen, vorsichtig die wackeligen Leitern und Stiegen des hölzernen Wachturms erklommen, wohlbedacht, nichts von dem heißen Brei zu verschütten, der für den Wachposten, einen Bauernknaben aus dem nahen Ort, bestimmt war. Der Junge schlief in einer Ecke der zugigen, morschen Aussichtsplattform und erweckte nicht den Eindruck, in dieser Nacht auch nur für einen kurzen Moment dem ihm zugewiesenen Dienst nachgekommen zu sein. Johanna sah es ihm nach und dachte nicht im Traum daran, ihn bei seinem Herrn anzuschwärzen.
Wer auch sollte die Burg, die dieser Bezeichnung selbst in ihren jungen Tagen nicht gerecht geworden war, stürmen? Niemand – außer den Steuereintreibern des Herzogs oder vielleicht wütenden Kaufleuten, welchen der Herr und Ritter mitunter gern in vermummter Gestalt am Wegesrand auflauerte, um sie um ihr Transportgut zu erleichtern. Doch weder die einen noch die anderen hatten sich jemals in der Nähe dieser mit einem faulenden, morastigen Graben und einer verrottenden Holzpalisade umgebenen Wohnstatt der Ritter von Eicheck blicken lassen. Zu unbedeutend war der Herr, zu arm, zu elend, als dass man sich auch nur die Mühe hätte machen wollen, etwa Rache an ihm zu üben oder gar Geld bei ihm einzutreiben.
In letzter Zeit jedoch hatte es durchaus Besuch gegeben. Besuch von seltsamen Männern, aus deren Mitte ein Gesicht Johanna eigentümlich bekannt vorkam. Diese Männer schienen Wilhelm von Eicheck sehr aus der Fassung zu bringen. Er betrug sich ihnen gegenüber schleicherisch, fast ängstlich, und war stets bemüht, ihnen zu gefallen. Einmal hatte Wilhelm in seiner mehr als bescheidenen Behausung für sie auffahren lassen, wie es höchstens der Herzog von Calenberg vermochte. Eigens dazu hatte er sich gewaschen und war in das nahe Hameln aufgebrochen. Dort hatte er bei einem Juden Geld geliehen, um es hernach auf dem Markt der reichen Stadt in allerlei Leckereien zu investieren, welche er von einem Bauern auf einem Ochsengespann dann zu seiner Burg hatte karren lassen. Es war ein großes Schmausen und Saufen gewesen, bei dem auch der eine oder andere köstliche Happen für die Bediensteten abgefallen war. Johanna hatte es mit viel Geschick verstanden, sich an diesem Abend nicht vor den Gästen zeigen zu müssen, sondern in der Küche zu bleiben. Der Gedanke, dem Mann, den sie in einem der Besucher zu erkennen glaubte, unter die Augen zu treten, bereitete ihr Angst. Aber dennoch fühlte sie sich jedes Mal, wenn er zu Besuch war, regelrecht gezwungen, ihn heimlich durch einen Türspalt zu beobachten.
Er hatte sich nur wenig verändert, war zu einem Mann herangereift, zu einem ansehnlichen Mann. Doch der schwelende Zorn und die unendliche Traurigkeit in seinen Augen waren geblieben. Allein das hatte ihn schon damals, in ihren gemeinsamen Kindertagen, unverkennbar gemacht. Er war es, das stand fest. Und Johanna fragte sich seither, was er hier auf der Burg ihres Herrn wollte. Wer seine Begleiter waren. Und ob diese wussten, dass es sich bei ihm ganz und gar nicht um einen Edelmann handelte.
Wie alle ihre Gedanken und Gefühle behielt sie auch diese Fragen für sich, sprach mit niemandem darüber, denn es gab niemanden, dem sie sich hätte anvertrauen oder den sie gar vor diesem ihr wohlbekannten Menschen hätte warnen wollen. Sie hatte ihn wiedererkannt und hoffte nun, dass es ihm mit ihr nicht ebenso ergehen würde. Denn nur zu gut erinnerte sie sich an das, wozu dieser Mensch, dieser Teufel, einst in der Lage gewesen war.
Jetzt waren sie wieder im Anmarsch, die eigentümlichen Gäste des Ritters von Eicheck.
Johanna blickte durch die Schießscharte des Wachturms auf den noch im Morgengrauen liegenden Weg, über welchen sich die Reiter näherten. Es waren tatsächlich dieselben. Drei an der Zahl, und auch er war unter ihnen. Sie erkannte ihn an seiner aufrechten, schlanken Gestalt. Johanna atmete tief durch. Sie war sich nicht sicher, welches für sie das geringere Übel darstellte: die grabschenden Hände ihres Brotgebers oder die Anwesenheit dieses unberechenbaren Hexensohnes.
»Heute wird dem Herrn Ritter sicher nicht langweilig«, flüsterte sie leise zu sich selbst, trat dann von dem Guckloch zurück, weckte den Knaben mit einem leichten Fußtritt auf, reichte ihm die dampfende Holzschüssel und kletterte schnell die Stiege hinunter, um dem Stallknecht Bescheid zu geben, er möge das Tor öffnen, denn der Herr empfange Besuch.
»Stell dich nicht so an.«
Er stank schlimmer als ein Misthaufen und sah auch nicht sehr viel besser aus. Sein krauses Haar und sein wirrer Bart bildeten eine Einheit, aus der nur die dicke, knollige Nase und seine winzigen, verquollenen Sehschlitze hervorblickten. Seine fleischigen Lippen waren geöffnet, er atmete schnell und hüllte Johanna ein in einen Dunst aus verfaulten Zähnen, Zwiebeln und Bier. Doch das Widerwärtigste an ihm waren die Hände, diese dicken, riesigen Pranken. Ungeschlacht und grob, waren sie dennoch überall, griffen fest zu und nahmen sich, ohne zu fragen.
Johanna versuchte, die Luft anzuhalten, als er auf ihr lag. Sie kniff die Augen zusammen und hoffte inständig, dass es bald vorüber war. Doch er war zu betrunken, um ihr eine schnelle Erlösung zu ermöglichen, aber nicht betrunken genug, um nicht zu bemerken, wie sehr sie sich gegen ihn sträubte.
»Mach mit, sonst ist es das letzte Mal, du Metze«, stöhnte er, während mehrere Tropfen seines zähen Speichels in ihr Gesicht fielen. Johanna betete, dass er diese Drohung wahr machte und es das letzte Mal sein würde.
Sie hatte so sehr gehofft, am heutigen Tage verschont zu bleiben. Und der Besuch der Reiter war tatsächlich vielversprechend verlaufen, man war zur Jagd aufgebrochen, hatte danach zusammengesessen und zu feiern begonnen. Am späten Abend waren die drei Männer wieder verschwunden, spät, aber immerhin noch so früh, dass er nicht müde und nicht trunken genug war, um wie tot auf sein Lager zu sinken. Nein, er war noch munter gewesen und hatte Johanna, als sie zusammen mit der alten Magd die Tafel abräumte, am Arm gepackt und hinter sich her die Treppe hinaufgezogen.
Jetzt lagen sie also hier in der verwaisten Knechtekammer unter dem Giebeldach des Herrenhauses, dem Ort, welcher seit der Schwangerschaft der Herrin zum Schlafgemach des Ritters Wilhelm geworden war und an dem sie sich schon so häufig mit ihm hatte treffen müssen, während seine Frau unten in ihrem Zimmer saß und stickte.
Die Herrin war eine ruhige, zurückhaltende Frau. Sie sprach nicht viel, gab den Bediensteten kaum Anweisungen, und selbst mit ihrem einzigen Kind, dem nunmehr dreijährigen Knaben Heinrich, redete sie so gut wie kein Wort. Ihre Kammer verließ sie nur selten, sie las Bücher oder verrichtete Handarbeiten. Doch manchmal, ganz unvermittelt, veränderte sie sich. Man wusste nicht, was in sie gefahren war, wenn diese Wutanfälle kamen. Vom Teufel sei sie besessen, so sprach die alte Magd hinter vorgehaltener Hand, und selbst ihr Mann, der grobe Ritter Wilhelm, bekam es in solchen, jedoch seltenen Momenten mit der Angst zu tun.
Jetzt nahte wieder einmal ein solcher Moment. So dachte Johanna, während ihr Herr, der immer noch auf ihr lag, nichts zu bemerken schien. Da waren nämlich Schritte zu hören, laute Schritte. Die morschen Stufen der Holzstiege knarrten, jemand kam die Treppe zum Dachboden herauf. Und wer anders könnte es sein als die wütende Frau, die ihren Gatten mit dessen Buhlin ertappen wollte? Nicht, dass sie nichts von dessen Zusammenkünften mit der Amme wusste. Jeder wusste es. Aber in den rasenden Momenten ihrer Wutattacken war die Dame unberechenbar und all ihr Gleichmut wie weggeblasen. In solchen Momenten war sie zu allem fähig.
»Die Herrin kommt«, keuchte Johanna und versuchte, den heißen, schweißnassen Körper des Mannes von sich zu stoßen.
Anstatt die unwillige Frau wieder in seine Gewalt zu bringen, wie es normalerweise die Art Wilhelms von Eicheck war, hielt er tatsächlich inne, lauschte mit vor Schreck geweiteten Augen, sprang dann flink wie ein Wiesel von Johanna herunter und stieß leise, aber fast panisch hervor:
»Verbirg dich in der Truhe. Schnell!«
Er hatte gerade die mit mottenzerfressenem, grauem Leinen gefüllte Holzkiste geöffnet, und Johanna war hineingeschlüpft, da sprang auch schon ruckartig die Tür zu der düsteren, kleinen Dachkammer auf. In der Eile musste sich ein Stück Leinenstoff in der Klappe der Truhe verfangen haben, sodass sie sich nicht völlig geschlossen hatte und einen Spalt breit offen stand. Das war Johannas Glück, da sie sonst in dem massiven Ding gewiss nach wenigen Augenblicken erstickt wäre. So bekam sie also weiterhin Luft und auch die Gelegenheit, durch die schmale Ritze zu beobachten, was nun in dem Zimmer vor sich ging.
Es war nicht die Herrin, die diese für Johanna so widerwärtige Zusammenkunft jäh unterbrochen hatte.
Es war einer der Reiter. Niemand anderes als ausgerechnet er – Philipp. Er und ein weiterer, Johanna unbekannter Mann, ein Kraftprotz ohne Hals und ohne Haare, neben dem der so breite und muskelbepackte Wilhelm wirkte wie ein schmächtiges Hähnchen. Ein Hähnchen ohne Federkleid, denn er war zudem immer noch splitternackt.
Doch Johanna konnte nur auf ihn, auf Philipp, starren. »Den Schönen« nannten ihn die anderen weiblichen Bediensteten in diesem Hause, da er zweifellos über ein angenehmes Äußeres verfügte. Hochgewachsen, schlank, mit dunklem, vollem Haar und großen, grauen Augen, hätte er sicherlich jedes Frauenherz für sich gewinnen können, wenn – ja, wenn er nicht auch etwas an sich gehabt hätte, was die abergläubische alte Magd als »dämonisch« bezeichnete. Und Johanna wusste nur zu gut, wie recht die unwissende Alte damit hatte.
Nun stand Philipp also dem nackten Wilhelm gegenüber, neben ihm der Kahlkopf, welcher nichts Geringeres als eine Streitaxt in der Hand hielt, und niemand sprach ein Wort. Es war eine mehr als eigentümliche Situation, und Johanna ahnte, dass dies kein freundschaftliches Beisammensein geben würde.
»Nun?«, das war das Einzige, was Philipp nach vielen, vielen Augenblicken des Schweigens sagte.
»Ich sage dir, wo es ist, ich sag es dir«, stotterte Wilhelm. Seine Stimme klang flehentlich, ja weinerlich. So hatte Johanna ihn noch nie erlebt, und fast tat er ihr leid, dieser Widerling.
»Dann sprich.«
»Im Wald hinter der krummen Linde, dort, wo wir heute auf der Jagd Rast gemacht haben, da liegt ein alter Mühlstein. Man sieht ihn vom Wegesrand aus nicht. Geht man aber wenige Schritte hinein in den Wald, so kann man ihn nicht verfehlen. Unter diesem Stein ist es vergraben. Tief vergraben, zwei Ellen tief wenigstens.« Wilhelm bebte und zitterte. Sicherlich war die nächtliche Herbstkälte, die seinen nackten, verschwitzten Körper umfing, daran nicht unschuldig, mehr noch schien es jedoch die Angst zu sein, welche ihn mit dem Eintreten dieser beiden Männer so sehr gepackt hatte.
»Gut«, sagte Philipp nur. Sein Gesicht wirkte eisern, er verzog keine Miene. Er war nicht einmal erheitert durch den seltsamen Anblick, welcher sich ihm in Form dieses schlotternden, unbekleideten Mannes bot. Der Kahlkopf neben ihm hingegen grinste unaufhörlich.
Johanna betrachtete Philipp genau. Spurlos verschwunden war er damals. Man hatte ihn für tot gehalten, tot wie die drei anderen Buben, welche vom selben Tag an unauffindbar waren. Sie allein wusste es besser und hatte dieses Geheimnis bislang für sich behalten. Aus Angst. Angst davor, dass er eines Tages zurückkehrte und seine Drohung wahrmachte. Und diese Angst ließ sie nun inständig hoffen, nicht von ihm oder seinem Spießgesellen in der Truhe entdeckt zu werden.
Doch offenbar war ihre Hoffnung vergeblich, denn im nächsten Moment fragte Philipp den bibbernden Ritter: »Bist du allein hier?«
»Mutterseelenallein.«
Philipp neigte seinen Kopf und blickte Wilhelm von oben herab kühl und ungläubig an.
»Niemand weiß von dem Geld«, stammelte dieser weiter. »Niemand.«
Jetzt schweifte der kühle Blick durch die ganze Kammer und fiel auch auf die Truhe. Er musste auf die Truhe fallen, denn sie war mit Ausnahme des uralten Bettes das einzige Möbelstück in dem kleinen Raum.
»Dein Weib muss tatsächlich garstig sein, dass du dich jede Nacht in ein derartiges Rattenloch verziehst, Wilhelm«, meinte Philipp schließlich und setzte sich ausgerechnet auf die Truhe, sodass sich nun doch der Deckel gänzlich schloss.
Fortan vernahm Johanna die Vorgänge im Raume nur noch dumpf und weit entfernt. Sie rang schon nach kurzer Zeit nach Atem und war so sehr damit beschäftigt, nicht zu ersticken, dass sie kaum mehr darauf achtete, was die Männer miteinander sprachen. Sie konnte lediglich ausmachen, dass Wilhelm erneut zu jammern, ja zu flehen begann und dabei immer lauter wurde, während sein Besucher nach wie vor auf ihrem Versteck sitzen blieb und sie somit bald dazu bringen würde, ebenfalls laut zu jammern.
Doch dazu kam es nicht.
Johanna hörte mit einem Mal einen dumpfen Aufprall, und dann öffnete sich ebenso plötzlich die Truhe. Zum Glück öffnete sie sich nur wieder einen Spalt weit, ebenden Spalt, der durch das eingeklemmte Leinenstück verursacht wurde. Philipp hatte sich offenbar erhoben und sprach etwas wie: »Jetzt, du abscheulicher Strolch, weißt du, mit wem du es die ganze Zeit zu tun hattest.«
Johanna hörte nicht auf diese Worte. Sie konzentrierte sich allein darauf, leise zu atmen und nicht keuchend nach der nun einströmenden frischen Luft zu schnappen. Es gelang ihr tatsächlich, sich zu beherrschen.
Vorsichtig lugte sie sodann wieder durch die Ritze. Das Talglicht, das den Raum bislang spärlich beleuchtet hatte, war umgekippt und erloschen, sodass es nun sehr viel dunkler in der Dachkammer war. Und die Laterne, welche die beiden Eindringlinge dabeigehabt hatten, verschwand in ebendiesem Moment zusammen mit ihnen durch die Tür aus dem Zimmer. Sie gingen also fort und hatten Johanna nicht entdeckt.
Sie wartete noch einen Moment in ihrer Truhe ab, aber als sich nichts mehr zu regen schien und auch der Herr Wilhelm sich nicht zeigte, um sie aus ihrem Versteck hervorzuholen, stieß sie von innen heraus den schweren Deckel der riesigen Kiste auf. Ihre Knochen schmerzten, und so konnte sie sich, nachdem sie hinausgeklettert war, nur sehr ungelenk fortbewegen.
Stockfinster war es nun, und Johanna gewann bald den Eindruck, dass sie ganz allein im Raume war. Alles war still, allein von draußen war das Rufen eines Kauzes zu vernehmen. Johanna atmete auf. Es zog sie nun in ihr eigenes Kämmerlein, in ihr winziges Reich neben der Küche, welches sie sich mit der guten alten, schnarchenden Magd teilte. Hier wollte sie in aller Ruhe den kurzen Rest dieser denkwürdigen Nacht verbringen.
Vorsichtig tastete sie sich durch die Dunkelheit. Aber nach nur zwei Schritten stolperte sie und fiel. Sie fiel weich, und sofort nahm sie einen ihr vertrauten, aber unliebsamen Geruch wahr.
Der Herr.
Sie lag auf dem nackten Leib Wilhelm von Eichecks, und dieser regte sich nicht.
Johanna durchlief ein eiskalter Schauder. Sie versuchte, sich aufzurichten, und stützte sich dabei auf seine Schultern. Etwas Feuchtes, Warmes klebte an ihren Fingern. Ohne zu wissen, was sie tat, tastete sie im Finstern nach seinem Gesicht.
Doch sie fand es nicht.
Da war kein Gesicht. Da war nichts als ein nackter, blutnasser Stumpf.
Sein Kopf fehlte.
Johanna schrie entsetzlich auf. Sie versuchte, sich zu bewegen, doch ihre Schenkel und Arme zitterten derartig, dass sie sich nicht vom Fleck rühren konnte.
Noch immer bebte sie am ganzen Leibe, als man sie schließlich blutverschmiert auf der unbekleideten Leiche des Ritters sitzend fand. Es war ihr Glück, dass die herbeieilende Herrin einen Anfall erlitt, in Ohnmacht fiel und sich tags darauf an nichts mehr erinnern konnte. Und es war ihr Glück, dass der gutmütige Hofknecht Johanna noch in derselben Nacht inständig dazu riet, den Hof des ermordeten Ritters von Eicheck schnellstmöglich zu verlassen, wenn ihr ihr eigenes Leben lieb sei.
Sie gehorchte stumpf und mit regloser Miene. Ohne zu wissen wohin, stolperte sie, nur in ihr blutiges Leinenhemd gehüllt, in die herbstliche Nacht davon.
Kapitel II
»Guter Vestiarius, was verschafft mir die Ehre?«
»Ich werte es als Gunsterweisung, dass Ihr mich so formlos begrüßt, liebe Frau Margarethe.«
Mit immer den gleichen Worten wurde ein jeder Besuch des Stiftsherrn Hubertus Vestiarius bei der Kaufmannswitwe Margarethe Gänslein eingeleitet. Jedes Mal fragte sie ihn danach, was ihr die Ehre verschaffe, und jedes Mal wurde er nicht müde zu erwähnen, dass er es genoss, in ihrer Gunst zu stehen. Nach Beendigung dieses Rituals ging man meist zusammen in die Stube des prächtigen Kaufmannshauses, um bei einem Becher Glühwein und Konfekt über die neuesten Ereignisse in der Stadt Hameln, in der nahen Umgebung, im gesamten Reich, ja sogar in der ganzen Welt zu plauschen. Denn der Horizont der Margarethe Gänslein war ausgesprochen weit – ebenso wie der Horizont ihres treuen Gastes –, so weit gar, dass sie über den Rand der bis vor Kurzem noch bekannten Welt hinausgingen und gar bis zu dem neuen, noch nicht völlig erkundeten Kontinent im Westen reichten.
Margarethe Gänslein war eine Frau mittleren Alters, deren mehr als ansprechende Erscheinung verriet, dass es sich bei ihr in jungen Jahren um eine wahre Schönheit gehandelt haben musste. Dennoch war sie weit davon entfernt, eitel zu sein. Sie kleidete sich zwar teuer, aber ihrem Witwenstand entsprechend unauffällig und verzichtete gänzlich auf bunte Farben, bestickte Stoffe und ins Auge stechenden Schmuck, obwohl sie sich jeglichen Luxus beileibe hätte leisten können. Eitel war sie also nicht. Aber dennoch galt sie als hochmütig, und sie tat nichts, aber auch rein gar nichts dafür, diesen Leumund zu verbessern.
Nach dem frühen Tode ihres Gatten vor nunmehr fünf Jahren hatte die patente Witwe den Mut aufgebracht, dessen florierende Geschäfte allein weiterzuführen, und es war ihr nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen, den Reichtum ihres Kaufmannshauses sogar zu mehren. Margarethe glaubte diesen Erfolg der Tatsache zu verdanken, dass sie, anders als ihren seligen Reinold, keinerlei Gewissensbisse plagten, wenn es darum ging, das aus ihrem Gewürzhandel erzielte Geld gewinnbringend anzulegen und es nicht etwa zur Hälfte der Kirche und dem eigenen Seelenheil zu vermachen, so wie Reinold es zeit ihrer Ehe mit großer, inbrünstiger Andacht getan hatte. Margarethe Gänslein jedoch machte sich nichts aus Stiftungen, Ablässen, Wallfahrten und Seelenmessen. Sie hielt es nicht für verwerflich, fleißig zu sein und mehr zu erwirtschaften als andere, und wenn sie den Armen geben wollte, dann tat sie es selbst und benötigte dazu nicht den Almosenkasten in der Kirche.
Mit diesem Verhalten machte sie sich unter der führenden Geistlichkeit der Stadt – den Stiftsherren – nur wenige Freunde, sie galt als »lutherisch«, und jeder wusste, dass sie in ihrem Hause sämtliche Schriften des Reformators beherbergte. Es war nicht ungewöhnlich für einen Vertreter des Kaufmannsstandes in Hameln, dass er sich mit den Pfaffen vom Stift überwarf. Reibereien zwischen den katholischen Geistlichen und der selbstbewussten Bürgerschaft waren seit mittlerweile Jahrhunderten an der Tagesordnung und längst zur Tradition geworden. Die Stadt teilte sich also in zwei Lager: den Rat und die einflussreiche Großbürgerschaft einerseits und den katholischen Dekan mit seinen Kanonikern andererseits. Und so gab es in Hameln auch zwei Hauptkirchen, denn neben dem Münster des Stifts im Süden hatte sich die Kaufmannschaft am Pferdemarkt ein eigenes Gotteshaus errichtet, die Nicolaikirche, geweiht dem Patron der Kaufleute. Auch sie war katholisch – noch war sie es, würde es jedoch gewiss nicht mehr lange bleiben, denn Margarethe Gänslein war nicht die Einzige unter den reichen Hamelner Bürgern, der die Lehren des Herrn Luther zusagten.
Trotzdem fand die Witwe auch unter den Ratsherren und Kaufleuten der Stadt keine Freunde. Im Gegenteil, mit diesen verstand sie sich noch weniger als mit den Pfaffen des Stiftes. In diesem Fall war der Grund in ihrem berüchtigten Hochmut zu suchen: Vier Heiratsanträge hatte sie nach dem Tode ihres Gatten Reinold abgelehnt, vier vielversprechende Partien müde lächelnd abgewiesen. Und nicht nur das. Sie fand auch immer wieder schlagende Gegenargumente, wenn der Rat ihr nahelegte, als alleinstehende Kauffrau zumindest einen Vormund in geschäftlichen Dingen an ihrer Seite zu dulden. Allein ihr stets wachsender Reichtum und ihr offensichtlicher Sinn für die erfolgreiche Abwicklung ihrer Geschäfte stimmten die Ratsherren milde, denn niemand brachte zu dieser Zeit mehr Geld in die Stadtkasse als Grete Pfeffersack, wie man die Gewürzhändlerwitwe hinter vorgehaltener Hand zu schimpfen pflegte.
Alles in allem war Margarethe Gänslein also eine reiche und angesehene, aber ebenso hochmütige und unbequeme Frau, die es die meiste Zeit vorzog, sich mit einer möglichst geringen Zahl an Menschen zu umgeben.
Unter den wenigen Besuchern, die sie in ihrem imposanten Hause empfing, war der Kanoniker Hubertus Vestiarius der einzige Geistliche. Margarethe genoss die Gesellschaft dieses gebildeten und durchaus duldsamen Mannes, mit dem es möglich war, vollkommen frank und frei über Gott und die Welt zu reden. Dabei war sie sich durchaus bewusst, dass sich Vestiarius gegenüber ihr, der störrischen Witwe, nicht gänzlich ohne Hintergedanken so freundlich und verständnisvoll verhielt. Er schwärmte für sie, doch daneben gab es weitere, triftige Gründe. Immerhin war sie kinderlos, es gab keine Erben für ihren immensen Reichtum, und insgeheim schien er zu hoffen, dass sie eines Tages, vielleicht im hohen Alter, milde würde und sich doch noch dazu bewegen ließe, das Stift mit ihrer Hinterlassenschaft zu bedenken. Diese Hoffnungen machte sich Vestiarius vollkommen uneigennützig, denn jenen Tag würde er wahrscheinlich nicht erleben, da er bereits älter als die schöne Witwe war.
Im letzten Monat hatte er sein achtundvierzigstes Lebensjahr vollendet. Er war ein stattlicher Mann, und anders als seiner Gastgeberin konnte man ihm den Vorwurf der Eitelkeit durchaus machen, denn auch wenn sein Stand ihm eine gewisse Kleiderordnung vorschrieb, so war Vestiarius einer der vielen Geistlichen seiner Zeit, die ebendiese Ordnung bis zum Maximum hin ausreizten, indem sie es verstanden, das übliche Gewand eines Kanonikers mit möglichst viel edlem Pelz, schwarzem Samt und Goldschmuck zu verfeinern. Vestiarius war nun einmal kein schlichtes Mönchlein, sondern ein Stiftsherr, er lebte nicht in der Abgeschiedenheit des Klosters, sondern war Inhaber eines Herrenhofes sowie einer Kurie und somit Verwalter zahlreicher stiftseigener Ländereien im Umland der Stadt. Zwar hatte er die Gelübde der Frömmigkeit, der Keuschheit und des Gehorsams abgelegt, nicht aber das der Armut. Das konnte man von einem Kurienverwalter nicht verlangen, widersprach es doch seinen tagtäglichen Aufgaben, die da unter anderem waren, das Hab und Gut des Stifts zu wahren und bei Gelegenheit zu mehren. Dennoch war Vestiarius nicht unbedingt ein habgieriger Mensch, vielmehr liebte er den Genuss. Und einen besonderen Genuss bereitete es ihm, einen Nachmittag in der Gesellschaft der verehrten Margarethe Gänslein zu verbringen.
So betraten sie also eine der beiden Stuben des großen Kaufmannshauses, welches unmittelbar am Pferdemarkt in Nachbarschaft zum Rathaus und zur stiftfremden Nicolaikirche gelegen war. Boden, Decke und Wände des gesamten Raumes bestanden aus einer edlen Eichenholzverkleidung, teilweise mit schlichten, aber schmuckvollen Schnitzereien versehen. Ein riesiger, grün lasierter Kachelofen, der vom Nachbarraum aus betrieben wurde, spendete in Anbetracht des ungemütlichen, nasskalten Frühherbstwetters eine wohlige Wärme. Man nahm Platz an einem großen Tisch, der von zehn schweren, gepolsterten Stühlen umgeben war. Eine junge Magd, ein hübsches, aber dümmlich dreinblickendes Ding, brachte unversehens und schüchtern lächelnd eine silberne Kanne mit dampfendem und köstlich duftendem Glühwein sowie ein ebenfalls silbernes Tablett voller verschiedenartiger Konfektstücke.
Noch während das Mädchen im Raume war, begann Margarethe das Gespräch mit ihrem Gast.
»Ruhige Tage sind es, Vestiarius, nicht wahr? Zu ruhige Tage, wie mir scheint. Oder bringt Ihr mir etwa interessante Nachrichten?«
»Nein, Frau Margarethe, nichts Neues ist mir bekannt. Nichts, außer diesem herrlichen Duft Eures köstlichen Gewürzweines. Eine solche Mischung habt Ihr mir nie zuvor kredenzt.«
»Das ist ein Claret, mein lieber Vestiarius. Man nehme einen erlesenen roten Wein, erwärme ihn und hänge ein Beutelchen mit Zimt, Ingwer, Nelken, Safran, Honig und Zucker hinein. Eine Spezialität, die mir aus Venedig geschickt wurde. Man lässt dort wieder besser mit sich handeln, nachdem die Portugiesen den eingebildeten Venezianern so ordentlich ins Handwerk pfuschen. Drei ganze Kisten voll solcher Beutelchen hat man mir zum Geschenk gemacht, nicht einmal die Kosten für den Transport über die Alpen musste ich bezahlen.«
»Bezieht Ihr also fortan Eure Waren wieder unmittelbar aus Venedig?«
»Das wird sich nicht lohnen, Vestiarius. Venedigs Stern sinkt spätestens seit seinem Konflikt mit der Liga von Cambrai immer weiter. Es rechnet sich nicht mehr, Waren über die Berge zu bringen. Selbst bei einem leichten und teuren Gut, wie Gewürze es darstellen, ist ein solch aufwendiger Transport kaum zu bezahlen. Die Zeiten, in denen ein Pfund Safran den Wert eines Pferdes überstieg, sind vorüber.«
»Aber die Venediger steuern doch auch Brügge an«, entgegnete der Stiftsherr.
»Das ist wahr«, gab Margarethe zurück, »doch selbst mit dem guten Brügge ist es bald vorbei, mehr und mehr versinkt es in der Bedeutungslosigkeit. Es heißt, dass es zusehends versandet und von großen Schiffen nicht mehr erreicht werden kann. Antwerpen heißt der neue Stern am Handelshimmel, und mit denen hat Venedig nichts zu tun. Leider auch nicht unsere gute alte Hanse. Ich fürchte, auch sie hat den Wandel nicht erkannt und ist nur noch brauchbar für den einen oder anderen Selschop, also für begrenzte Handelsgesellschaften. Nun, es bleibt mir nichts anderes übrig, als meinerseits die Zeichen der Zeit zu erkennen und mich an andere zu wenden.«
»Ihr sprecht von den Portugiesen und den Spaniern.«
»So ist es. Wir leben in neuen Zeiten, Vestiarius. Da gilt es mitzuhalten oder stehenzubleiben und zu verstauben. Seit ihr Seefahrer Vasco da Gama den Seeweg nach Indien gefunden hat, beziehen die Portugiesen die Gewürze unmittelbar vor Ort, zahlreiche Zwischenhändler fallen aus, sodass ihre Preise so niedrig sind, dass es für mich sogar günstiger wäre, meine Pfeffersäcke auf eigene Kosten aus Lissabon abzuholen, als sie über die Hanse zu beziehen.«
»Aber Ihr wollt doch nicht etwa höchstselbst ...«
»Wo denkt Ihr hin, Vestiarius? Es ist nicht notwendig, dass ich mich selbst auf Handelsreise begebe. Wozu hat man all diese wunderbaren, schriftkundigen, aber auch teuren Leute vor Ort, welche die Dinge so hervorragend in meinem Sinne erledigen? Außerdem erlaubt uns unsere ungemein günstige Lage an der Weser einen florierenden Zwischenhandel, auf den ich künftig ein größeres Augenmerk legen werde.«
»Wo wir von der Zukunft sprechen: Verweilt der Sohn Eurer Base denn nach wie vor in Italien und erlernt dort den Kaufmannsberuf?«
»Wie lange haben wir uns nicht mehr gesprochen, guter Vestiarius? Ihr wisst es nicht? Er hat Italien längst verlassen. Ein Turbulentus ist er, ein Herumtreiber und Abenteurer. Ihr glaubt nicht, was er in diesem Moment gerade treibt.«
»Was, Frau Margarethe, was?« Der Besucher nutzte den Eifer seiner Gastgeberin, als sie über den geliebten Sohn ihrer Base sprach, und beugte sich, ihr tief in die Augen blickend, über den Tisch in Richtung der Dame, zu nah für einen Vertreter seines Standes. Sein Interesse an den Abenteuern des jungen Georg war aufrichtig, aber genauso aufrichtig war auch sein Interesse, in Erfahrung zu bringen, ob dieser Herumtreiber tatsächlich einen berechtigten Anwärter auf das Erbe des Gewürzhandels Gänslein darstellte.
»Er war bereits in Lissabon, und erst gestern haben seine gute Mutter und ich einen Brief von ihm erhalten, in dem er berichtet, dass er zusammen mit einem portugiesischen Händler in die Neue Welt aufbricht.«
»Nein!«
»Oh doch. Es ist eine gefährliche Reise, aber mit Gottes Hilfe wird er heil wieder in Portugal eintreffen und mir bald eine ganze Kiste voller neuer Kostbarkeiten schicken.«
»Die da wären?«
»Nun, es heißt, auch dort soll es allerlei unbekannte Gewürze geben. Eine purpurrote Schote gar, die einem ein derartiges Brennen im Hals verursacht, dass man Feuer speien möchte.«
»Aber das ist doch kein Genuss, gute Margarethe«, entgegnete der Kanoniker entsetzt.
»Geschmäcker sind verschieden. Jetzt wollen wir aber über etwas anderes reden. Habt Ihr mir wirklich nichts Neues gebracht, Vestiarius?«
»Hmmmh.« Der Gast legte nachdenklich seinen rechten Zeigefinger an die glatt rasierte Oberlippe und betrachtete eine Weile die hölzerne, polierte Decke. »Nein, mir fällt nichts ein. Nichts, außer dass vorgestern dieser so niederträchtige wie nichtige Raubritter von Eicheck gemeuchelt wurde. Und das auf seinem eigenen Gut, in seinen eigenen vier Wänden.«
»Was Ihr nicht sagt! Aber mit Verlaub, es geschieht ihm recht. Im Grunde dürfte ich es nicht sagen, ist doch meine Familie weitläufig mit derer von Eichecks verwandt. Dennoch, die Welt ist nicht ärmer ohne diesen Straßendieb und Buschklepper. Zum Glück hatte ich nie unter seinen erbärmlichen Raubzügen zu leiden. Solche Waren, wie meine Fuhrleute sie transportieren, waren wohl nicht nach dem Geschmack des Tölpels.«
»Ja, sein Tod stellt für viele wahrlich eine Erleichterung dar«, bestätigte auch Vestiarius. »Mich wundert es, dass der Hamelner Rat beim Herzog nicht schon längst die Zerstörung der Eicheckburg erwirkt hat. Dieses Schicksal haben schon die Räuberlöcher anderer adeliger Wegelagerer erfahren, zuletzt die Hermersche Burg vor etwas mehr als vierzig Jahren. Und eine Sünde ist eine solche Schleifung nun wirklich nicht, geht doch von diesen Halunken und ihren heruntergekommenen Nestern nur Übles aus.«
»Nur gut, lieber Gast, dass es meine Ahnen dereinst vorzogen, ihre verarmenden Güter aufzugeben und hinter den Mauern der Stadt Obdach zu finden. Und in diesen Zeiten haben es Edelleute noch schwerer, wenn sie nicht gerade dem erlauchten Kreise des Hochadels zuzuzählen sind. Wenig Land, wenig Einkünfte. Da bleibt vielen nur das Bauernschinden oder die Wegelagerei. Aber nun sagt mir, Vestiarius: Wer hat es getan? Wer hat den Ritter auf dem Gewissen?«
»Man vermutet einen seiner gequälten Bauern. Sein Gut war damals, vor vier Jahren, ohnehin eines der ganz wenigen in dieser Gegend, auf denen sich die Bauern im Namen des Ketzers Luther gegen ihren Grundherrn erhoben haben. Aufgehängt hat Ritter Eicheck die Empörer, eigenhändig sogar. Das wird man ihm wohl nachgetragen haben.«
»Nennt Luther nicht schon wieder einen Ketzer, lieber Vestiarius. Einen groben Polterer dürft Ihr ihn schimpfen. Ihr wisst, auch ich halte ihn nicht für einen begnadeten Denker, wie es etwa Erasmus von Rotterdam ist. Aber das, was er sagt, ist sicherlich keine Ketzerei, sondern schlicht die unverblümte Wahrheit, gekleidet in die Worte und die Redewendungen eines Bauern. Er ist frei heraus und kein vorsichtiger, abwägender, humanistischer Bücherwurm.«
»Und eben das ist das Entsetzliche an diesem Mann, liebe Frau Margarethe. Luther hat die Worte des großen Erasmus nicht erhört, als dieser ihm riet, bei Dingen, die so fest eingewurzelt sind, dass man sie nicht plötzlich aus dem Herzen reißen kann, besser beständig zu disputieren, statt schroffe Behauptungen aufzustellen. Im Gegenteil, ihm war es wichtig, Erasmus zu trotzen und sich zu gebärden wie ein grobschlächtiger Unhold. Denn nur so versteht man ihn, jeder versteht ihn, selbst der dümmste Knecht. Und das hat nicht allein damit zu tun, dass er sich ausschließlich des Deutschen bedient, sondern wie er sich dessen bedient.«
»So ist es, Vestiarius, und ich halte ebendiese Grobschlächtigkeit für einen mehr als klugen Schachzug, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob dieser Mönch dies auch tatsächlich beabsichtigt hat. Er scheint mir mehr ein Mann des Herzens als einer der Vernunft zu sein und mitunter etwas unbedacht, aber gerade das wirkt so erfrischend ehrlich und verschafft Vertrauen. Ehrlichkeit, guter Vestiarius, ist in diesen Tagen eine wahrlich seltene Tugend.«
»Wem sagt Ihr das, wem sagt Ihr das, Frau Margarethe.«
»Fürwahr, fürwahr«, antwortete sie nur leise, den Gast heimlich musternd, während sie eigenhändig nach der silbernen Kanne griff. »Darf ich Euch noch etwas von dem Claret einschenken, Vestiarius?«
»Gern doch, gern. Habt vielen Dank. Dennoch«, fuhr Vestiarius mit besorgter Miene fort, »wenn ich das anmerken darf, ist es ratsam, gute Frau, nicht zu häufig und zu vehement die Ansichten dieses Luther zu vertreten. Vor allem nicht in der Öffentlichkeit.«
»Aber Vestiarius, habt Ihr in den letzten Monaten denn geschlafen? Wenn selbst unter den angesehensten Reichsfürsten brennende Verfechter der lutherischen Lehren sind, wie etwa unser Nachbar Herzog Ernst von Braunschweig-Lüneburg, dann darf doch wohl auch ein schlichtes Kaufmannsweib es wagen, sich dem anzuschließen. Das hat die Protestatio der Evangelischen auf dem Reichstag zu Speyer im vergangenen Frühjahr mehr als deutlich gemacht.«
»Das wagten sie doch nur, weil der Kaiser auf dem Reichstag nicht anwesend sein konnte. Und da Karl seinen Krieg in Italien nun erfolgreich beendet hat, wird er in Zukunft im Reich wieder härter durchgreifen. Da könnt Ihr Euch sicher sein, Frau Margarethe. Aus brennenden Verfechtern der Lutherschen Lehre könnten dann durchaus brennende Verfechter im wahrsten Sinne des Wortes werden. Abgesehen davon gehört diese Stadt nicht zum Herrschaftsbereich des Herzogs von Braunschweig-Lüneburg, sondern zu dem des Herzogs von Calenberg. Auch wenn Ernst und Erich einer Familie angehören, so bleibt doch Erich von Calenberg der katholischen Sache verhaftet.«
»Das wollen wir abwarten. Gerüchten zufolge sieht seine Angetraute das bereits anders. Sie ist sehr angetan von den neuen Lehren. Und übrigens: Seit wann hat Erich von Calenberg wieder etwas in Hameln zu sagen? Sind wir de facto nicht längst unsere eigenen Herren? Ich verstehe gar nicht, weshalb sich der Rat so sehr ziert, sich zu Luther zu bekennen. Das wäre doch ein gelungener Schachzug im Machtkampf gegen euch katholische Stiftsherren.«
»Ihr wollt mich wieder einmal nur necken, meine Liebe. Doch das wird Euch nicht gelingen, denn nun wechsle ich einfach das Thema. Habt Ihr schon gehört, dass der Ratsherr Peter Hasenstock wieder zurück in der Stadt ist?«
»Ach.« Margarethes Gesichtszüge, die bisher eine gewisse ironische Selbstzufriedenheit verraten hatten, entgleisten plötzlich. »Dann bringt Ihr also doch noch interessante Neuigkeiten.«
Kapitel III
Man hatte sie nicht einlassen wollen. Zu spät sei sie, hatte der Wächter am Ostertor missmutig geraunt, als er nach einer halben Ewigkeit vehementen Pochens endlich eine kleine Luke an dem Tor geöffnet und sein wettergegerbtes Gesicht hinausgestreckt hatte. Längst herrsche Nachtruhe in der Stadt, und er werde einen Teufel tun und einer fahrenden, fremden Dirne zu dieser Stunde Einlass gewähren.
»Ich bin keine Dirne«, hatte ihm Johanna zugerufen und dabei ihre Stimme sehr erheben müssen, um gegen den heftigen Herbstwind anzukommen, der an diesem Abend wehte und einen unangenehm peitschenden Regen zum Begleiter hatte.
»Das ist mir gleich. Komm morgen wieder, dann lass ich dich ein.«
Und mit diesen Worten war die Holzklappe krachend geschlossen worden, das Gesicht des Wärters war verschwunden, und Johanna stand nun allein im Regen vor der massiven und undurchlässigen Stadtmauer Hamelns.
»Morgen«, flüsterte sie, bibbernd vor Kälte.
In ihrem Dorf war sie gewesen, nachdem die Mordtat an ihrem Herrn verübt worden war. Dorthin hatte sie sich geflüchtet und Unterschlupf bei ihrem Schwager gesucht. Hermann war der Bruder ihres verstorbenen Mannes und der einzige Verwandte, der Johanna noch geblieben war. Doch Hermann war nicht nur arm wie ein jeder Bauer, der den Ritter Wilhelm von Eicheck zum Grundherrn hatte, sondern ihn plagte auch seit dem Tode seines Bruders ein schlechtes Gewissen. Und von ebendiesem schlechten Gewissen wollte Johanna sich nicht abhängig machen, denn sie spürte, dass, so freundlich sich der Schwager auch gab, es ihm dennoch unwohl dabei war, Johanna in seinem kleinen Haus zu beherbergen. Ganz abgesehen davon, dass sie auf den Herrenhof gehörte, von dort geflohen war und gewiss bald gesucht werden würde.
Johanna hatte nach nur einem Tag eingesehen, dass sie hier nicht bleiben konnte. Also war sie gegangen. Nach Hameln, in die Stadt hatte es sie gezogen, dort hatte sie eine Arbeit finden wollen. Aber offenbar war sie nun zu spät.
Morgen solle sie zurückkehren. Doch wo die Nacht verbringen?
Das wollene braune Tuch, welches ihr die gute Trudi, die Frau des Schwagers, mitgegeben hatte, war schwer vom Regen und spendete schon lange keine Wärme mehr, im Gegenteil. Johanna streifte es ab und versuchte, es auszuwringen, doch die Mühe war bei diesem Wetter vergeblich.
Wollte sie sich nicht den Tod holen, dann musste sie zurück. Zurück in die Hölle. Denn nichts anderes war dieses Haus, welches sie vor weniger als einer halben Stunde auf ihrem Marsch nach Hameln passiert hatte.
Ein Nobiskrug.
Johanna wusste aus Erzählungen von derartigen Kaschemmen; sie selbst hatte nie eine betreten, denn in derlei Häusern ging es mitunter wild zu. Auf dem Hellweg, der uralten Handelsroute, die schon in heidnischen Zeiten von Aachen bis hin nach Königsberg geführt hatte, lagen zahlreiche dieser berüchtigten Absteigen. Und auch wenn niemand jemals dort ein und aus gegangen sein wollte, so waren dennoch ausgesprochen viele Erzählungen über die Räuberlöcher in Umlauf. Zu den Zeiten der Lepra, als neben Kaufleuten, Söldnern, Pilgern und Landstreichern auch Aussätzige auf dem Hellweg unterwegs waren, hatte es auf der Strecke Gasthäuser gegeben, die eigens der Aufnahme von Leprösen dienten. Nicht Erbarmen und Mitleid waren Anlass für die Wirtsleute gewesen, sich auf derartige Kundschaft zu spezialisieren, nein, das Ganze stellte durchaus ein lohnendes Geschäft dar. Denn groß war einst die Zahl derer, die an dieser Geißel Gottes erkrankt waren und verkrüppelt, zerlumpt und bettelnd durch die Lande streiften, um Almosen von ihren Mitmenschen zu erbitten und sie daran zu erinnern, dass Mildtätigkeit gegenüber den Armen Gott ein Wohlgefallen sei. Doch lange schon schien diese Plage nun ein Ende gefunden zu haben, kaum mehr wurde ein Mensch vom Aussatz befallen, die eigens am Rande der Städte errichteten Leprösenhäuser verwaisten oder änderten ihre Gestalt, indem sie zu Hospitälern oder aber zur Herberge für einsame Alte wurden. Und auch die berüchtigten, bis dato von Gesunden gemiedenen Nobiskrüge änderten ihre Gestalt. Gemieden wurden sie jedoch weiterhin, nicht etwa weil man befürchtete, sich dort eine unheilbare Krankheit einzufangen. Nein, man musste dort viel unmittelbarer mit dem Verlust seines Lebens rechnen, denn mit dem Schwinden der Siechen kamen die Räuber, Tunichtgute, Geächteten und Ehrlosen, welche die Leprosengasthöfe zu ihren angestammten Wirtshäusern machten. Den Wirten aber war dieser Wandel durchaus recht.
An einer derartigen Absteige war auch Johanna vorübergegangen, und dorthin zog es sie nun zurück, denn es war das einzige Haus weit und breit, in welches man zu dieser Stunde außerhalb der Stadtmauern noch eintreten konnte. Ihr blieb also nur die Wahl, sich in der nasskalten Nacht Schutz unter einem tropfenden Baum zu suchen oder aber die Gesellschaft unangenehmer Zeitgenossen zu ertragen. Sie entschied sich für Letzteres, auch wenn es sie schmerzte, ihr einziges Geld, die drei Münzen, die sie nur widerwillig von Hermann in Empfang genommen hatte, in einem Nobiskrug zu lassen.
Es war ein winziges, windschiefes, strohgedecktes Fachwerkhäuschen, das inmitten des Nichts, unweit eines dunklen Waldes, aber weit entfernt vom nächsten Dorf, die frierende Johanna empfing. Vorsichtig versuchte sie, einen Blick durch die Schweinsblase zu erhaschen, welche vor das einzige kleine Fenster der Kaschemme gespannt war. Doch alles, was Johanna durch die gelblich braune Haut ausmachen konnte, war, dass Licht in der Gaststube brannte. Laute hörte sie keine, kein Grölen, kein Singen, kein Spielen von Fideln oder Flöten. Es war ruhig in dem Nobiskrug, und das beruhigte auch Johanna, die sich nun ein Herz fasste, zur Tür ging und sie vorsichtig aufstieß.
Eine angenehm trockene, aber übelriechende Wärme schlug ihr entgegen, als sie eintrat. Der Raum war ganz und gar nicht groß, hätte aber gut und gerne Platz für drei Dutzend Menschen geboten. Und dass so viele hier mitunter verkehrten, konnte man durchaus wahrnehmen, denn es stank noch immer erbärmlich nach ungewaschenen menschlichen Leibern und nach allem, was diese so von sich gaben oder geben konnten. Am heutigen Abend jedoch waren die vielen Stammgäste bloß zu riechen, nicht aber zu sehen, denn außer Johanna hielten sich nur zwei weitere Personen in der Gaststube auf: eine alte, beleibte Frau, offenbar die Wirtin, welche dösend auf einem Hocker neben dem Ausschank saß, und ein junger Mann. Dieser saß gekrümmt so weit wie möglich entfernt von der Alten in der äußersten Ecke des Raumes hinter einem runden Tisch und blickte die eintretende Johanna aus traurigen Augen staunend an.
»Gut«, dachte diese bei sich und hockte sich auf dem nächstbesten Platz neben der Tür nieder. Eine Weile saß sie nur da und rührte sich nicht. Die Wirtin döste weiter, und der Mann starrte wieder in seinen Bierkrug. Johanna war es recht, sie wrang erneut ihren triefenden Umhang über dem auf dem Boden verteilten schmutzigen Stroh aus und hängte ihn schließlich über eine Stange, die in der Nähe der Kochstelle angebracht war. Dann begab sie sich zurück zu der Holzbank und hoffte, dass die Nacht bald ein Ende finden würde.
Es war mit Sicherheit eine geschlagene Stunde vergangen, die Wirtin hatte bereits zu schnarchen begonnen, als der junge Mann schließlich das Wort ergriff und Johanna, die es bislang nicht gewagt hatte, die Augen zu schließen, ansprach.
»Wollt Ihr etwa nichts trinken oder essen?«
Johanna zuckte zusammen, obwohl er eine durchaus angenehme, leise, ja nahezu schüchterne Stimme hatte. Eine Stimme, die ganz und gar nicht zu seinem kräftigen, grobschlächtigen Erscheinungsbild passte. Nie zuvor in ihrem Leben war sie derart höflich angesprochen worden.
»Vielen Dank. Aber ich möchte die Wirtin nicht wecken. Es langt mir, mich hier ein wenig aufzuwärmen und den Morgen zu erwarten.«
Zum ersten Mal schaute sie den anderen Gast nun genauer an. Er war auf den zweiten Blick ein gar nicht so übler Bursche. Trotz seiner jungen Jahre fiel ihm das Haar schon aus, und sein Gesicht war ein wenig zu rund, aber er hatte schöne, große blaue Augen, und sein verschämtes Lächeln offenbarte gesunde Zähne.
»Wohin zieht es Euch, wenn ich fragen darf?«
»Ich wollte in die Stadt Hameln gehen, aber die Tore waren bereits verschlossen.«
»Ihr wart noch nie zuvor in Hameln, nicht wahr?«
»Woher wollt Ihr das wissen?«
»Nun, sonst wäre Euch bekannt, dass es zahlreiche Schlupflöcher gibt, um anderweitig in die Stadt zu gelangen.«
»Ach.« Johanna lächelte. Es schien ein freundlicher, harmloser Mensch zu sein, vor dem sie sich als einsame Frau nicht zu fürchten brauchte.
»Ich lebe in der Stadt und werde mich auch gleich wieder dorthin aufmachen. Wenn Ihr mögt, kann ich Euch zu Eurem Schutze begleiten und Euch eines der heimlichen Tore zeigen.«
Vielleicht hatte sie sich doch in ihm geirrt, denn Johanna stand der Sinn ganz und gar nicht danach, mit einem Fremden durch die Nacht zu streifen und sich von ihm geheime Orte zeigen zu lassen.
»Habt vielen Dank, aber ich werde bis morgen warten«, antwortete sie, nun weniger freundlich, um ihm zu verdeutlichen, dass sie nicht eine solche sei.
Er schien zu verstehen und wurde über und über rot. Fast konnte er ihr leidtun, denn Johanna hatte den Eindruck, dass er gar nicht beabsichtigt hatte, sie zu beleidigen. Er war einfach noch ein junger, unerfahrener Tölpel.
Es verging eine Weile des Schweigens, in der Johanna einer auf dem Rücken liegenden Schabe beim Sterben zuschaute. Dann fragte der junge Mann, nachdem er sich mehrere Male verlegen geräuspert hatte:
»Was treibt Euch in die Stadt?«
»Ich will mir dort eine Anstellung als Magd suchen.«
»Seid Ihr vom Lande?«
»So ist es.«
»Seid Ihr etwa schollenflüchtig?«
»Wie kommt Ihr denn darauf?« Johanna wurde nervös.
»Nun, das ist bei den meisten so, die es vom Lande in die Stadt zieht. Nach Jahr und Tag ist man frei. Wo kein Kläger, da kein Richter. Bislang hat es nur wenige Herren gegeben, die ihre Leute an den Ohren wieder durch die Tore hinausgezogen haben. Und wer sucht schon nach einem schwachen Weib?«
Jetzt wurde er offenbar munter.
»Also gibt es in Hameln viele wie mich?« Johannas Interesse war nun geweckt.
»Durchaus. Und wie gesagt: Die Grundherren suchen nur selten nach ihnen. Häufiger sind es die gehörnten Ehegatten, welche ihren Weibern nachstellen. Ihr seid nicht etwa Eurem Gatten entlaufen, oder?«
»Ich bin Witwe.«
Er schmunzelte. Diese Antwort schien ihm zu gefallen.
»Kinderlein?«
Wollte er jetzt wieder unverschämt werden?
»Auch mein einziges Kind ist gestorben«, antwortete Johanna wahrheitsgemäß.
»Dann könnte wahrlich die Stadt die einzige Rettung aus Eurer trostlosen Lage sein. Mägde werden dort durchaus gesucht. Das ist eine gute Möglichkeit für anständige Weiber, in einem reichen Haushalt unterzukommen. Derlei Haushalte gibt es viele in Hameln.«
»Wisst Ihr etwa einen, in dem eine fleißige Hand fehlt?«
»Durchaus.«
»Wollt Ihr es mir sagen?«, bohrte Johanna weiter.
»Erst gestern musste ich Gerda Klinger vor die Tore führen, weil sie sich ein Kind hat machen lassen. Das darf einer Magd nicht passieren. Sie war bei der Witwe Pfeffersack beschäftigt, und die dürfte jetzt nach einem neuen Mädchen Ausschau halten. Oh, hat die geschimpft.« Und in Erinnerung an den gestrigen Tag klopfte er sich lachend auf die Schenkel.
»Wer, die Magd?«
»Nein, die Pfeffersack. Die wollte das lose Stück behalten. Hätte nichts dagegen gehabt, deren kleinen Bastard in ihrem Hause großzuziehen. Im Grunde ist sie nämlich ein guter Mensch. Aber was zu weit geht, geht zu weit.«
»Und was habt Ihr damit zu tun?«
Jetzt wurde er wieder stiller und spielte mit seinen Fingern verlegen an der Tischkante herum.
»Mein Name ist Justus Carnifex. Ich bin der Scharfrichter der Stadt Hameln.«
Johanna musste schlucken. Sie hatte sich tatsächlich mit einem Henker unterhalten. Das war eine Sünde, die es in jedem Fall zu beichten galt. Kein Wunder, dass sich ein unehrenhafter Geselle wie er in einer abgelegenen Spelunke wie dieser herumtrieb. Denn so wichtig seine Tätigkeit für das Fortbestehen von Sicherheit und Ordnung in einer Stadt auch war, so wenig wollte man mit diesen Leuten zu tun haben. Scharfrichter wurden gemieden, man sprach nicht mit ihnen, saß nicht mit ihnen an einem Tisch und ließ sie nach Möglichkeit erst recht nicht in sein Haus, denn das brachte mehr als Unglück: Es war eine Schande.
Dennoch beschloss Johanna, weiter mit ihm zu reden, denn das, was er da sagte, interessierte sie trotz aller Widrigkeiten ungemein.
»Was habt Ihr denn mit der schwangeren Magd gemacht?«
»Nichts. Fortgejagt habe ich sie. Das wurde mir aufgetragen, und was mir aufgetragen wird, das muss ich machen. Aber wie ich die kenne, lässt die sich den Balg von der nächstbesten Engelmacherin wegmachen und ist in der nächsten Woche wieder zurück in der Stadt.«
»Und ihr Platz bei der Frau Pfeffersack ist frei?«
»Ja, aber die heißt nicht Pfeffersack. So wird sie nur geschimpft. Gänslein ist ihr Name, und sie lebt im prächtigsten Haus am Pferdemarkt. Das werdet Ihr nicht verfehlen, wenn Ihr denn dort morgen vorsprechen wollt.«
»Habt vielen Dank für den Ratschlag.« Johanna lächelte etwas gequält. Sie fühlte sich mehr als unwohl, eine Empfehlung von einem Henker erhalten zu haben. Ein schlechtes Omen konnte das bedeuten. Dennoch beschloss sie, am morgigen Tage das Haus der Witwe Pfeffersack aufzusuchen. Schlechtes Omen hin oder her, sie musste nun einmal von etwas leben. Und besser, sie nahm den Rat eines Unehrlichen an, als dass sie sich letzten Endes gezwungen sah, selbst unehrlich zu werden, indem sie in ein Hurenhaus eintrat.
Während sie wieder nachdenklich auf die nun regungslose Schabe starrte, erhob sich der junge Mann von seinem Platz und ging zur Tür.
»Ich muss nun zurück in die Stadt. Ein wenig Schlaf sollte schon sein, bevor ich morgen in aller Früh die Jauchegrube des Bürgermeisters aushebe. Eine geruhsame Nacht wünsche ich Euch. Vielleicht sieht man sich eines Tages hinter den Mauern Hamelns wieder. Doch keine Sorge, gute Frau, ich werde Euch nicht böse sein, wenn Ihr dann so tut, als hätte es nie ein Gespräch zwischen uns gegeben.«
Er nickte höflich und verschwand dann in der stürmischen Dunkelheit.
Kapitel IV
Es waren nur wenige Schritte, die Margarethe Gänslein von ihrem großen Kaufmannshaus hinüber zum Rathaus gehen musste, sie hatte sie seit gestern mehrere Male zurückgelegt – und jedes Mal vergeblich.
Beschwichtigt hatte man sie, und die Verantwortlichkeiten von einem zum anderen geschoben. Der Bürgermeister hatte sie zum zuständigen Ratsherrn Knipping verwiesen, welcher wiederum von gar nichts wusste und behauptete, allein der Vogt sei für derlei Kleinigkeiten zuständig. Dieser wiederum verweilte bereits seit mehr als einer Woche weit entfernt auf der Erichsburg bei seinem Herrn, dem Herzog von Calenberg, um ihn wieder einmal über das Treiben in der selbstbewussten Stadt Hameln zu unterrichten.
»Gute Frau Margarethe, wo kämen wir denn hin, wenn ein jeder für sich eine Sonderbehandlung in Anspruch nähme? Auch meine Magd würde der Stadt verwiesen, wäre sie nicht imstande, sich gebührlich zu betragen.«
Das waren die Worte des Bürgermeisters, als Margarethe an diesem Tag erneut in sein Amtszimmer gestürzt kam. Wohlgenährt und in eine schwarze Amtsrobe gekleidet, saß er behäbig hinter seinem mächtigen Pult und sprach langsam und dabei herablassend lächelnd auf sie ein. Ganz so, als habe er in Margarethe Gänslein eine Närrin vor sich.
»So, eine Sonderbehandlung nennt Ihr mein Ansinnen?«, erwiderte diese. »Nun, auch die Stadt Hameln erhielt von meinem verstorbenen Gemahl und selbst von meiner Wenigkeit durchaus die eine oder andere Sonderbehandlung. Ich erinnere nur an das Bedrängnis während der Stiftsfehde und das angebliche Wunder des Bonifatius, durch welches die Belagerer plötzlich zum Abzug bewogen wurden. Von wegen Wunder! Handsalben waren es, die man ihnen zahlte! Und wer trug dazu den Großteil bei? Niemand anders als mein Gemahl Reinold Gänslein. Ganz zu schweigen von den Steuern, die unser Handel Jahr für Jahr auf die Stadtwaage bringt.«