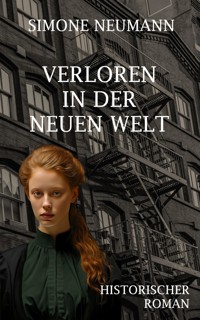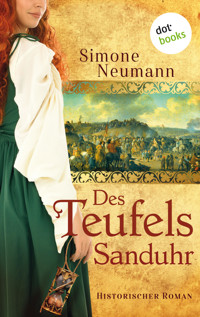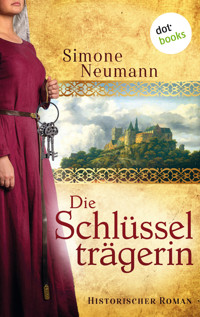3,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als die Pest die Welt in Atem hielt … Der historische Roman »Die Flucht der Gauklerin« von Simone Neumann jetzt als eBook bei dotbooks. Westfalen im 14. Jahrhundert. Im letzten Moment ist Maja ihrem brutalen Ziehvater entkommen – aber weiß er, wo sie sich vor ihm versteckt? Für die junge Frau gibt es keinen anderen Ausweg, als sich einer Siedlergruppe anzuschließen, die auf dem gefahrvollen Weg ins weit entfernte Mähren ist – dort, so heißt es, wartet ein Leben in Freiheit und Frieden auf sie. Doch je weiter sie ziehen, umso mehr wächst die Angst vor dem Schrecken, der über das Land hereingebrochen ist: der schwarze Tod. Hat der Kreuzritter Konrad, der seit einiger Zeit mit ihnen reist, die grausame Krankheit aus dem Heiligen Land hierhergebracht? Und während Maja hin- und hergerissen ist zwischen der Furcht vor der Pest und den zarten Gefühlen, die sie für Konrad hegt, wächst ihre Angst, dass ihr Ziehvater ihr immer noch unbarmherzig auf den Fersen ist … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der historische Roman »Die Flucht der Gauklerin« von Simone Neumann – spannend wie ein Krimi und so lebensecht geschrieben, dass man sich in die abenteuerliche Epoche des Spätmittelalters versetzt fühlt, jene Zeit, in der das heutige Europa wie selten zuvor von religiösen und politischen Krisen erschüttert wurde … und der Pest, jener Pandemie, die ganze Landstriche entvölkerte. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Westfalen im 14. Jahrhundert. Im letzten Moment ist Maja ihrem brutalen Ziehvater entkommen – aber weiß er, wo sie sich vor ihm versteckt? Für die junge Frau gibt es keinen anderen Ausweg, als sich einer Siedlergruppe anzuschließen, die auf dem gefahrvollen Weg ins weit entfernte Mähren ist – dort, so heißt es, wartet ein Leben in Freiheit und Frieden auf sie. Doch je weiter sie ziehen, umso mehr wächst die Angst vor dem Schrecken, der über das Land hereingebrochen ist: der schwarze Tod. Hat der Kreuzritter Konrad, der seit einiger Zeit mit ihnen reist, die grausame Krankheit aus dem Heiligen Land hierhergebracht? Und während Maja hin- und hergerissen ist zwischen der Furcht vor der Pest und den zarten Gefühlen, die sie für Konrad hegt, wächst ihre Angst, dass ihr Ziehvater ihr immer noch unbarmherzig auf den Fersen ist …
Über die Autorin:
Simone Neumann, geboren 1977 in Höxter, lebt heute in München. Nach ihrem Studium der Geschichte und Slavistik arbeitete sie zunächst bei einem Verlag als Lektorin und machte sich nach der Geburt ihrer Kinder als Redakteurin und Autorin selbstständig.
Bei dotbooks erschienen Simone Neumanns fundiert recherchierten historischen Romane, die sie stets mit einer fesselnden Spannungsnote würzt: »Des Teufels Sanduhr«, »Die Schlüsselträgerin« und »Das Geheimnis der Gewürzhändlerin« (ursprünglich unter dem Titel »Das Geheimnis der Magd« erfolgreich).
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Copyright © der Originalausgabe © 2013 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung zweier Motive von shutterstock/Martina Janina und shutterstock/Mihail Guta sowie des Gemäldes »Flusslandschaft mit Dorf« von Jan Peeter van Bredael
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-796-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Flucht der Gauklerin« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Simone Neumann
Die Flucht der Gauklerin
Historischer Roman
dotbooks.
Prolog
Messina auf Sizilien, im Oktober 1347
»Ihr seid Brüder vom Deutschen Orden, nicht wahr?«
Konrad von Tiefenbrunn nickte nur missmutig. Das böswillige Gesicht des Mannes gefiel ihm nicht. Er war es gewohnt, in seinem weißen Umhang mit dem schwarzen Kreuz nicht überall auf Gegenliebe zu stoßen. Dennoch konnte er sich nur selten dazu durchringen, den meist bloß durch Blicke, Worte und Gesten geäußerten Feindseligkeiten der Menschen mit der gleichen Milde zu begegnen, wie sie seinem Bruder Crispin zu eigen war.
»Was wollt Ihr hier?«, fragte der sonnengegerbte, kleingewachsene Wirt weiter, der sich keine Mühe gab, seine Abneigung zu verbergen.
»Wein und eine warme Mahlzeit, wenn’s beliebt«, knurrte Konrad und fasste dabei unwillkürlich unter seinen Mantel und an den Griff seines großen, scharfen Schwertes. Dieser Sizilianer begann ihm auf die Nerven zu gehen.
»Das meinte ich nicht«, erwiderte der Wirt ungerührt, während er bereits dabei war, den fünf ungeliebten Gästen von seinem schlechtesten Wein einzuschenken. Er entschuldigte sich nicht einmal, als einige rote Tropfen auf den Mantel des jungen Bruders Friedrich spritzten.
»Was meinst du dann?«, fragte Konrad und kostete von dem bitteren Wein, woraufhin er angewidert das Gesicht verzog.
»Ihr Leute aus den Ländern jenseits der Alpen habt hier nichts mehr verloren. Die Zeiten der Züge ins Heilige Land sind vorüber, keines Eurer Schiffe muss mehr von Sizilien aus übersetzen. Und auch die Ära Eurer Kaiser aus dem Geschlechte der Staufer hat ein trauriges Ende gefunden. Alle Bande zwischen Euch und unserer Insel sind nun gelöst, wir brauchen Euch hier nicht mehr und haben Euch hier nie gebraucht.«
Das waren klare Worte.
»Ich verstehe«, erwiderte Konrad bloß und kippte mit einer gleichgültig wirkenden Geste den Fusel auf den Boden. »Jetzt hätten wir gerne besseren Wein und etwas zu essen.«
Dabei griff er erneut unter seinen weißen Mantel und holte aus einem dort verborgenen Beutel drei Silbermünzen hervor, die er vor dem Wirt auf den Tisch warf. Dieser machte sogleich große Augen, und sein Gesicht begann sich wie durch ein Wunder zu erhellen.
»Wie der Herr wünschen«, stieß er rasch aus, langte flink nach dem Geld und dem Krug mit gepanschtem, saurem Wein und kehrte im Nu mit einem größeren Krug zurück, dessen Inhalt von kräftigerem Rot und zudem auch kräftigerem Duft war.
»So wollen wir es haben«, grinste Konrad und zwinkerte seinen Brüdern zu. »Hier auf Sizilien ist es doch nicht notwendig, einen Wein zu trinken, der schlimmer schmeckt als unsere Kulmer Traube.«
Die anderen lachten, wohl wissend, wie ungenießbar der ordenseigene Rebensaft aus dem kalten Nordosten des Kontinents war.
Sie waren fünf an der Zahl: Konrad, dessen Ritterbruder Crispin, dann noch der junge Ritteranwärter Friedrich sowie die beiden gestandenen, tapferen Sariantbrüder Walter und Bertold, denen allein ihre nichtadelige Herkunft den Ritterstand versagte. Eine monatelange Reise durch zahlreiche Balleien, die Zweigstellen ihres Ordens, hatten sie hinter sich. Aufgebrochen von der unweit des nördlichen Ostmeeres gelegenen Marienburg, hatten sie in einem großen Bogen Thüringen, Westfalen, Lothringen und Franken durchquert, überall Station gemacht, um dann den beschwerlichen Weg über die Alpen zu den Ordensbesitzungen in Italien anzutreten. Im Gepäck einen Auftrag ihres Hochmeisters Heinrich von Dusemer. Vordergründig ging es dabei um die Visitation der Balleien. Konrad und dessen Leute sollten deren wirtschaftliche, aber auch moralische Situation in Augenschein nehmen und darüber Bericht erstatten – eine wichtige Aufgabe, die dem Hochmeister in dessen weit abgelegenem Sitz ein großes Anliegen war. Tatsächlich gab es da aber noch einen weiteren, einen unausgesprochenen Grund für diese lange Reise: Heinrich von Dusemer war es wichtig, Konrad von Tiefenbrunn für eine ganze Weile fern der Marienburg zu wissen. Es hatte einen Vorfall gegeben, in welchen der mitunter störrische, leicht aufbrausende und wenig umsichtige Ritter verwickelt gewesen war – ein zunächst unbedeutender Vorfall, ein Streit oder vielmehr eine Schlägerei mit zwei jungen Edelleuten. Leider jedoch hatte diese handfeste Auseinandersetzung eine ganze Kette unangenehmer Folgen nach sich gezogen, die den Hochmeister dazu zwangen, seinen Günstling Konrad von Tiefenbrunn möglichst weit fortzuschicken, um nicht nur diesen, sondern auch die Reputation des ganzen Ordens zu schützen.
So waren Konrad und seine Leute nun von der Ostsee bis ans Mittelmeer gezogen, wo ihre letzte Station Sizilien hieß. Auf der Insel verfügte der Orden über Niederlassungen und Besitzungen, die noch aus den ruhmreichen Zeiten der Kreuzzüge stammten, und diese Güter galt es zu halten und zu verwalten. Grundsätzlich war das Halten und Verwalten sowie das Mehren von Land mittlerweile zum Hauptanliegen der einst so wehrhaften Kreuzritter geworden, die vor vielen Generationen ins Heilige Land ausgezogen waren, um dort gegen Feinde des christlichen Glaubens zu kämpfen, Pilgern Schutz und Geleit zu geben sowie Kranken und Bedürftigen in einem eigens errichteten Hospital beizustehen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hatten sie eine durchaus fruchttragende Wandlung durchlaufen – und das nicht zuletzt dank ihres einflussreichen Großmeisters Hermann von Salza, der es verstanden hatte, die Zeichen der Zeit zu erkennen und mit einem Haufen aus dem Heiligen Land vertriebener Kreuzzügler einen eigenen Staat an der Ostsee zu gründen. Einen aufgrund seiner durchdachten Organisation immer reicher werdenden Staat, der aus Abenteurern Kaufleute werden ließ, die es an klugem Wirtschaftssinn durchaus mit den Venezianern oder Florentinern aufnehmen konnten.
»Na, Ihr schwarz-weißen Ordensritter habt es besser getroffen als die Templer. Ihr musstet nicht auf den Scheiterhaufen, als Euer König und der Papst Eure ehrenhaften Dienste nicht mehr benötigten«, scherzte nun der kleine Wirt, während er ihnen eine üppige Platte voller Meeresfrüchte, frischem Brot und in Knoblauch eingelegtem Gemüse vorsetzte. Seine Laune war nun offenbar bestens, was an den Silberlingen lag, die hell in seiner Tasche klangen.
Konrad zuckte mit den Schultern. Er hatte wenig Lust, mit dem plötzlich freundlich gewordenen Kerl zu reden, und griff stattdessen lieber nach einer herrlich duftenden Languste.
»Es war eine Schande, was den Templern widerfahren ist«, meldete sich jedoch Bruder Crispin de Montbard aufgebracht zu Wort. Er stammte aus der Familie eines der neun Gründer des Templerordens und vertrug es nicht, wenn man schlecht über diese vor wenigen Jahrzehnten zerstörte Gemeinschaft sprach. »Keine der böswilligen Anschuldigungen, die ihnen entgegengebracht wurden, entsprach der Wahrheit.«
Konrad kannte Crispin gut und wusste, dass es nur wenige Themen gab, die es vermochten, den sonst so ruhigen und besonnenen Mann zur Weißglut zu bringen, und die hinterhältige, grausame Zerschlagung des Templerordens zählte zu diesen Themen. Crispin wäre aufgrund seiner Herkunft gewiss eher den Templern als den Deutschordensrittern beigetreten, wenn Erstere nicht in Crispins Jugend von König Philipp dem Schönen – aus reiner Habgier, wie es hieß – als Ketzer verbrannt oder vertrieben und ihr Orden aufgelöst worden wäre.
Kam man auf diese schrecklichen Ereignisse zu sprechen, so konnte Crispin sehr ungemütlich werden. Deshalb war es auch äußerst unklug von dem sizilianischen Wirt, nun eine mehr als eindeutige Bewegung mit seinem Unterleib zu machen, die in verulkender Form auf die angeblich sodomitischen Vergehen der Templer hinweisen sollte, denen man nachgesagt hatte, ihr Keuschheitsgelübde nur in Hinsicht auf körperliche Nähe zu Weibsvolk eingehalten zu haben.
»Untersteh dich!«, fuhr Crispin ihn an. Er war aufgestanden und kurz davor, sein Schwert zu ziehen. Ruhig griff Konrad nach dem Arm des Freundes und forderte ihn mit einem entschiedenen Nicken auf, sich wieder zu setzen.
»Erzähl von den Seeleuten aus Kaffa, Wirt«, meinte Konrad nun, an den Gastgeber gewandt, um von den Templern abzulenken, indem er ein Gerücht ansprach, welches sie auf ihrem Ritt durch die Gassen der Hafenstadt Messina immer wieder aufgeschnappt hatten.
»Ah, du meinst die Genueser!«, der Wirt schien nicht nachtragend. Vielmehr beachtete er den noch immer vor Zorn geröteten Crispin gar nicht, sondern drückte sich zu dem jungen Friedrich auf die Bank und schenkte sich selbst von seinem den zahlenden Gästen gereichten Wein ein.
Friedrich sowie die Laienbrüder Walter und Bertold blickten sich bloß verdutzt an. Sie hatten bislang nicht ein Wort verstanden. Anders als Konrad und Crispin waren sie des Italienischen nicht mächtig und blieben deshalb auch ahnungslos, als der Wirt jetzt die tragische Geschichte erzählte, welche über die vor drei Tagen von der Krim eingetroffenen Seeleute aus Genua im Umlauf war.
»Gegen die wilden Tataren haben sie gekämpft, die Genueser. In Kaffa, das ist eine ihrer Niederlassungen am Schwarzen Meer. Die Tataren belagerten die Stadt schon eine ganze Zeit. Alles sah danach aus, als hätten sie die Genueser bald ausgehungert, aber dann begann der Tod unter den Wilden um sich zu greifen. Einfach dahingerafft haben soll es einen großen Teil von ihnen, wie die Fliegen sollen sie gestorben sein. Eine schreckliche Seuche. Ihren Ursprung hat sie in Asien, so sagt man, wo eines Tages Blut und Schlangen vom Himmel geregnet kamen, was einen ungeheuren Gestank und damit die Pestilenz auslöste. Und die Tataren hatten diese Seuche nach Kaffa getragen. Die Genueser konnten es von den Stadtmauern aus beobachten, wie die gottlosen Wilden mir nichts, dir nichts reihenweise umfielen. Doch Barbaren wären keine Barbaren, wenn ihnen nicht barbarische Einfälle in den Sinn kämen. Sogar in ihrer eigenen größten Not. Wisst Ihr, was die überlebenden Tataren gemacht haben? Na, wisst Ihr es, Deutsche Ritter?«
»Sie haben die Leichen ihrer eigenen Leute über die Mauern katapultiert, um den Genuesern in Kaffa die Luft zu verpesten«, antwortete Konrad mit ruhiger Stimme, die sich deutlich von der des temperamentvoll erzählenden Sizilianers unterschied.
»Ja, Ihr habt es also schon gehört, werter Ritterfreund. Widerwärtig sind sie, die Barbaren, aber wem sage ich das?« Und mit einem kecken Blick auf sein Gegenüber machte der Wirt eine kurze Erzählpause, um herauszufinden, ob Konrad die Spitze verstanden hatte. Er hatte verstanden, doch es bekümmerte ihn nicht mehr. Hungrig griff er mit seinen von Olivenöl triefenden Fingern erneut auf die sich allmählich leerende Platte und nahm sich eine Handvoll Muscheln, die er mit den Zähnen knackte.
Ganz so, als sähe er sich durch diese Geste in seiner Meinung über die in seinen Augen ebenfalls barbarische Herkunft seiner Gäste bestätigt, nickte der Wirt und fuhr mit seinem Bericht fort: »Dann aber, nach wenigen Tagen, verschwanden die Tataren. Ihrer wurden immer weniger. Das Sterben unter ihnen wollte kein Ende nehmen. Aber mit dem Gestank ihrer als Geschenk gereichten Leichen ist der faulige Wind tatsächlich in Kaffa eingedrungen, sodass das Sterben auch dort begann. Wer von den Genuesern es vermochte, der bestieg ein Schiff und trat schleunigst die Heimreise an. Auch unterwegs auf dem Meer musste so manch einer von ihnen tot über Bord geworfen werden. Die wenigen, die nun vor drei Tagen lebendig den Hafen von Messina erreichten, lassen sich jetzt in den Freudenhäusern und Tavernen gesundpflegen. Sie sind dem Unglück um Haaresbreite entgangen.«
»Na, dann hat ja wenigstens ihnen der Himmel beigestanden«, meinte Konrad kauend, während sein Freund Crispin entsetzt den Kopf schüttelte. Crispin hatte als einer der wenigen unter den Ordensrittern noch Erfahrungen im Spitaldienst gesammelt, und bei den Worten des Wirtes stellten sich ihm die Nackenhaare auf.
»Denkst du wirklich, das Übel sei mit den letzten Toten im Meer versunken?«, fragte er den Wirt. Sein Tonfall war nun nicht mehr wütend wie zuvor, vielmehr klang er traurig und warnend.
Er musste jedoch nicht auf eine Antwort des Wirtes warten, denn diese erscholl urplötzlich und dröhnend von draußen, aus der engen, langen Gasse. Ein Klagen aus mehr als fünfzig Kehlen war zu vernehmen. Eine immer größer werdende Menschentraube zog durch die Straßen von Messina. Sie war aus dem Hafenviertel herbeigekommen, dem Ort, an dem die Flüchtlinge aus Kaffa Herberge gefunden hatten. Schnell und unerwartet war dort etwas geschehen, das die Hafenbewohner in diesen verzweifelten Aufruhr versetzte.
»Mortalega grande, Mortalega grande«, riefen sie, immer und immer wieder.
Es war ein bitterlicher Gesang, der sämtlichen Anwesenden durch Mark und Bein ging. Die meisten der sizilianischen Gäste des Wirtshauses standen sofort auf und strömten hinaus, mit ihnen der Wirt. Nur die Gesandtschaft der Ordensritter blieb starr an ihrem Tisch sitzen.
»Was rufen sie da?«, fragte der junge Friedrich mit bleichem Gesicht.
»Das große Sterben«, übersetzte Konrad die Klageworte und schaute besorgt zu dem mit einem Male ebenfalls blass werdenden Crispin hinüber. Der letzte Bissen blieb ihm dabei im Halse stecken.
»Messina stirbt. Ich hatte es befürchtet.«
Kapitel 1
Im selben Jahr in einem kleinen Dorf in Westfalen
Der Herrgott hatte ihm diese Frau gesandt.
Der Überzeugung war der Bauer Ulrich Filzhut bereits am Tage ihres plötzlichen Erscheinens in seiner bescheidenen Heimstatt gewesen. Und dieser Überzeugung war er auch noch ein Jahr später, obwohl die übrigen Männer und auch die Weiber aus dem Dorf es anders sahen. Und mit dieser ihrer Meinung hielten sie nicht hinterm Berg, raunten Ulrich auf den schmalen Feldwegen, sobald er ihnen mit seinem Karren entgegenkam, Ermahnungen zu, warnten ihn nach einem jeden Kirchgang oder redeten eindringlich auf ihn ein, wenn er – was selten der Fall war – den Dorfkrug aufsuchte.
Eine Undurchschaubare sei sie, eine Fremde, eine Verteufelte gar, viel zu schön für einen alternden, gebeutelten Mann wie ihn. Ob er sich nie frage, woher sie stamme? Ob er sich nie frage, was sie ausgerechnet auf seinen erbärmlichen Hof getrieben habe? Ob er sich nie frage, was ihr eigentliches Ansinnen sei? So oder ähnlich waren ihre Worte.
Ja, die zweite Frau des Bauern Filzhut war wahrlich kein gewöhnliches Weib, und sie gab sich auch nur wenig Mühe, ihren zweifelhaften Leumund zu verbessern. Zwar benahm sie sich sittsam und war fleißig, aber im Gegensatz zu den anderen Frauen des Dorfes und seiner Umgebung legte sie keinen Wert darauf zu reden. Sie sprach mit kaum jemandem. Wäre sie stumm gewesen, so hätte man ihre Verschwiegenheit verstehen können. Doch sie war nicht stumm, sie konnte sprechen und tat es auch, wenn es um das Nötigste ging. Doch darüber hinaus sagte sie nichts. Kein Wort.
War ihr Verhalten den Menschen im Dorf unheimlich, so erkannte Ulrich in ihrer Zurückhaltung einen Segen. Er liebte sie, hielt sie für einen Engel, eine Himmelsbotin, die ihm niemand anders als seine verstorbene Elsa im Auftrag der Mutter Gottes auf die Erde geschickt hatte, um für ihn, den Witwer, und seine drei Kinder zu sorgen. Und sie sorgte in der Tat gut für sie, war emsig, sauber und sich keiner Arbeit zu schade. Sie kümmerte sich rührend um die Kinder, um das Haus, den Garten, den Stall und das Vieh. Sie kümmerte sich auch um Ulrich, verweigerte sich ihm niemals, war immerzu gütig, lauschte seinem Kummer, seinen Sorgen und betete mit ihm. Nichts, aber auch rein gar nichts gab es an diesem Weib zu beanstanden. Es sei denn, man war interessiert an ihrer Vergangenheit und ihrer Herkunft, über welche sie entschieden den Umhang des ihr eigenen Schweigens hüllte.
Keine sieben Tage hatte Elsa unter der Erde geruht, da war Marie plötzlich aufgetaucht. Elsa hatte lange gelitten, nicht mehr arbeiten können, war rasch dünner und dünner geworden, bis schließlich nur noch ein hohläugiges, mit fahler Haut überzogenes Gerippe in dem kleinen Bett des Bauernhäuschens gelegen hatte. Für alle war es eine Erlösung gewesen, dass Gott sich schließlich ihrer erbarmte und sie zu sich nahm. Dennoch war die Trauer groß und Ulrich noch ganz blass und benommen, als es eines Abends leise an seine Kate geklopft hatte.
Spät war es gewesen, starker Regen war gefallen. Ulrich hatte geglaubt, der Pfarrer erbitte Einlass, um wegen der Seelenmessen anzufragen, von denen sich der arme Bauer lediglich eine einzige würde leisten können. Doch nicht der fettleibige Pfarrer hatte vor der Tür im Regen gestanden, sondern eine durchnässte, zitternde, blutende Frau. Eingehüllt in einen grauen Wollmantel, hatte sie Ulrich aus großen Augen flehentlich angeblickt und war dann auf der Schwelle zusammengebrochen. Er hatte sie aufgehoben und auf sein Lager gebettet, und nachdem sie am folgenden Morgen erwacht war, blieb sie. Sie blieb bei Ulrich und seinen Kindern. Man zahlte dem Grundherrn den Stechgroschen, galt somit als verheiratet und lebte seither in Zufriedenheit beisammen.
Ja, Ulrich fühlte sich zeitweise sogar glücklich in diesem neuen Leben.
Nicht so Marie.
Doch darüber sprach sie nicht.
»Du kannst mich nicht verlassen! Ich werde dich finden!«
Von diesen Worten erwachte sie in nahezu jeder dritten Nacht, wenn sie neben ihrem treuen Ulrich in dessen engem Bettkasten ruhte. Ein Albtraum war es, wiederkehrend und zukunftsweisend, denn Marie glaubte fest daran, dass diese Drohung sich eines Tages erfüllen würde. Dann nämlich, wenn er, der ihr so deutlich in diesem Traume erschien, leibhaftig vor ihr stünde.
Er, der bei ihr gewesen war, seitdem sie hatte denken können. Ihr Ziehvater, ihr Begleiter, ihr eigentlicher Gatte. Mit nur zwei Jahren war sie von ihrer Mutter für ein Stück Speck, ein Ei und einen schmutzigen Taler an ihn verkauft worden. Damals in Köln, zu Füßen des unfertigen Domes, war dies gewesen, als die Mutter sich zusätzlich rücklings in eine Nische des Gotteshauses zwängte und er seinen entblößten Unterleib stoßweise an ihr Hinterteil drückte. Danach hatte er das im Dreck sitzende Kind gegriffen und es mit sich genommen. Marie war bei ihm groß geworden, hatte von ihm einiges gelernt: Seiltanz, Singen, Handlesen, Lügen, Stehlen und sich aus dem Staube machen – auf all das verstand sie sich bereits mit fünf Jahren bestens. In den entferntesten Gegenden kamen sie herum, zu Fuß meist, mitunter auf einem gestohlenen Wagen. Oft wurden sie bespuckt, verjagt, verfolgt, litten unter Hunger, Durst und Kälte, aber dennoch blieben sie am Leben, obwohl Marie sich bereits als Kind häufig gewünscht hatte, sterben zu dürfen.
Doch wirklich schrecklich war es erst geworden, als ihre Brüste zu wachsen begannen und die monatlichen Blutungen einsetzten. An jenem Tage veranstaltete er ein Freudenfest für sie beide, er schmückte Marie mit Blumen, kaufte ein ganzes gebratenes Huhn und ließ es sie allein essen. Nicht einmal mit seinen geliebten zahmen Ratten, die ihm sonst wichtiger waren als jedes menschliche Wesen, hatte sie teilen müssen. In der Nacht dann wurde sie erstmals zu seiner Geliebten. Und blieb es dreizehn schreckliche Jahre lang.
Sie hörte in diesen Jahren auf zu zählen, wie oft er mit ihr zu zwielichtigen Hebammen, alten Zigeunerinnen und anderen Engelmacherinnen ging – je nachdem, wo sie sich gerade befanden, ob auf dem Lande oder in der Stadt –, nein, sie zählte nicht mehr, verdrängte die Schmerzen, die Demütigungen, stumpfte ab und fügte sich.
Dann – sie hatte bereits ihr fünfundzwanzigstes Jahr erreicht – wurde sie uninteressant für ihn. Sie genügte ihm nicht mehr, und er kaufte sich in einem kleinen Dorf bei einer armen Tagelöhnerfamilie ein neues Mädchen. Doch dieses Kind überlebte keine Woche in seiner Gesellschaft, es war nicht so stark, so robust, so stumpf wie Marie. Es starb in Maries Armen, nachdem er es gegen sechs Eier eine ganze Nacht lang an eine im Wald lebende Horde von ausgehungerten Aschenbrennern verliehen hatte.
Mit dem Tod dieses unschuldigen Mädchens sollte sich auch für Marie plötzlich alles ändern. In dem Moment, als sie den leblosen, geschändeten Körper zu Boden gleiten ließ, übermannte es sie – das Leben kehrte mit all seiner Wut und Verzweiflung in ihren ebenfalls geschändeten, aber noch nicht gänzlich toten Leib zurück. Rasend stürmte Marie auf den in der Sonne Schlummernden zu, riss das Messer an sich, welches in seinem Gürtel steckte, und stach blind auf ihn ein. Sie traf ihn überall, sie zerschnitt ihm die Haut im Gesicht, zog die Klinge durch sein rechtes Auge, sie rammte sie in seine Schulter, in seinen Rücken, stach ihn in Arme und Beine. Sie schrie dabei. Und als ihr das Messer aus den blutigen Händen glitt, schlug sie mit den Fäusten auf ihn ein. Erst als sie nicht mehr konnte, als sie völlig außer Atem war, als ihr fast schwindelig und übel vor Erschöpfung wurde, erst da ließ sie von ihm ab.
Doch er war nicht tot. Er lebte, lachte sogar noch, lachte sie an.
Marie meinte damals zum ersten Male in ihm den leibhaftigen Teufel zu erkennen. Ohne den Blick von der unberechenbaren Gestalt abzuwenden, griff sie erneut nach dem am Boden liegenden Messer. Sie war plötzlich ganz ruhig geworden, der Zorn war verraucht, Trauer und Müdigkeit hatten sich ihrer bemächtigt. Dennoch musste es sein. Sie würde diese Sache nun zu einem Ende führen müssen, sonst würde er ihr seinerseits ein Ende bereiten.
Als sie aber zum finalen Streich ausholte, ein letztes Mal zustechen wollte, da konnte sie nicht. Es war ihr nicht mehr möglich, es widerte sie an, ihn, den Wehrlosen, den Verletzten, aber nach wie vor so Mächtigen wieder berühren zu müssen. Entsetzt ließ sie das Messer fallen und taumelte davon.
Er aber raffte sich auf, blickte ihr aus dem verbliebenen Auge in seinem entsetzlich entstellten, blutüberströmten Gesicht nach und rief:
»Du kannst mich nicht verlassen! Ich werde dich finden! Das verspreche ich dir. Du gehörst mir.«
Ein ganzes Jahr war seither vergangen. Marie war damals bis tief in die Nacht hinein um ihr Leben gelaufen, hatte zahlreiche Meilen hinter sich gebracht, und auch am folgenden Tage war sie unermüdlich weitergehastet. Erst am zweiten Abend gönnte sie sich Ruhe. Sie war mehr tot als lebendig, als sie auf die nächstbeste Hütte in einem fremden Dorf zusteuerte und mit letzter Kraft an die Türe des Bauern Ulrich Filzhut schlug.
Und obgleich es Marie von da an besser erging als je zuvor in ihrem Leben, blieb dennoch die Angst. Die Zeit strich ins Land. Genügend Zeit für ihn, um zu genesen, um seine berüchtigte Rachsucht reifen zu lassen, um Nachforschungen anzustellen. Marie kannte ihn nur zu gut. Sie wusste, wie zäh, wie unnachgiebig er war. Er würde seine Drohung wahrmachen, er suchte sie längst. Und bald, da war sich Marie sicher, würde er sie finden. Von da an wäre ihr ruhiges und warmes Leben in der Hütte des Bauern Ulrich, umringt von dessen lebhaften Kindern, vorbei. Dann müsste sie wieder aufbrechen, wieder gehen, weiter und weiter durch die Fremde ziehen.
Aber wenn Marie ganz ehrlich zu sich war, dann war es genau das, was sie sich tief in ihrem Inneren wünschte. Sie wollte weiter, sie wollte fort von diesem sesshaften Leben, sie wollte wieder in die Ferne. Denn so wie in einem jeden Menschen, der den Großteil seines Lebens wandernd, pilgernd oder umherstreifend verbracht hatte, wohnte auch in ihr eine Unrast, die in manch behaglicher, inniger Stunde im Kreise der Familie Filzhut zu einer brennenden Qual werden konnte. Marie verabscheute dieses Gefühl. Sie hätte alles gegeben, um es abzutöten, doch das gelang ihr nicht. Immer wieder flammte sie auf, die Rastlosigkeit, zog wie tausend Nadelstiche durch sämtliche Glieder ihres Körpers und ließ Marie unvermittelt aufstehen und aus der Hütte rennen, nur um bald wieder zurückzukehren. Sie brachte es nicht übers Herz, den Witwer Ulrich und dessen Kinder zu verlassen. Auf ihre Weise liebte sie diese kleine Welt, in der sie Schutz und Geborgenheit gefunden hatte.
Ein verstecktes Dörfchen war es, ruhig und beschaulich. Am Fuße einer trutzigen Burg gelegen, war es eingeschlossen von fruchtbaren Hügeln, und bei gutem Wetter konnte man in der Ferne die Türme des reichen Klosters Marienmünster in der Sonne glänzen sehen.
Leider aber war dieses friedliche, besinnliche Bild, welches Marie sich so gern machte, nichts weiter als ein Trugbild, denn bereits seit Jahren herrschte alles andere als gutes Wetter. Die Sonne schien kaum, und die Türme des Klosters waren selbst im Sommer meist von einem grauen Regenschleier verhangen. Darum konnte man auch die Hügel mit ihren Feldern nicht mehr fruchtbar nennen, da das Korn verfaulte, falls es, nach dem bis in den Mai hineinreichenden Frost, überhaupt je gewachsen war. Im letzten Jahr hatte man von einer misslichen Lage gesprochen, in diesem Jahr, dem Jahre 1347, war bereits von einer drohenden, unausweichlichen Hungersnot die Rede.
Auf die Hilfe des Grundherrn, das wussten die Bauern, war nicht zu hoffen. Denn die Herren kamen und gingen. Waren es in einem Jahr zwei Ritterbrüder gewesen, die über sie herrschten, so wurden diese im nächsten durch die Ministerialen einer entfernten Adelsfamilie ersetzt, dann wieder sahen sich die nahen Benediktiner zuständig für das Einholen der Abgaben, und danach kam mit einem Mal wieder ein Burgherr aus dem Nichts zurück. Die Lehen wurden hin- und hergegeben, man befehdete sich, vertrug sich wieder, Rechte und Pflichten wurden verschachert, verliehen, verschenkt, und mit ihnen die daranhängenden Bauern. Diesen war es recht gewesen, solange sie von Brandschatzungen und Plünderungen durch Fehden verschont blieben und es ihnen gelang, mit den neuen Herren auch bessere Bedingungen auszuhandeln. So waren im Laufe der Zeit die Frondienste entfallen und die schwankenden Naturalabgaben in einen festen Pachtzins umgewandelt worden, den die Bauern in Form von Geld zu entrichten hatten. Das waren goldene Zeiten gewesen. Doch diese hatten sich bald wieder gewandelt.
Schuld daran trugen einerseits die wiederholt auftretenden, wetterbedingten Missernten der letzten zwanzig Jahre, und die Schuld daran trug auch – so hatte es der Dorfpfarrer mahnend von der Kanzel gepredigt –, dass, trotz wachsender Armut, die Leute keine Hemmungen kannten, sich schier grenzenlos zu vermehren. Und damit hatte er recht: Die Zahl der Menschen in Dörfern und Städten wuchs rasch, während andererseits das Essen immer knapper wurde. Da deshalb auch den Edlen langsam die Not ins Haus stand, verfielen sie bald darauf, Altes, längst Vergangenes wieder einzuführen: Der Frondienst kam zurück, und auch Naturalabgaben wurden wieder erhoben, ohne dass jedoch der Pachtzins gekürzt oder gar abgeschafft wurde. Es waren harte Zeiten, und viele befürchteten, darin nur die Vorboten eines noch schlimmeren Übels zu erkennen, eines Übels, welches bald kommen und den Tag des Jüngsten Gerichts einläuten würde.
Marie bekümmerten diese düsteren Prophezeiungen nicht, welche die Dorfbewohner in seltsamen Wolkenformationen, am Flug der Raben oder an der Farbe des Regens zu erkennen glaubten. Sie hatte dem Schrecken bereits ins Auge gesehen. Und nichts war so schrecklich wie das Leben mit dem Mann, den sie zwar nahe wähnte, von dem sie aber nicht wusste, dass er tatsächlich nur wenige Meilen entfernt in einem Walde zusammen mit einer Handvoll Mönchen lebte.
Kapitel 2
Seit nunmehr einem Jahr war dieser mystische, heilige, ja fabelhafte Ort Vitus Fips eine Heimat geworden. Nie jedoch hatte er ein Auge für die wunderbare Eigentümlichkeit seiner Wohnstatt besessen, deren Anblick für einen jeden anderen, der zum ersten Mal in diese Gegend kam, so unglaublich beeindruckend war: Vollkommen unerwartet ragten plötzlich, sobald man nach einem Marsch durch einen urwüchsigen Wald eine große Lichtung betrat, fünf enorme Felsen vor dem überraschten Pilger auf – Externsteine genannt. In den fernen Alpen hätte diese Formation nur wenig Aufsehen erregt, hier aber, inmitten des zwar hügeligen, aber dennoch sanften, begrünten Teutoburger Waldes, stellten die schroffen Gesteinsblöcke eine staunenswerte Sonderbarkeit dar. Man konnte sich nicht erklären, wie diese nicht von Menschenhand geschaffene Felsenburg einst an diesen Ort gekommen war – eine Gegend, die sonst keinerlei derartige Naturerscheinungen aufwies.
Bereits in heidnischen Zeiten hatten sich die Menschen darüber die Köpfe zerbrochen und die merkwürdigen Felsen zu ihrer Kultstätte gemacht, und auch jetzt, nach Einzug des Christentums, blieben sie ein heiliger Ort. Ein Ort, der gerade in den letzten Jahrzehnten Unmengen von Pilgern anzog, denn geschickte Gottesleute hatten diese fremdartige Kulisse gekonnt in einen Wallfahrtsort verwandelt, wo man bußfertigen Menschen die Möglichkeit bot, einen beeindruckenden Nachbau des Jerusalemer Höhlengrabes zu besuchen. Die Kreuzzüge waren lange vorüber, und mit der Rückkehr der letzten Ritter aus dem Heiligen Land sowie der endgültigen Eroberung Jerusalems durch die Mohammedaner war es frommen Pilgern und auch dazu verurteilten Sündern nur unter größten Gefahren möglich, den Originalschauplatz der Kreuzigung und Grablegung Christi aufzusuchen. Aber die zu diesem Zwecke kunstvoll bearbeiteten Externsteine boten einen willkommenen – und zudem weniger aufwendig zu erreichenden – Ersatz: Sie verfügten über eine in einer Höhle liegende Wallfahrtskapelle, einer ihrer Gipfel war zum Hügel Golgatha umgestaltet worden, ein geschickter Steinmetz hatte sogar das Grab Jesu in einen Felsen gehauen, und ein noch fähigerer Kollege hatte ein großes, eindrucksvolles Bild gemeißelt, welches auf äußerst lebendige Weise die Abnahme Christi vom Kreuze darstellte. Darüber hinaus – und das war nicht unwesentlich – waren an diesem Ort auch die gewünschten Ablassbriefe zu erhalten, ausgestellt von den hier in nahen Holzhütten wohnenden Mönchen, unter denen Vitus Fips nun seit Längerem lebte.
Man konnte sich also an diesen Pilgersteinen gegen eine kleine oder gern auch größere Spende von allerlei Sünden befreien und somit seine Zeit im Fegefeuer beträchtlich verkürzen. Darum wunderte es nicht, dass das Kommen und Gehen von Wallfahrern aus aller Herren Länder ein großes war. Die Aufgabe von Vitus Fips war die, sich um das Wohl der häufig erschöpften Menschen zu kümmern, da viele von ihnen am Ende ihrer Kräfte waren, sobald sie das Ziel ihrer Reise erreicht hatten. Das lag nicht allein an dem weiten Marsch. Nein, um die selbst oder vom Beichtvater auferlegte Pilgerschaft noch zu erschweren, gingen einige in mit schweren Steinen behangenen Ketten, andere mit Nägeln in den Schuhen, wieder andere verzichteten während der Reise vollkommen auf Nahrung. Es gab sogar solche, die ihren Weg auf allen vieren krabbelnd bestritten. Und die Wege waren mitunter sehr lang. Nicht nur aus dem Reich reisten die Pilger an, es gab auch solche, die aus Flandern, Tirol oder Polen hierherkamen.
Um einen dieser weit gereisten Pilger, der mit gegeißeltem, eitrig verschorftem Rücken vom Altvatergebirge in Mähren, welches zum Königreich Böhmen zählte, bis zu den Externsteinen gewandert war, kümmerte sich Vitus Fips seit einigen Tagen besonders ausgiebig.
Er tat dies nicht aus Nächstenliebe.
Das war eine ihm völlig fremde Gemütsregung. Nein, Fips hatte einen anderen, einen besseren Grund.
Der Pilger, ein etwa vierzigjähriger, kräftiger Holzfäller, lag im Sterben. Die durch eine mit Nägeln versehene, neunschwänzige Peitsche selbst zugefügten Wunden an seinem Rücken hatten sich zum Teil so stark entzündet, dass bereits ein Brand entstanden war und sich sogar Maden in einigen der offenen Stellen eingenistet hatten. Sein Fieber war hoch, er sprach wirr, verkrampfte Hände und Füße zu Klauen, doch der Tod wollte noch nicht kommen. Und das war gut so, denn Vitus Fips musste noch einiges in Erfahrung bringen, bevor sein Gast aus Mähren dahinschied.
Also pflegte und hegte er den siechen Mann, so gut es ging, und die an der Pilgerstätte lebenden Geistlichen waren mit dieser sorgfältigen, hingebungsvollen Arbeit ihres Schützlings sehr zufrieden.
Denn das, was die Mönche einst ihm getan hatten, das sollte er nun anderen tun. So lauteten die Erwartungen, welche die Gottesmänner in Vitus Fips setzten, den sie vor einem Jahr blutüberströmt und halbtot im Wald aufgefunden hatten. Sie hatten den anscheinend von Räubern übel zugerichteten Mann mühevoll gesundgepflegt und ihm danach gestattet, bei ihnen zu bleiben, um in ewiger Dankbarkeit geschwächten Pilgern nun seinerseits seine pflegende Hilfe anzubieten.
Fips tat, was man von ihm erwartete, obwohl es ihn anwiderte. Doch das ließ er sich nicht anmerken, vielmehr wartete er geduldig auf einen günstigen Moment. Bis dahin wollte er hier bei den Mönchen noch weitere Kraft schöpfen, um schließlich bereit für die Fortsetzung seines wahren Lebens zu sein. Und mit diesem mährischen Holzfäller war nun ein solcher Moment gekommen. Das Waschen von eitrigen Wunden, das Reinigen verkoteter Leiber, das Flicken stinkender Lumpen hatte sich tatsächlich gelohnt. Vitus Fips war sehr zufrieden.
»Ich wollte ihn nicht töten!«, stöhnte der Mann aus Mähren kraftlos.
Fips verdrehte die Augen. Diesen Satz hörte er nun schon zum hundertsten, nein, zum tausendsten Male, dabei war es etwas ganz anderes, was er aus dem Pilger, Wenzeslaus mit Namen, herausbringen wollte.
»Es war die Wut. Die Wut ...«, stöhnte der Fiebernde weiter, während Fips versuchte, ihm einen heißen Kräutertrank einzuflößen. Sie waren allein in einer der bescheidenen, aus unbearbeiteten Ästen gefertigten Hütten der Mönche, fernab von den übrigen, an den Felsen betenden und ruhenden Menschen.
»Ja, es war die Wut«, bestätigte Fips gelangweilt die Worte des Kranken. »Ich weiß, dass du deinen Nachbarn nicht töten wolltest. Doch es ist geschehen, und nun hast du deine Buße getan. Mehr noch, dein eigenes Leben wirst du geben für diese Tat. Das ist mehr, als Gott von dir verlangt hat. Glaube mir, Wenzeslaus, dein letzter Weg wird dich in den Himmel führen. Das ist gewiss.«
Der Holzfäller lächelte und griff mit seinen sich immer wieder verkrampfenden Fingern nach der verkrüppelten Hand seines Heilers.
»Du bist ein guter Mensch, Bruder Vitus. Ich bin froh, dich hier angetroffen zu haben. Mein Geheimnis ist gut bei dir aufgehoben.«
Fips nickte. Ein ungeduldiger, gieriger Zug huschte über sein entstelltes Gesicht, doch er fing sich schnell und setzte stattdessen eine sanfte, mitfühlende Miene auf.
»Ich verspreche dir, Wenzeslaus, die Kunde von deinem Tod und von deinem geheimen Fund an dein Weib und deine Kinder weiterzugeben. Doch du solltest mir noch einiges darüber berichten, denn ich fürchte, dass ein törichtes Weib und unmündige Bälger mit einer Karte allein nur wenig anzufangen wissen.«
Fips griff unwillkürlich an seine graue Laienbruderkutte, unter welcher er im Hüftbereich erleichtert das eingerollte Stück Pergament spürte, das er sich mit einem Strick an den Leib gebunden hatte. Es handelte sich dabei um die Karte, die Wenzeslaus in der letzten Nacht unter großen Mühen und unter ständigem Antreiben seines Pflegers gezeichnet hatte. Eine Karte, die im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert war.
»Ja, du hast recht.« Der Holzfäller blickte Fips mit blutunterlaufenen Augen an, seine Lippen waren trocken und gerissen, sie zitterten stark. Fips starrte erwartungsvoll auf diesen Mund, aus dem er nun neue, wichtige Informationen erwartete.
Doch es kam nichts. Nur ein erneutes, qualvolles Stöhnen.
Eine entsetzliche Wut breitete sich in Fips aus. Am liebsten hätte er diesem stinkenden, tumben Kerl den Schwamm, den er nun in Händen hielt, aufs Gesicht gedrückt, damit er endlich erstickte und seinem langweiligen Leiden ein Ende gesetzt war. Doch stattdessen beherrschte sich Fips und wrang den Schwamm über den Lippen des Kranken aus, benetzte diese somit mit Wasser und hoffte, dass Wenzeslaus nun zum Weitersprechen in der Lage war.
Ja, er war es.
»Der Eingang der Höhle liegt in einer tiefen, engen Schlucht, Dachsschlucht genannt«, flüsterte er leise und langsam. »So tief und eng ist sie, dass bislang niemand dort hineingestiegen ist. Außerdem, so heißt es, sei der Ort verwunschen. Keine Menschenseele wagt sich freiwillig dorthin. Beim Holzfällen verirrte ich mich und stürzte tief hinein, überlebte glücklich und fand dort unten die Höhle. Sie ist voller Golderz. Riesige Klumpen.«
»Wem gehört das Land?« Wieder benetzte Fips die Lippen des Pilgers.
»Dem Bischof. Doch er weiß nichts von seinem Glück. Das Bergregal obliegt jedoch nicht dem Grundherrn, sondern dem König von Böhmen.«
»Das heißt, dass alles Gold, was man dort findet, dem König Karl zukommt.« Fips kratzte sich nachdenklich am Kinn.
»Nicht, wenn er nichts davon weiß«, ächzte Wenzeslaus und verdrehte besorgniserregend die Augen. Fips begann den Pilger zu schütteln, wobei er ihn immer wieder mit dem wunden Rücken gegen den Strohsack stieß, auf dem er lag. Der schreckliche Schmerz ließ ihn wieder erwachen.
»Du sagst, die Schlucht sei so abgelegen, dass niemand sie finden kann? Und selbst wenn man an ihrem Rande steht, kann man die Höhle von oben nicht erkennen?«
»So ist es.«
»Keiner ahnt, dass dort Gold zu finden ist?«
»Einige Meilen nordöstlich graben sie wie die Verrückten. Aber dort, an der Stelle, die ich gefunden habe, dort sucht man nicht.«
»Die Leute des Grundherrn gelangen dort niemals hin?«
»Es gibt keinen Weg. Nicht einmal einen Pfad.«
»Deine Frau und deine Kinder könnten das Gold also heimlich herausholen? Niemand würde es bemerken?«
Wenzeslaus nickte und schloss seine geröteten Augen vor Erschöpfung, doch Fips bohrte weiter.
»Werden sie das denn können? Sollte man ihnen nicht helfen?«
»Sie können niemanden aus der Gegend anheuern. Das ist zu gefährlich«, stammelte Wenzeslaus nur noch unverständlich.
»Man benötigt also ortsfremde Bergleute, die mit keinem aus den umliegenden Dörfern zu tun haben und im Zweifelsfall den Mund halten. Das sollte gelingen.« Fips sagte dies mehr zu sich als zu dem Kranken, dessen Kopf nun zur Seite kippte. Er schien bewusstlos geworden zu sein.
»Ja, das ist gut«, murmelte Fips nun äußerst zufrieden grinsend. »Vielen Dank, Wenzeslaus. Mehr muss ich nicht wissen.«
Wieder griff Fips zum Schwamm.
Doch dieses Mal nicht, um dem Pilger die trockenen Lippen zu befeuchten. Nein, er vollendete jetzt, was er sich ohnehin vorgenommen hatte, sobald es ihm endlich gelungen war, alles Notwendige in Erfahrung zu bringen. Fips musste nicht besonders fest zudrücken.
»Ruhe in Frieden, mein goldbringender Freund«, lachte er, nachdem Wenzeslaus’ letzte, schwache Zuckungen aufgehört hatten.
Fips war sehr glücklich, als er mit einer seiner zahmen Ratten auf der Schulter hinaus ins Freie trat und die von einem Regenschleier verhangenen Externsteine betrachtete. Endlich hatte er wieder ein Ziel. Er würde leben, reich sein und neu beginnen – mit Marie an seiner Seite. Seit nunmehr einem Jahr träumte er davon. Er hatte gelernt, sie zu vermissen, hatte erfahren müssen, wie sehr er sich doch nach ihrer Anwesenheit sehnte. Er wusste, wo sie war, hatte es längst herausgefunden und sie mitunter beobachtet. Sie gehörte zu ihm, sie würde mit ihm gehen müssen, und spätestens dann, wenn er im Altvatergebirge aus ihr ein Goldmariechen gemacht hätte, würde sie auch freiwillig bei ihm bleiben.
Doch alles zu seiner Zeit.
Erst einmal mussten sämtliche weiteren Fäden zu einem ausgefeilten Plan verknüpft werden, bei dessen Ausführung Fips lediglich der Puppenspieler im Hintergrund zu bleiben trachtete. Denn die Drecksarbeit sollten andere für ihn erledigen.
Kapitel 3
»Nimm nicht so viele Garben für ein Bündel, Marie.«
Marie ließ sich von dem jungen Johann gern das Bündel mit dem geschnittenen Roggen aus der Hand nehmen. Er zeigte ihr, wie sie es geschickt binden konnte, damit der Meier in der Herrenscheuer den Eindruck gewann, sie hätten weitaus mehr von dem kläglichen Getreidefeld des Grundherrn geerntet. Es war der zweite Tag des Frondienstes, den die Leute aus dem Dorf auf den Gütern ihres Beschützers und Pachtgebers leisten mussten. Und es würde voraussichtlich der letzte sein, denn die Arbeit war schneller getan als befürchtet.
»Es ist ohnehin alles verdorben«, wandte sich nun Ulrich, der ebenfalls auf dem Feld arbeitete, an Johann. »Wenn du mich fragst, das Zeug kann man nur noch zerstampfen und den Schweinen zum Fraß vorwerfen. Sieh es dir an«, und dabei brach er eine Ähre und hielt sie dem jungen Burschen unter die Nase. »Faulig ist es. Und stinken tut’s auch. Wie will man davon ein gutes Korn erhalten?«
»Besser als nichts, Ulrich«, erwiderte Johann gut gelaunt und reichte Marie das fertige Bündel zurück. Er war, mit Ausnahme ihres Gatten Ulrich, der Einzige auf diesem Feld, der freundlich zu ihr war. Alle anderen Dienste leistenden Leute aus dem Dorf beachteten sie entweder gar nicht oder warfen ihr schiefe Blicke zu. So auch jetzt, wo Marie sich absichtlich dumm anzustellen schien, um sich von dem schönen Jüngling helfen zu lassen, während ihr Gemahl arglos danebenstand. Besonders die Frauen schüttelten darüber verächtlich die Köpfe.
Auch als sie am Mittag am Rande des Feldes inmitten eines Eichenhains saßen, um auf dem feuchten, moosigen Untergrund, geschützt vor dem trüben Nieselregen, ein bescheidenes Mahl einzunehmen, wurde der fremden Frau des Ulrich absichtlich keine Beachtung geschenkt. Alle anderen jedoch hatten ihren Spaß: ulkten, erzählten sich wenig fromme Geschichten, ahmten den stotternden Küster nach und führten lustige Tänze auf. Marie lauschte nur stumm, während sie aus Grashalmen eine Kette flocht, um nicht in die Gesichter blicken zu müssen.
»Da kommt der Meier«, rief schließlich Johann, als er gerade aufgestanden war, um den anderen vorzuführen, wie er kürzlich zwei alternde Jungfern in Verlegenheit gebracht hatte. »Na, dem werd ich eine Geschichte erzählen, dem Dummhans. Habt ihr noch Lust zu arbeiten, Freunde?«
Ein eindeutig verneinendes Gemurmel der Umsitzenden gab Johann den Anstoß, sein kühnes Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wie, das wusste er noch nicht, aber bis der einfältige Meier bei ihnen war, würde ihm gewiss etwas in den Sinn kommen. Keck wandte er sich noch einmal kurz nach Marie um und kniff dabei ein Auge zu.
Sie blickte auf und lächelte zurück. Johann war ein freundlicher Kerl. Er mochte vielleicht zwanzig Jahre zählen, war der Drittgeborene eines ordentlichen Bauern und wahrlich das ansehnlichste Mannsbild im Dorf. Und das wusste Johann. Rank und schlank, mit dichtem blondem Schopf und den Augen eines kleinen Jungen, verzückte er jedes Mädchen weit und breit. Das nutzte er durchaus aus, das genoss er, aber das war ihm nicht genug. Johann strebte nach mehr, und eines Tages, da war er sich sicher, würde er seine Siebensachen packen und von dannen ziehen. Allein, es fehlte bisher an der Gelegenheit. Und vielleicht fehlte es ihm auch an Mut. Denn – das hatte Marie längst bemerkt und deshalb mochte sie den Jungen auch besonders gern –, denn im Grunde seines Herzens war Johann scheu wie ein Reh und fromm wie ein Lamm. Jetzt jedoch setzte er wieder seine spitzbübische Miene auf und erwartete mit unschuldigem Blick den sich nähernden Meier.
Dieser klägliche Mensch, mit seinen großen, runden Augen, in denen das Weiße ganz zu fehlen schien, seinem wie gerupft aussehenden Haar und seinem krummen Rücken, hätte einem wahrlich leidtun können, denn schwer lastete offenbar die Bürde des Verwalters auf seinen knochigen Schultern. Er war nicht wirklich dumm, durchaus nicht. In seinen stillen Stunden reimte er sich sogar Gedichte der niederen Minne zusammen, in denen es zünftig zuging, die er aber niemals jemandem vorzutragen wagte. Nein, dumm war er nicht, vielmehr konnte man ihn eher leichtgläubig nennen, und das wusste der schlaue Johann einmal wieder auszunutzen. Wie gerufen kam ihm da eine Krähe, die sich unmittelbar neben den Meier auf einen Baumstumpf setzte und laut sowie anhaltend zu krächzen begann.
»Was habt ihr da für einen Vogel, liebe Leut’?«, fragte der Meier, sich erstaunt nach dem schwarzen Tier umblickend, das nicht aufhören wollte, seinen unschönen Gesang von sich zu geben.
»Unser Zeitvogel ist das, mein guter Herr Meier. Kennst du den etwa nicht?«, fragte Johann.
»Euer Zeitvogel?«
»Ja, er ist von Gott gesandt. Wenn er erscheint, dann heißt das, der Frondienst ist vorüber, und wir Bauersleut dürfen nach Hause gehen.«
»Ach?« Der Meier blickte erstaunt in die Runde, doch da alle wie selbstverständlich nickten, wagte er diese Aussage nicht in Zweifel zu ziehen.
»Ja, der kam schon zu den Zeiten unserer Vorväter, als es noch die Fronarbeit gab. Lange Jahre war er fort, doch nun, da wir wieder für die Herren schaffen müssen, ist er erneut aufgetaucht. Bös kann er werden, wenn man ihm nicht Folge leistet.«
»Ach«, wiederholte der Meier nur.
»Meine Großmutter wusste zu berichten, dass er gar einem Meier, der ihn nicht hatte beachten wollen und die Bauern zur weiteren Arbeit antrieb, beide Äugelein ausgehackt habe.« Mit diesen Worten näherte sich Johann dem Meier und machte mit beiden Zeigefingern eine leichte Hackbewegung.
»Jetzt übertreibt er es«, flüsterte Ulrich Marie ins Ohr, die gebannt der Szene folgte.
»Ob das gutgeht?«, bestätigte sie die Bedenken ihres Gemahls. Doch es ging gut. Der Meier ließ die Bauern ziehen, die Krähe flog fort, die Garben lagen noch einen weiteren Tag sowie eine weitere Nacht im Nieselregen. Und das Übel, welches sich ohnehin schon in ihnen eingenistet hatte und bezüglich dessen die Menschen ahnungslos waren, konnte weiter prächtig gedeihen.
»Es wird schwer, unser aller Mäuler in diesem Winter zu stopfen«, sagte Ulrich leise, seine stumpfe, alte Sense tragend. Marie und er passierten soeben ein schmales Waldstück, durch welches ein Weg von den Feldern des Grundherrn zurück zu ihrer bescheidenen Kate führte. »Die von der Burg werden ihren ritterlichen Pflichten nachkommen müssen und für uns Bauern ihre Speicher öffnen. Machen sie es nicht, dann wird es Hungertote geben. Lutz Rotschopf – du weißt, der mit den neun Kindern –, er hat von seinem Rübenacker nicht einen Schubkarren voll geerntet, und die wenigen Rüben, die er aus dem Boden geholt hat, waren klein, schrumpelig und bereits völlig zerfressen. Bei uns wird es nicht anders sein, ich fürchte mich schon davor. Zumal unser Acker die meiste Zeit im Schatten liegt. Ginge es in diesem verregneten Jahr darum, Moos einzufahren, ich wäre ein reicher Mann.«
Bei diesen Worten legte Ulrich sein ohnehin schon runzeliges Gesicht in noch tiefere Sorgenfalten. Marie blickte ihn von der Seite mitleidig an. Sie hatte ihn wirklich gern, diesen Bauern Filzhut. Er war ein guter Mensch, der beste, der ihr je im Leben begegnet war. Und sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dass seine Befürchtungen unbegründet waren. Denn das schlechte Gewissen plagte sie, wenn sie daran dachte, sich in dem bevorstehenden entbehrungsreichen Winter ein weiteres Mal bei einer armen Familie durchzuschlagen und mit den ohnehin mageren Kindern das wenige Brot zu teilen, um dann womöglich bereits im Frühjahr Lebewohl zu sagen.
Doch mit einem Mal verschwanden diese trüben Gedanken, und Marie musste lächeln.
»Vater, Stiefmutter, da seid ihr endlich!« Ein fröhliches Mädchen kam ihnen lachend mit bloßen Füßen durch den Schlamm entgegengerannt und stürzte sich sogleich in Maries Arme. »Ein Mönch ist unten im Waldgrund im sumpfigen Weiher stecken geblieben. Wir haben ihm gemeinsam mit einem langen Stock herausgeholfen. Und sieh an, was er uns zum Dank geschenkt hat!«
Aus ihrer Rocktasche zog die Zehnjährige drei blankpolierte, mächtig große, rote Äpfel, die in ihrer Üppigkeit und Schönheit im schier grotesken Widerspruch zu den grauen, mageren Menschen und dem modernden, mickrigen Korn am Wegesrand standen.
»Wir wollten mit der Überraschung auf euch warten und sie mit euch teilen, wenn ihr nach Hause kommt«, sagte das Kind, Gretchen mit Namen, freudestrahlend und wandte sich dabei nach einem weiteren Kind, einem kleinen Jungen von sechs Jahren, um, der nun ebenfalls auf dünnen, aber äußerst flinken Beinen angerannt kam und sein schmutziges Gesichtchen lachend in Maries Schürze verbarg.
»Was hast du ausgefressen, Toni?«, fragte Marie, ging in die Hocke und blickte den kleinen Schelm nur scheinbar streng an.
»Toni war es, der den Mönch so sehr erschreckt hat, dass er in den Sumpf gefallen ist. Mit seiner Steinschleuder hat er auf ihn geschossen«, verpetzte nun Grete ihren kleinen Bruder.
»So etwas macht man doch nicht mit einem Gottesmann, du kleiner Raubritter«, schimpfte Marie, konnte sich aber das Lachen nicht verkneifen.
»Macht nur«, winkte Ulrich ab und strich seinem Jüngsten mit seiner prankenartigen, abgearbeiteten Hand über den Wuschelkopf. »Wer in solch schlechten Erntezeiten wie diesen über derart prächtiges Obst verfügt, der darf gern einmal etwas davon hergeben.«
»Lauft Kinder, bringt eurem großen Bruder den dritten Apfel. Ihr braucht so hart verdienten Lohn nicht mit uns zu teilen. Lasst es euch schmecken«, rief Marie und sah den beiden Kleinen hinterher, wie sie fröhlich zurück zu der niedrigen, moosbedeckten Hütte rannten.
In manchen Momenten beneidete Marie diese Kinder. Bitterarm waren sie, ihre Mutter hatten sie verloren, litten oft Hunger, aber dennoch blieben sie so unbeschwert, so fröhlich, was allein an der Liebe lag, die ihnen zeit ihres Lebens zuteil geworden war und die sie so freigiebig an sie, die Fremde, weitergaben. Stolz müsste sie sein auf dieses unbezahlbare Geschenk. Doch Marie war vielmehr peinlich berührt von der unverdienten Zuneigung, welche ihr von diesen kleinen Menschen entgegengebracht wurde. Manchmal wünschte sie sich gar, ihre Stiefkinder würden sie verabscheuen und Ulrich wäre ein garstiger, brutaler Trunkenbold – denn das hätte ihr den Abschied erleichtert.
Und so zogen die Monate ins Land.
Der Winter nahte, und mit ihm die Furcht vor dem Hunger. Maries schlechtes Gewissen blieb, und mit ihm die Albträume. Immer wieder sah sie des Nachts das Gesicht ihres Peinigers vor Augen, und jedes Mal sprach er die gleiche Aufforderung, ja Drohung an sie aus: »Ich finde dich. Wir gehören zusammen.«
Es war ein deutliches Zeichen. Marie würde nicht mehr lange bleiben können, denn auch tagsüber beschlich sie mitunter das untrügliche Gefühl, dass er sie nicht nur in ihren Träumen aufsuchte. Manchmal, wenn sie allein oder auch in Begleitung von Gretchen in den Wald ging, um Brennholz zu sammeln, da meinte sie ihn mitunter hinter einem umgestürzten Baum lauern zu sehen. Ja, sie glaubte deutlich seine entstellte, vernarbte Fratze erkennen zu können. In solchen Momenten kam es vor, dass sie das mühsam zusammengesuchte Reisig fallen ließ, das verdutzte Kind an die Hand nahm und hastig davoneilte. Ulrich erzählte sie nichts von ihrer Furcht, und der kleinen Grete erklärte sie ihr seltsames Verhalten mit der Lüge, einen Wolf gesichtet zu haben.
Doch während Maries Angst vor ihrem Verfolger eher einem panischen Wahn glich und sie sich selbst oft den Vorwurf der bloßen Einbildung machen musste, so erwies sich eine andere Befürchtung bald als schreckliche Wahrheit: Der Hunger stand bedrohlich vor den Türen der Hütten und Höfe. Noch vor Weihnachten waren sämtliche ohnehin mageren Kornspeicher leer, und auch das ebenfalls hungernde, dürre Vieh erweckte nicht den Eindruck, sämtliche Bewohner des Dorfes über den Winter bringen zu können. Baumrinde, Eicheln, Frösche, Spatzen und Katzen würden als Nahrung dienen müssen – so ekelerregend dies auch klang, wäre es dennoch nicht das erste Mal gewesen. Man machte sich also darauf gefasst, dass es in den kommenden kalten Monaten viel Leid und auch Tote geben würde.
Doch dann geschah ein Wunder, denn eines Sonntags verkündete der Pfarrer in der winzigen, hölzernen Kirche, dass der Grundherr seinen Hintersassen von seinem Korn abgeben werde. Eine großzügige Gabe sei dies, denn auch der Ritter selbst habe nun das dritte Jahr in Folge große Ernteverluste eingefahren und somit keinerlei Überschüsse erwirtschaftet.
Mit Freuden wurde der Wagen erwartet, welcher gleich einen Tag später eine Ladung Roggen brachte, von dem sich jeder pro Mann und Frau einen Viertel, pro Kind einen Achtel Scheffel nehmen durfte.
»Drei Hände voll Roggen sollen uns also über den Winter bringen. Da müssen wir dann wohl auf Almosen des Klosters hoffen, sonst werden wir eingehen wie die Fliegen«, murmelte Ulrich mürrisch, während sich sein ältester Sohn daranmachte, das Säcklein, welches tatsächlich mickrig vor ihnen auf dem Tisch lag, aufzuknüpfen.
»Seltsam riecht das«, meinte der Zwölfjährige nur und hielt nun auch seiner Schwester Grete den Sack unter die Nase.
»Das hat schon gestunken, als wir es geerntet haben«, erinnerte sich Ulrich kopfschüttelnd.
»Lasst, Kinder, es ist noch feucht, wir werden es auf dem Speicher trocknen und dann zur Mühle bringen«, versuchte Marie sie alle zu beruhigen, nahm den Sack vom Tisch und trug ihn die steile Leiter, welche sich unmittelbar neben der in die Wand eingelassenen Schlafstatt befand, hinauf auf den Heuboden.
Der Raum unter dem Strohdach der Hütte war klein, aber dennoch so gut wie leer. In einer Ecke lagerten wenige Rüben, und auf einem klapprigen Holzregal faulten, obgleich erst im Herbst gepflückt, winzige Äpfel vor sich hin. Das war alles, denn die Vorräte an eigenem Korn waren nie der Rede wert gewesen und längst verbraucht. Stumm schüttete Marie die Roggenkörner auf dem Boden aus. Sie waren viel zu zeitig geerntet und gedroschen worden, teilweise hingen sie noch an den Ähren, welche sich nun auf den hölzernen Dielen verteilten. Dennoch gab es keinen Grund zur Klage: Getrocknet, gemahlen und gestreckt, würde diese Gabe ausreichen, um reichlich Brei zu kochen und womöglich auch einen Laib Brot zu backen. Vielleicht gab es ja Hoffnung, vielleicht folgten tatsächlich noch mehr Spenden, und sie würden allesamt wohlbehalten über den Winter kommen.
Ein wenig Zuversicht keimte in ihr auf, als sie langsam zu der kleinen Dachluke ging und hinaus in die Dunkelheit blickte, wo sich der volle, helle Mond seinen Weg hinter dicken Wolken hervorzubahnen versuchte. Zuversicht nicht nur der Spenden des Grundherrn wegen, sondern auch deshalb, weil sie wusste, dass ihr Verfolger des Winters gewiss nicht umherstreifen würde, um sie ausfindig zu machen.
Fips hasste Schnee und Kälte. Als sie noch bei ihm war, hatte er mit Marie in einem jeden Jahr zwischen Dezember und März die schützenden Mauern einer Stadt aufgesucht, wo sie sich mit Diebereien, Kupplereien und Betrügereien einigermaßen über Wasser gehalten hatten.
»In den nächsten Monaten ist Ruhe«, flüsterte sie leise, noch immer den Blick auf den Mond gerichtet, dessen Licht nun dabei war, den Kampf gegen die Wolken aufzugeben.
Kapitel 4
Der Pfarrer erfuhr bald von den Mönchen aus dem nahen Kloster, dass man das, was seit dem Weihnachtsfest im Dorf sein Unwesen trieb, als »ignis sacer«, heiliges Feuer, bezeichnete. Und er hatte auch gesagt bekommen, wen man gegen dieses Übel anrufen musste, nämlich den heiligen Antonius. Einst in der Wüste vom Teufel in Versuchung geführt, hatte Antonius den Höllenfürsten schließlich bezwungen und galt nun als Schutzpatron gegen das brennende Leiden, welches in diesem ohnehin entbehrungsreichen Winter zusätzlich so zahlreiche Menschen quälte und einige gar zu Tode brachte.
Mehr als ein Dutzend Dorfbewohner war bereits befallen. Begonnen hatte es mit einem Kitzeln in Händen und Füßen, dann hatte die Haut sich gerötet, brannte, juckte, Blasen bildeten sich am ganzen Körper, wie Feuer zog es über den Leib, trieb die Befallenen schier in den Wahnsinn und färbte bei einigen Finger, Ohren und Nasen schwarz, bis diese schließlich abfielen. Niemand wusste zu sagen, woher die entsetzliche Heimsuchung kam. Es musste eine Strafe sein, eine Strafe Gottes, ein weiteres Vorzeichen des nahenden großen Endes, oder aber die Rache des heiligen Antonius, der sich bis dato nicht genügend verehrt gefühlt hatte. Zur Sicherheit betete man nun täglich zu ihm, morgens, mittags und abends fanden Andachten in der Kirche statt, man machte Prozessionen zu den Häusern der Kranken und besprenkelte sie mit Weihwasser.
Ratsamer wäre es gewesen, die Roggenfelder mit Weihwasser zu besprenkeln, denn sie bildeten den eigentlichen Quell des Übels. Auf ihnen war er in dem kaltnassen Sommer gekeimt – der unsichtbare Unheilbringer. Selbst im getrockneten, gedroschenen und gemahlenen Zustand behielt das von ihm befallene Korn seine tödliche Wirkung bei. Doch darüber herrschte unter den Menschen Unwissenheit. Sie verdächtigten nicht das verunreinigte Mehl, sie suchten die Schuld vielmehr bei sich selbst, in ihrem Unglauben, ihren Sünden und ihren heimlichen Schandtaten.
So betrachteten sie es als notwendiges Opfer, als verdiente Bußleistung, dass einige von ihnen eines entsetzlichen Todes starben, kurz bevor der Lenz nach einem harten, bitterkalten Winter Einzug hielt. Neun waren es, zumeist aus den ärmeren der ohnehin wenig betuchten Bauernhäuser des Dorfes. Alte waren darunter, aber auch Kinder, unter anderem alle drei Sprösslinge des bedauernswerten Ulrich Filzhut, dem unlängst erst sein treues Weib Elsa genommen worden war.
Ulrich selbst hatte das Antoniusfeuer überlebt. Zwei Finger der rechten Hand büßte er ein, war aber alsbald am Leib wieder genesen. Nicht so an der Seele, die derart verletzt war, dass er in seinen bittersten Stunden an Gott zu zweifeln begann. Ja, man hatte ihn sogar des Nachts auf dem Kirchhof gesehen, wo er laute, unflätige Flüche in Richtung Himmel ausgestoßen haben sollte. Sein neues Weib habe ihn daraufhin beruhigt und nach Hause geführt. Sie selbst – so hieß es – war die Einzige im Hause, die vom Feuer vollkommen verschont geblieben war. Warum dies so war, darüber wurde man bald müde, sich das Maul zu zerreißen, denn der Frühling stand ins Haus, der Neubeginn, der Wandel. Es gab viel zu tun, und auch wenn Hunger, Seuchen und anhaltend düstere Zukunftsaussichten die letzten Jahre geprägt hatten, so war die Hoffnung auf Gnade dennoch nicht gänzlich verloren.
Das Leben musste weitergehen.
So lange zumindest, bis es Gott gefiel, tatsächlich den allerletzten Tag auf Erden einzuläuten.
»Ihr glaubt es nicht, Ihr glaubt es nicht.
Liebe Leut, liebe Leut,
die Botschaft, die ich bringe heut,
ist so froh, so gut, so wunderbar
da jauchzt das Schwein am Spieße gar.«
Marie traute ihren Ohren kaum. Es war der erste sonnige Frühjahrstag nach der so tödlichen, kalten Jahreszeit, und sie war gerade dabei, nach den soeben geborenen Kaninchen zu schauen, als sie diese seltsamen lauten, frivolen Klänge vernahm. Zunächst war es nur ein melodisches Pfeifen gewesen, dann hatte die durchdringende Stimme zu singen begonnen. Nicht einmal die Kirchturmglocken des nahen Klosters hatten sie zu übertönen vermocht.
Wie durch einen Paukenschlag wurden die Bewohner des kleinen, traurigen Ortes daran erinnert, dass das Leben offensichtlich auch lustige Seiten bereithielt.
»Meister Lenz ist da!«, riefen einige Buben und Mädchen und rannten über den holprigen Weg an dem stillen, kinderlosen Haus des Bauern Filzhut vorüber in Richtung des singenden Mannes, der gewiss auf dem Dorfplatz unter der Linde zu finden war.
»Ein Fremder ist in den Ort gekommen«, berichtete Marie ihrem Mann aufgeregt, nachdem sie in die Kate zurückgegangen war.
Aber Ulrich kümmerte sich nicht um Maries Worte. Er kümmerte sich um gar nichts mehr. Alles Leben, alle Freude hatten ihn verlassen. Mit dem Tod seiner Kinder war auch sein eigenes Dasein lediglich zu einem mühseligen Fortbestehen geworden. Selbst die Fürsorge seiner jungen Frau konnte ihn nicht aufmuntern, sodass er die meiste Zeit des Tages damit verbrachte, dumpf auf einer Bank in der dunkelsten Ecke des kleinen Häuschens zu hocken.
»Komm, guter Ulrich, wir wollen nachschauen gehen, wer der fremde Mensch ist«, forderte Marie ihn nun auf, ihr hinaus an die frische Luft zu folgen.
Es war ein herrlicher Tag und das Erscheinen des Musikanten im Dorf ein willkommener Anlass, Ulrich Filzhut seine tiefe Trauer für einen Moment vergessen zu lassen. In dessen Gesicht zeigte sich wahrlich mehr vom Tode als vom Leben. Wenn er weiterhin in solch tiefer Trauer versank, würde Marie ihn bald neben seiner ersten Frau und seinen drei Kindern auf dem Kirchhof zu Grabe tragen müssen. Dann wäre sie allein, ihr Gewissen wäre befreit, und sie könnte gehen, ohne jemanden verlassen zu müssen. Doch das wollte sie nicht. Sie mochte diesen kauzigen, alternden Mann, und noch lieber hatte sie dessen Kinder gehabt, um welche sie in jeder Nacht weinte. Es war ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass es Ulrich wieder besser ging, dass er ins irdische Leben zurückfand, und darum zog sie ihn nun an der verkrüppelten, noch immer verbundenen Hand von seiner Bank. Willenlos folgte er ihr und trottete langsam mit gesenktem Kopf neben seiner Frau her zum Dorfplatz.