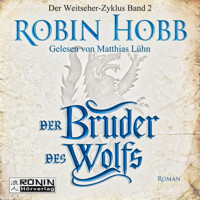9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Seelenschiff-Händler
- Sprache: Deutsch
Das packende Finale der Bestsellertrilogie! Wird die Drachenkönigin die Stadt der Seelenschiffe retten – oder der Vernichtung überlassen?
Bingstadt befindet sich im Krieg, und einzig die Drachenkönigin Tintaglia kann die Stadt der Seelenschiffe noch retten. Doch um sie zu überzeugen, ihnen zu helfen, müssten die Händler von Bingstadt ihre Macht und ihren Wohlstand aufgeben. Kann Althea Vestrit ihr Volk davon überzeugen? Dabei hat die junge Kapitänin eigentlich andere Sorgen. Endlich kann sie um ihr Seelenschiff Viviace kämpfen und ihm zeigen, dass sie zusammengehören. Doch die Zeit in der Gesellschaft des Piraten Kennit hat Viviace verändert. Sind Kapitänin und Seelenschiff wirklich noch für einander bestimmt?
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 5 – Die vergessene Stadt« und »Die Zauberschiffe 6 – Herrscher der drei Reiche«. Diese Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1583
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Bingstadt befindet sich im Krieg, und einzig die Drachenkönigin Tintaglia kann die Stadt der Seelenschiffe noch retten. Doch um sie zu überzeugen, ihnen zu helfen, müssten die Händler von Bingstadt ihre Macht und ihren Wohlstand aufgeben. Kann Althea Vestrit ihr Volk davon überzeugen? Dabei hat die junge Kapitänin eigentlich andere Sorgen. Endlich kann sie um ihr Seelenschiff Viviace kämpfen und ihm zeigen, dass sie zusammengehören. Doch die Zeit in der Gesellschaft des Piraten Kennit hat Viviace verändert. Sind Kapitänin und Seelenschiff wirklich noch für einander bestimmt?
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Von Robin Hobb bei Penhaligon erschienen:
Die Chronik der Weitseher
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten
3. Die Tochter des Wolfs
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Das Geheimnis der Seelenschiffe
Die Drachenkönigin
Roman
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »The Liveship Traders 3. Ship of Destiny« bei Bantam Books, New York.
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 5 – Die vergessene Stadt« und »Die Zauberschiffe 6 – Herrscher der drei Reiche«. Diese Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2000 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München
Redaktion: Maike Claußnitzer
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock (atabik yusuf djufni; Aprilphoto)
HK · Herstellung: sam
E-Book-Produktion: VRH
ISBN 978-3-641-25387-5V002
www.penhaligon.de
Dieses Buch ist
Jane Johnson und Anne Groell gewidmet.
Denn ihnen war es so wichtig, dass sie dafür
gesorgt haben, dass ich es richtig mache.
Spätsommer
Prolog»Die, die sich erinnert«
Wie es wohl wäre, perfekt zu sein?
An dem Tag, an dem sie geschlüpft war, hatte man sie eingefangen, bevor sie sich über den Sand in die kühle und salzige Umarmung des Meeres hatte retten können. »Die, die sich erinnert« war dazu verdammt, sich mit vollkommener Klarheit an jede Einzelheit dieses Tages zu erinnern. Erinnerung war ihre einzige Funktion und der alleinige Grund für ihre Existenz. Sie war ein Gefäß für Erinnerungen. Sie erinnerte sich nicht nur an ihr eigenes Leben, sobald es sich in dem Ei herauszubilden begann, sondern auch an das Leben all derer, die vor ihr gegangen waren. All diese Erinnerungen ruhten in ihr. Vom Ei zur Schlange, vom Kokon zum Drachen und wieder zum Ei … Sie wachte über die gesamten Erinnerungen ihres Volks. Nicht jede Schlange war so reich beschenkt oder mit einer so schweren Verantwortung belastet worden. Nur wenige Schlangen trugen die gesamte Vergangenheit ihrer Spezies in sich, aber mehr waren auch nicht nötig.
Am Anfang war sie perfekt gewesen, mit einem makellosen, winzigen, glatten Körper, geschmeidig und mit Schuppen bedeckt. Mit dem Eizahn auf ihrer Schnauze hatte sie sich durch die ledrige Eischale gearbeitet. Sie war jedoch erst spät geschlüpft. Die anderen aus ihrem Gelege hatten sich bereits durch Schalen und Sandhaufen gearbeitet. Sie konnte ihren gewundenen Spuren folgen. Das Meer hatte sie unaufhörlich gelockt. Jede Welle des Ozeans rief sie. Sie hatte ihre Reise begonnen, war unter der sengenden Sonne durch den trockenen Sand geglitten. Sie hatte den feuchten Geruch des Ozeans in der Nase gehabt. Die glitzernden Wellen seiner Oberfläche zogen sie unwiderstehlich an.
Aber sie hatte ihre Reise niemals beendet.
Die Missgestalten hatten sie gefunden. Sie hatten sie eingekreist und ihr mit den plumpen Körpern den Weg zum lockenden Ozean verstellt. Obwohl sie sich heftig gewehrt hatte, hatten sie sie aus dem Sand gehoben und in ein Becken in einer Höhle im Kliff gesteckt, das von der Flut gespeist wurde. Dort hatten sie sie festgehalten, sie nur mit toter Nahrung gefüttert und ihr nie erlaubt, frei zu schwimmen. Sie war niemals mit den anderen nach Süden gewandert, in die wärmeren Meere, wo es reichlich Nahrung gab. Deshalb hatte sie auch nicht die Größe und Stärke erreicht, die ihr ein Leben in Freiheit gewährt hätte. Dennoch wuchs sie, bis das Becken in der Höhle nur noch eine winzige Pfütze für sie war. Sie schaffte es kaum, ihre Haut und ihre Kiemen feucht zu halten. Ihre Lunge war die ganze Zeit in ihren Windungen eingeklemmt, und das Wasser war ständig von ihren Giften und Exkrementen verunreinigt. Die Missgestalten hielten sie gefangen.
Wie lange war sie hier eingesperrt gewesen? Sie konnte es nicht ermessen, aber sie war davon überzeugt, mehrere Generationen lang hier gefangen gehalten worden zu sein. Immer wieder hatte sie den Ruf der Wanderung verspürt. Dann überkam sie eine rastlose Energie, gefolgt von einem intensiven Verlangen, ihre eigene Spezies zu suchen. Die Giftdrüsen in ihrem Hals schwollen schmerzhaft an, so voll waren sie. In solchen Zeiten fand sie keine Ruhe, denn die Erinnerungen durchdrangen sie und wollten freigesetzt werden. Sie rutschte unruhig in ihrem kleinen Becken hin und her und schwor den Missgestalten, die sie hier gefangen hielten, ewige Rache. Dann war der Hass auf sie am schlimmsten. Wenn ihre überströmenden Drüsen das Wasser mit ihren uralten Erinnerungen durchsetzten und es von den Säften der Vergangenheit so verseucht wurde, dass ihre Kiemen sie mit ihrer eigenen Geschichte vergifteten, kamen die Missgestalten. Sie wagten sich in ihr Gefängnis, schöpften Wasser aus ihrem Becken und berauschten sich daran. Trunken prophezeiten sie sich dann gegenseitig die Zukunft, tobten und lallten unter dem Licht des vollen Mondes. Sie stahlen die Erinnerungen ihrer Art und versuchten so, die Zukunft zu erkennen.
Dann hatte der Zweibeiner Wintrow Vestrit sie befreit. Er war auf die Insel der Missgestalten gekommen, um für sie die Schätze zu sammeln, die das Meer an den Strand spülte. Im Austausch dafür erwartete er von ihnen, dass sie ihm seine Zukunft voraussagten. Selbst jetzt noch schwoll ihre Mähne allein bei diesem Gedanken vor Wut giftig an. Die Missgestalten prophezeiten nur eine Zukunft, die sie aus der Vergangenheit erahnten, die sie ihr stahlen! Sie verfügten nicht über die wahre Gabe des Sehens. Denn sonst hätten sie gewusst, dass die Zweibeiner ihren Untergang herbeiführen würden! Sie hätten Wintrow Vestrit aufgehalten. Stattdessen hatte er »Die, die sich erinnert« entdeckt und befreit.
Obwohl ihre Häute sich berührten und obgleich ihre Erinnerungen sich durch ihre Gifte miteinander vermischten, verstand sie nicht, was den Zweibeiner dazu gebracht hatte, sie zu befreien. Er war ein so kurzlebiges Geschöpf, dass die meisten seiner Erinnerungen sich gar nicht in sie einbrennen konnten. Sie hatte seine Sorgen und Schmerzen gespürt. Sie hatte gewusst, dass er seine kurze Existenz aufs Spiel setzte, indem er sie befreite. Der Mut dieses alles andere als langen Lebens hatte sie gerührt. Sie hatte die Missgestalten abgeschlachtet, als sie sie wieder einfangen wollten. Und als der Zweibeiner fast in der kochenden See ertrunken wäre, hatte sie ihn zu seinem Schiff geführt.
»Die, die sich erinnert« öffnete weit die Kiemen. Sie schmeckte ein Geheimnis in den Wellen. Sie hatte den Zweibeiner zu seinem Schiff gebracht. Doch das Schiff selbst hatte sie sowohl fasziniert als auch beunruhigt. Der silbrig-graue Rumpf des Schiffs hatte das Wasser um sie herum mit Geruch erfüllt. Sie folgte ihm und sog den flüchtigen Geschmack von Erinnerungen ein.
Das Schiff roch, und zwar nicht wie ein Schiff, sondern wie eine von ihrer Art. Sie war ihm jetzt zwölf Gezeiten lang gefolgt und verstand immer noch nicht, wie das sein konnte. Sie wusste sehr genau, was Schiffe waren. Die Uralten hatten ebenfalls Schiffe besessen, aber keines wie dieses. Ihre Drachenerinnerungen sagten ihr, dass ihre Art oft über solche Schiffe hinweggeflogen war und sie mit dem Luftzug ihrer mächtigen Schwingen spielerisch zum Schaukeln gebracht hatte. Normalerweise waren Schiffe kein Geheimnis, dieses hier jedoch war eines. Wie konnte ein Schiff nach Seeschlange riechen? Und zu allem Überfluss roch es nicht nur nach einer einfachen Seeschlange, sondern nach »Einer, die sich erinnert«!
Ihre Pflicht trieb sie weiter. Dieser Instinkt war stärker als der Drang, zu fressen oder sich zu paaren. Es war Zeit, schon längst Zeit. Sie hätte mittlerweile unter ihresgleichen sein und sie auf den Pfad der Wanderung führen sollen, den ihre Erinnerungen so gut kannten. Sie sollte die schwächeren Erinnerungen der anderen mit ihren mächtigen Giften wachrufen. Der biologische Drang rumorte in ihrem Blut. Zeit für den Wechsel. Sie verfluchte erneut ihren verkrüppelten grüngoldenen Körper, der sich so unbeholfen durch das Wasser wälzte. Sie hatte keine Ausdauer. Es war einfacher, im Kielwasser des Schiffs zu schwimmen und sich von seiner Bewegung durch die Fluten ziehen zu lassen.
Also schloss sie einen Kompromiss mit sich selbst. Solange der Kurs des Schiffs mit dem ihren übereinstimmte, würde sie ihm folgen. Sie konnte seine Verdrängung nutzen, während sie selbst Kraft und Ausdauer sammelte. Außerdem wollte sie sein Geheimnis ergründen. Trotzdem durfte dieses Rätsel sie nicht von ihrem eigentlichen Ziel ablenken. Wenn sie näher an den Strand kamen, würde sie das Schiff ziehen lassen und ihre eigene Spezies suchen. Sie würde Knäuel von Seeschlangen finden und sie den großen Fluss hinauf zu ihren Kokongründen führen. Nächstes Jahr um diese Zeit würden dann die jungen Drachen ihre Flügel im Wind erproben.
Das hatte sie sich während der zwölf Gezeiten geschworen, die sie dem Schiff bereits folgte. Doch mitten in dem dreizehnten Gezeitenwechsel hatte ein Geräusch ihre Haut zum Vibrieren gebracht, ein Geräusch, das gleichzeitig fremd und herzzerreißend vertraut war. Das Trompeten einer Seeschlange! Sie riss sich sofort aus dem Kielwasser des Schiffs los und tauchte ab, weg von den Ablenkungen der Wasseroberfläche. »Die, die sich erinnert« stieß eine Antwort aus und wartete regungslos auf eine Erwiderung. Nichts.
Sie war entmutigt. Hatte sie sich getäuscht? Während ihrer Gefangenschaft hatte es Phasen gegeben, in denen sie ihre Qualen immer und immer wieder laut heraustrompetet hatte, bis die Wände ihres Kerkers von ihrem Elend vibrierten. Als sie sich an diese bittere Zeit erinnerte, schloss sie kurz die Augen. Jetzt würde sie sich nicht quälen. Sie öffnete die Augen wieder und akzeptierte ihre Einsamkeit. Entschlossen drehte sie sich um und verfolgte das Schiff, das die einzige schwache Spur von Vertrautheit repräsentierte, die sie kannte.
Durch diese kurze Pause nahm sie ihre Schwäche nur noch deutlicher wahr. Sie musste all ihre Willenskraft aufbringen, um weiterzuschwimmen. Doch einen Augenblick später war alle Schwäche vergessen, als eine weiße Schlange an ihr vorbeischoss. Sie schien sie nicht zu bemerken, so konzentriert war sie auf die Verfolgung des Schiffs. Dessen merkwürdiger Geruch musste sie verwirrt haben. Ihre Herzen hämmerten wild. »Hier bin ich!«, schrie sie der Schlange hinterher. »Hier. Ich bin ›Die, die sich erinnert‹. Ich bin endlich zu euch gekommen!«
Das weiße Männchen schwamm mit scheinbar mühelosen Wellenbewegungen seines dicken, blassen Körpers. Es wendete bei ihrem Ruf nicht einmal den Kopf. Sie starrte ihm erschrocken nach und eilte dann hinterher. Ihre Müdigkeit war vergessen. Sie zwang sich, das Männchen zu verfolgen, und keuchte bald vor Anstrengung.
Sie fand es im Kielwasser des Schiffs. Es glitt in die Dämmerung darunter und murmelte und jammerte an den Planken des Rumpfs. Seine Mähne mit den giftigen Tentakeln war halb aufgerichtet, und ein schwacher Strom seiner bitteren Gifte verseuchte das Wasser um ihn herum. Als »Die, die sich erinnert« sein sinnloses Verhalten beobachtete, wuchs ihr Entsetzen. Aus ihrem tiefsten Inneren warnten ihre Instinkte sie vor ihm. Ein solch seltsames Verhalten deutete auf eine Krankheit oder Wahnsinn hin.
Aber es war das erste Exemplar ihrer eigenen Spezies, das sie seit dem Tag ihres Ausschlüpfens gesehen hatte. Die Anziehungskraft dieser Verwandtschaft war stärker als jede Abneigung, also näherte sie sich ihm. »Sei gegrüßt«, sagte sie demütig. »Suchst du ›Die, die sich erinnert‹? Das bin ich.«
Seine großen roten Augen rollten hin und her, und es schnappte warnend nach ihr. »Mein!«, trompetete das Männchen heiser. »Meine Nahrung!« Es drückte die aufgerichtete Mähne gegen das Schiff und schmierte seine Gifte an den Rumpf. »Füttere mich«, forderte es von dem Schiff. »Gib mir Nahrung!«
Sie zog sich hastig zurück. Die weiße Schlange bettelte weiter am Schiffsrumpf. »Die, die sich erinnert« nahm einen schwachen Duft von Beunruhigung wahr, den das Schiff ausstrahlte. Das war ungewöhnlich. Die ganze Situation war so merkwürdig wie ein Traum, und wie in einem Traum reizte sie sie mit möglichen Bedeutungen und einem dräuenden Verständnis. Konnte ein Schiff tatsächlich auf die Gifte und die Rufe der weißen Schlange reagieren? Nein, das war einfach lächerlich. Der geheimnisvolle Geruch des Schiffs verwirrte sie beide.
»Die, die sich erinnert« schüttelte die eigene Mähne und fühlte, wie sie sich unter ihren eigenen hochwirksamen Giften aufrichtete. Dieser Akt gab ihr ein Gefühl von Macht. Sie maß sich kurz mit der weißen Schlange. Das Männchen war größer und muskulöser als sie, aber das spielte keine Rolle. Sie konnte es töten. Trotz ihres verkrüppelten Körpers und ihrer Unerfahrenheit konnte sie es lähmen und auf den Meeresgrund sinken lassen. Mit einem Schlag, trotz der berauschenden Wirkung ihrer eigenen Körpergifte, wurde ihr noch etwas klar: Sie vermochte noch viel mehr. Sie konnte es erleuchten und am Leben lassen.
»Weiße Schlange!«, trompetete sie. »Hör mir zu! Ich habe dir Erinnerungen zu geben, Erinnerungen von unserer Spezies, Erinnerungen, die dein Gedächtnis schärfen. Bereite dich darauf vor, sie zu empfangen!«
Es achtete nicht auf ihre Worte und bereitete sich auch nicht vor. Doch das kümmerte sie nicht. Dies hier war ihre Bestimmung. Dafür war sie ausgebrütet worden. Und das Männchen würde der erste Empfänger ihres Geschenks sein, ob es wollte oder nicht. Ungeschickt und behindert von ihrem deformierten Körper, schwamm sie auf das Männchen zu. Es wirbelte herum und erwartete mit aufgerichteter Mähne ihren Angriff, doch sie ignorierte seine armseligen Gifte. Mit einem ungelenken Sprung wand sie sich um ihn. Im selben Moment schüttelte sie ihre Mähne und ließ die mächtigen Gifte frei, die seinen Verstand kurzfristig außer Kraft setzen und seinen verborgenen Geist dahinter wieder öffnen konnten. Es kämpfte wie verrückt und wurde plötzlich in ihrem Griff steif wie ein Baumstamm. Seine ungeschützten, wirbelnden Augen wurden immer größer und schienen beinahe aus ihren Höhlen zu treten. Das Männchen machte einen letzten Versuch, Sauerstoff in seine Kiemen zu spülen.
Sie konnte es nur festhalten. Sie wand sich um die andere Schlange und zog sie weiter durch das Wasser. Das Schiff entfernte sich von ihnen, aber sie ließ es, beinahe ohne zu zögern, ziehen. Diese einzelne Seeschlange war wichtiger für sie als alle Geheimnisse, die das Schiff barg. Sie hielt sie fest und drehte ihren Hals, damit sie ihr ins Gesicht sehen konnte. Sie beobachtete, wie die Augen des Männchens sich drehten und wieder ruhig wurden. Sie hielt es tausend Lebenszeiten lang fest, während ihm die Vergangenheit seiner ganzen Art wieder bewusst wurde. Schließlich erlöste sie es und sonderte die schwächeren Gifte ab, die sein Unterbewusstsein beruhigten und sein eigenes kurzes Leben wieder in den Vordergrund seines Bewusstseins treten ließen.
»Erinnere dich!« Sie stieß diese Worte leise hervor und lud die Verantwortung all seiner Vorfahren auf seine Schultern. »Erinnere dich und sei.« Es hielt in ihren Umarmungen ganz still. Sie fühlte, wie sein eigenes Leben wieder zurückkehrte, als sein Körper der Länge nach erzitterte. Seine Augen drehten sich plötzlich wieder, und dann richtete sich sein Blick auf sie. Es wich vor ihr zurück. Sie wartete auf seinen Dank.
Doch der Blick, den das Männchen ihr zuwarf, war anklagend.
»Warum?«, begehrte es plötzlich auf. »Warum jetzt? Wo es schon für uns alle zu spät ist? Warum konnte ich nicht sterben, ohne zu wissen, was ich hätte sein können?«
Seine Worte erschreckten sie so sehr, dass sie losließ. Das Männchen befreite sich mit einem verächtlichen Zucken aus ihrer Umarmung und schoss von ihr weg durch die Fluten. Sie wusste nicht genau, ob es floh oder sie einfach nur im Stich ließ. Beides schien ihr unerträglich. Das Erwachen seiner Erinnerungen hätte es mit Freude und Zuversicht erfüllen sollen, nicht mit Verzweiflung und Wut.
»Warte!«, rief sie ihm hinterher, aber die dämmrigen Tiefen verschluckten es. Sie verfolgte es unbeholfen, obwohl sie wusste, dass sie es nicht würde einholen können. »Es darf nicht zu spät sein! Ganz gleich, was passiert, wir müssen es versuchen!« Sie trompetete die sinnlosen Worte in die leere Fülle hinaus.
Das Männchen hatte sie abgehängt. Wieder war sie allein. Zunächst weigerte sie sich, das zu akzeptieren. Ihr verkrüppelter Körper taumelte durch das Wasser, und ihr Maul war weit aufgerissen, um den leichten Duft wahrzunehmen, den das Männchen hinterließ. Er wurde immer schwächer und war schließlich verschwunden. Es war zu schnell, und sie war zu deformiert. Enttäuschung stieg in ihr hoch, die beinahe genauso betäubend wirkte wie ihre eigenen Gifte. Sie schmeckte erneut das Wasser. Jetzt war keine Spur mehr von dem Männchen geblieben.
Sie schlug auf ihrer verzweifelten Suche nach seinem Geruch immer weitere Bögen durch das Wasser. Als sie ihn schließlich fand, hämmerten ihre beiden Herzen vor Entschlossenheit. Sie peitschte mit dem Schwanz durchs Wasser, um ihn rasch einzuholen. »Warte!«, trompetete sie. »Bitte. Du und ich, wir sind die einzige Hoffnung für unsere Art! Du musst mir zuhören!«
Der Geruch nach Schlange wurde plötzlich stärker. Die einzige Hoffnung für unsere Art. Dieser Gedanke schien durch die Fluten zu ihr zu dringen, als wären die Worte durch die Luft zu ihr gelangt und nicht durch die Tiefen zu ihr trompetet worden. Mehr Ermutigung brauchte sie nicht.
»Ich komme!«, versprach sie und hetzte unermüdlich weiter. Doch als sie die Quelle des Schlangengeruchs endlich erreichte, war das einzige Geschöpf weit und breit der silbrige Rumpf, der die Wellen über ihr durchpflügte.
1Die Regenwildnis
Malta tauchte ihr provisorisches Paddel ins Wasser und zog es kräftig durch. Das kleine Boot glitt vorwärts. Schnell tauchte sie die Zedernplanke auf der anderen Seite des Kahns in die Fluten und runzelte die Stirn, als Wassertropfen von dem Holzstück ins Boot fielen. Aber dagegen konnte sie nichts machen. Die Planke war das Einzige, was ihr als Ruder diente, und wenn sie nur auf einer Seite ruderte, drehten sie sich unweigerlich im Kreis. Sie wollte nicht daran denken, wie sich die beißenden Tropfen jetzt durch die Planken des Bootes fraßen. Ein kleines bisschen Regenwildniswasser konnte sicher keinen so großen Schaden anrichten. Hoffentlich würde das pudrig weiße Metall am Rumpf den Fluss daran hindern, das Boot zu rasch zu zerfressen. Aber verlassen konnte sie sich darauf nicht. Sie unterdrückte den Gedanken. Es war nicht mehr weit.
Ihr taten alle Knochen weh. Sie hatte die ganze Nacht geschuftet und versucht, sich nach Trehaug durchzuschlagen. Ihre erschöpften Muskeln zitterten vor Anstrengung. Wir haben es nicht mehr weit, hämmerte sie sich ein. Aber sie kamen nur quälend langsam voran. Ihr tat der Kopf weh, doch am schlimmsten war die Wunde auf ihrer Stirn. Sie heilte, aber warum musste sie immer dann am übelsten jucken, wenn sie keine Hand frei hatte, um sich zu kratzen?
Sie manövrierte die winzige Nussschale zwischen den gewaltigen Stämmen und dem Wurzelgeflecht der Bäume hindurch, welche die Ufer des Regenflusses säumten. Unter dem Baldachin des Regenwildniswaldes wirkten der Nachthimmel und seine Sterne wie ein Mythos, den man nur selten zu Gesicht bekam. Aber zwischen den Stämmen und Zweigen lockte sie ein unstetes Funkeln immer weiter. Es waren die Lichter der Stadt in den Bäumen. Trehaug. Ein Leuchtzeichen, das Wärme und Sicherheit verhieß – und vor allem Ruhe. Um sie herum herrschte tiefste Dunkelheit, aber die Rufe der Vögel hoch oben in den Zweigen verrieten ihr, dass im Osten die Sonne bereits den Himmel aufhellen musste. Allerdings würde ihr Licht den Blätterwald erst später durchdringen, und auch dann würden nur einige wenige Strahlen die Düsternis vertreiben. Wo der Fluss sich einen Pfad durch die dicken Bäume bahnte, glänzte dann sein breites Band silbrig im Tageslicht.
Das Ruderboot verfing sich mit dem Bug plötzlich in einer verborgenen Wurzel. Malta biss sich auf die Lippen, um nicht frustriert aufzuschreien. Sich mit dem Kahn einen Weg durch diese bewaldeten Untiefen zu bahnen glich einem Herumirren durch ein Labyrinth. Immer wieder hatten Äste und Grünzeug, das auf dem Wasser trieb, oder unter der Wasseroberfläche versteckte Wurzeln sie von ihrem ursprünglichen Kurs abgebracht. Aber das schwache Licht vor ihnen schien mittlerweile nicht mehr ganz so weit weg zu sein wie noch bei ihrem Aufbruch. Malta verlagerte ihr Gewicht und beugte sich über die Seite. Sie drückte mit der Planke gegen das Hindernis. Ächzend schob sie das Boot frei. Dann ruderte sie um die Barriere herum.
»Warum paddelt Ihr uns nicht dorthin, wo die Bäume nicht so dicht stehen?«, wollte der Satrap wissen. Der ehemalige Herrscher von ganz Jamaillia hockte im Heck und hatte die Knie fast bis ans Kinn hochgezogen. Seine Gefährtin Kekki kauerte sich furchtsam im Bug zusammen. Malta machte sich nicht einmal die Mühe, sich umzudrehen. »Wenn Ihr eine Planke nehmt und mitrudert oder steuert, dann könnt Ihr auch mitreden, in welche Richtung wir fahren. Ansonsten haltet den Mund.« Sie hatte die gebieterische Haltung dieses kindischen Satrapen und seine vollkommene Nutzlosigkeit in praktischen Belangen satt.
»Jeder Dummkopf sieht doch, dass es dort weniger Hindernisse gibt. Wir kämen viel schneller voran.«
»Oh, sicher, sehr viel schneller«, stimmte Malta ihm sarkastisch zu. »Vor allem wenn die Strömung uns packt und in die Mitte des Flusses zieht.«
Der Satrap holte gereizt Luft. »Da wir oberhalb der Stadt sind, dürfte die Strömung uns wohl eher von Nutzen sein. Wir könnten uns ihrer bedienen und uns von ihr dorthin tragen lassen, wohin ich will. Und zwar erheblich schneller.«
»Wir könnten auch vollkommen die Kontrolle über dieses Boot verlieren und an der Stadt vorbeitreiben.«
»Ist es denn noch weit?«, jammerte Kekki kläglich.
»Das seht Ihr doch genauso gut wie ich«, erwiderte Malta. Ein Tropfen des Flusswassers fiel auf ihr Knie, als sie das Paddel auf die andere Seite hob. Erst kitzelte es, dann juckte und brannte es. Sie tupfte die Stelle mit dem zerrissenen Saum ihres Kleides ab. Der Stoff hinterließ einen schmutzigen Fleck. Er war von ihrem langen Herumirren in den Sälen und Korridoren der versunkenen Stadt der Uralten ruiniert. Es war so viel passiert, dass es ihr vorkam, als wären seitdem schon tausend Nächte verstrichen, obwohl es erst letzte Nacht passiert war. Als sie versuchte, sich daran zu erinnern, überschlugen sich ihre Gedanken. Sie war in die Tunnel gestiegen, um sich der Drachenkönigin zu stellen, damit sie Reyn in Frieden ließ. Aber dann hatte die Erde gebebt, und als sie das Drachenweibchen gefunden hatte … An diesem Punkt verwirrte sich ihre Erinnerung hoffnungslos. Das Drachenweibchen in ihrem Kokon aus Holz hatte Maltas Verstand für alle Erinnerungen geöffnet, die in dieser Kammer der Stadt verborgen waren. Sie war vom Dasein der Wesen überschwemmt worden, die hier gelebt hatten, war in ihren Erinnerungen beinahe ertrunken. Von dem Moment an bis zu dem Augenblick, als sie den Satrapen und seine Gefährtin aus dem verborgenen Labyrinth hinausgeführt hatte, war ihre Erinnerung undeutlich und neblig gewesen, fast wie ein Traum. Deshalb wurde ihr auch erst jetzt klar, dass die Regenwildnishändler den Satrapen und Kekki zu ihrem eigenen Schutz hier versteckt hatten.
Oder vielleicht doch nicht? Ihr Blick glitt kurz über Kekki, die sich im Bug zusammenrollte. Waren sie gut beschützte Gäste gewesen oder Geiseln? Vermutlich beides. Und Maltas Sympathien galten vollkommen den Regenwildnishändlern. Je eher sie Satrap Cosgo und seine Gefährtin Kekki wieder ihrer Obhut übergab, desto besser. Sie waren wertvolle Tauschgüter, die man gegen den jamaillianischen Adel, die Neuen Händler und gegen die Chalcedier einsetzen konnte. Als sie dem Satrapen auf dem Ball das erste Mal begegnet war, hatte sie sich kurz von dem äußerlichen Glanz seiner Macht blenden lassen. Jetzt jedoch wusste sie, dass seine elegante Kleidung und seine aristokratischen Manieren nur Tünche über einem nutzlosen, korrupten Jungen waren. Sie wollte ihn so schnell wie möglich loswerden.
Sie konzentrierte sich auf die Lichter vor sich. Als sie den Satrapen und seine Gefährtin aus der versunkenen Stadt der Uralten herausgeführt hatte, waren sie an einer Stelle an die Oberfläche gelangt, die weit von der entfernt war, an der Malta ursprünglich die unterirdischen Ruinen betreten hatte. Ein breiter Streifen aus Morast und sumpfigen Untiefen des Flusses trennte sie noch von der Stadt. Malta hatte die Dunkelheit abgewartet, um sich von den Lichtern Trehaugs leiten zu lassen, bevor sie sich in dem betagten Boot der Uralten auf den Weg machten. Jetzt ging die Sonne auf, und sie paddelte immer noch auf die lockenden Laternen Trehaugs zu. Sie konnte nur hoffen, dass ihr missglücktes Abenteuer bald zu Ende war.
Die Stadt Trehaug lag in den Zweigen der riesigen Bäume. Kleinere Kammern hingen schwankend in den obersten Ästen, während sich die größeren Familiensäle von Stamm zu Stamm spannten. An ihnen wanden sich gewaltige Treppen hinauf, deren Absätze genügend Platz für Händler, Spielleute und Bettler boten. Der Boden unter der Stadt war zweifach verflucht: einmal aufgrund seiner Sumpfigkeit und dann wegen der Labilität dieser erdbebengeplagten Region. Die wenigen vollkommen trockenen Flecken waren zumeist kleine Inseln rund um den Fuß der Bäume.
Diese gewaltigen Bäume, um die herum Malta das Boot auf die Stadt zusteuerte, glichen Säulen des vorzeitlichen Tempels eines vergessenen Gottes. Jetzt blieb das Boot wieder an einem Hindernis hängen. Wasser klatschte dagegen. Es fühlte sich jedoch nicht wie eine Wurzel an. »Was hält uns diesmal auf?«, fragte Malta und spähte nach vorn.
Kekki wagte es nicht einmal, sich umzudrehen und hinzusehen, sondern blieb zusammengekauert liegen. Sie schien sogar Angst zu haben, die Füße auf die Bohlen des Bootes zu setzen. Malta seufzte. Allmählich glaubte sie, dass mit dem Verstand der Gefährtin etwas nicht stimmte. Entweder haben die Ereignisse des vergangenen Tages ihre Sinne verwirrt, dachte Malta bissig, oder sie ist immer schon dumm gewesen. Es hatten jedenfalls bereits einige Widrigkeiten genügt, um dieses Verhalten zu Tage zu fördern. Malta legte die Planke weg und kroch vorsichtig nach vorn. Das Boot schwankte, und sowohl der Satrap als auch Kekki schrien ängstlich auf. Malta ignorierte sie. Als die den Bug erreichte, sah sie, dass der Kahn auf ein dichtes Gewirr aus Zweigen, Ästen und anderem Flussabfall aufgelaufen war. Aber in dem dämmrigen Licht konnte sie nicht erkennen, wie weit sich dieses Hindernis erstreckte. Vermutlich hatte die Strömung den Unrat hierher getrieben und zu diesem schwimmenden Morast verdichtet. Die Schicht war zu dick, als dass sie mit dem Boot hätten hindurchrudern können. »Wir müssen es umfahren«, verkündete sie und kaute nervös auf der Unterlippe. Das bedeutete, sie mussten näher an die Hauptströmung des Flusses heran. Der Satrap hatte bereits angemerkt, dass jede Strömung sie flussabwärts nach Trehaug tragen würde. Vielleicht erleichterte ihr das ja ihre undankbare Aufgabe. Also setzte sie sich über ihre Ängste hinweg und ruderte das Boot von der Barriere weg und auf den Hauptkanal zu.
»Das ist unerträglich!«, rief Satrap Cosgo plötzlich. »Ich bin schmutzig, werde von Insekten gepeinigt, bin hungrig und durstig. Und das alles ist die Schuld dieser elenden Regenwildnissiedler. Die sich hier übrigens niedergelassen haben, ohne eine offizielle Anerkennung ihres Status zu haben! Sie haben keinerlei rechtmäßigen Anspruch auf die Schätze, die sie ausgraben und verkaufen. Sie sind kein bisschen besser als die Piraten, die die Innere Passage verseuchen. Entsprechend sollte man mit ihnen verfahren!«
Malta hatte noch genug Luft, um ihrer Verachtung Ausdruck zu verleihen. »Ihr seid wohl kaum in der Lage, irgendjemandem zu drohen! In Wirklichkeit seid Ihr von ihrem guten Willen weit abhängiger als sie von Eurem. Wie einfach wäre es für sie, Euch an den Meistbietenden zu verschachern, ganz gleich, ob der Euch ermordet, Euch als Geisel festhält oder Euch wieder auf Euren Thron setzt! Und was die Rechte der Landnahme angeht: Sie wurden von Händlern direkt vom Satrapen Esclepius verliehen, Eurem Vorfahren. Die Originalcharta für die Bingstädter Händler schreibt nur vor, wie viele Leffer Land jeder Siedler beanspruchen darf, nicht, wo das Land liegt. Die Regenwildnishändler haben ihr Anrecht hier geltend gemacht, die Bingstädter Händler ihres in der Bucht von Bingstadt. Diese Rechte sind sowohl uralt als auch vollkommen ehrenhaft, und sie sind dem jamaillianischen Gesetz entsprechend dokumentiert. Im Gegensatz zu denen der Neuen Händler, die Ihr uns einfach aufgebürdet habt!«
Nach ihren Worten herrschte einen Augenblick schockiertes Schweigen. Dann lachte der Satrap gezwungen. »Wie amüsant, dass Ihr sie verteidigt! Was seid Ihr doch für ein dummer Bauerntrampel. Seht Euch doch an, in Euren Lumpen und dreckverschmiert. Euer Gesicht ist auf immer von diesen Aufständischen entstellt worden! Und trotzdem verteidigt Ihr sie! Und warum? Lasst mich raten. Wahrscheinlich wisst Ihr, dass ein richtiger Mann Euch niemals wieder begehren würde. Eure einzige Hoffnung ist, in eine Familie einheiraten zu können, deren Angehörige genauso missgestaltet sind, wie Ihr es seid. Dann könnt Ihr Euch hinter einem Schleier verbergen, damit niemand Euren schrecklichen Anblick ertragen muss! Erbärmlich! Wären diese Aktionen der Rebellen nicht gewesen, hätte ich Euch vielleicht sogar als Gefährtin auserkoren. Davad Restate hat gut von Euch gesprochen, und ich fand Eure unbeholfenen Bemühungen, zu tanzen und Konversation zu betreiben, liebenswert provinziell. Aber jetzt? Pfui!« Das Boot wiegte sich kaum merklich, als er eine verächtliche Handbewegung machte. »Es gibt kaum etwas Perverseres als eine einstmals schöne Frau, deren Gesicht entstellt ist. Die besseren Familien von Jamaillia würden Euch nicht einmal als Sklavin im Haushalt beschäftigen. Eine solche Disharmonie hat in einem aristokratischen Haus nichts zu suchen.«
Malta gelang es mit eiserner Selbstbeherrschung, nicht zu ihm zurückzublicken, aber sie konnte sich vorstellen, wie seine Lippen sich verächtlich verzogen. Trotzdem gelang es ihr nicht, wütend über seine Arroganz zu sein. Der Satrap war nichts weiter als ein unwissender, eitler, jungenhafter Geck. Aber sie hatte ihr eigenes Gesicht nicht mehr gesehen, seit sich die Kutsche in dieser Nacht überschlagen hatte und sie beinahe gestorben wäre. Während ihrer Rekonvaleszenz in Trehaug hatte man ihr keinen Spiegel gegeben. Ihre Mutter und auch Reyn hatten die Verletzungen in ihrem Gesicht heruntergespielt. Das ist ja auch klar, flüsterte ihr verräterisches Herz ihr ein. Das mussten sie tun, deine Mutter, weil sie eben deine Mutter ist, und Reyn, weil er sich für den Unfall verantwortlich fühlt. Wie schlimm war diese Narbe? Der Schnitt auf ihrer Stirn hatte sich unter ihren tastenden Fingern lang und zackig angefühlt. Jetzt fragte sie sich, ob er ihre Stirn in Falten legte oder ihr Gesicht vielleicht verzerrte. Sie umklammerte die Planke fest mit beiden Händen, während sie ruderte. Absetzen wollte sie sie nicht, denn sie würde dem Satrapen nicht die Genugtuung geben, mit den Fingern ihre Narbe abzutasten. Sie presste die Zähne zusammen und paddelte weiter.
Nach einem Dutzend Schlägen gewann der kleine Kahn plötzlich an Geschwindigkeit. Er ruckte ein kleines Stück zur Seite und drehte sich einmal um sich selbst, als Malta ihre Planke eintauchte und verzweifelt versuchte, das kleine Boot wieder ins flachere Wasser zurückzusteuern. Sie ruderte mit ihrem provisorischen Paddel und hob dann die andere Planke vom Boden des Kahns hoch. »Ihr müsst steuern, während ich paddele«, befahl sie dem Satrapen atemlos. »Sonst werden wir in die Mitte des Flusses getrieben.«
Er musterte die Planke, die sie ihm hinhielt. »Steuern?«, fragte er und nahm das Stück Holz zögernd entgegen.
Malta bemühte sich, ruhig zu antworten. »Haltet die Planke am Heck ins Wasser. Haltet das Ende fest und benutzt es als Ruder, um uns wieder ins flache Wasser zu lenken, während ich in diese Richtung paddele.«
Der Satrap hielt die Planke in den feingliedrigen Händen, als hätte er noch nie zuvor ein Stück Holz gesehen. Malta packte ihre Planke, stieß sie wieder ins Wasser und bemerkte verblüfft, wie stark die Strömung jetzt war. Sie umklammerte unbeholfen das Holzstück, während sie versuchte, sich gegen das Wasser zu stemmen, das sie vom Ufer wegtrug. Als sie den Schutz der Bäume verließen, schien ihnen die Morgensonne ins Gesicht. Die Helligkeit wurde vom Wasser reflektiert und war nach dem Dämmerlicht unerträglich grell. Es platschte hinter ihr, und im selben Moment stieß jemand einen wütenden Laut aus. Sie drehte sich um. Der Satrap saß mit leeren Händen da.
»Der Fluss hat mir die Planke einfach aus der Hand gerissen!«, beschwerte er sich.
»Ihr Narr!«, rief Malta. »Wie sollen wir jetzt steuern?«
Der Satrap lief vor Wut rot an. »Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Du bist die Närrin, weil du geglaubt hast, dass es uns überhaupt nützen könnte! Das Holz war nicht mal wie ein Ruder geformt. Außerdem, selbst wenn es funktioniert hätte, brauchen wir es nicht. Benutz doch deine Augen, Weib! Wir haben nichts zu fürchten. Da vorn liegt die Stadt! Der Fluss trägt uns direkt dorthin!«
»Oder daran vorbei!«, fuhr Malta ihn an. Sie drehte ihm angewidert den Rücken zu und konzentrierte sich ausschließlich auf ihren einsamen Kampf gegen den Fluss. Den beeindruckenden Anblick der Stadt nahm sie nur kurz zur Kenntnis. Von unten sah es aus, als würde Trehaug wie ein Schloss mit vielen Türmen in den gewaltigen Bäumen schweben. Auf Höhe des Wasserspiegels war ein langes Dock an mehreren Bäumen befestigt. Der Kendry lag dort vor Anker, aber der Bug des Seelenschiffs war von ihnen abgewandt. Malta konnte die vernunftbegabte Galionsfigur nicht einmal sehen und paddelte wie verrückt.
»Wenn wir näher kommen«, stieß sie hervor, »dann ruft nach Hilfe! Das Schiff könnte uns hören oder vielleicht die Menschen auf dem Pier. Selbst wenn wir vorbeitreiben, senden sie uns vielleicht jemanden hinterher, der uns retten kann.«
»Ich sehe niemanden auf dem Pier«, informierte der Satrap sie schneidend. »Genauer gesagt sehe ich nirgendwo jemanden. Ein ziemlich faules Gesindel, das nur im Bett herumliegt.«
»Niemanden?« Malta konnte diese Frage nur noch hauchen. Sie hatte einfach keine Kraft mehr. Die Planke drehte sich in ihrer Hand und klatschte nutzlos auf das Wasser. Sie trieben mit jedem Moment, der verstrich, weiter auf den Fluss hinaus. Malta hob den Blick. Die Stadt war nah, viel näher als noch vor einem Moment. Und der Satrap hatte recht. Aus einigen Schornsteinen stieg zwar Rauch empor, aber ansonsten wirkte Trehaug verlassen. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Wo waren die Bewohner? Wieso herrschte nicht wie gewöhnlich geschäftiges Treiben auf den Übergängen und Treppen?
»Kendry!«, schrie sie, aber ihre Stimme klang schwach. Das rauschende Wasser übertönte sie mit Leichtigkeit.
Kekki schien jedoch plötzlich zu begreifen, was hier passierte. »Hilfe! Hilfe!«, schrie sie und sprang leichtsinnig in dem kleinen Boot auf, während sie mit den Händen herumfuchtelte. »Helft uns! Rettet mich!« Der Satrap fluchte, als das Boot heftig schwankte. Malta sprang hoch und zog die Frau wieder herunter, wobei sie beinahe die Planke verloren hätte. Ein kurzer Blick sagte ihr, dass dieses Stück Holz nun sowieso nicht mehr von Nutzen war. Der kleine Kahn befand sich jetzt vollkommen in der Gewalt des Flusses und wurde rasch an Trehaug vorbeigetrieben.
»Kendry! Hilfe! Hilf uns! Hier draußen auf dem Fluss! Schick uns Hilfe! Kendry! Kendry!« Ihre Rufe wurden schwächer, als ihre Hoffnung schwand.
Das Seelenschiff zeigte keine Reaktion. Im nächsten Augenblick sah Malta schon zu ihm zurück. Die Galionsfigur war offenbar in tiefem Nachdenken versunken und blickte in Richtung Stadt. Malta sah eine einsame Gestalt auf den Hängebrücken, aber der Mann hatte es eilig und sah sich nicht um. »Hilfe! Hilfe!« Sie schrie und winkte mit der Planke, solange sie die Stadt sehen konnte, aber das dauerte nicht lange. Die Bäume, die den Fluss säumten, nahmen ihr bald die Sicht. Die Strömung trieb sie unaufhaltsam weiter. Malta blieb niedergeschlagen sitzen.
Dann sah sie sich um. Hier war der Regenfluss breit und tief. Das andere Ufer lag in ständigem Nebel. Der Himmel war blau und wurde auf beiden Seiten von dem mächtigen Regenwildniswald gesäumt. Etwas anderes war nicht zu sehen, weder Schiffe auf dem Wasser noch menschliche Siedlungen am Ufer. Als die Strömung sie immer weiter vom Ufer wegtrug, schwand auch ihre Hoffnung auf Rettung. Selbst wenn sie ihren kleinen Kahn jetzt noch ans Ufer steuern konnte, würden sie sich hoffnungslos in der Wildnis unterhalb der Stadt verirren. Die Ufer des Regenflusses bestanden aus Sumpf und Morast. Es war unmöglich, über Land zurück nach Trehaug zu gelangen. Die Planke entglitt ihren tauben Fingern und fiel polternd ins Boot. »Ich denke, wir werden sterben«, teilte sie den anderen leise mit.
Keffrias Hände schmerzten entsetzlich. Sie biss die Zähne zusammen und zwang sich, erneut die Griffe der Schubkarre zu packen, die die Grabungsarbeiter gerade vollgeschaufelt hatten. Als sie sie anhob und ihre Last den Flur hinaufschob, verdoppelte sich dieser Schmerz. Aber sie hieß ihn willkommen. Denn sie verdiente ihn. Dieser scharfe Schmerz konnte sie fast von dem Brennen in ihrem Herzen ablenken. Sie hatte sie verloren. Sie hatte ihre jüngsten Kinder beide in einer einzigen Nacht verloren. Sie war ganz und gar allein auf der Welt.
Solange es ging, hatte sie sich an der Ungewissheit festgeklammert. Malta und Selden waren nicht in Trehaug. Niemand hatte sie seit gestern gesehen. Ein heulender Spielkamerad von Selden hatte schluchzend gestanden, dass er dem Jungen den Weg in die uralte, versunkene Stadt gezeigt hatte. Einen Weg, den die Erwachsenen für gesichert und verschlossen gehalten hatten. Jani Khuprus hatte Keffria gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen. Mit kalkweißem Gesicht und schmallippig hatte sie Keffria mitgeteilt, dass der infrage kommende Zugang aufgegeben worden war, weil Reyn ihn als gefährlich instabil eingestuft hatte. Falls Selden in diese versunkenen Korridore gegangen war und falls er Malta mitgenommen hatte, waren sie genau in das Gebiet vorgedrungen, das bei einem Erdstoß am wahrscheinlichsten zusammenfallen würde. Seit dem Morgengrauen hatte es zwei heftige Erdbeben gegeben. Keffria wusste nicht mehr, wie viele leichte Beben sie seitdem gespürt hatte. Als sie darum gebeten hatte, die Grabungsarbeiter den Weg entlangzuschicken, den die Kinder genommen hatten, fanden sie den Tunnel bereits kurz nach dem Einstieg eingestürzt vor. Sie konnte nur zu Sa beten, dass ihre Kinder vor diesem Beben einen sicheren Abschnitt der versunkenen Stadt erreicht hatten, dass sie irgendwo zusammengekauert auf Hilfe warteten.
Reyn Khuprus war ebenfalls nicht zurückgekehrt. Er hatte die Grabungsarbeiter schon am Vormittag verlassen und sich geweigert zu warten, bis die Korridore gesäubert und befestigt waren. Er war den Arbeitsgruppen vorausgeeilt, hatte sich durch die zum größten Teil zusammengebrochenen Tunnel gearbeitet und war verschwunden. Gerade erst hatten die Arbeiter das Ende der Linie erreicht, die er an die Wand gemalt hatte, um ihnen zu zeigen, wo er entlanggegangen war. Sie hatten einige Kreidezeichen gefunden, einschließlich einer Bemerkung an der Kammer des Satrapen. Hoffnungslos, hatte Reyn geschrieben. Zäher Schlamm drang unter der blockierten Tür hervor und füllte vermutlich den ganzen Raum. Kurz nach dieser Tür war der Korridor vollkommen eingestürzt. War Reyn hier entlanggegangen, war er entweder von den Erdmassen begraben worden oder dahinter abgeschnitten.
Keffria zuckte zusammen, als jemand sie am Arm berührte. Sie drehte sich um und sah sich Jani Khuprus gegenüber. Die Frau wirkte erschöpft. »Habt Ihr etwas gefunden?«, fragte Keffria automatisch.
»Nein«, antwortete Jani leise. Die Furcht, dass ihr Sohn tot sein könnte, war in ihrem Blick deutlich zu erkennen. »Der Korridor läuft beinahe ebenso schnell wieder mit Schlamm voll, wie wir ihn entleeren. Wir haben beschlossen, ihn aufzugeben. Die Uralten haben diese Stadt nicht so gebaut wie wir unsere. Die Häuser stehen hier nicht voneinander getrennt, sondern ähneln eher einem gewaltigen Bienenkorb. Es ist ein Labyrinth aus miteinander verbundenen Korridoren. Wir werden versuchen, von einem anderen Flur aus an diesen Abschnitt heranzukommen. Die Mannschaften werden bereits verlegt.«
Keffria blickte auf ihre beladene Schubkarre und dann den ausgeschachteten Flur entlang. Die Arbeiten waren eingestellt worden, und die Arbeiter gingen wieder an die Oberfläche zurück. Ein Strom aus schmutzigen und müden Frauen und Männern glitt an ihr vorbei. Ihre Gesichter waren grau vor Schmutz und Niedergeschlagenheit, und sie gingen mit schleppenden Schritten. Laternen und Fackeln blakten und qualmten. Hinter ihnen wurde der Gang immer dunkler. War etwa all die Arbeit umsonst gewesen? Sie holte tief Luft. »Wo sollen wir jetzt graben?«, fragte sie ruhig.
Jani warf ihr einen gehetzten Blick zu. »Es wurde beschlossen, eine Weile zu ruhen. Heißes Essen und ein paar Stunden Schlaf werden uns allen guttun.«
Keffria sah sie unglücklich an. »Essen? Schlafen? Wie können wir das, wo unsere Kinder noch vermisst werden?«
Die Regenwildnisfrau nahm Keffrias Stelle an der Schubkarre ein und schob sie weiter. Keffria folgte ihr zögernd. »Wir haben Vögel zu den Siedlungen in der Nähe geschickt.« Das war keine direkte Antwort auf Keffrias Frage. »Die Viehzüchter und Erntearbeiter der Regenwildnis werden uns Hilfe schicken. Sie sind unterwegs, aber es wird eine Weile dauern, bis sie hier sind.« Über die Schulter gewandt, fügte sie hinzu: »Wir haben Nachrichten von den anderen Grabungstrupps. Sie hatten mehr Glück. Es wurden vierzehn Menschen aus einem Abschnitt gerettet, den wir das Gobelinwerk nennen. Und drei weitere wurden in den Korridoren der Flammenjuwelen entdeckt. Sie sind schneller vorangekommen. Wir kommen vielleicht von einem dieser Abschnitte an diesen Teil der Stadt heran. Bendir berät sich bereits mit denen, die sich in der Stadt am besten auskennen.«
»Hat nicht Reyn die Stadt am besten gekannt?« Keffria stellte diese grausame Frage bewusst.
»Das hat er. Das tut er. Deshalb klammere ich mich an die Hoffnung, dass er noch lebt.« Die Regenwildnishändlerin betrachtete Keffria. »Falls jemand Malta und Selden finden kann, dann Reyn. Wenn er sie gefunden hat, wird er kaum versuchen, diesen Weg zurückzukommen, sondern sich in die sicheren Gebiete der Stadt zurückziehen. Mit jedem Atemzug bete ich, dass jemand erscheint und uns die Nachricht bringt, dass sie aus eigener Kraft herausgekommen sind.«
Sie standen vor einer großen Kammer, die einem Amphitheater glich. Die Arbeitsgruppen hatten ihr Werkzeug hier abgestellt. Jani kippte den Inhalt der Schubkarre auf den unordentlichen Haufen in der Mitte des ehemals prächtigen Saals. Ihre Schubkarre gesellte sich in die Reihe zu den anderen. Schaufeln und Hacken lagen auf einem Haufen daneben. Keffria roch plötzlich Suppe, gerade erst aufgebrühten Kaffee und frisch gebackenes Morgenbrot. Der Hunger, den sie während der Arbeit unterdrückt hatte, machte sich jetzt plötzlich mit einem lauten Magenknurren bemerkbar, und ihr wurde klar, dass sie die ganze Nacht noch nichts gegessen hatte. »Ist es schon Morgen?«, fragte sie Jani. Wie viel Zeit war verstrichen?
»Ich fürchte, sogar schon erheblich später«, antwortete Jani. »Die Zeit scheint immer dann zu fliegen, wenn ich es am liebsten hätte, dass sie langsam verstreicht.«
Am anderen Ende des Flurs hatte man Tische und Bänke aufgebaut. Die ganz Alten und die sehr Jungen arbeiteten hier, löffelten Suppe in Schalen, hielten kleine Feuer unter blubbernden Töpfen in Gang, stellten Teller und Tassen hin, räumten sie ab und spülten sie. Die ungeheure Kammer dämpfte die entmutigten Gespräche. Ein Kind von etwa acht Jahren eilte mit einem Becken voll dampfendem Wasser heran. Über dem Arm trug es ein Handtuch. »Waschen?«, bot es an.
»Danke.« Jani deutete auf Keffria. Diese wusch sich Hände und Arme und bespritzte sich das Gesicht. Die Wärme machte ihr bewusst, wie kalt ihr war. Der Verband um ihren verletzten Finger war durchnässt und schmutzig. »Er muss gewechselt werden«, stellte Jani fest, während Keffria sich abtrocknete. Jani wusch sich ebenfalls und bedankte sich bei dem Kind, bevor sie Keffria zu den Tischen führte, an denen verschiedene Heiler ihrer Arbeit nachgingen. Einige verbanden Blasen und massierten schmerzende Rücken, aber es gab auch einen Bereich, in dem gebrochene Gliedmaßen und blutende Wunden behandelt wurden. Einen verschütteten Korridor freizuräumen war eine gefährliche Arbeit. Jani führte Keffria zu einem Tisch, wo sie warten sollte, bis sie an die Reihe kam. Ein Heiler war bereits dabei, ihre Hand neu zu verbinden, als Jani mit frischem Brot, Suppe und Kaffee zurückkam. Der Heiler beendete seine Arbeit, teilte Keffria energisch mit, dass sie nicht mehr weiterarbeiten dürfe, und kümmerte sich um den nächsten Patienten.
»Esst etwas!«, drängte Jani sie.
Keffria nahm den Kaffeebecher zwischen die Hände. Seine Wärme wirkte seltsam beruhigend. Sie trank einen tiefen Schluck. Als sie den Becher abstellte, wanderte ihr Blick in dem Amphitheater umher. »Es ist alles so organisiert«, bemerkte sie verwirrt. »Als ob Ihr erwartet hättet, dass es passiert, dafür geplant hättet …«
»Das haben wir auch«, erwiderte Jani gelassen. »Das Einzige, was dieses Beben von anderen unterscheidet, ist seine Stärke. Jedes Beben bringt Verschüttungen mit sich. Manchmal bricht ein Korridor sogar einfach so zusammen. Meine beiden Onkel sind bei solchen Einstürzen ums Leben gekommen. Fast jede Regenwildnisfamilie, die in der Stadt arbeitet, verliert pro Generation ein oder zwei Mitglieder. Es ist einer der Gründe, warum mein Ehemann Sterb den Regenwildnisrat so glühend darum ersucht hat, ihm dabei zu helfen, andere Verdienstquellen für uns zu suchen. Manche sind der Ansicht, er habe damit nur sein eigenes Vermögen vermehren wollen. Als jüngerer Sohn des Enkels eines Regenwildnishändlers hatte er nur wenig Anspruch auf den Wohlstand seiner eigenen Familie. Aber ich glaube wirklich, dass er nicht aus Eigeninteresse, sondern aus Gemeinsinn so hart gearbeitet hat, um Stützpunkte für die Viehzüchter und Erntearbeiter zu schaffen. Er hat immer behauptet, dass die Regenwildnis all unsere Bedürfnisse befriedigen könnte, wenn wir nur die Augen für den Reichtum der Wälder öffneten.« Sie verstummte und schüttelte den Kopf. »Trotzdem macht es uns die Sache nicht leichter, wenn er sagt: ›Ich habe euch gewarnt!‹, sobald so etwas passiert. Die meisten von uns wollen die versunkene Stadt nicht gegen die Freigiebigkeit des Regenwildniswaldes eintauschen. Die Stadt kennen wir alle. Erdbeben wie dies hier sind die Gefahr, der wir uns stellen, so wie Eure Familien wissen, dass sie irgendwann Angehörige an das Meer verlieren werden.«
»Das geschieht unausweichlich«, stimmte Keffria zu. Sie nahm ihren Löffel und begann zu essen. Nach ein paar Bissen ließ sie ihn wieder sinken.
»Was?«, fragte Jani und setzte sich mit ihrem Kaffee ihr gegenüber hin.
Keffria hielt ihre Hände sehr still. »Wer bin ich noch, wenn meine Kinder tot sind?«, fragte sie. Kalte Ruhe stieg in ihr hoch, während sie weitersprach. »Mein Ehemann und mein ältester Sohn sind fort, gefangen von Piraten und vielleicht schon tot. Meine einzige Schwester hat sich auf die Suche nach ihnen gemacht. Meine Mutter ist in Bingstadt geblieben, als ich geflohen bin. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Ich bin nur wegen meiner Kinder hierhergekommen. Jetzt sind sie verschwunden, vielleicht sogar schon tot. Wenn ich allein überlebe …« Sie hielt inne, unfähig, sich dieser Möglichkeit zu stellen. Ihre Ungeheuerlichkeit überwältigte sie.
Jani lächelte sie merkwürdig an. »Keffria Vestrit. Noch vor einem Tag habt Ihr Euch freiwillig angeboten, Eure Kinder in meiner Obhut zu lassen, nach Bingstadt zurückzukehren und die Neuen Händler für uns auszuspionieren. Mir scheint, dass Ihr da eine sehr klare Vorstellung davon hattet, wer Ihr seid, unabhängig von Eurer Rolle als Mutter oder Tochter.«
Keffria stützte die Ellbogen auf den Tisch und vergrub das Gesicht in den Händen. »Und jetzt kommt mir das hier wie eine Bestrafung dafür vor. Sicher hat Sa geglaubt, dass ich meine Kinder erst dann genug wertschätze, wenn er sie mir wegnimmt.«
»Vielleicht. Wenn Sa nur eine männliche Seite hätte. Aber erinnert Euch an die alte, wahre Anbetung von Sa. Mann und Weib, wildes Tier und Pflanze, Erde, Feuer, Luft und Wasser, alles wird in Sa verehrt und durch ihn geehrt. Wenn das Göttliche also auch weiblich ist und das Weibliche göttlich, dann wird sie verstehen, dass eine Frau mehr ist als eine Mutter, eine Tochter und eine Ehefrau. Das sind Facetten eines erfüllten Lebens, aber kein Juwel wird nur von einer einzigen Facette definiert.«
Dieses alte Sprichwort mochte früher einmal tröstlich gewesen sein; jetzt klang es hohl in ihren Ohren. Aber Keffria dachte nicht lange darüber nach. Ein Aufruhr am Eingang erregte ihre Aufmerksamkeit. »Bleibt sitzen und ruht Euch aus«, sagte Jani. »Ich sehe nach, worum es geht.«
Aber Keffria konnte ihr nicht gehorchen. Wie hätte sie still dasitzen und überlegen können, ob diese Unruhe durch Neuigkeiten über Reyn, Malta oder Selden ausgelöst worden war? Sie stand auf und folgte der Regenwildnishändlerin.
Müde und schmutzige Grabungsarbeiter drängten sich um vier Jugendliche, die ihre Eimer mit frischem Wasser auf den Boden gestellt hatten. »Ein Drache! Ein riesiger silberner Drache, wenn ich es Euch doch sage! Er ist direkt über uns hinweggeflogen!« Der größte Junge sprach die Worte aus, als wollte er seine Zuhörer herausfordern. Einige Arbeiter wirkten verwirrt, andere schienen von seiner Geschichte angewidert zu sein.
»Er lügt nicht! Es ist wirklich so gewesen. Er war so real, so hell, dass ich ihn kaum anblicken konnte. Aber er war blau, ein schimmerndes Blau!«, verbesserte ein jüngerer Bursche.
»Silberblau!«, mischte sich der Dritte ein. »Und größer als ein Schiff!« Das einzige Mädchen in der Gruppe schwieg, aber ihre Augen leuchteten vor Erregung.
Keffria blickte Jani an und erwartete, einen gereizten Blick zu sehen. Wie konnten diese Jungen es sich herausnehmen, eine so ungeheuerliche Geschichte zu erfinden, wenn Menschenleben auf dem Spiel standen? Doch die Regenwildnisfrau war leichenblass geworden, was die Falten und Runzeln um ihre Augen und Lippen noch stärker betonte. »Ein Drache!«, stammelte sie. »Ihr habt einen Drachen gesehen?«
Der große Junge spürte ihr Verständnis und drängte sich durch die Gruppe zu ihr. »Es war ein Drache, und zwar einer wie auf den Fresken. Ich erfinde das nicht, Händlerin Khuprus. Aus irgendeinem Grund habe ich hochgeblickt, und da war er. Ich habe meinen Augen nicht getraut! Er flog wie ein Falke! Nein, mehr wie eine Sternschnuppe! Er war so wunderschön!«
»Ein Drache!«, wiederholte Jani benommen.
»Mutter!« Bendir war so schmutzig, dass Keffria ihn kaum erkannte, als er sich durch die Gruppe schob. Er sah den Jungen an, der vor Jani stand, und blickte dann in das erschrockene Gesicht seiner Mutter. »Also hast du es schon erfahren. Eine Frau, die oben in der Stadt die Säuglinge hütete, hat einen Jungen geschickt, der berichtete, was sie gesehen hat. Einen blauen Drachen!«
»Kann das sein?«, fragte Jani erschüttert. »Könnte Reyn die ganze Zeit recht gehabt haben? Was bedeutet das?«
»Zwei Dinge«, erwiderte Bendir angespannt. »Ich habe Leute ausgeschickt, die die Stelle ausfindig machen sollen, von wo die Kreatur aus der Stadt ausgebrochen ist. Nach der Beschreibung war sie zu groß, um sich durch die Tunnel zu zwängen. Sie muss aus der Kammer des Gekrönten Hahns gekommen sein. Vielleicht gibt es dort eine Spur von Reyn. Möglicherweise tut sich so ein anderer Weg auf, wie wir in die Stadt gelangen und nach Überlebenden suchen können.« Stimmengemurmel erhob sich, eine Mischung aus Unglauben und Staunen. Bendir sprach lauter, um den Lärm zu übertönen. »Das Zweite ist: Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Kreatur unser Feind sein kann.« Als der Junge neben ihm protestieren wollte, warnte Bendir ihn. »Ganz gleich, wie schön sie aussehen mag, sie könnte uns Böses wollen. Wir wissen so gut wie nichts über die wahre Natur von Drachen. Tut nichts, um ihn zu ärgern, und nehmt auch nicht an, dass er die gutmütige Kreatur ist, die wir auf den Fresken und Mosaiken gesehen haben. Und erregt nicht seine Aufmerksamkeit.«
Jetzt schwoll das Gemurmel zu einem lauten Stimmengewirr an. Keffria zupfte verzweifelt an Janis Ärmel und versuchte, sich in dem Lärm verständlich zu machen. »Wenn Ihr dort Reyn findet … Glaubt Ihr, dass Malta bei ihm ist?«
Jani sah ihr direkt in die Augen. »Genau das hat er befürchtet«, erwiderte sie. »Dass Malta zu der Kammer des Gekrönten Hahns gehen würde. Und zu der Drachenkönigin, die dort schlief.«
»Ich habe noch nie etwas so Wundervolles gesehen. Glaubst du, dass sie zurückkommt?« Der Junge flüsterte, vor Schwäche wie vor Ehrfurcht.
Reyn drehte sich um und betrachtete ihn. Selden kauerte auf einer kleinen Insel aus Abfall über dem Schlamm. Er starrte auf das Licht über ihnen, und seine Miene verriet, dass er noch vollkommen im Bann des Vorgangs stand, dessen Zeugen sie gerade geworden waren. Die befreite Drachenkönigin war verschwunden, schon weit außerhalb ihres Blickfelds, aber der Junge starrte immer noch in den Himmel.
»Wir sollten uns besser nicht darauf verlassen, dass sie zurückkommt und uns rettet. Das dürfte wohl uns beiden überlassen bleiben«, erklärte Reyn pragmatisch.
Selden schüttelte den Kopf. »Oh, das meinte ich auch nicht. Ich erwarte nicht einmal, dass sie uns überhaupt wahrnimmt. Ich glaube auch, dass wir uns selbst befreien müssen. Aber ich würde sie gern wiedersehen, einmal noch. Was für ein Wunder sie ist. Und was für eine Freude.« Er hob den Blick erneut zu der geborstenen Decke. Trotz des Schmutzes und des Schlamms, der sein Gesicht bedeckte, strahlte der Junge.
Sonne schien in die Kammer. Es wurde heller, aber leider nicht sehr viel wärmer. Reyn wusste nicht mehr, wie es sich anfühlte, trocken zu sein. Hunger und Durst quälten ihn, und es fiel ihm schwer, sich zu bewegen. Aber er lächelte. Selden hatte recht. Es war ein Wunder. Eine Freude.
Die Kuppel über der Kammer des Gekrönten Hahns war geborsten wie die Schale eines weichgekochten Eis. Er stand auf irgendwelchen Trümmern und blickte auf die schwankenden Wurzeln und den kleinen Ausschnitt des Himmels. Die Drachenkönigin war auf diesem Weg entkommen, aber er zweifelte, dass ihm und Selden das Gleiche gelingen würde. Schlamm füllte die Kammer immer schneller, als der Sumpf jetzt die Stadt in Besitz nahm, die ihm so lange widerstanden hatte. Der kalte Schlick und das Wasser würden sie unter sich begraben, lange bevor er sich einen Weg ausgedacht hatte, wie sie den Ausgang über sich erreichen konnten.
Aber so trübe ihre Lage auch war, er musste immer noch bewundernd an die Drachenkönigin denken, die von ihrem jahrhundertelangen Warten erlöst worden war. Die Fresken und Mosaiken seiner Jugend hatten ihn nicht auf die Realität der Drachenkönigin vorbereiten können. Das Wort »blau« bekam beim Anblick ihrer strahlenden Schuppen eine ganz neue Bedeutung. Er würde niemals vergessen, wie ihre schlaffen Flügel Stärke und Farbe angenommen hatten, als sie sie aufgepumpt hatte. Der Reptilgestank ihrer Transformation hing immer noch in der feuchten Luft. Er konnte keinerlei Spuren des Hexenholzstammes sehen, der sie geschützt hatte. Anscheinend hatte sie bei ihrer Verwandlung in einen erwachsenen Drachen den gesamten Stamm absorbiert.
Aber jetzt war sie fort. Für Reyn und den Jungen blieb das Problem des Überlebens. Die Erdbeben der letzten Nacht hatten die Wände und Decken der versunkenen Stadt endgültig zum Bersten gebracht. Die Sümpfe drangen in die Kammer ein. Und der einzige Fluchtweg lag weit über ihnen, ein quälend ferner Ausschnitt des blauen Himmels.
An den Rändern des Kuppelstücks, auf dem Reyn stand, blubberte feuchter Schlamm. Schließlich triumphierte er und sickerte bis zu Reyns nackten Füßen.
»Reyn.« Seldens Stimme klang heiser vor Durst. Maltas kleiner Bruder hockte auf einer Insel aus Trümmern, die schnell versank. Als die Drachenkönigin verzweifelt versucht hatte, sich aus der Öffnung zu zwängen, hatte sie Schutt, Erde und sogar einen Baum gelöst. Er war in die Kammer gestürzt, und ein Teil davon schwamm auf der steigenden Schlammflut. Der Junge runzelte die Stirn, als seine angeborene Sachlichkeit wieder die Oberhand gewann. »Vielleicht können wir den Baumstamm heben und gegen die Wand stemmen. Wenn wir dann hinaufklettern, könnten wir vielleicht …«
»Dafür bin ich nicht stark genug«, unterbrach Reyn den optimistischen Plan des Jungen. »Selbst wenn es uns gelänge, den Stamm anzuheben, würde der weiche Schlamm mich nicht genügend tragen. Aber wir könnten vielleicht einige kleinere Zweige abbrechen und eine Art Floß flechten. Wenn wir unser Gewicht über eine genügend große Fläche verteilen, schwimmen wir vielleicht auf dem Schlamm.«
Selden blickte hoffnungsvoll auf das Loch, durch das Tageslicht fiel. »Glaubst du, dass der Schlamm hoch genug steigt, dass wir hinausklettern könnten?«
»Vielleicht«, log Reyn inbrünstig. Er vermutete, dass die Schlammflut schon bald aufhören würde zu steigen. Sie würden vermutlich ersticken, wenn der Morast sie verschluckte. Wenn nicht, würden sie hier verhungern. Das Stück Kuppel unter seinen Füßen sank rasch. Es wurde Zeit, es zu verlassen. Er warf sich auf einen Haufen Erde und Moos, aber der versackte sofort unter seinen Füßen. Der Schlamm war noch weicher, als er vermutet hatte. Er sprang zu dem Baumstamm, erwischte einen seiner Zweige und zog sich daran hoch. Der Schlamm war mittlerweile brusthoch gestiegen und hatte die Konsistenz von Haferschleim. Wenn er tiefer hineingeriet, würde er in seiner kalten Umklammerung sterben. Aber er war jetzt dichter an Selden herangekommen. Er streckte dem Jungen die Hand hin. Selden stieß sich von seiner sinkenden Insel ab, aber er sprang zu kurz. Rasch krabbelte er über den Schlamm und erreichte Reyn. Der zog und schob ihn auf den Stamm des herabgestürzten Nadelbaums. Der Junge kauerte sich erschaudernd dagegen. Seine Kleidung war von demselben Schlamm durchtränkt, der auch sein Gesicht und seine Haare bedeckte.
»Ich wünschte, ich hätte meine Werkzeuge und Vorräte nicht verloren. Wir müssen Zweige abbrechen und sie zu einer dichten Matte zusammenstecken.«
»Ich bin so müde.« Der Junge beschwerte sich nicht – es war einfach nur eine Feststellung. Er blickte Reyn prüfend an. »So schlecht siehst du gar nicht aus, nicht mal aus der Nähe. Ich habe mich immer gefragt, wie du unter diesem Schleier wohl sein würdest. In den Tunneln konnte ich dein Gesicht im Kerzenschein nicht erkennen. Aber als deine Augen letzte Nacht so blau glühten, hatte ich erst Angst. Nach einer Weile war es einfach … na ja, es war gut, sie zu sehen und zu wissen, dass du noch da warst.«
Reyn lachte. »Glühen meine Augen tatsächlich? Normalerweise passiert das erst, wenn ein Regenwildnismann viel älter ist. Wir akzeptieren das als ein Zeichen dafür, dass er erwachsen geworden ist.«
»Oh. Aber in diesem Licht siehst du beinahe normal aus. Du hast nicht viele von diesen warzigen Dingern. Nur ein paar Stellen um deine Augen und deinen Mund.« Selden betrachtete ihn unverhohlen.
Reyn grinste. »Nein, noch habe ich keine von diesen warzigen Dingern. Aber sie kommen vielleicht ebenfalls mit fortschreitendem Alter.«
»Malta hatte Angst, dass du überall Warzen haben könntest. Einige ihrer Freundinnen haben sie damit aufgezogen, und sie wurde ziemlich wütend. Aber …« Plötzlich schien Selden aufzufallen, dass er nicht sonderlich taktvoll war. »Zuerst, als du sie umworben hast, hat sie sich viele Gedanken darüber gemacht. In letzter Zeit hat sie nicht mehr davon gesprochen«, sagte er aufmunternd. Er blickte Reyn an und krabbelte dann über den Stamm von ihm weg. Er packte einen Zweig und zog daran. »Die lassen sich aber schwer abbrechen.«
»Ich könnte mir vorstellen, dass sie etwas anderes im Sinn hatte«, murmelte Reyn. Die Worte des Jungen machten ihm das Herz schwer. Bedeutete Malta sein Äußeres so viel? Sollte er sie durch seine Taten gewinnen, nur um dann erleben zu müssen, wie sie sich abwandte, sobald sie sein Gesicht sah? Ein bitterer Gedanke stieg in ihm hoch. Vielleicht war sie ja schon tot, und er würde es nie erfahren. Oder er würde sterben, und sie würde niemals sein Gesicht sehen.
»Reyn?«, fragte Selden zögernd. »Ich glaube, wir sollten besser mit diesen Zweigen loslegen.«
Reyn wurde unvermittelt klar, wie lange er schweigend dagehockt hatte. Es wurde Zeit, nutzlose Grübeleien beiseitezuschieben. Er packte einen Ast mit beiden Händen und brach einen Zweig ab. »Versuch nicht, den ganzen Ast auf einmal zu nehmen. Brich einfach nur Zweige ab. Wir häufen sie da vorne auf. Wir müssen sie miteinander verbinden, als würden wir ein Dach flechten …« Ein neuerlicher Erdstoß unterbrach ihn. Er hielt sich an dem Baumstamm fest, als Erde von dem zerborstenen Dach auf sie herunterregnete. Selden schrie und barg den Kopf in den Armen. Reyn krabbelte über den Stamm zu ihm hin und schützte ihn mit seinem Körper. Die uralte Tür der Kammer ächzte, sackte plötzlich in den Angeln ab, und ein Fluss aus Schlamm und Wasser ergoss sich in die Kammer.