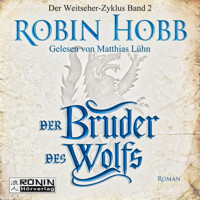9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Seelenschiff-Händler
- Sprache: Deutsch
Die große Trilogie von Weltbestsellerautorin Robin Hobb endlich als ungeteilte und überarbeitete Neuausgabe.
Ephron Vestrit war bis zu seinem Tod ein angesehener Händler, doch er hinterlässt seiner Familie hohe Schulden – und das Seelenschiff Viviace. Seelenschiffe sind empfindungsfähig, aber erst wenn sie zu vollem Bewusstsein erwachen, sind sie unschlagbar. Es war Ephrons Wunsch, dass seine Tochter Althea Kapitänin werden soll. Doch ihre Mutter übergibt das Schiff nicht ihr, sondern ihrem Schwiegersohn Kyle Haven. Zähneknirschend akzeptiert Althea diese Entscheidung. Bis sie erfährt, was Kyle ihrer geliebten Viviace antut. Und so entschließt sie sich, für ihr Seelenschiff zu kämpfen – und für ihr eigenes Schicksal.
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 1 – Der Ring der Händlerin« und »Die Zauberschiffe 2 – Viviaces Erwachen«. Diese Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1594
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Ephron Vestrit war bis zu seinem Tod ein angesehener Händler, doch er hinterlässt seiner Familie hohe Schulden – und das Seelenschiff Viviace. Seelenschiffe sind empfindungsfähig, aber erst wenn sie zu vollem Bewusstsein erwachen, sind sie unschlagbar. Es war Ephrons Wunsch, dass seine Tochter Althea Kapitänin werden soll. Doch ihre Mutter übergibt das Schiff nicht ihr, sondern ihrem Schwiegersohn Kyle Haven. Zähneknirschend akzeptiert Althea diese Entscheidung. Bis sie erfährt, was Kyle ihrer geliebten Viviace antut. Und so entschließt sie sich, für ihr Seelenschiff zu kämpfen – und für ihr eigenes Schicksal.
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Von Robin Hobb bei Penhaligon erschienen:
Die Chronik der Weitseher
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher
1. Die Tochter des Drachen (ab 08/19)
2. Die Tochter des Propheten (ab 10/19)
3. Die Tochter des Wolfs (ab 12/19)
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Robin Hobb
Das Geheimnis der Seelenschiffe
Die Händlerin
Roman
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 1998 unter dem Titel »The Live Ship Traders 1. Ship of Magic« bei Bantam Books, New York.
Dieser Roman ist bereits in zwei Teilen erschienen unter den Titeln »Die Zauberschiffe 1 – Der Ring der Händlerin« und »Die Zauberschiffe 2 – Viviaces Erwachen«. Die vorliegende Ausgabe wurde komplett überarbeitet und aktualisiert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 1998 by Robin Hobb
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München
Redaktion: Maike Claußnitzer
Covergestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Bilder von Shutterstock (atabik yusuf djufni; Aprilphoto)
HK · Herstellung: sam
eBook-Erstellung im Verlag
ISBN978-3-641-25385-1V002
www.penhaligon.de
Dieses Buch ist gewidmet
Der Teufelskralle
Der Totem
Der E. J. Bruce
Der Free Lunch
Der Labrador (Schuppen! Schuppen!)
Der (so treffend benannten) Massaker-Bucht
Der Treugläubigen (Gummibärchen ahoi!)
Der Eingangspunkt
Der Cap St. John
Der American Patriot (und Käpt’n Wookie)
Der Lesbischen Kriegsfurie
Der Anita J. und Marcy J.
Der Tarpon
Der Capelin
Der Dolphin
Der (leider nicht besonders) Gute-Nachrichten-Bucht
Und sogar der Kleines Hühnchen
Doch ganz besonders ist dieses Buch
der Rain Lady gewidmet,
wo auch immer sie jetzt sein mag.
Prolog
Das Knäuel
Maulkin wuchtete sich unvermittelt mit einem heftigen Schlag aus dem Schlamm, der das Wasser um ihn herum wie ein Schleier verdunkelte. Fetzen seiner abgeworfenen Haut schwebten zwischen dem Sand und dem Schlamm wie die Reste eines Traums, aus dem man gerade erwacht ist. Er bildete mit seinem langen, gewundenen Körper träge eine Schleife und rieb sich an sich selbst, um so die letzten Reste der alten Haut abzuschleifen. Als sich der Bodenschlamm allmählich wieder setzte, betrachtete er die etwa zwei Dutzend Seeschlangen, die sich in den angenehm kratzigen Sedimenten aalten. Er schüttelte den großen Kopf mit der beeindruckenden Mähne und streckte dann seinen gewaltigen Muskel der Länge nach aus. »Es ist Zeit«, dröhnte er mit seiner tiefen kehligen Stimme. »Die Zeit ist gekommen.«
Alle sahen ihn vom Meeresboden aus an. Ihre großen Augen, die grün, golden und kupfern funkelten, zwinkerten nicht. Shreeva sprach für alle, als sie fragte: »Warum? Hier ist das Wasser warm, und es gibt reichlich Nahrung. Seit hundert Jahren gab es hier keinen Winter. Warum sollten wir jetzt fortgehen?«
Statt einer Antwort wand sich Maulkin noch einmal gemächlich um sich selbst. Seine neuen Schuppen glänzten strahlend in dem blaugefilterten Sonnenlicht. Als er sich putzte, glühten die falschen, goldenen Augen auf seiner Haut, die über seinen ganzen Körper liefen und ihn als einen von denen mit uralter Kenntnis auswiesen. Maulkin konnte sich an Dinge erinnern, Dinge aus der Zeit noch vor dieser Zeit. Seine Wahrnehmung war nicht klar und auch nicht immer logisch. Wie viele von denen, die zwischen den Zeiten gefangen waren, Kenntnis von beiden Leben hatten, sprach er oft unkonzentriert und unzusammenhängend. Er schüttelte die Mähne, bis sein Lähmungsgift in einer blassen Wolke um seinen Kopf schwebte. Er schluckte sein eigenes Gift und atmete es durch die Kiemen wieder aus, als wollte er damit unterstreichen, dass er die Wahrheit sprach. »Weil es jetzt Zeit ist!«, wiederholte er drängend. Plötzlich schoss er davon, hinauf zur Oberfläche, und überholte pfeilschnell selbst die Luftblasen. Weit oben schnellte er aus dem Wasser und segelte kurz in die Große Leere hinaus, bevor er wieder hinabtauchte. Dann umkreiste er die anderen immer wieder, und die Dringlichkeit seiner Botschaft machte ihn sprachlos.
»Ein paar der anderen Knäuel sind schon fort«, meinte Shreeva nachdenklich. »Wenn auch nicht alle, ja nicht einmal die Mehrzahl. Aber es sind genug, um sie zu vermissen, wenn wir in die Große Leere hinaufsteigen, um zu singen. Vielleicht ist es Zeit.«
Sessurea schmiegte sich tiefer in den Schlamm. »Vielleicht auch nicht«, erwiderte er träge. »Ich finde, wir sollten warten, bis Aubrens Knäuel aufbricht. Aubren ist … verlässlicher als Maulkin.«
Hinter ihm fuhr Shreeva plötzlich aus dem Schlamm empor. Das glänzende Rot ihrer neuen Haut war frappierend. Fetzen von Dunkelrot hingen immer noch an ihrem Körper. Sie riss mit dem Maul einen großen Strang ab und schluckte ihn herunter, bevor sie sprach. »Vielleicht solltest du dich Aubrens Knäuel anschließen, wenn du Maulkins Worten misstraust. Ich jedenfalls werde ihm nach Norden folgen. Wir gehen besser zu früh als zu spät. Wenn wir zusammen mit den anderen Knäueln gehen, werden wir mit ihnen um Nahrung kämpfen müssen.« Sie glitt geschmeidig durch den Knoten, den sie mit ihrem eigenen Körper bildete, und rieb so die letzten Reste der alten Haut ab. Sie schüttelte die Mähne und warf den Kopf zurück. Ihr schrilles Trompeten rührte das Wasser auf. »Ich komme, Maulkin! Ich folge dir!« Sie stieg auf, um sich zu ihrem Anführer zu gesellen, der immer noch über ihnen unruhig seine Kreise zog.
Eine nach der anderen hoben die übrigen großen Seeschlangen die langen Körper aus dem Schlamm und befreiten sich von ihren alten Häuten. Alle, selbst Sessurea, stiegen in das wärmere Wasser, unmittelbar unter der Grenze zur Fülle, und reihten sich in den Tanz des Knäuels ein. Sie würden nach Norden ziehen, zurück in die Gewässer, aus denen sie gekommen waren, vor so langer Zeit, dass sich nur noch wenige daran erinnerten.
Hochsommer
1Von Piraten und Priestern
Kennit schlenderte an der Wasserlinie entlang, ohne auf die salzigen Wellen zu achten, die seine Stiefel umspülten und seine Fußspuren auf dem Sandstrand wegwuschen. Er hielt den Blick starr auf die gekrümmte Linie aus Seegras, Muscheln und Treibholz gerichtet, die den höchsten Stand des Wassers markierte. Die Gezeiten wechselten gerade, und der sehnsüchtige Schlag der Wellen gegen das Land wurde immer kürzer. In dem Maß, in dem sich das Salzwasser vor dem schwarzen Strand zurückzog, entblößte es auch die verblichenen Schieferplatten und Knäuel von Seetang, die jetzt noch in den Fluten verborgen waren.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Insel der Anderen ankerte seine Zweimastbark in der Bucht der Tücke. Er hatte die Marietta hier vor Anker gesetzt, als die Morgenwinde den letzten Rest des Sturms vom Himmel geblasen hatten. Da war die Flut noch im Steigen begriffen, und die scharfen Kliffe der berüchtigten Bucht hatten sich missmutig unter das schaumige grüne Band zurückgezogen. Das Beiboot des Schiffs mit ihm und Gankis an Bord war über die muschelübersäten Felsen geschrammt und hatte sich dazwischen hindurchgemogelt, um die beiden auf dem winzigen schwarzen Sandstrand abzusetzen, der vollkommen verschwand, wenn der Sturm die Wellen weit über die Hochwassermarkierung hinauftrieb. Darüber erhoben sich drohend die Schieferklippen. Immergrüne Pflanzen, die so dunkel waren, dass sie beinahe schwarz wirkten, trotzten den vorherrschenden Winden.
Kennit besaß zwar Nerven aus Stahl, aber selbst ihm kam es so vor, als träten sie in das weit aufgerissene Maul einer Kreatur.
Sie hatten Opal bei der Gig gelassen, damit ihr nicht dasselbe widerfuhr, was so oft unbewachten Booten in der Bucht der Tücke zustieß. Und zum sichtlichen Unbehagen des Schiffsjungen hatte Kennit Gankis befohlen, ihn zu begleiten und das Boot und den Jungen allein zurückzulassen. Als Kennit einen letzten Blick zurückwarf, sah er, wie der Junge in dem Boot kauerte, das schief am Strand lag. Abwechselnd hatte er furchtsam über die Schulter zu den bewaldeten Klippenspitzen gespäht und dann wieder angestrengt hinaus auf die Bucht geblickt, wo die Marietta sich gegen ihre Ankerkette stemmte. Als sehne sie sich danach, den Strömungen aus der Mündung der Bucht hinauszufolgen.
Die Gefahren, die einen beim Besuch dieser Insel erwarteten, waren legendär. Es waren nicht nur die Unwirtlichkeit des »besten« Ankerplatzes auf der Insel oder die merkwürdigen Unfälle, die bekanntermaßen Schiffen und Besatzungen zustießen. Die ganze Insel war von der seltsamen Magie der Anderen überzogen. Kennit hatte gemerkt, wie sie an ihm zog und zupfte, während Gankis und er dem Pfad folgten, der von der Bucht der Tücke zum Kleinodienstrand führte. Für einen Weg, der nur selten genutzt wurde, war er wunderlich frei von Laub oder wuchernden Pflanzen. Von den Blättern über ihnen fielen die letzten Regentropfen des nächtlichen Sturms auf Farne, die bereits mit kristallenem Tau schwer beladen waren. Die Luft war kühl und erfüllt von Leben. Bunte Blumen wuchsen mindestens eine Körperlänge vom Wegrand entfernt und spotteten der Dunkelheit des schattigen Waldbodens. Ihre verführerischen Düfte erfüllten die Morgenluft, als wollten sie die Männer verlocken, vom Weg abzuweichen und ihre Welt zu erforschen. Weniger zuträglich sahen hingegen die orangefarbenen Pilze aus, die sich wie Treppen um die Stämme vieler Bäume wanden. Die schockierende Brillanz ihrer Farbe verriet Kennit den Hunger des Parasiten. Ein Spinnennetz hing vor ihnen über den Weg und zwang sie, sich zu ducken. Es war wie die Farne mit schillernden Regentropfen behangen. Die Spinne, die an seinem Rand hockte, war orangefarben wie die Pilze und beinahe so groß wie die Faust eines Säuglings. Eine grüne Baumkröte hatte sich in dem klebrigen Netz der Spinne verfangen und versuchte sich zu befreien, doch die Spinne schien das nicht zu interessieren. Gankis gab ein missbilligendes Grunzen von sich, als er sich bückte, um das Netz nicht zu berühren.
Der Pfad führte direkt durch das Reich der Anderen. Hier konnte ein Mensch die unscharfen Grenzen ihres Territoriums überschreiten. Falls er genug Kühnheit besaß, den gut markierten Pfad zu verlassen, der den Menschen zugewiesen war, und sich in den Wald traute, um die Wesen zu suchen. Früher einmal, so berichteten die Legenden, waren auch Helden hierhergekommen. Und zwar nicht, um dem Pfad zu folgen, sondern um ihn vorsätzlich zu verlassen. Sie wollten die Anderen in ihren Höhlen aufspüren und die Weisheit ihrer Göttin suchen, die angeblich in einer Höhle eingesperrt war. Oder Geschenke von ihnen verlangen, wie zum Beispiel den Mantel, der Unsichtbarkeit verlieh, oder Schwerter, die Flammen warfen und jede Panzerung durchschlugen. Barden, die es gewagt hatten, diesen Weg zu gehen, verfügten, wenn sie nach Hause kamen, über Stimmen, die das Ohr eines Mannes zerschmettern konnten oder aber jeden Zuhörer mit ihrer Kunstfertigkeit dahinschmelzen ließen. Alle kannten die uralte Sage von Kaven Rabenschwarz, der über ein halbes Jahrhundert bei den Anderen geblieben und zurückgekehrt war, als wäre für ihn ein Tag vergangen. Seine Haare hatten die Farbe von Gold, seine Augen glühten wie Kohlen, und seine Lieder waren von Wahrheit erfüllt. Sie verkündeten in komplizierten Reimen die Zukunft. Kennit schnaubte verächtlich. Alle kannten diese alten Märchen, aber wenn zu seinen Lebzeiten jemals ein Mann diesen Weg verlassen hatte, hatte er es bestimmt niemandem erzählt. Vielleicht war auch niemand jemals zurückgekehrt, um damit zu prahlen. Der Pirat schob diese Gedanken beiseite. Er war nicht auf die Insel gekommen, um den Pfad zu verlassen, sondern um ihm bis ans Ende zu folgen. Denn es war allgemein bekannt, was dort wartete.
Kennit folgte dem Schotterweg, der sich durch die bewaldeten Hügel des Inneren der Insel schlängelte, bis der gewundene Pfad sie schließlich auf einer kargen Hochebene ausspie, die eine langgezogene, offene Bucht einrahmte. Sie lag genau gegenüber der anderen Bucht der winzigen Insel. Die Legenden besagten, dass jedes Schiff, das hier ankerte, als Nächstes nur noch die Unterwelt anlaufen würde. Kennit hatte keine Aufzeichnungen von irgendeinem Schiff gefunden, dessen Besatzung es gewagt hätte, den Wahrheitsgehalt dieses Gerüchtes zu überprüfen. Falls Seeleute es dennoch versucht hatten, war ihre Kühnheit mit ihnen zum Teufel gegangen.
Über den blauen Himmel zogen noch einige Wolken von dem nächtlichen Sturm. Die lange Kurve aus Felsen und Sand wurde nur von einem Fluss unterbrochen, der sich durch das hohe, grasige Ufer fraß, das den Strand säumte. Er schlängelte sich durch den Sand und mündete schließlich ins Meer. In größerer Entfernung erhoben sich die hohen Klippen aus schwarzem Schiefer und markierten das Ende des sichelförmigen Strandes. Ein spitzer Turm aus Schiefer stand von der Insel gelöst im Meer. Er war schief und durch ein kleines Stück Strand von dem Mutterkliff getrennt. Dieser Spalt im Kliff umrahmte eine blaue Scheibe des Himmels und der rastlosen See.
»Gestern Abend hatten wir ganz schön Wind und Wellen, Käpt’n. Manche sagen, dass die Bucht der Schätze am besten von den grasigen Dünen hier oben zu begehen ist … Angeblich werfen bei einem kräftigen Sturm die Wellen die Dinge bis hier oben hinauf, zerbrechliche Gegenstände, von denen man eher glaubt, dass sie an Felsen und so zerschmettert werden. Aber stattdessen landen sie auf dem Riedgras hier oben, und zwar so richtig sanft.« Gankis stieß die Worte keuchend hervor, während er versuchte, Kennit zu folgen. Er musste sich abmühen, um mit dem langbeinigen Piraten Schritt zu halten. »Mein Onkel sagte, er würde einen Mann kennen, der ein Holzkästchen hier oben gefunden hätte. Glänzend schwarz und ganz und gar mit Blumen bemalt. Drinnen wäre eine kleine Glasstatue einer Frau mit Schmetterlingsflügeln gewesen. Aber es war nicht einfach nur durchsichtiges Glas, o nein. Die Farben der Flügel waren direkt ins Glas eingewirbelt, waren sie wirklich.« Gankis blieb bei seinem Bericht stehen und hob den Kopf, als er vorsichtig seinen Herrn ansah. »Möchtet Ihr wissen, was die Anderen daraus weissagten?«, fragte er zurückhaltend.
Kennit blieb stehen und stieß mit der Stiefelspitze gegen eine Furche in dem nassen Sand. Das Glitzern von Gold belohnte ihn. Er bückte sich lässig und schob seinen Finger unter eine prachtvolle Goldkette. Als er sie anhob, zog er damit auch ein Medaillon aus dem sandigen Grab. Er wischte es an seiner vornehmen Leinenhose ab und versuchte sich dann ungeschickt an dem winzigen Verschluss. Die goldenen Hälften klappten auf. Das Salzwasser hatte die Ränder des Medaillons durchdrungen, aber das Porträt einer jungen Frau lächelte ihn noch gut erkennbar an. Ihr Blick war sowohl fröhlich als auch schüchtern zurückweisend. Kennit knurrte anerkennend über seinen Fund und schob ihn in die Tasche seiner bestickten Weste.
»Käpt’n, Ihr wisst doch, dass sie Euch das nicht behalten lassen. Niemand behält irgendwas vom Kleinodienstrand«, meinte Gankis mit vorsichtigem Nachdruck.
»Ach, erlauben sie das nicht?«, fragte Kennit. Er gab seinen Worten einen amüsierten Anstrich und bemerkte, wie Gankis darüber rätselte, ob das jetzt Selbstironie oder eine Drohung war. Gankis verlagerte unauffällig sein Gewicht, so dass sich sein Gesicht nicht mehr in Reichweite der Faust seines Kapitäns befand.
»Das sagen alle, Käpt’n«, erwiderte er zögernd. »Niemand kann irgendwas mit nach Hause nehmen, was er am Kleinodienstrand findet. Ich weiß ganz sicher, dass der Freund meines Onkels es jedenfalls nicht konnte. Nachdem die Anderen sich seinen Fund angesehen und ihm die Zukunft daraus geweissagt hatten, ist er den Anderen den Strand entlang bis zu diesem Steinkliff gefolgt.« Gankis streckte den Arm aus und deutete auf die entfernten Schieferklippen. »Und in ihrer Vorderseite befinden sich Tausende von kleinen Löchern, kleine … wie nennt man sie noch …?«
»Alkoven«, kam ihm Kennit mit beinahe träumerischer Stimme zu Hilfe. »Ich nenne sie Alkoven, Gankis. Und das würdest du auch tun, wenn du deine Muttersprache beherrschtest.«
»Jawohl, Käpt’n. Alkoven. Und in jedem befand sich ein Schatz, außer in denen, die leer waren. Und die Anderen ließen ihn an der Wand entlanggehen und all die Schätze ansehen. Es waren Dinge darunter, die er sich nicht einmal hätte vorstellen können. Porzellanteetassen mit wunderschönen Rosenblüten verziert, goldene Weinbecher mit diamantenen Rändern und kleine, bunt bemalte Spielzeugfiguren und … ach, Hunderte von wunderbaren Dingen und jedes davon in einem Alkoven, Käpt’n. Und dann hat er einen Alkoven gefunden, der genau die richtige Größe und Form hatte, und hat die Schmetterlingsdame hineingestellt. Er hat meinem Onkel erzählt, dass sich niemals etwas so gut und so richtig angefühlt hat, wie diesen kleinen Schatz in diese Nische zu stellen. Dann hat er sie dort gelassen, ist von der Insel weggesegelt und nach Hause gefahren.«
Kennit räusperte sich. Dieser einzelne Laut drückte mehr Verachtung und Widerwillen aus, als die meisten Menschen in einen ganzen Schwall von Verwünschungen hätten packen können. Gankis senkte den Blick. »Er hat das gesagt, Käpt’n, nicht ich.« Er zog am Bund seiner schäbigen Hose und fügte beinahe zögernd hinzu: »Der Mann lebt ein bisschen in einer Traumwelt. Er hat ein Siebtel von allem, was er verdient hat, Sas Tempel geschenkt und dann auch noch seine beiden ältesten Kinder. Solch ein Mann denkt nicht wie wir, Käpt’n.«
»Falls du überhaupt denkst, Gankis«, erwiderte der Kapitän spöttisch. Er sah mit den blassen Augen in die Ferne, auf die Wasserlinie, und blinzelte etwas, als die Morgensonne sich grell auf den wogenden Wellen brach. »Schwing dich wieder auf dein Riedgras, Gankis, und geh dort oben entlang. Und bring mir, was du findest. Sofort.«
»Jawohl, Käpt’n.« Der ältere Pirat schlurfte davon, nicht ohne seinem jungen Kapitän noch einen reumütigen Blick zuzuwerfen. Dann kletterte er geschickt das niedrige Ufer hinauf auf die üppig begraste Hochebene, die den Strand abgrenzte. Er ging parallel zur Wasserlinie und musterte dabei den Weg vor sich. Und stieß beinahe augenblicklich auf etwas. Er lief darauf zu und hob einen Gegenstand auf, der im Sonnenlicht glänzte. Er hielt ihn vor die Augen und betrachtete ihn voller Bewunderung. »Käpt’n, Käpt’n, Ihr solltet Euch ansehen, was ich gefunden habe!«
»Das könnte ich auch, wenn du es zu mir bringen würdest, wie ich es dir befohlen habe!«, erklärte Kennit verärgert.
Wie ein Hund, der gerufen wird, eilte Gankis wieder zu seinem Kapitän zurück. Seine braunen Augen funkelten mit jugendlichem Feuer, und er umklammerte den Schatz mit beiden Händen, als er unbeholfen den mannshohen Abhang zum Strand hinuntersprang. Während er lief, drang Sand in seine flachen Schuhe. Kennit runzelte kurz die Stirn, als er beobachtete, wie Gankis sich ihm näherte. Obwohl der alte Seemann beinahe einen Kotau machte, um ihm zu schmeicheln, war er eigentlich nicht mehr geneigt, seine Beute zu teilen, als jeder andere Mann seines Gewerbes. Kennit hatte nicht wirklich erwartet, dass Gankis ihm seinen Fund von den grasigen Dünen freiwillig bringen würde. Im Gegenteil, er war sogar eher davon ausgegangen, dass er sich den Mann bis zum Ende ihres Spaziergangs vom Hals geschafft hatte. Dass Gankis jetzt auf ihn zustürmte und sein Gesicht vor Freude glühte wie das eines Bauerntölpels, der seinem Liebchen einen Blumenstrauß überreicht, war wirklich beunruhigend.
Dennoch trug Kennit sein sardonisches Lächeln zur Schau, hinter dem er wie gewohnt seine Gedanken verbarg. Es war eine sorgfältig einstudierte Mimik, die etwas von der trägen Eleganz einer jagenden Katze hatte. Schon seine Körpergröße erlaubte es ihm, auf den Seemann hinabzusehen. Indem er nun noch diese amüsierte Miene zur Schau trug, machte er seine Gefolgsleute glauben, dass es ihnen niemals gelingen konnte, ihn zu überraschen. Er wollte seine Mannschaft in der Überzeugung lassen, dass er nicht nur all ihre Züge voraussehen, sondern auch ihre Gedanken lesen konnte. Eine Mannschaft, die so etwas glaubte, würde weniger schnell meutern, und wenn sie doch aufbegehrte, würde niemand gern den ersten Stein werfen.
Also behielt er diese Miene bei, während Gankis durch den Sand auf ihn zustolperte. Mehr noch, er schnappte ihm nicht sofort den Schatz weg, sondern ließ den Mann mit ausgestrecktem Arm warten, während er, Kennit, den Gegenstand belustigt betrachtete.
Doch von dem Augenblick an, als er ihn sah, musste Kennit seine ganze Beherrschung aufbringen, um ihn nicht sofort zu packen. Noch nie hatte er eine so erstaunlich gefertigte Kugel gesehen. Sie war aus Glas, und sie war absolut perfekt. Die Oberfläche wies nicht den kleinsten Kratzer auf. Das Glas selbst schimmerte bläulich, aber die Farbe verschleierte nichts von dem Wunder, das sich im Inneren der Kugel befand. Drei winzige Figürchen in bunten Narrengewändern und mit weiß geschminkten Gesichtern standen auf einer winzigen Bühne und schienen miteinander verbunden zu sein. Wenn Gankis die Kugel in den Händen drehte, setzte er sie in Bewegung. Einer drehte eine Pirouette auf den Zehen, und der Nächste schwang sich über ein Reck. Der Dritte nickte mit dem Kopf im Takt zu den Aktionen der anderen, als wenn alle drei auf eine fröhliche Melodie reagierten, die mit ihnen in der Kugel eingesperrt war.
Kennit gestattete Gankis, es ihm zweimal vorzuführen. Dann streckte er, ohne ein Wort zu sagen, mit einer eleganten Bewegung die Hand mit den langen, schlanken Fingern aus. Der Seemann legte den Schatz auf seine Handfläche. Kennit achtete darauf, ja nicht sein überlegenes Lächeln zu verlieren, als er die Kugel gegen die Sonne hielt und die Figuren selbst in Bewegung setzte. »Ein Kinderspielzeug«, meinte er leichthin.
»Aber nur wenn das Kind der reichste Prinz der Welt wäre«, bemerkte Gankis kühn. »Es ist viel zu zerbrechlich, um es einem Kind zum Spielen zu geben, Käpt’n. Man braucht es nur einmal fallen zu lassen …«
»Dennoch scheint es die Fahrt auf den stürmischen Wellen genauso unbeschadet überstanden zu haben wie die harte Landung am Strand«, erklärte Kennit gewollt gutmütig.
»Wohl wahr, Käpt’n, wohl wahr, aber hier ist schließlich der Kleinodienstrand. Fast alles, was hier landet, bleibt heil, jedenfalls nach dem zu urteilen, was ich gehört habe. Das liegt an der Magie dieses Ortes.«
»Magie.« Kennit lächelte noch ein bisschen stärker, während er die Kugel in der Innentasche seiner weiten blauen Jacke verschwinden ließ. »Also glaubst du, dass es Magie ist, die diesen Tand an den Strand spült, ja?«
»Was denn sonst, Käpt’n? Wenn es mit rechten Dingen zugehen würde, müsste diese Kugel in Stücke zerschmettert oder zumindest vom Sand zerschrammt worden sein. Stattdessen sieht sie aus, als käme sie soeben aus einem Schmuckladen.«
Kennit schüttelte traurig den Kopf. »Magie? Nein, Gankis, hier handelt es sich genauso wenig um Magie wie bei den Sturmfluten auf den Halligen oder den reißenden Strömungen, die Segelschiffe auf ihrer Fahrt zu den Inseln vorwärtstreiben oder sie auf dem Heimweg aufhalten. Es ist nur ein Trick der Winde, der Strömungen und der Gezeiten. Mehr nicht. Derselbe Trick, der garantiert, dass jedes Schiff, das auf dieser Seite der Insel ankert, noch vor der nächsten Flut an den Strand gespült und zerschmettert wird.«
»Jawohl, Käpt’n«, stimmte Gankis ihm pflichtschuldigst zu, aber überzeugt wirkte er nicht. Sein Blick glitt verräterisch zu der Tasche, in der der Kapitän die Glaskugel verstaut hatte. Kennits Lächeln vertiefte sich noch.
»Also? Lunger hier nicht herum. Geh wieder hinauf und such die Dünen ab. Vielleicht findest du ja noch etwas.«
»Jawohl, Käpt’n.« Gankis salutierte, drehte sich nach einem letzten sehnsüchtigen Blick auf die Tasche um und hastete wieder zu den Dünen hinauf. Kennit schob die Hand in die Tasche, liebkoste unbemerkt das glatte, kalte Glas und setzte seinen Marsch den Strand entlang fort. Über ihm folgten ihm die Möwen und suchten in dem flachen Wasser nach Leckerbissen. Er beeilte sich nicht, aber er vergaß auch nicht, dass sein Schiff auf der anderen Seite der Insel in den heimtückischen Gewässern wartete. Er würde die ganze Länge des Strands abmarschieren, wie die Tradition es verlangte, aber er hatte nicht die Absicht hierzubleiben, nachdem er die besänftigenden Worte eines Anderen gehört hatte. Und genauso wenig hatte er vor, die Schätze zurückzulassen, die er gefunden hatte. Als er diesmal lächelte, war es echt.
Während er den Strand entlangschlenderte, zog er die Hand aus der Tasche und berührte beiläufig sein anderes Handgelenk. Die weiße Spitzenmanschette seines Seidenhemdes verbarg ein zierliches, geflochtenes Lederband. Es presste ein kleines Holzschmuckstück fest an sein Handgelenk. Die Schnitzerei zeigte ein Gesicht, das an Stirn und Kinn durchbohrt war, so dass es sich fest an sein Handgelenk schmiegte, und zwar genau über seinem Puls. Das Gesicht war einmal schwarz bemalt gewesen, aber die Farbe war mittlerweile fast vollkommen verwaschen. Die Gesichtszüge waren jedoch immer noch deutlich zu erkennen. Es war eine winzige, spöttische Maske, die mit äußerster Sorgfalt geschnitzt worden war. Diese Schnitzerei in Auftrag zu geben hatte ihn eine außerordentliche Summe Goldes gekostet. Nicht jeder, der Hexenholz schnitzen konnte, tat das auch bereitwillig, selbst wenn man die Chuzpe besaß, welches zu stehlen.
Kennit konnte sich noch gut an den Künstler erinnern, der das winzige Gesicht für ihn hergestellt hatte. Er hatte lange Stunden in dem Atelier des Mannes zugebracht und im kühlen Licht der Morgensonne Modell gesessen, während der Bildhauer mühsam das eisenharte Holz bearbeitet hatte, um Kennits Züge zu formen. Sie hatten nicht gesprochen. Der Künstler, weil er nicht konnte. Und der Pirat, weil er nicht sollte. Der Schnitzer brauchte absolute Ruhe, um sich zu konzentrieren, denn er bearbeitete nicht nur das Holz, sondern auch einen Zauberspruch, der dieses Amulett verpflichtete, seinen Träger vor anderen Zaubern zu bewahren. Außerdem hatte Kennit dem Mann nichts zu sagen. Der Pirat hatte ihm vor Monaten eine ungeheure Summe gezahlt und dann gewartet. Schließlich kam ein Bote des Künstlers mit der Nachricht, dass der Mann ein Stück von dem kostbaren und eifersüchtig gehüteten Holz erworben habe. Kennit hatte innerlich vor Wut geschäumt, als der Holzschnitzer noch mehr Gold verlangt hatte, bevor er mit der Schnitzerei und dem Zauber anfing, doch nach außen hin hatte er nur sein rätselhaftes Lächeln gezeigt und Münzen, Juwelen und Silber auf die Waage des Künstlers geschüttet, bis dieser nickte, um anzuzeigen, dass der Preis erreicht war. Wie viele von Bingstadts illegalen Händlern hatte er schon vor langer Zeit seine Zunge geopfert, um seinen Kunden Verschwiegenheit zu garantieren. Zwar war Kennit von der Wirksamkeit einer solchen Verstümmelung nicht sonderlich überzeugt, erkannte aber den symbolischen Akt an, der darin lag. Als der Künstler schließlich fertig war und Kennit eigenhändig das Amulett angelegt hatte, blieb ihm nur, seine tiefe Genugtuung über seine eigenen handwerklichen Fähigkeiten mit einem Nicken zu bekunden, während er das Holz mit seinen gierigen Fingern berührte.
Danach tötete Kennit ihn. Es war das einzig Vernünftige, und Kennit war ein außerordentlich vernünftiger Mann. Und er nahm sich auch das Extrahonorar wieder, das der Mann verlangt hatte. Kennit konnte Menschen nicht leiden, die sich nicht an eine einmal vereinbarte Abmachung hielten. Doch nicht deshalb hatte er ihn getötet. Sondern um das Geheimnis zu wahren. Wenn seine Männer erfuhren, dass Kapitän Kennit ein Amulett trug, um Zauber abzuwehren, dann würden sie vielleicht glauben, dass er diese Magie fürchtete. Und er konnte nicht zulassen, dass seine Mannschaft vermutete, er habe vor irgendetwas Angst. Sein Glück war legendär. Alle Männer, die ihm folgten, glaubten daran, die meisten sogar überzeugter als er selbst. Es war der Grund, warum sie ihm folgten. Sie durften nicht auf den Gedanken kommen, dass er fürchtete, irgendetwas könnte dieses Glück bedrohen.
Er hatte sich in dem Jahr, in dem er den Künstler getötet hatte, gefragt, ob dieser Mord das Amulett beeinträchtigt haben könnte, denn es war nicht »erwacht«. Als er den Holzschnitzer gefragt hatte, wie lange es dauern würde, bis der kleine Glücksbringer erwachte, hatte dieser nur vielsagend mit den Schultern gezuckt und mit viel Gefuchtel erklärt, dass dies weder er noch jemand anders voraussagen könnte. Ein Jahr lang hatte Kennit darauf gewartet, dass sein Zauberamulett erwachte, damit er endlich sicher sein konnte, dass der Zauber auch vollkommen wirksam war. Aber dann kam die Zeit, da er nicht mehr länger warten konnte. Er wusste rein instinktiv, dass er den Kleinodienstrand besuchen und herausfinden musste, welche Reichtümer der Ozean für ihn anschwemmen würde. Er konnte nicht mehr darauf warten, dass sein Amulett erwachte, sondern musste das Risiko eingehen. Wieder blieb ihm nur, darauf zu vertrauen, dass sein Glück ihn beschützte. Das hatte es schließlich auch an dem Tag getan, als er den Holzschnitzer töten musste, oder etwa nicht? Der Mann hatte sich unerwarteterweise umgedreht und gesehen, wie Kennit seinen Dolch zog. Der Pirat war überzeugt, dass der Mann viel lauter geschrien hätte, wäre er noch im Besitz seiner Zunge gewesen.
Kennit schob alle Gedanken an den Künstler beiseite. Jetzt war nicht der richtige Moment, um über ihn nachzudenken. Er war nicht zum Kleinodienstrand gekommen, um über die Vergangenheit nachzugrübeln, sondern um einen Schatz zu finden, der seine Zukunft sicherte. Er richtete den Blick scharf auf die gewundene Flutgrenze und folgte ihr den Strand entlang. Glitzernde Muscheln, Krebszangen und die Knäuel aus Seetang und großen und kleinen Stücken Treibholz beachtete er nicht. Der Blick seiner blauen Augen suchte nach treibenden Wracks und Wrackteilen. Er musste nicht weit gehen, bis er belohnt wurde. In einer kleinen, mitgenommenen Holzkiste fand er ein Service aus Teetassen. Er glaubte nicht, dass sie von Menschen gemacht oder benutzt worden waren. Es waren zwölf, und sie waren aus ausgehöhlten Vogelknochen angefertigt. Miniaturen in Blau waren darauf aufgemalt, und die Linien waren so fein, dass sie aussahen, als habe der Pinsel nur ein einziges Haar gehabt. Die Tassen waren offenbar häufig benutzt worden, denn die blauen Bilder waren so verblasst, dass nicht mehr zu erkennen war, was sie eigentlich darstellten, und die knöchernen Henkel waren glatt und abgenutzt. Er klemmte sich den Kasten unter den Arm und setzte seinen Weg fort.
Er schritt in der Sonne und gegen den Wind weiter. Seine eleganten Stiefel hinterließen deutliche Spuren im nassen Sand. Gelegentlich hob er den Blick und ließ ihn beiläufig über den ganzen Strand gleiten. Dabei achtete er darauf, dass seine Miene keinerlei Erwartung verriet. Als er wieder hinuntersah, bemerkte er eine kleine Schachtel aus Zedernholz. Das Salzwasser hatte das Holz quellen lassen. Um sie zu öffnen, musste er sie wie eine Nuss gegen einen Stein schlagen. In der Schachtel befanden sich Fingernägel. Sie waren aus prachtvollem Perlmutt gefertigt. Mit zierlichen Klammern konnte man sie auf einem gewöhnlichen Fingernagel befestigen. An der Spitze von jedem einzelnen Nagel befand sich eine winzige Vertiefung, vielleicht für Gift. Es waren zwölf. Kennit schob die Dose in seine andere Tasche, wo die Nägel rasselten und vernehmlich aneinanderschlugen, als er weiterging.
Es störte ihn nicht, dass seine Funde weder von Menschenhand gefertigt noch für menschlichen Gebrauch entworfen waren. Obwohl er sich zuvor über Gankis’ Glauben an den Zauber, der über dem Strand lag, lustig gemacht hatte, wussten doch alle, dass die Wellen von mehr als einem Ozean an diesen Strand schlugen. Schiffe, deren Kapitäne dumm genug waren, während einer weißen Bö irgendwo vor dieser Insel zu ankern, verschwanden fast immer ganz und gar, ohne auch nur einen Trümmersplitter zu hinterlassen. Alte Seeleute behaupteten, sie seien während eines Sturms aus dieser Welt in die Meere einer anderen gefegt worden. Kennit zweifelte nicht an ihren Worten. Er blickte zum Himmel hinauf, aber der war blau und strahlend. Der Wind war zwar frisch, aber er vertraute darauf, dass das Wetter beständig blieb. Dann konnte er den Kleinodienstrand ganz abgehen und anschließend quer über die Insel zu seinem Schiff zurückkehren, das in der Bucht der Tücke ankerte. Er vertraute darauf, dass sein Glück anhielt.
Schließlich machte er eine beunruhigende Entdeckung. Es war ein Beutel aus blauem und rotem Leder, der halb unter dem feuchten Sand begraben lag. Es war festes Leder. Anscheinend sollte der Beutel lange halten. Das Salzwasser hatte ihn durchnässt und befleckt, und die Farben waren ineinandergelaufen. Die Sole hatte die Messingverschlüsse aufquellen lassen, die ihn sicherten, und auch die Lederbänder, die hindurchliefen. Kennit zertrennte mit seinem Messer den Saum. In dem Beutel lag ein Wurf junger Kätzchen. Sie waren perfekt ausgebildet, hatten lange Klauen und schillernde Flecken hinter den Ohren. Sie waren tot, alle sechs. Kennit unterdrückte seinen Ekel, nahm das kleinste hoch und drehte den schlaffen Körper in seinen Händen. Das Tier hatte ein blaues Fell, ein tiefes, kühles Blau, und rosafarbene Augenlider. Es war klein. Wahrscheinlich das kleinste des Wurfs. Es war durchnässt, kalt und widerlich. Ein Ohrring mit einem Rubin saß wie eine fette Zecke auf einem der nassen Ohren. Am liebsten hätte Kennit es einfach fallen lassen. Lächerlich. Er riss den Ohrring herunter und ließ ihn in seine Tasche fallen. Aus einem Impuls heraus, den Kennit nicht verstand, verstaute er die kleinen blauen Leichen wieder in dem Beutel, ließ sie neben der Wasserlinie liegen und ging weiter.
Bewunderung strömte wie Blut durch seine Adern. Baum. Rinde und Saft, der Duft von Holz und die Blätter, die über ihm rauschten. Baum. Aber auch Erde und Wasser, Luft und Licht, all das kam und ging durch das Wesen, das man als Baum kannte. Er bewegte sich mit ihnen, glitt in die Existenz von Rinde, Blättern und Wurzeln, von Luft und Wasser hinein und wieder hinaus.
»Wintrow.«
Der Junge löste langsam den Blick von dem Baum vor sich und zwang sich dazu, ihn auf das lächelnde Gesicht des jungen Priesters zu konzentrieren. Berandol nickte aufmunternd. Wintrow schloss einen Moment die Augen, hielt den Atem an und riss sich von seiner Aufgabe los. Als er die Lider wieder aufschlug, schnappte er nach Luft, als steige er soeben aus einer großen Tiefe herauf. Die Lichtreflexe, das süße Wasser und der sanfte Wind verblassten unvermittelt. Er war wieder im Werkraum des Klosters, einer kühlen Halle mit gemauerten Wänden und steinernem Boden. Letzterer fühlte sich unter seinen nackten Füßen kalt an. In dem Raum standen mehrere massive Tische. An dreien arbeiteten Jungen wie er selbst. Sie waren ebenso langsam. Ihre traumwandlerischen Bewegungen verrieten ihren Trancezustand. Einer flocht einen Korb, und die beiden anderen formten mit nassen, grauen Händen Lehm.
Er blickte auf die bunten Glasstücke und das Blei auf dem Tisch vor sich. Die Schönheit des bunten Glasbildes, das er zusammengefügt hatte, erstaunte ihn selbst, und dennoch kam es nicht an das Wunder heran, der Baum gewesen zu sein. Er berührte es mit den Fingern, strich über den Stamm und die elegant geschwungenen Äste. Das Bild zu liebkosen war, wie seinen eigenen Körper zu berühren; so gut kannte er es. Er hörte, wie Berandol leise nach Luft schnappte. In dem Zustand seiner verschärften Wahrnehmung spürte er, wie die Bewunderung des Priesters sich mit seiner vereinte. Eine Weile standen sie schweigend da und weideten sich an dem Wunder von Sa.
»Wintrow«, wiederholte der Priester leise. Er streckte die Hand aus und zeichnete mit dem Finger den Umriss des winzigen Drachens nach, der zwischen den oberen Zweigen des Baumes hervorlugte, dann berührte er den glänzenden Schwung des Schlangenkörpers, der von den verzweigten Ästen beinahe verborgen wurde. Er legte dem Jungen die Hand auf die Schulter und drehte ihn mit sanftem Druck vom Arbeitstisch weg. Als er ihn aus dem Werkraum führte, tadelte er ihn freundlich. »Du bist noch zu jung, um einen ganzen Morgen in einem solchem Zustand zu verweilen. Du musst lernen, das Tempo zu regulieren.«
Wintrow rieb sich mit den Knöcheln die Augen, in denen plötzlich Sand zu sein schien. »War ich den ganzen Morgen da drin?«, fragte er benommen. »Es kam mir gar nicht so vor, Berandol.«
»Davon bin ich überzeugt. Aber ich bin auch sicher, dass die Müdigkeit, die du jetzt empfindest, dir verdeutlicht, dass es so ist. Man muss vorsichtig sein, Wintrow. Beim nächsten Mal bittest du einen Aufpasser, dich am Vormittag aufzurütteln. Das Talent, das du besitzt, ist zu kostbar, um es ausbrennen zu lassen.«
»Jetzt spüre ich den Schmerz«, gab Wintrow zu. Er strich sich über die Stirn, schob sich das dünne schwarze Haar aus den Augen und lächelte. »Aber der Baum war es wert, Berandol.«
Berandol nickte langsam. »In mehr als einer Hinsicht. Der Verkauf eines solchen Fensters wird genug Geld einbringen, um das Dach des Novizenschlafsaals neu zu decken. Wenn Mutter Dellity es über sich bringt, dass sich das Kloster von einem solchen Wunder trennt.« Er zögerte einen Moment, bevor er weitersprach. »Ich sehe, dass sie wieder erschienen sind. Der Drache und die Schlange. Du hast immer noch keine Ahnung …?« Er ließ die Frage unvollendet.
»Ich erinnere mich nicht einmal daran, dass ich sie dorthin gesetzt habe«, erwiderte Wintrow.
»Nun denn.« Berandols Stimme klang kein bisschen verurteilend. Nur geduldig.
Sie schwiegen kameradschaftlich, während sie durch die kühlen, steinernen Flure des Klosters schritten. Langsam verloren Wintrows Sinne ihre Schärfe und sanken wieder auf ihr normales Niveau zurück. Er nahm nicht mehr den Geschmack der Salze wahr, die in den steinernen Wänden steckten, und hörte auch nicht länger das unmerkliche Arbeiten der uralten Steinquader. Das grobe braune Sackleinen seiner Novizenrobe wurde allmählich wieder erträglich auf der Haut. Als sie das große Holzportal erreichten und hinaus in den Klostergarten traten, war er wieder sicher in seinem Körper aufgehoben. Er fühlte sich so wacklig auf den Beinen, als wäre er soeben aus einem langen Schlaf erwacht, und dennoch so erschöpft, als habe er den ganzen Tag Kartoffeln gehackt. Schweigend ging er neben Berandol her, wie es der Klostersitte geziemte. Sie begegneten anderen, Frauen und Männern in den grünen Gewändern der Priesterschaft – und solchen in den weißen Kutten der Akolythen. Man grüßte sich durch ein Nicken.
Als sie sich dem Werkzeugschuppen näherten, überkam ihn plötzlich das beunruhigende Gefühl, dass dies ihr Ziel sein könnte und er den Rest des Nachmittags im sonnigen Garten arbeiten müsste. Zu jeder anderen Zeit hätte er sich darauf vielleicht gefreut, aber durch die Anstrengungen in dem dämmrigen Werkraum waren seine Augen überaus lichtempfindlich geworden. Er zögerte, und Berandol sah sich um.
»Wintrow«, tadelte er ihn sanft. »Widersetze dich der Unruhe. Wenn du Sorgen über das empfindest, was vielleicht sein könnte, dann wirst du den Moment vernachlässigen, den du jetzt genießen solltest. Der Mann, der sich über das grämt, was als Nächstes geschieht, verliert diesen Moment aus Furcht vor dem nächsten und vergiftet den anderen mit seiner Voreingenommenheit.« Berandols Stimme wurde eine Spur härter. »Du gibst dich zu oft deinen Vorurteilen hin. Sollte dir die Priesterschaft verweigert werden, dann hauptsächlich aus diesem Grund.«
Wintrows Blick flog entsetzt zu Berandol. Einen Augenblick zeichnete sich die Trostlosigkeit deutlich auf seiner Miene ab. Dann erkannte er die Falle. Er grinste, und Berandol erwiderte es, als der Junge antwortete: »Aber wenn ich mich darüber gräme, dann habe ich mir mein Scheitern selbst zuzuschreiben.«
Berandol versetzte dem Jungen einen gutmütigen Stoß mit dem Ellbogen. »Genau. Ach, du wächst und lernst so schnell. Ich war viel älter als du, bestimmt schon zwanzig, als ich endlich gelernt habe, diesen Widerspruch auf mein tägliches Leben anzuwenden.«
Wintrow zuckte verlegen die Achseln. »Ich habe gestern Abend vor dem Einschlafen darüber meditiert. ›Man muss für die Zukunft planen und sie akzeptieren, ohne sie zu fürchten.‹ Das ist der Siebenundzwanzigste Widerspruch des Sa.«
»Dreizehn Jahre, das ist noch sehr jung, um schon den Siebenundzwanzigsten Widerspruch zu erreichen«, bemerkte Berandol.
»Bei welchem bist du denn?«, fragte Wintrow ohne Hintergedanken.
»Beim Dreiunddreißigsten. Bei diesem Spruch verweile ich bereits seit zwei Jahren.«
Wintrow zuckte die schmalen Schultern. »So weit bin ich noch nicht gekommen.« Sie gingen im Schatten der Apfelbäume weiter, deren Zweige in der Hitze herunterhingen. Reife Früchte bogen die Äste tief herab. Am anderen Ende des Obstgartens bewegten sich zwischen den Bäumen Akolythen nach einem genauen Plan mit Eimern, die sie aus dem Fluss füllten.
»Ein Priester sollte nicht urteilen, bis er so urteilen kann, wie Sa es tut. Absolut gerecht und absolut gnädig.« Berandol schüttelte den Kopf. »Ich muss zugeben, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie das möglich sein soll.«
Der Blick des Jungen war bereits wieder nach innen gerichtet, und er runzelte nur unmerklich die Stirn. »Solange du glaubst, dass es unmöglich ist, verschließt du deinen Verstand davor, es zu verstehen.« Seine Stimme klang wie aus weiter Ferne. »Außer natürlich, dass es genau das ist, was wir entdecken sollen. Dass wir als Priester nicht urteilen können, weil wir nicht über die absolute Gnade und die absolute Gerechtigkeit verfügen, um dies zu tun. Vielleicht ist es uns nur bestimmt, zu vergeben und zu trösten.«
Berandol schüttelte den Kopf. »In einem kurzen Moment hast du mehr Knoten durchtrennt, als ich in sechs Monaten gelöst habe. Doch wenn ich mich umsehe, erblicke ich viele Priester, die urteilen. Die Wanderer unseres Ordens tun nichts anderes, als die Streitigkeiten der Menschen zu schlichten. Also müssen sie irgendwie den Dreiunddreißigsten Widerspruch überwunden haben.«
Der Junge sah ihn neugierig an und öffnete den Mund, um etwas zu sagen. Er errötete und schloss ihn wieder.
Berandol sah seinen Schützling an. »Was es auch sein mag, sprich es aus. Ich werde dich nicht tadeln.«
»Das Problem ist, dass ich dich tadeln wollte«, gestand Wintrow. Der Junge strahlte, als er weitersprach. »Aber ich habe mich vorher zusammengenommen und es nicht getan.«
»Und was wolltest du mir sagen?«, setzte Berandol nach.
Als der Junge den Kopf schüttelte, lachte sein Tutor laut auf. »Komm schon, Wintrow. Glaubst du, ich wäre so ungerecht, dir deine Worte übelzunehmen, wenn ich dich auffordere zu sprechen? Was hast du gedacht?«
»Ich wollte dir sagen, dass du dein Verhalten nach den Geboten Sas ausrichten solltest und nicht nach dem, was du andere tun siehst«, erwiderte der Junge aufrichtig, doch dann senkte er den Blick. »Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, dich darauf hinzuweisen.«
Berandol schien jedoch zu tief in Gedanken, als daran Anstoß zu nehmen. »Wenn ich jedoch den Geboten allein folge und mir mein Herz sagt, dass ein Mensch unmöglich so urteilen kann, wie es Sa tut, mit absoluter Gerechtigkeit und absoluter Gnade, dann muss ich zu dem Schluss kommen …« Er sprach langsamer, als wehre er sich gegen den Gedanken. »Ich muss zu dem Schluss kommen, dass die Wanderer entweder über eine größere geistige Tiefe verfügen als ich oder dass sie nicht mehr recht haben zu urteilen als ich.« Sein Blick glitt zwischen den Apfelbäumen umher. »Kann es denn sein, dass ein ganzer Zweig unseres Ordens ohne jedes Recht existiert? Ist allein dieser Gedanke nicht schon eine Verletzung der Loyalität?« Sein beunruhigter Blick blieb an dem Jungen hängen.
Wintrow lächelte erst. »Wenn die Gedanken eines Mannes den Geboten Sas folgen, dann können sie nicht irreführen.«
»Ich muss mehr darüber nachdenken«, schloss Berandol mit einem Seufzer und bedachte Wintrow mit einem Blick herzlicher Zuneigung. »Ich segne den Tag, an dem du mir als Schüler zugeteilt wurdest. Obwohl ich mich oft frage, wer hier eigentlich der Schüler und wer der Lehrer ist. Ich werde dich vermissen.«
Wintrow sah ihn plötzlich besorgt an. »Mich vermissen? Gehst du fort? Bist du so schnell in den Dienst gerufen worden?«
»Nein, ich nicht. Ich hätte dir diese Neuigkeiten sicherlich geschickter übermitteln sollen, aber wie immer haben mich deine Worte weit von meinem anfänglichen Ziel abgebracht. Nicht ich verlasse das Kloster, sondern du. Deshalb habe ich dich heute gesucht. Ich bitte dich zu packen, denn du bist nach Hause gerufen worden. Deine Großmutter und deine Mutter haben uns Nachricht geschickt, dass dein Großvater im Sterben liegt. Sie möchten dich in einer solchen Zeit in ihrer Nähe haben.« Als er die Verzweiflung auf dem Gesicht des Jungen sah, fügte Berandol hinzu: »Es tut mir leid, dass ich so geradeheraus war. Du sprichst so selten von deiner Familie. Ich wusste nicht, dass du deinem Großvater so nahestandest.«
»Das tue ich auch nicht«, gab Wintrow zu: »Um die Wahrheit zu sagen: Ich kenne ihn kaum. Als ich noch klein war, war er immer auf See. Und wenn er zu Hause war, hat er mir nur Angst eingejagt. Nicht durch Grausamkeit, sondern durch seine … Macht. Alles an ihm schien zu groß für den Raum zu sein, von seiner Stimme bis zu seinem Bart. Selbst als ich noch klein war und andere Leute belauscht habe, wie sie über ihn redeten, war es, als sprächen sie von einer Legende oder einem Helden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn jemals Opa oder auch nur Großvater genannt habe. Wenn er heimgekommen ist, fegte er durch das Haus wie ein Nordwind. Ich habe vor seiner Gegenwart immer eher Schutz gesucht, als dass ich sie genossen hätte. Als man mich vor ihn gezerrt hat, kann ich mich nur noch daran erinnern, dass er etwas an meinem Wachstum auszusetzen hatte. ›Warum ist der Junge so winzig?‹, wollte er wissen. ›Er sieht genauso aus wie meine Jungen, aber ist nur halb so groß! Gebt ihr ihm kein Fleisch? Isst er nicht gut?‹ Dann zog er mich zu sich und betastete meinen Arm, als müsste ich für ein Festmahl gemästet werden. Damals schämte ich mich wegen meiner Größe, als wäre sie ein Makel. Seit ich der Priesterschaft übergeben wurde, habe ich ihn weniger gesehen, aber mein Eindruck von ihm hat sich nicht geändert. Aber es ist nicht mein Großvater, den ich fürchte, und auch nicht die Totenwache. Es ist das Heimkommen, Berandol. Es ist dort so … lärmig.«
Berandol schnitt eine mitfühlende Grimasse.
»Ich glaube, ich habe erst denken gelernt, nachdem ich hierhergekommen bin«, fuhr Wintrow fort. »Dort war es zu laut und zu geschäftig. Ich hatte nie die Zeit nachzudenken. Von dem Augenblick an, als uns unser Kindermädchen morgens aus dem Bett gescheucht hat, bis zum Abend, wenn wir gebadet, angezogen und wieder ins Bett gesteckt wurden, waren wir in Bewegung. Wir wurden angezogen und auf Ausflüge mitgenommen, wurden unterrichtet und bekamen zu essen, besuchten Freunde, wurden wieder umgezogen und bekamen noch mehr zu essen … Es war endlos. Weißt du, als ich zuerst hierherkam, habe ich meine Zelle zwei Tage lang nicht verlassen. Ohne mein Kindermädchen oder meine Großmutter oder meine Mutter, die mich herumscheuchten, wusste ich nichts mit mir anzufangen. Und außerdem waren meine Schwester und ich so lange eine Einheit gewesen. ›Die Kinder‹ brauchten ihren Mittagsschlaf, ›die Kinder‹ brauchten ihr Mittagessen. Als man uns trennte, hatte ich das Gefühl, als verlöre ich die Hälfte meines Körpers.«
Berandol lächelte anerkennend. »So ist es also, ein Vestrit zu sein. Ich habe mich immer gefragt, wie die Kinder der alten Händlerfamilien von Bingstadt leben. Bei mir war es ganz anders und dennoch sehr ähnlich. Wir waren Schweinehirten, meine ganze Familie. Ich hatte weder Kindermädchen, noch wurde ich auf Ausflüge mitgenommen, aber es warteten immer genug Pflichten, die uns auf Trab hielten. Wenn ich zurückblicke, dann haben wir die meiste Zeit einfach versucht zu überleben. Wir haben das Essen gestreckt, Dinge repariert, die zu reparieren sich sonst längst niemand mehr die Mühe gemacht hätte, uns um die Schweine gekümmert … Ich glaube, das Borstenvieh hat eine bessere Behandlung bekommen als alle anderen. Und niemand verschwendete einen Gedanken daran, ein Kind für die Priesterschaft aufzugeben. Dann wurde meine Mutter krank, und mein Vater legte ein Gelübde ab. Wenn sie überlebte, würde er eines seiner Kinder Sa schenken. Sie überlebte, und man schickte mich fort. Ich war sozusagen das jüngste im Wurf. Das jüngste überlebende Kind und dann auch noch mit einem zurückgebliebenen Arm. Es war ein Opfer für sie, davon bin ich überzeugt, aber sicher war es nicht so groß, wie etwa einen meiner strammen Brüder zu verlieren.«
»Du hattest einen schwachen Arm?«, fragte Wintrow überrascht.
»Ja. Ich bin einmal darauf gefallen, als ich noch klein war, und es hat lange gedauert, bis er heilte. Danach war er nie mehr so stark, wie er hätte sein sollen. Aber die Priester haben mich kuriert. Sie steckten mich in die Bewässerungsmannschaft des Obstgartens. Der leitende Priester gab mir zwei unterschiedliche Eimer und ließ mich den schwereren mit meinem schwächeren Arm tragen. Erst dachte ich, er wäre verrückt. Meine Eltern hatten mich immer gelehrt, den stärkeren Arm für alles zu benutzen. Nun, das war meine erste Einführung in Sas Gebote.«
Wintrow dachte einen Augenblick stirnrunzelnd nach und lächelte dann. »Denn der Schwächste muss nur versuchen, seine Stärke zu finden, und dann wird auch er stark werden.«
»Ganz genau.« Der Priester deutete auf ein niedriges, langgestrecktes Gebäude vor ihnen. Die Zellen der Akolythen waren ihr Ziel gewesen. »Der Bote hierher wurde aufgehalten. Du musst schnell packen und sofort aufbrechen, wenn du den Hafen noch erreichen willst, bevor dein Schiff die Segel setzt. Es ist ein langer Marsch.«
»Ein Schiff!« Die Verzweiflung, die kurzzeitig aus Wintrows Miene verschwunden war, überflutete ihn wieder. »Daran habe ich nicht gedacht. Ich hasse Seereisen. Aber wenn man von Jamaillia nach Bingstadt kommen will, dann hat man natürlich keine andere Wahl.« Seine Miene wurde finsterer. »Zum Hafen gehen? Haben sie keinen Bediensteten mit einem Pferd für mich bereitgestellt?«
»Kehrst du so schnell zu den Bequemlichkeiten des Wohlstandes zurück, Wintrow?«, tadelte ihn Berandol. Als der Junge den Kopf hängen ließ, fuhr er fort: »Nein, in der Botschaft stand nur, dass ein Freund dir die Passage angeboten und deine Familie das Angebot gern angenommen hat.« Freundlicher fügte er hinzu: »Ich vermute, dass deine Familie nicht mehr so viel Geld hat wie einst. Der Krieg im Norden hat vielen Handelsfamilien geschadet, sowohl was die Waren angeht, die niemals den Grünen Fluss hinuntergekommen sind, als auch die Güter, die dort nicht verkauft werden konnten.« Nachdenklich sprach er weiter. »Und unser junger Satrap begünstigt Bingstadt nicht so, wie sein Vater und Großvater es getan haben. Sie schienen der Überzeugung gewesen zu sein, dass diejenigen, die mutig genug waren, sich an den Verfluchten Gestaden niederzulassen, sich auch großzügig an den Schätzen bereichern sollten, die sie dort vorfanden. Nicht so unser junger Satrap Cosgo. Er ist angeblich der Meinung, dass die Händler lange genug die Belohnung für ihren Mut geerntet hätten, dass die Ufer jetzt dicht besiedelt seien und alle Flüche, die einmal darauf gelegen hätten, mittlerweile verschwunden wären. Er hat ihnen nicht nur neue Steuern aufgebürdet, sondern auch einigen seiner Günstlinge neue Parzellen mit Land in der Nähe von Bingstadt zugeteilt.« Berandol schüttelte den Kopf. »Er bricht das Versprechen seiner Vorfahren und bringt Unbill über Menschen, die ihm gegenüber immer ihr Wort gehalten haben. Daraus kann nichts Gutes entstehen.«
»Ich weiß. Ich sollte dankbar sein, dass ich nicht den ganzen Weg laufen muss. Aber es ist hart, Berandol, eine Reise zu einem Ziel zu akzeptieren, das ich fürchte, und das zu allem Überfluss auch noch mit dem Schiff. Es wird mir die ganze Fahrt über schlecht gehen.«
»Du wirst seekrank?«, fragte Berandol überrascht. »Ich hätte nicht gedacht, dass jemand aus einem Seefahrergeschlecht darunter leiden könnte.«
»Das richtige Wetter kann jedermanns Magen verderben, aber nein, das ist nicht der Grund. Es sind der Lärm und die Hektik und die Enge an Bord. Der Gestank. Die Seeleute. Auf ihre Art mögen es ja ganz annehmbare Männer sein, aber …« Der Junge zuckte mit den Schultern. »Sie sind nicht wie wir. Sie haben nicht die Zeit, über Dinge zu sprechen, die wir hier erwägen, Berandol. Und wenn doch, dann wären ihre Gedanken wahrscheinlich so, wie die des unerfahrensten Akolythen. Sie leben wie die Tiere und argumentieren auch so. Ich werde mich fühlen, als befände ich mich unter Bestien. Obwohl sie natürlich nichts dafür können«, fügte er rasch hinzu, als er sah, wie der junge Priester die Stirn runzelte.
Berandol holte Luft, als wollte er etwas einwenden, überlegte es sich dann jedoch anders. Nach einem Moment meinte er nachdenklich: »Es ist zwei Jahre her, seit du dein Elternhaus zuletzt besucht hast, Wintrow. Zwei Jahre, seit du das letzte Mal das Kloster verlassen und mit arbeitenden Menschen zusammengekommen bist. Sieh genau hin und hör gut zu, und wenn du dann zu uns zurückkehrst, dann sag mir, ob du immer noch mit dem übereinstimmst, was du eben gesagt hast. Ich bitte dich, daran zu denken, denn ich werde es tun.«
»Ich werde es auch tun, Berandol«, versprach der Junge feierlich. »Und ich werde dich vermissen.«
»Wahrscheinlich aber erst in ein paar Tagen, weil ich dich nämlich auf deiner Reise zum Hafen begleiten werde. Komm. Lass uns packen gehen.«
Lange bevor Kennit das Ende des Strands erreichte, spürte er, dass die Anderen ihn beobachteten. Er hatte oft gehört, sie wären Kreaturen der Nacht und wagten sich nur selten heraus, solange die Sonne am Himmel stand. Ein geringerer Mann hätte vielleicht Angst gehabt, aber ein geringerer Mann verfügte auch nicht über Kennits Glück. Oder über seine Geschicklichkeit im Umgang mit dem Säbel. Er setzte seinen Spaziergang am Strand fort und sammelte dabei unablässig Beute. Dabei tat er, als bemerke er das Geschöpf nicht, das ihn beobachtete, und gleichzeitig wollte das unheimliche Gefühl nicht von ihm weichen, dass es seine Täuschung durchschaute. Es ist ein Spiel im Spiel, sagte er sich und lächelte unmerklich.
Doch als Gankis einige Sekunden später auf ihn zustürzte, um ihm mitzuteilen, dass ein Anderer ihn beobachtete, wurde er fürchterlich wütend.
»Das weiß ich«, beschied er den alten Seemann schroff. Einen Augenblick später hatte er Stimme und Miene wieder unter Kontrolle. Freundlich erklärte er: »Und das Geschöpf weiß auch, dass wir wissen, dass es uns beobachtet. Aus diesem Grund schlage ich vor, dass du es ignorierst, wie ich es tue, und deine Dünen zu Ende absuchst. Hast du irgendetwas Bemerkenswertes gefunden?«
»Ein paar Sachen«, gab Gankis wenig erfreut zu. Kennit richtete sich auf und wartete. Der alte Seemann wühlte in den geräumigen Taschen seines abgetragenen Mantels. »Dies hier«, meinte er und zog einen buntbemalten Gegenstand aus der Tasche. Es waren Scheiben und Stöcke, und die Scheiben hatten runde Löcher in der Mitte.
Kennit verstand es nicht. »Das muss irgendein Kinderspielzeug sein«, erklärte er. Er sah Gankis fragend an und wartete.
»Und das hier«, sagte der Seemann. Er beförderte einen Rosenzweig aus der Tasche. Kennit nahm ihn vorsichtig entgegen und achtete dabei auf die Dornen. Bis er ihn berührte, hatte er den Zweig für echt gehalten. Dann merkte er, dass der Stängel steif und unnachgiebig war. Er wog ihn in der Hand. Der Zweig war so leicht wie eine echte Rose. Er drehte ihn um und versuchte herauszufinden, aus welchem Material er gemacht war. Er kam zu dem Schluss, dass er so etwas noch nie zuvor gesehen hatte. Noch rätselhafter als ihre Struktur war der Duft der Rose. Sie roch so intensiv und würzig, als wäre es eine voll erblühte Blume aus einem Sommergarten. Kennit sah Gankis abschätzend an, während er die Rose an seinem Revers befestigte. Die Drahtdornen hielten sie fest. Kennit sah, wie Gankis die Lippen zusammenpresste, aber der alte Seemann wagte nicht zu widersprechen.
Kennit blickte zur Sonne hoch und dann auf das Wasser, das sich allmählich zurückzog. Für den Marsch auf die andere Seite der Insel würden sie mehr als eine Stunde brauchen. Er konnte nicht mehr länger bleiben, ohne zu riskieren, dass sein Schiff auf den Felsen zerschellte, die sich jetzt aus dem ablaufenden Wasser erhoben. Ihn überkam einer dieser seltenen Momente der Unentschlossenheit, und seine Miene umwölkte sich. Er war nicht nur wegen der Beute zum Kleinodienstrand gekommen, sondern auch weil er das Orakel der Anderen suchte. Er vertraute darauf, dass es zu ihm sprach. Hatte er nicht deshalb Gankis als Zeugen mitgenommen? Gankis war einer der Männer an Bord, die ihre eigenen Abenteuer nicht automatisch ausschmückten. Er wusste, dass nicht nur seine eigenen Leute, sondern auch jeder Pirat in Deelestadt Gankis’ Bericht für bare Münze nehmen würde. Außerdem … wenn der Spruch, dessen Zeuge Gankis wurde, Kennits Zwecken nicht diente, konnte er den alten Matrosen leicht töten.
Erneut überlegte er, wie viel Zeit ihm noch blieb. Ein umsichtiger Mann hätte jetzt die Suche abgebrochen, sich dem Anderen gestellt und wäre dann zu seinem Schiff zurückgeeilt. Kluge Männer vertrauten nie auf ihr Glück. Aber Kennit war schon lange zu dem Schluss gekommen, dass man seinem Glück vertrauen musste, damit es wuchs. Es war eine persönliche Überzeugung, und er sah keinen Grund, sie irgendjemandem anzuvertrauen. Er hatte niemals einen nennenswerten Triumph erlebt, ohne zuvor ein Risiko eingegangen zu sein und seinem Glück vertraut zu haben. Vielleicht würde sein Glück ihn ja an dem Tag, an dem er klug und vorsichtig wurde, beleidigt verlassen. Er schnitt eine Grimasse, weil eben dieses Risiko das einzige war, das er niemals eingehen würde. Er würde niemals dem Glück vertrauen, dass sein Glück ihn niemals verlassen würde.
Dieser logische Haken gefiel ihm. Er schlenderte weiter die Wasserlinie entlang. Als er sich den spitzen Felsen näherte, die das Ende des sichelförmigen Strandes markierten, spürte er prickelnd mit allen Sinnen die Anwesenheit des Anderen. Sein Geruch war verlockend süß, schlug jedoch unvermittelt um und wurde ranzig und faulig, wenn der Wind den Duft stärker heranbrachte. Der Gestank wurde so stark, dass es ihn würgte. Aber es war nicht nur der Duft der Kreatur. Kennit konnte es auch auf der Haut fühlen. Seine Ohren rauschten, und er spürte seinen Atem als Druck auf seinen Augen und auf der Haut an seinem Hals. Er glaubte nicht, dass er schwitzte, und dennoch war seine Gesichtshaut plötzlich mit einem fettigen Film überzogen, als habe der Wind eine Substanz von dem Anderen abgezogen und sie gegen ihn geschleudert. Kennit kämpfte gegen den Widerwillen an, der schon beinahe an Ekel grenzte. Aber er weigerte sich, diese Schwäche zuzugeben.
Stattdessen richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und glättete unauffällig seine Weste. Der Wind spielte mit der Feder an seinem Hut und wehte durch seine glänzenden schwarzen Locken. Kurz gesagt, er sah blendend aus und zog einen großen Teil seiner Macht aus dem Wissen, dass sowohl Frauen als auch Männer von seiner Erscheinung beeindruckt waren. Er war groß, muskulös und gut proportioniert. Der Schnitt seines Mantels betonte seine breiten Schultern, seine ausladende Brust und den flachen Bauch. Sein Gesicht gefiel ihm ebenfalls. Er wusste, dass er ein gutaussehender Mann war. Er hatte eine hohe Stirn, ein festes Kinn und eine gerade Nase. Seine Lippen besaßen einen fast vornehmen Schwung, und sein Bart war modisch spitz, die Enden sorgfältig gewachst. Das Einzige, was ihm missfiel, waren seine Augen. Es waren die seiner Mutter, wässrig und blau. Wenn er ihrem Blick in einem Spiegel begegnete, glaubte er, dass sie ihn ansah: verheult und verzweifelt über seinen ausschweifenden Lebenswandel. Auf ihn wirkten sie wie die leeren Augen eines Trottels, und sie schienen ihm überhaupt nicht zu dem gebräunten Gesicht zu passen. Bei einem anderen Mann hätten die Leute sicher gesagt, er habe sanfte blaue Augen, fragende Augen. Kennit bemühte sich, einen eisigen blauen Blick zu pflegen, aber er wusste, dass seine Augen selbst dafür zu blass waren. Er unterstützte seine Bemühungen mit einem amüsierten Lächeln, als er den Blick auf den Anderen richtete.