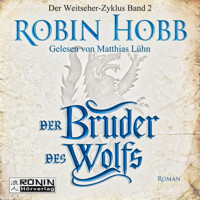12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Regenwildnis-Chroniken
- Sprache: Deutsch
Erstmals auf Deutsch: der dritte Band der Regenwildnis-Saga von New-York-Times-Bestsellerautorin Robin Hobb!
Einst herrschten die Drachen von ihrer Stadt Kelsingra aus über die Regenwildnis. Aber heute sind sie nur noch ein schwacher Schatten ihrer selbst, und ihre menschlichen Hüter verfügen bei Weitem nicht über die Ausbildung der Diener der alten Zeit. Und doch haben sie gemeinsam ihr Ziel erreicht und Kelsingra wieder in Besitz genommen. Keinen Tag zu früh, denn ihre menschlichen Feinde – Drachenjäger und Schlimmeres – sind ihnen dicht auf den Fersen. Kaum haben die Drachen ihre alte Heimat wiedergefunden, müssen sie kämpfen, um sie zu verteidigen …
Die New-York-Times-Bestsellersaga »Regenwildnis« von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Einst herrschten die Drachen von ihrer Stadt Kelsingra aus über die Regenwildnis. Aber heute sind sie nur noch ein schwacher Schatten ihrer selbst, und ihre menschlichen Hüter verfügen bei Weitem nicht über die Ausbildung der Diener der alten Zeit. Und doch haben sie gemeinsam ihr Ziel erreicht und Kelsingra wieder in Besitz genommen. Keinen Tag zu früh, denn ihre menschlichen Feinde – Drachenjäger und Schlimmeres – sind ihnen dicht auf den Fersen. Kaum haben die Drachen ihre alte Heimat wiedergefunden, müssen sie kämpfen, um sie zu verteidigen …
Autorin
Robin Hobb wurde in Kalifornien geboren, zog jedoch mit neun Jahren nach Alaska. Nach ihrer Hochzeit zog sie mit ihrem Mann nach Kodiak, einer kleinen Insel an der Küste Alaskas. Im selben Jahr veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichte. Seither war sie mit ihren Storys an zahlreichen preisgekrönten Anthologien beteiligt. Mit »Die Gabe der Könige«, dem Auftakt ihrer Serie um Fitz Chivalric Weitseher, gelang ihr der Durchbruch auf dem internationalen Fantasy-Markt. Ihre Bücher wurden seither millionenfach verkauft und sind Dauergäste auf der New-York-Times-Bestsellerliste. Robin Hobb hat vier Kinder und lebt heute in Tacoma, Washington.
Die Regenwildnis-Saga von Robin Hobb ist unabhängig von der Weitseher-Saga lesbar und erscheint komplett bei Penhaligon:
1. Wächter der Drachen
2. Stadt der Drachen
3. Kampf der Drachen
4. Blut der Drachen
Die Chronik der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Gabe der Könige
2. Der Bruder des Wolfs
3. Der Erbe der Schatten
Das Erbe der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Diener der alten Macht
2. Prophet der sechs Provinzen
3. Beschützer der Drachen
Das Kind der Weitseher von Robin Hobb bei Penhaligon:
1. Die Tochter des Drachen
2. Die Tochter des Propheten
3. Die Tochter des Wolfs
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Robin Hobb
Kampf der Drachen
Roman
Deutsch von Simon Weinert
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »City of Dragons (Rain Wilds Chronicles Book 3)« bei Spectra, New York.
Dieser Roman erscheint erstmals auf Deutsch.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2012 by Robin Hobb
Copyright dieser deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Redaktion: Alexander Groß
Covergestaltung und -illustration: © Max Meinzold, www.meinzold.de, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock.com
HK · Herstellung: mr
Satz: Vornehm Mediengestaltung, München
ISBN 978-3-641-27093-3V002
www.penhaligon-verlag.de
Für die Little Red Hen.
Prolog
TINTAGLIAUNDEISFEUER
Mühelos segelte sie auf den Luftströmen, die Beine eng an den Körper gelegt, die Schwingen weit ausgebreitet. Auf dem gewellten Wüstensand unter ihr kräuselte sich ihr Schatten als ein schlangengleiches Geschöpf mit Fledermausflügeln und einem langen, gerippten Schwanz. Tintaglia ließ ein tiefes, kehliges Summen vernehmen, einen Freudenlaut über diesen Tag. Im Morgengrauen hatten sie gejagt und gute Beute gemacht. Wie immer hatte jeder sein eigenes Tier gerissen, und den restlichen Morgen hatten sie mit Schlemmen und Schlafen zugebracht. Nun hatten die beiden Drachen, von der Jagd noch immer schmutzig und blutverschmiert, etwas anderes im Sinn.
Weiter unten und ein Stück voran glänzte Eisfeuers schwarze Gestalt. Sein langer Leib bog sich, wenn er das Gewicht verlagerte, um auf dem Wind zu treiben. Sein Rumpf war dicker und schwerer als ihrer, sein Körper länger. Ihre Schuppen, die Federn glichen, glitzerten in einem funkelnden Blau, doch er war überall gleichmäßig schwarz. Dass er so lange im Eis eingeschlossen gewesen war, hatte seinen Körper gezeichnet, und er würde Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Zwischen den Fingerrippen seiner riesigen Schwingen klafften noch immer Risse in der dicken Haut. Die kleineren Verletzungen waren längst verheilt, aber die Risse in seinen Flügeln würden nur langsam zuwachsen, und die Narbenwülste würden für immer sichtbar bleiben. Ganz anders als ihre vollkommene, himmelblaue Haut. Aus den Augenwinkeln bewunderte Tintaglia das Funkeln der eigenen Schwingen.
Als spürte er, dass sie ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenkte, schwenkte Eisfeuer abrupt herum und fing an, in Kreisbahnen nach unten zu fliegen. Sie kannte sein Ziel. In der Nähe ragte eine felsige Hügelkette aus dem Sand. Ihre zerklüfteten Gipfel und schroffen Schluchten waren von gedrungenen Bäumen und graugrünem Gestrüpp bestanden. Zu Füßen der Hügelkette schlummerte eine Oase in einem breiten, sandigen und von einigen Bäumen eingeschlossenen Becken. Von tief aus der Erde sprudelte das Wasser in einen großen, stillen Teich. In der Senke hielt sich die Wärme des Tages auch im Winter. Hier suhlten sie sich oft in dem von der mittäglichen Sonne aufgewärmten Wasser, wuschen sich das Blut von der Haut und wälzten sich anschließend im rauen Sand, um die Schuppen zu polieren. Sie kannten die Stelle gut. Innerhalb ihres riesigen Reviers waren sie zwar ständig von einem Jagdgebiet zum nächsten unterwegs, aber ungefähr alle zehn Tage führte Eisfeuer sie hierher zurück. Er behauptete, dass er sich aus seiner längst vergangenen Jugend an den Ort erinnerte.
Früher hatten hier ein paar Uralte gesiedelt, die sich um die Drachen gekümmert hatten, wenn diese hierherkamen. Von ihren weißen Steinhäusern und sorgsam gehegten Weingärten war allerdings nichts mehr zu sehen. Sie waren von der vorrückenden Wüste verschlungen worden, und nur die Oase war geblieben. Tintaglia wäre lieber noch viel weiter nach Süden geflogen, in die roten Sandwüsten, wo es keinen Winter gab, aber Eisfeuer hatte sich geweigert. Immer wieder hatte sie mit dem Gedanken gespielt, ihn, dem vermutlich die Ausdauer für einen derart langen Flug fehlte, hier zurückzulassen und allein zu fliegen. Doch die furchtbare Einsamkeit während ihrer langen Gefangenschaft im Kokon hatte sie gezeichnet. Die Gesellschaft eines Drachen, selbst eines verschrobenen, nörgelnden Drachen, war besser als das Alleinsein.
Eisfeuer flog nun ganz tief, streifte beinahe den aufgeheizten Sand. Seine Flügel schlugen nur hin und wieder, aber dann kräftig, sodass er den Sand aufwirbelte. Tintaglia folgte ihm, tat es ihm gleich, um die eigenen Flugkünste zu verfeinern. An ihrem Gefährten störte sie vieles, aber er war wahrhaft ein Herr der Lüfte.
Sie folgten den Konturen der Landschaft. Tintaglia wusste, was er vorhatte. Sie würden bis an den oberen Rand des Beckens hinaufgleiten, um dann in wildem Flug über den Dünen hinabzusausen. Am Ende würden sie beide mit ausgebreiteten Schwingen in das stille, sonnengewärmte Wasser platschen.
Sie waren auf halber Höhe des Hangs, als entlang des Beckenrands etwas aus dem Sand hervorbrach. Planen wurden zur Seite geschleudert, unter denen ganze Reihen von Bogenschützen aufsprangen. Eine Pfeilsalve raste auf die Drachen zu. Während noch die Geschosse der ersten Salve auf sie einprasselten und schmerzhaft an ihren Schwingen und Rümpfen abprallten, schwirrte bereits die zweite in hohem Bogen auf sie zu. Sie waren zu nah am Boden, um mit kräftigen Flügelschlägen in die Höhe zu entweichen. Eisfeuer streifte den Sand, schlingerte und klatschte in den flachen Teich. Tintaglia war zu dicht hinter ihm, um abzubremsen oder auszuweichen. Sie krachte in ihn hinein, und ihrer beider Schwingen und Beine verhedderten sich im warmen Tümpel. Im selben Moment sprangen Speerkämpfer aus ihren getarnten Verstecken und machten sich wie ein Heer angriffslustiger Ameisen über sie her. Hinter ihnen tauchten immer mehr Krieger auf und stürmten nach vorn; sie hielten schwere Netze aus dicken Seilen und Ketten in der Hand.
Ohne Rücksicht darauf, dass er sie verletzen könnte, befreite sich Eisfeuer von Tintaglia. Platschend kroch er aus dem flachen See, griff die Männer an und stieß Tintaglia dabei ins Wasser. Einige der Speerträger ergriffen die Flucht, andere zermalmte er unter seinen mächtigen Hinterpranken; dann wirbelte er herum und wischte zwei Dutzend weitere von ihnen mit seinem langen Schwanz von den Füßen. Benommen und halb im Wasser untergetaucht, beobachtete Tintaglia, wie er die Kiefer dehnte und weit aufriss. Hinter den glänzend weißen Zahnreihen konnte sie das Scharlachrot und Orange seiner Giftbeutel ausmachen. Erneut warf er sich den Angreifern entgegen, und mit seinem fauchenden Gebrüll stob roter Sprühnebel aus seinem Rachen. Die Wolke hüllte die Männer ein, und ihre Schreie hallten zur blauen Himmelskuppe empor.
Die Säure fraß die Kämpfer auf. Rüstungen aus Leder oder Metall konnten die Wirkung verlangsamen, aber nicht aufhalten. Wenn die Tröpfchen zur Erde fielen, durchdrangen sie dabei menschliche Körper. Haut, Gewebe, Knochen und Eingeweide wurden von den fallenden Gifttropfen durchlöchert. Zischend trafen sie auf den Sand. Manche der Kämpfer starben schnell, die meisten jedoch nicht.
Tintaglia hatte zu lange starr beobachtet. Ein Netz landete auf ihr. Die Maschen waren mit angeknüpften Bleiklumpen beschwert worden. Ketten, manche dünn, manche dick und manche mit Widerhaken versehen, waren in das Netz eingewoben. Ihre Schwingen verfingen sich darin, und als sie mit den vorderen Klauen daran zerrte, verfingen sich auch diese. Sie stieß ein wütendes Gebrüll aus und spürte, wie ihre eigenen Giftbeutel anschwollen. Da wateten die ersten Speerträger bereits ins flache Wasser. Sie bemerkte flüchtig, dass Bogenschützen mit angelegten Pfeilen schlitternd die Sandhänge heruntereilten. Sie fuhr zusammen, weil ein Speer sie zwischen den Schuppen hinter ihrem Vorderbein getroffen hatte, zwischen Brust und Bein, wo sie verwundbar und empfindlich war. Zwar drang er nicht tief ein, doch Tintaglia war noch nie zuvor von etwas gestochen worden. Sie drehte sich um, brüllte vor Schmerz und Wut, und bei ihrem Schrei spritzte ihr eigenes Gift als Sprühnebel aus ihrem Rachen. Entsetzt wichen die Kämpfer zurück. Das Gift tropfte auf das Netz, die Seile und Ketten wurden schwächer und gaben ihren Befreiungsversuchen schließlich nach. Noch hingen Teile davon an ihr, doch sie konnte sich bewegen. Wut füllte sie ganz aus. Menschen wagten es, Drachen anzugreifen?
Tintaglia watete aus dem Teich heraus und mitten unter die Feinde, schlug um sich und peitschte mit ihrem Schwanz. Und mit jedem zornigen Brüllen, das sie ausstieß, versprühte sie ihr Gift. Bald war die Luft vom Kreischen der Sterbenden erfüllt. Nach Eisfeuer brauchte sie gar nicht zu schauen, denn sie hörte das Blutbad, das er anrichtete.
Pfeile prallten klappernd an ihr ab und knallten schmerzhaft gegen ihre verfangenen Schwingen. Sie schlug mit ihnen, warf dabei ein Dutzend Kämpfer um und befreite sich von den Resten des Netzes. Doch mit ausgebreiteten Flügeln gab sie ihre verwundbaren Stellen preis. Unter ihrer linken Schwinge spürte sie den brennenden Biss eines Pfeils. Sie klappte die Flügel ein, nachdem sie zu spät begriffen hatte, dass die Menschen sie dazu hatten verleiten wollen, dass sie die Schwingen spreizte und ihre ungeschützten Stellen darunter entblößte. Doch indem sie den Flügel einklappte, stieß sie den Pfeil nur tiefer ins eigene Fleisch. Wieder fauchte Tintaglia vor Schmerz, fuhr herum und peitschte mit dem Schwanz. Da erhaschte sie einen Blick auf Eisfeuer, der einen Menschen im Maul hatte und ihn hochhob. Die Schreie des Sterbenden übertönten die anderen Kampfgeräusche, als der Drache seinen Leib auseinanderriss. Die entsetzten Rufe der Menschen, die weiter hinten standen, klangen ihr lieblich in den Ohren, und plötzlich begriff sie, was ihr Partner vorhatte.
Sein Gedanke drang zu ihr durch. Angst ist genauso wichtig wie das Töten. Wir müssen sie lehren, niemals auch nur daran zu denken, einen Drachen anzugreifen. Ein paar wenige müssen wir entkommen lassen, damit sie davon erzählen. Grimmig fügte er hinzu: Aber nur ganz wenige!
Nur wenige, pflichtete sie ihm bei und lief mitten in die Menge hinein, die sich zusammengeschart hatte, um sie zu töten. Mit ihren klauenbewehrten Vorderpranken fegte sie sie so mühelos zur Seite wie eine Katze, die mit einem Faden spielt. Sie schnappte nach ihnen, biss ihnen die Beine ab, die Arme an den Schultern, verstümmelte sie, anstatt sie rasch zu töten. Dann reckte sie den Kopf in die Höhe, warf ihn nach vorn und stieß dabei eine Nebelwolke aus giftiger Säure aus. Die Menschenmauer schmolz zu einem Häufchen Blut und Knochen zusammen.
Als sich der Nachmittag dem Abend zu neigte, flogen die beiden Drachen eine letzte Runde über dem Becken. Ein paar wenige Krieger flohen wie orientierungslose Ameisen in die von Gestrüpp überzogenen Hügel. Sollen sie die Nachricht ruhig verbreiten!, sagte Eisfeuer. Wir sollten zur Oase zurückkehren, bevor ihr Fleisch schlecht wird. Er drehte bei und brach die halbherzige Verfolgung ab. Tintaglia folgte seinem Beispiel.
Sein Vorschlag kam ihr gerade recht. Zwar war der Speer, der in ihrer Haut gesteckt hatte, inzwischen herausgefallen, der Pfeil auf der anderen Seite jedoch nicht. In einem ruhigeren Moment nach dem ersten Gemetzel, als die Überlebenden, die dazu noch fähig waren, sich zur Flucht gewandt hatten, hatte sie versucht, ihn herauszuziehen. Doch dabei war er abgebrochen, und der Stumpf, der noch herausschaute, war zu kurz, als dass sie ihn mit den Zähnen hätte greifen können. Als sie mit den Klauen daran herumgescharrt hatte, war er nur tiefer eingedrungen. Bei jedem Flügelschlag spürte sie den hölzernen Schaft und die Metallspitze unangenehm in ihrem Fleisch stecken.
Wie viele Menschen haben uns angegriffen?, fragte sie.
Hunderte. Aber was spielt das für eine Rolle? Sie haben uns nicht getötet, und diejenigen, denen wir die Flucht gestattet haben, werden ihren Artgenossen erzählen, dass es eine dumme Idee war, es zu versuchen.
Warum haben sie uns angegriffen?
Der Angriff passte nicht zu dem, wie sie die Menschen bisher erlebt hatte. Die Menschen, denen sie begegnet war, hatten stets Ehrfurcht vor ihr gehabt, hätten ihr eher gedient als sie überfallen. Manche hatten gemurrt, doch sie hatte Mittel und Wege gefunden, sie zur Räson zu bringen. Sicher hatte sie auch schon gegen Menschen gekämpft, aber nicht, weil sie ihr einen Hinterhalt gelegt hatten. Sie hatte Chalcedier getötet, allerdings nur, weil sie mit den Kaufleuten Bingstadts ein Bündnis eingegangen war. Sie tötete deren Feinde als Gegenleistung dafür, dass die Kaufleute den Schlangen halfen, die nach der Verwandlung Drachen werden würden. Konnte der Angriff damit zusammenhängen? Menschen hatten ein so kurzes Leben. Waren sie überhaupt in der Lage zu einer so durchdachten Rache?
Eisfeuers Gedankengang war einfacher: Sie haben uns angegriffen, weil sie Menschen sind und wir Drachen. Die meisten Menschen hassen uns. Manche tun so, als hätten sie Ehrfurcht, und machen uns Geschenke, aber hinter ihrer Schmeichelei und dem Buckeln steckt Hass auf uns. Das darfst du nie vergessen. In diesem Teil der Welt hassen die Menschen uns schon sehr lange. Früher einmal, noch bevor ich mich zum Drachen gewandelt habe, hatten die Menschen alle Drachen vernichten wollen. Sie haben ihren Viehherden Gift gefüttert, um auch uns langsam zu vergiften. Sie haben unsere Diener, die Uralten, gefangen genommen und gefoltert, weil sie hofften, Geheimnisse zu erfahren, die sie gegen uns hätten verwenden können. Sie haben unsere Hochburgen zerstört und die Steinsäulen, mit deren Hilfe sich unsere Diener fortbewegten. Auf diese Weise wollten sie uns schwächen. Die wenigen von uns, die sie tatsächlich töten konnten, haben sie geschlachtet wie Vieh, dann haben sie unser Fleisch und Blut als Arznei und Heilmittel für ihre gebrechlichen Leiber benutzt.
Ich kann mich an nichts von alledem erinnern. Tintaglia forschte vergeblich in den Erinnerungen ihrer Vorfahren.
Es gibt vieles, an was du dich nicht zu erinnern scheinst. Ich glaube, du warst zu lange eingeschlossen. Das hat deinen Geist in Mitleidenschaft gezogen, sodass du viele Dinge nicht mehr weißt.
Sie spürte Wut auf ihn in sich aufflackern. Eisfeuer sagte ihr oft derlei Dinge. Häufig dann, wenn sie andeutete, dass ihn die lange Gefangenschaft im Eis wahnsinnig hatte werden lassen. Doch unterdrückte sie ihre Wut fürs Erste. Sie musste mehr erfahren. Und der Pfeil in ihrer Seite zwickte sie.
Was ist passiert? Damals?
Eisfeuer drehte den Kopf auf dem langen Hals und sah sie finster an. Was passiert ist? Wir haben sie vernichtet, was sonst? Menschen, die nicht meinen, sich unseren Wünschen widersetzen zu müssen, sind schon lästig genug.
Sie näherten sich der Quelle im Herzen der Oase. Im Sand lagen überall Menschenleichen. In das Becken hinabzutauchen war, als springe man in einen See, der aus dem Duft von Blut bestand. Die Sonne am späten Nachmittag erhitzte die Kadaver, sodass sie sich langsam in Aas verwandelten.
Wenn wir gefressen haben, suchen wir uns zum Schlafen einen saubereren Ort, verkündete der schwarze Drache. Diese Stelle müssen wir eine Weile meiden, bis die Schakale und Raben sie für uns gereinigt haben. Es ist zu viel Fleisch, als dass wir es alles auf einmal essen könnten, und Menschen verderben schnell.
Schlitternd landete er im Teich, in dem noch ein paar Menschenleichen schwammen. Tintaglia folgte ihm. Während die von der Landung geschlagenen Wellen ans Ufer klatschten, schnappte er sich einen Kadaver aus dem Wasser. Nimm besser nicht die mit der Metallkruste, riet er ihr. Die Bogenschützen sind am besten. Die tragen meistens nur Leder.
Er riss den Leib auseinander und fing die eine Hälfte auf, bevor sie ins Wasser fallen konnte. Er warf sie in die Luft, schnappte sie mit dem Maul, lehnte den Kopf nach hinten und verschlang den Happen. Die andere Hälfte platschte ins Wasser und versank. Eisfeuer suchte sich eine andere Leiche, schob sie sich mit dem Kopf voraus ins Maul und zermalmte sie zwischen seinen mächtigen Kiefern, ehe er sie schluckte.
Tintaglia watete aus dem verunreinigten Teich und sah ihm zu.
Sie werden schnell schlecht. Du solltest sie gleich fressen.
Ich habe noch nie einen Menschen gefressen. Sie empfand einen leisen Ekel. Zwar hatte sie schon viele Menschen getötet, aber noch keinen verspeist. Jetzt kam ihr das sonderbar vor.
Sie dachte an die Menschen, mit denen sie sich angefreundet hatte: Reyn und Malta und ihr junger Sänger Selden. Sie hatte sie dazu veranlasst, Uralte zu werden, doch seither hatte sie nicht mehr oft an sie gedacht. Selden. Beim Gedanken an ihn regte sich ein angenehmes Gefühl in ihr. Er war ein Sänger, der wusste, wie man das Lob eines Drachen sang. Diese drei Menschen hatte sie sich erwählt und Uralte aus ihnen gemacht. Dann waren sie vielleicht anders. Sollte sie zugegen sein, wenn sie starben, dann würde sie ihre Leichen fressen, um ihre Erinnerungen zu bewahren.
Aber andere Menschen fressen? Eisfeuer hatte recht. Sie waren einfach nur Fleisch. Sie bewegte sich am Teichufer entlang und suchte eine Leiche, die noch so frisch war, dass nach wie vor Blut aus ihr heraussickerte. Diese riss sie entzwei, auch wenn sich ihre Zunge bei der Berührung mit Stoff und Leder wand. Dann kaute sie ein paarmal darauf herum, bevor sie sie den mächtigen, mahlenden Schluckmuskeln in ihrem Hals überließ.
Die Leiche glitt hinab. Fleisch war Fleisch, beschloss sie, und nach dem Kampf war sie hungrig.
Eisfeuer fraß weiter, wo er war, watete ein paar Schritte und reckte den Hals, um sich weitere Tote zu angeln. Es waren genug da. Tintaglia war wählerischer. Er hatte recht, wenn er sagte, dass Menschen schnell schlecht wurden. Einige verströmten bereits Verwesungsgeruch. Deshalb suchte sie diejenigen, die erst kürzlich gestorben waren, und schob diejenigen, die schon steif wurden, mit der Schnauze zur Seite.
So arbeitete sie sich durch einen Leichenberg, als ein Kadaver einen leisen Schrei ausstieß und davonzukrabbeln versuchte. Er war nicht groß, und das Gift hatte ihm Teile seiner Beine weggefressen. Er schleppte sich über den Boden, wimmerte, und als Eisfeuer, von dem Laut angelockt, näher kam, fand der Junge seine Sprache wieder.
»Bitte!«, rief er, und seine Stimme überschlug sich wie die eines Kindes. »Bitte, lasst mich am Leben! Wir wollten euch nicht angreifen, mein Vater und ich. Sie haben uns gezwungen! Die Männer des Fürsten haben den Erbsohn meines Vaters und meine Mutter und meine beiden Schwestern geholt. Sie sagten, wenn wir uns der Jagd auf euch nicht anschließen würden, würden sie sie verbrennen. Dass der Name meines Vaters mit ihm aussterben und das Familienerbe zu Staub zerfallen würde. Deshalb mussten wir mitkommen. Wir wollten euch nichts tun, ihr Prächtigen. Ihr verständigen Drachen.«
»Um uns mit Lob um den Finger wickeln zu wollen, ist es nun etwas spät«, stellte Eisfeuer amüsiert fest.
»Wer hat deine Familie geholt?« Tintaglia packte die Neugier. Am Bein des Jungen schimmerte der Knochen hervor. Er würde nicht überleben.
»Die Männer des Fürsten. Der Fürst von Chalced. Sie sagten, wir sollten dem Fürsten Teile von Drachen bringen. Er braucht Drachenteile als Medizin, damit er nicht stirbt. Würden wir Blut oder Schuppen oder die Leber oder ein Drachenauge mitbringen, dann würde der Fürst uns ein Leben lang reich beschenken. Aber wenn nicht …« Der Junge sah auf sein Bein hinab. Einige Zeit starrte er es an, und dann änderte sich sein Gesichtsausdruck. Er sah zu Tintaglia auf. »Wir sind bereits tot. Wir alle.«
»Ja«, sagte sie, doch ehe das Wort sich im Geist des Jungen einnisten konnte, hatte Eisfeuer ihn schon mit seinem Maul gepackt. Es geschah so schnell wie das Zuschnappen einer Schlange.
Frisches Fleisch. Warum sollte man ihn erst noch liegen lassen, damit er ebenfalls anfängt zu verwesen?
Der schwarze Drache warf den Kopf zurück, umschloss den Rest des Jungen mit seinen Kiefern und schluckte ihn. Dann wandte er sich dem nächsten Leichenberg zu.
Neunundzwanzigster Tag des Stillmonds
IMSIEBTENJAHRDESUNABHÄNGIGENHÄNDLERBUNDS
Von Reyall, stellvertretender Vogelwart in Bingstadt, an Kim, Vogelwart in Cassarick
Seid gegrüßt, Kim,
mir wurde die Aufgabe anvertraut, Euch eine Beschwerde zu übermitteln, die von mehreren unserer Kunden eingereicht wurde. Laut diesen Kunden gibt es Hinweise, dass vertrauliche Nachrichten geöffnet worden sind, auch wenn die Wachsversiegelungen der Nachrichtenröhren intakt zu sein schienen. In zwei Fällen war das gestempelte Wachssiegel von höchst vertraulichen Botschaften gebrochen, und in einem weiteren Fall fand man das Wachssiegel zerbröselt im Innern der Röhre, und die Briefrolle schien schief aufgerollt worden zu sein, als hätte jemand das Röhrchen aufgemacht, die Nachrichten gelesen, sie anschließend wieder hineingetan und das Röhrchen erneut mit Vogelwartwachs versiegelt. Diese Anschuldigungen wurden unabhängig voneinander von drei Händlern geäußert und beziehen sich auf Nachrichten des Händlers Candral aus Cassarick.
Bislang wurde keine offizielle Untersuchung verlangt. Ich habe die Händler darum gebeten, Euch kontaktieren zu dürfen und Euch zu bitten, mit Händler Candral wegen einer Probe des Siegelwachses und des Stempels zu sprechen, die er für seine Nachrichten benutzt. Ich und auch meine Dienstherren hier in Bingstadt hoffen sehr, dass es sich hier lediglich um schlechtes, altes und sprödes Siegelwachs handelt und sich kein Vogelwart an den Nachrichten zu schaffen gemacht hat. Nichtsdestotrotz möchten wir Euch bitten, Euch sämtliche Vogelwartgesellen und -lehrlinge gründlich vorzunehmen, die während des letzten Jahres bei Euch gearbeitet haben.
Wir äußern diese Bitte mit großem Bedauern und hoffen, dass Ihr sie uns nicht übelnehmt. Mein Meister lässt mich ausrichten, dass wir vollstes Vertrauen in die Rechtschaffenheit der Vogelwarte in Cassarick haben und es kaum erwarten können, diese Anschuldigungen zu entkräften.
Wir bitten um rasche Beantwortung.
1
DERFÜRSTUNDDERGEFANGENE
Wir haben keine Nachricht erhalten, höchste Hoheit.« Der Bote, der vor dem Fürsten kniete, hatte Mühe, ruhig zu sprechen.
Der Fürst, der auf einem Kissenberg auf seinem Thron saß, sah ihn an und wartete auf den Augenblick, wo der Bote die Fassung verlieren würde. Das Mindeste, was der Überbringer schlechter Kunde erwarten konnte, war eine Tracht Prügel. Kam die schlechte Kunde jedoch mit Verspätung, dann erwartete ihn der Tod.
Der Mann hielt den Blick gesenkt und starrte verbissen auf den Boden. Aha. Dieser Bote war also schon einmal ausgepeitscht worden. Er wusste, dass er es überleben würde, und nahm es hin.
Der Fürst machte eine leichte Bewegung mit dem Finger. Große Gesten brauchten so viel Kraft. Doch sein Kanzler hatte gelernt, auf kleine Fingerzeige zu achten und rasch darauf zu reagieren. Dieser wiederum gab dem Gardisten ein weitaus deutlicheres Zeichen, woraufhin der Bote abgeführt wurde. Die Stiefel der Gardisten stampften, die leichteren Sandalen des Boten patschten. Niemand sagte etwas. Der Kanzler wandte sich wieder dem Fürsten zu und verneigte sich tief, sodass seine Stirn sein Knie berührte. Dann kniete er sich langsam hin und besaß die Kühnheit, auf die Sandalen des Fürsten zu starren.
»Es schmerzt mich, dass Ihr eine so unbefriedigende Neuigkeit ertragen musstet.«
Das Schweigen im Thronsaal hielt an. Es war ein großer Saal mit grob gemauerten Wänden, die die Eintretenden daran gemahnten, dass er einmal Teil einer Festung gewesen war. Die gewölbte Decke war mitternachtsblau gestrichen, und unbeweglich prangten auf ihr die Sterne einer Mittsommernacht. Durch hohe, schmale Schießschartenfenster sah man auf die weite Stadt.
Kein Punkt der Stadt war höher als die Fürstenzitadelle auf ihrem Hügel. Einst hatte sich hier eine Festung erhoben, in deren Mauern sich ein schwarzer Steinkreis unter freiem Himmel befand, ein Ort mächtiger Magie. Man erzählte sich, dass die Steine umgeworfen worden waren, worauf ihre böse Zauberkraft verschwunden war. Nun waren diese Steine mit ihren uralten, inzwischen unkenntlichen und verunstalteten Runen in einem Kreis rings um den Thron in den grau gepflasterten Boden eingelassen. Die fünf schwarzen Steine deuteten in die fünf Ecken der bekannten Welt. Man erzählte sich, dass sich unter jedem Stein ein Schacht befand, in dem man die Zauberfeinde Chalceds lebendig eingeschlossen hatte. Der Thron in der Mitte gemahnte alle daran, dass der Fürst von einem Ort aus herrschte, den früher niemand zu betreten gewagt hatte.
Der Fürst bewegte die Lippen. Sogleich sprang ein Page auf und eilte herbei, eine Schale mit kühlem Wasser in der Hand. Der Junge kniete nieder und reichte sie dem Kanzler. Der Kanzler wiederum rückte auf den Knien näher an den Fürsten heran und hob die Schale an dessen Lippen.
Dieser neigte den Kopf und trank. Als er ihn wieder hob, war bereits ein weiterer Page erschienen, der dem Kanzler ein weiches Tuch reichte, mit dem dieser dem Fürsten Gesicht und Kinn abtrocknete.
Danach gestattete er dem Kanzler, wieder von ihm abzurücken. Nachdem sein Durst gestillt war, sprach er: »Es sind keine Nachrichten unserer Sendboten aus der Regenwildnis eingetroffen?«
Der Kanzler duckte sich tiefer. Seine Gewänder aus schwerer kastanienbrauner Seide wallten rings um ihn auf dem Boden. Durch das dünner werdende Haar schimmerte die Kopfhaut. »Nein, erhabenste Majestät. Es beschämt und betrübt mich, Euch sagen zu müssen, dass sie uns keine neuen Nachrichten gesandt haben.«
»Keine Drachenfleischlieferung ist auf dem Weg?« Er kannte die Antwort zwar bereits, wollte Ellik aber dazu zwingen, sie laut auszusprechen.
Das Gesicht des Kanzlers berührte beinahe den Boden. »Strahlendster Herr, wir haben keine Nachricht bezüglich einer Lieferung. Es beschämt mich zutiefst, Euch dies mitteilen zu müssen.«
Der Fürst bedachte die Lage. Es strengte ihn zu sehr an, die Augen ganz zu öffnen. Oder so laut zu sprechen, dass man seine Stimme hörte. Die kostbaren Ringe aus schwerem Gold mit ihren riesigen Edelsteinen hingen ihm lose an den knochigen Fingern und drückten seine Hände nieder. Die prächtigen Gewänder seiner Majestät konnten seine Hagerkeit nicht verbergen. Er siechte dahin, starb langsam und unter den lauernden Blicken des Hofes. Er musste eine Antwort geben. Er durfte nicht schwach erscheinen.
Leise sprach er: »Sporne sie an. Schicke Sendboten zu allen unseren Kontaktpersonen. Sie sollen besondere Geschenke machen. Ermutige sie zu rücksichtslosem Handeln.« Mit einiger Anstrengung hob er die Hand und sprach lauter. »Muss ich euch, euch alle, daran erinnern, dass ihr, sollte ich sterben, mit mir begraben werdet?«
Seine Worte hätten an den Steinwänden widerhallen sollen. Doch er vernahm dasselbe wie seine Untertanen: den schrillen Aufschrei eines im Sterben liegenden alten Mannes. Der Gedanke, dass jemand wie er ohne einen Thronfolger sterben sollte war unerträglich! Er sollte nicht für sich selbst sprechen müssen. Eigentlich sollte sein Erbsohn vor ihm stehen, die Adligen anbrüllen und sie zu raschem Gehorsam zwingen. Doch stattdessen musste er Drohungen zischeln wie eine zahnlose alte Schlange.
Wie war es so weit gekommen? Er hatte so viele Söhne gehabt, mehr als genug. Zu viele Söhne, doch manche waren zu ehrgeizig für seinen Geschmack gewesen. Einige hatte er in den Krieg geschickt, andere wegen Aufmüpfigkeit in die Folterkammern bringen lassen. Ein paar hatte er diskret vergiftet. Wenn er gewusst hätte, dass eine Krankheit nicht nur seinen auserwählten Erben, sondern auch seine letzten drei Söhne dahinraffen würde, hätte er noch ein paar mehr als Reserve übrig gelassen. Doch das hatte er nicht getan. Und nun blieb ihm nur noch eine unnütze Tochter, eine Frau von fast dreißig Jahren ohne eigene Kinder und mit einer unweiblichen Art zu denken und sich zu bewegen. Eine bereits dreimal verwitwete Frau, die das Pech hatte, nie ein Kind geboren zu haben. Eine Frau, die Bücher las und Gedichte schrieb. Völlig nutzlos, höchstens noch eine Gefahr, falls sie eine Hexe war. Und er hatte nicht mehr genug Kraft, um einer Frau ein Kind zu machen.
Unerträglich. Er durfte nicht ohne Sohn sterben, denn dann würde sein Name wie Staub im Rachen der Welt vergehen. Man musste ihm das Drachenheilmittel bringen, das kostbare Drachenblut, das ihm Jugend und Manneskraft zurückgeben würde. Dann würde er ein Dutzend Erben zeugen und sie wegschließen, damit sie vor aller Unbill geschützt waren.
Drachenblut. Ein so einfaches Heilmittel, und doch schien es ihm niemand besorgen zu können.
»Sollte mein Gebieter sterben, wäre mein Schmerz so groß, dass ich ohnehin nur mit Euch zusammen im Grab Frieden finden könnte, gnädigste Hoheit.« Die schmeichlerischen Worte des Kanzlers klangen plötzlich wie grausamer Hohn.
»Ach, halt den Mund. Deine Schmeichelei geht mir auf den Geist. Was nützt deine leere Ergebenheit schon? Wo sind die Drachenteile, die mich retten könnten? Bring mir die statt deiner eitlen Lobhudelei. Dient mir hier denn keiner bereitwillig?« Zwar kostete es ihn Kraft, die er nicht erübrigen konnte, aber dieses Mal hallte seine Stimme tatsächlich. Als er den Blick über die Höflinge schweifen ließ, wagte es kein Einziger, ihm in die Augen zu schauen. Sie duckten sich, und er ließ ihnen Gelegenheit, an ihre als Geiseln gefangenen Söhne zu denken, die sie alle seit Monaten nicht mehr gesehen hatten. Sie sollten sich ruhig erst die Frage stellen, ob ihre Erben noch lebten, bevor er im Plauderton fragte: »Gibt es Neues von den Soldaten, die wir ausgesandt haben, um den Gerüchten von Drachensichtungen in der Wüste nachzugehen?«
Der Kanzler rührte sich nicht, festgenagelt vom qualvollen Zwiespalt widerstreitender Befehle.
Kochst du innerlich, Ellik?, fragte er sich. Erinnerst du dich daran, dass du einst neben mir in die Schlacht geritten bist? Schau, was aus dem Kriegsherrn und seinem Schwertarm geworden ist: ein schlotternder Greis und ein buckelnder Diener. Wenn du mir doch nur bringen würdest, was ich brauche, dann wäre alles wieder wie früher. Warum enttäuschst du mich? Hast du etwa eigene Pläne? Muss ich dich töten?
Er starrte seinen Kanzler an, doch Ellik hielt den Blick gesenkt. Als er den Eindruck hatte, dass der Kerl kurz vor dem Zusammenbrechen war, bellte er ihn an: »Antworte!«
Ellik hob den Blick, und der Fürst erkannte die Wut in der unterwürfigen grauen Miene. Sie waren zu lange miteinander unterwegs gewesen, hatten zu oft Seite an Seite gekämpft, um ihre Gefühle voreinander gänzlich verheimlichen zu können. Ellik kannte jede List des Fürsten. Früher hatte er bei allem mitgespielt, doch inzwischen wurde seine Schwerthand dieser Spiele überdrüssig. Der Kanzler holte tief Luft. »Bislang kamen keine Nachrichten, Herr. Aber die Drachen haben die Wasserstelle in unregelmäßigen Abständen aufgesucht, und wir haben den Soldaten befohlen, so lange dort zu bleiben, bis sie Erfolg haben.«
»Nun, immerhin haben wir noch keine Nachricht eines Misserfolgs.«
»Nein, ruhmreiche Hoheit. Es besteht noch Hoffnung.«
»Hoffnung. Du hoffst vielleicht. Ich verlange. Kanzler, hoffst du, dass dich dein Name überlebt?«
Eine furchtbare Ruhe ergriff von dem Mann Besitz. Sein Fürst kannte seine verwundbarste Stelle. »Ja, Herr.« Er flüsterte nur.
»Und du hast nicht nur einen Erbsohn, sondern auch noch einen zweiten Sohn?«
Zufrieden vernahm der Fürst das Zittern in der Stimme des Kanzlers. »Diese Gnade wurde mir zuteil, gnädigste Hoheit.«
»Mmm.« Der Fürst von Chalced wollte sich räuspern, musste stattdessen jedoch husten, worauf unter der Dienerschaft hektische Betriebsamkeit ausbrach. Eine neuerliche Schale gekühlten Wassers und eine dampfende Tasse Tee wurden gebracht. Ein kniender Diener hielt ein sauberes weißes Tuch bereit, während ein anderer ein Glas Wein reichte.
Mit einer winzigen Handbewegung verscheuchte der Fürst sie alle. Rasselnd holte er Luft.
»Zwei Söhne, Kanzler. Und du hoffst. Ich aber habe keinen Sohn. Und ich krepiere, weil mir eine Kleinigkeit fehlt. Ich verlange lediglich ein einfaches Heilmittel, etwas Drachenblut. Doch hat man es mir nicht gebracht. Da frage ich mich: Ist es gerecht, dass du so viel Hoffnung haben kannst, dass dein Name in der Welt auch künftig vernommen wird, während meiner wegen dieses Mangels verstummen soll? Ganz sicher nicht.«
Langsam schrumpfte der Kanzler. Unter dem starren Blick seines Herrn brach er zusammen, der Kopf sank ihm auf die gekrümmten Knie, und dann neigte sich auch der restliche Körper zu Boden und verdeutlichte sichtbar seinen Wunsch, unter der Wahrnehmung des Fürsten abzutauchen.
Der Fürst von Chalced verzog den Mund, die Erinnerung an ein Lächeln.
»Heute magst du deine beiden Söhne noch behalten. Aber morgen? Für morgen erhoffen wir uns beide gute Nachrichten.«
»Da lang.«
Jemand hob das schwere Tuch, das als Tür diente. Ein Lichtbalken stach in das Dunkel, verschwand jedoch schlagartig wieder und wurde von gelblichem Lampenlicht ersetzt. Der zweiköpfige Hund in dem Verschlag nebenan jaulte auf und wand sich. Selden fragte sich, wann die arme Kreatur zum letzten Mal Tageslicht gesehen hatte, richtiges Tageslicht. Das verkrüppelte Tier hatte bereits hier gehaust, als Selden hergebracht worden war. Er hatte schon seit Monaten, vielleicht sogar seit einem Jahr keine Sonne mehr gesehen. Tageslicht war der Feind des Geheimnisses. Denn Tageslicht vermochte zu offenbaren, dass die Hälfte der Wunder und Legenden, die in den schäbigen Buden des abgedeckten Basars ausgestellt wurden, entweder Missgeburten oder Fälschungen waren. Und das Tageslicht konnte auch zum Vorschein bringen, in was für einem schlechten gesundheitlichen Zustand diejenigen waren, die immerhin zu einem gewissen Grad echt waren.
So wie er.
Das Licht der Laterne kam näher, das gelbe Gleißen trieb ihm Tränen in die Augen. Er wandte den Blick ab und machte die Augen zu. Er stand nicht auf. Er wusste genau, wie lange die Kette an seinen Fußgelenken war. Er hatte mit aller Kraft daran gezerrt, als man ihn hierhergebracht hatte. Die Ketten waren seither kein bisschen schwächer geworden, er aber schon. Er blieb liegen, wie er war, und wartete darauf, dass die Besucher an ihm vorbeiflanierten. Doch sie blieben vor seiner Bude stehen.
»Das ist er? Ich dachte, er wäre groß! Aber der ist kein bisschen größer als ein normaler Mensch.«
»Er ist hochgewachsen. Das sieht man nur nicht, wenn er so eingerollt daliegt.«
»Ich kann ihn da hinten kaum sehen. Können wir hineingehen?«
»Ihr solltet besser nicht so nah herangehen, wie seine Kette reicht.«
Es herrschte Schweigen, und dann unterhielten sich die Männer tuschelnd miteinander. Selden rührte sich nicht. Dass sie über ihn sprachen, interessierte ihn nicht im Geringsten. Er war nicht mehr imstande, sich verlegen oder erniedrigt zu fühlen. Zwar sehnte er sich nach Kleidern, aber vor allem, weil ihm kalt war. Manchmal warfen sie ihm zwischen zwei Vorführungen eine Decke zu, doch meistens vergaßen sie es. Von den Leuten, die sich um ihn kümmerten, sprachen nur wenige seine Sprache, weshalb es nichts half, darum zu betteln. Langsam begriff sein fiebriger Verstand, dass die beiden Männer sich über ihn in einer Sprache unterhielten, die er kannte. Chalcedisch. Die Sprache seines Vaters, die er einst gelernt hatte, weil er seinen Vater hatte beeindrucken wollen – vergebens. Er machte keine Bewegung und ließ sich auch sonst nicht anmerken, dass er sie wahrnahm, hörte aber genauer hin.
»He! He, du. Drachenjunge! Steh auf. Lass dich von dem Mann anschauen.«
Er konnte sie ignorieren. Dann würden sie wahrscheinlich mit etwas nach ihm werfen, damit er sich bewegte. Oder sie würden an der Kettenwinde drehen, sodass er entweder gehen musste oder an den Fußgelenken zur Rückwand der Bude geschleift wurde. Seine Wärter hatten Angst vor ihm und glaubten ihm nicht, wenn er beteuerte, dass er ein Mensch war. Sie zogen jedes Mal die Kette an, wenn sie hereinkamen, um das Stroh auf dem Boden zu rechen. Seufzend streckte er sich und stand langsam auf.
Einer der Männer keuchte. »Der ist wirklich groß! Schau dir bloß mal an, wie lang seine Beine sind! Hat er einen Schwanz?«
»Nein. Kein Schwanz. Aber er hat Schuppen am ganzen Leib. Die glitzern wie Diamanten im Tageslicht.«
»Dann bringt ihn hinaus. Lasst mich ihn im Licht betrachten.«
»Nein. Das mag er nicht.«
»Lügner.« Selden sprach deutlich. Das Laternenlicht blendete ihn, aber er richtete sich an den anderen der beiden Männer, den er trotzdem ausmachen konnte. »Er will nicht, dass Ihr seht, dass ich krank bin. Er will nicht, dass Ihr seht, dass ich überall wund bin, dass ich von der Kette ein Geschwür am Knöchel habe. Vor allem möchte er nicht, dass Ihr seht, dass ich genauso ein Mensch bin wie Ihr.«
»Er spricht!« Der Mann klang eher beeindruckt als bestürzt.
»Das tut er. Aber es wäre klüger, wenn Ihr nicht auf ihn hören würdet. Er ist zum Teil ein Drache, und wie jeder weiß, können Drachen einen alles Mögliche glauben machen.«
»Ich bin nicht zum Teil ein Drache! Ich bin ein Mensch wie Ihr, nur verwandelt durch die Gunst eines Drachen.« Selden wollte seine Stimme energisch klingen lassen, doch er hatte nicht die Kraft dazu.
»Da seht Ihr, wie er lügt. Wir gehen gar nicht auf ihn ein. Sobald man sich auf ein Gespräch mit ihm einlässt, verfällt man seinen Schlichen. Bestimmt hat sich seine Mutter genau auf diese Weise von einem Drachen verführen lassen.« Der Mann räusperte sich. »Also. Ihr habt ihn gesehen. Mein Meister verkauft ihn nur ungern, aber er meint, dass er sich Euer Angebot anhören wird, weil Ihr so weit gereist seid.«
»Meine Mutter …? Das ist ja absurd! Ein Märchen, das nicht einmal ein Kind glauben würde. Und Ihr könnt mich nicht verkaufen. Ich gehöre Euch nämlich nicht!« Selden hob die Hand und schirmte seine Augen ab. Er wollte den Mann erkennen, doch es half nichts. Und seine Worte kitzelten noch nicht einmal eine Reaktion hervor. Auf einen Schlag kam er sich töricht vor. Die Sprachbarriere war hier noch nie das Problem gewesen. Sondern einzig ihre Weigerung, in ihm etwas anderes als eine einträgliche Missgeburt zu sehen.
Sie unterhielten sich weiter, als hätte er gar nichts gesagt.
»Nun, Ihr wisst, dass ich lediglich als Mittelsmann fungiere. Ich kaufe ihn nicht für mich selbst. Euer Meister verlangt einen ziemlich hohen Preis. Der Mann, in dessen Auftrag ich handle, ist reich, aber die Reichen sind knausriger als die Armen, wie man so sagt. Wenn ich sein Geld ausgebe und der Drachenmann ihn nachher enttäuscht, wird er von mir mehr als bloß Geld verlangen.«
Nur ihre Umrisse hoben sich vor seinen feuchten Augen ab. Zwei Männer, die er nicht kannte, die sich darüber stritten, wie viel er wert war. Er ging einen Schritt auf sie zu und schleifte dabei seine Kette durch das modrige Stroh. »Ich bin krank! Könnt Ihr das nicht sehen? Habt Ihr denn gar keinen Anstand? Ihr haltet mich hier angekettet, Ihr gebt mir halb verfaultes Fleisch und altes Brot zu essen, ich bekomme nie Tageslicht zu sehen … Ihr lasst mich verrecken. Ihr bringt mich um!«
»Der Mann, in dessen Auftrag ich hier bin, braucht einen Beweis, bevor er so viel Gold ausgibt. Lasst es mich offen sagen. Für den Preis, den Ihr fordert, müsst Ihr mir als Zeichen des Vertrauens etwas geben, was ich ihm zukommen lassen kann. Wenn er ist, was Ihr behauptet, dann wird Euer Meister bekommen, was er verlangt. Und unsere beiden Meister werden zufrieden mit uns sein.«
Es entstand eine lange Pause. »Ich werde mit meinem Meister darüber reden. Kommt. Trinkt einen Schluck mit uns. Vom Feilschen bekommt man Durst.«
Die Männer wandten sich um. Die Laterne schwang hin und her, als sie gingen. Selden machte noch zwei Schritte, dann war die Kette zu Ende. »Ich habe eine Familie!«, rief er ihnen nach. »Ich habe eine Mutter! Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich will nach Hause! Bitte, lasst mich nach Hause, bevor ich hier sterbe!«
Ein kurzes Aufblitzen von Tageslicht war die einzige Antwort darauf. Sie waren weg.
Selden hustete und fasste sich dabei an die Brust, um die Schmerzen besser auszuhalten. Er hustete Schleim herauf und spuckte ihn auf das schmutzige Stroh. Er fragte sich, ob wohl auch Blut dabei war, denn es war zu dunkel, um es zu erkennen. Sein Husten wurde schlimmer, das war ihm klar.
Er schwankte unsicher zu dem Strohhaufen zurück, auf dem er schlief. Er kniete sich erst hin und legte sich dann auf die Seite. Sämtliche Gelenke taten ihm weh. Er rieb sich die verklebten Augen und schloss sie dann wieder. Warum hatte er sich von ihnen zum Aufstehen verleiten lassen? Warum konnte er nicht einfach aufgeben und sich nicht mehr rühren, bis er starb?
»Tintaglia«, sagte er leise. Er sandte seine Gedanken zu der Drachin aus. Es hatte eine Zeit gegeben, wo er ihr noch bewusst gewesen war, wenn er nach ihr gesucht hatte, eine Zeit, wo sie zugelassen hatte, dass ihre Gedanken die seinen berührten. Dann hatte sie ihr Männchen gefunden, und seither hatte er sie nicht mehr gespürt. Er hatte sie nahezu wie eine Göttin verehrt, hatte sich an ihrer Drachenpracht geweidet und sie in seinen Liedern widergespiegelt.
Lieder. Wie lange war es her, dass er für sie gesungen hatte? Seit er überhaupt gesungen hatte? Er hatte sie geliebt und geglaubt, dass auch sie ihn liebte. Alle hatten ihn gewarnt. Sie hatten von der Zauberkraft der Drachen gesprochen, dass sie einen in ihren Bann schlugen, um die Menschen zu verführen. Aber er hatte ihnen nicht geglaubt. Ihr zu dienen war sein ganzer Lebensinhalt gewesen. Und schlimmer noch: Während er hier wie ein vergessenes Schoßtier auf dem schmutzigen Stroh lag, war ihm doch klar, dass, sollte sie ihm wieder begegnen, sie ihn nur einmal anzublicken brauchte, und er würde ihr aufs Neue getreulich dienen.
»So bin ich nun einmal. Das hat sie aus mir gemacht«, sagte er leise in der Dunkelheit.
Der zweiköpfige Hund im Verschlag nebenan winselte.
Siebter Tag des Hoffnungsmondes
IMSIEBTENJAHRDESUNABHÄNGIGENHÄNDLERBUNDS
Von Kim, Vogelwart in Cassarick, an Reyall, stellvertretender Vogelwart in Bingstadt
Richte deinen Vorgesetzten bitte aus, dass ich es äußerst geschmacklos finde, dass ein Handlanger wie du damit betraut wurde, mir diese widerlichen Anschuldigungen vorzutragen. Dass man dir erlaubt hat, während Ereks Abwesenheit das Amt des Vogelwarts auszufüllen, hat dir anscheinend ein überzogenes Gefühl von Bedeutung eingeflößt, das ungeziemend ist und mit dem sich ein Lehrling nicht an einen Meister wenden darf. Ich rate überdies den Vogelmeistern der Bingstädter Vogelwartgilde, sich einmal deinen familiären Hintergrund genauer anzusehen und sich bewusst zu machen, wie eifersüchtig deinesgleichen über meine Ernennung zum Vogelwart in Cassarick sein muss, denn ich bin überzeugt, dass der Ursprung dieser gemeinen Anschuldigungen hierin zu finden sein wird.
Ich lehne es ab, den Händler Candral wegen dieser Sache aufzusuchen. Er hat keinerlei Beschwerde in unserer Niederlassung eingereicht, und ich bin überzeugt, wenn diese Anschuldigungen Hand und Fuß hätten, wäre er persönlich bei uns erschienen, um sich zu beschweren. Ich vermute, dass der Fehler nicht bei seinem Wachs oder Siegel liegt, sondern an dem unsorgfältigen Umgang mit den Nachrichtenröhrchen im Bingstädter Vogelhaus durch denjenigen, der sich um die Vögel aus Trehaug und Cassarick zu kümmern hat. Wenn ich es recht weiß, dann bist du das, Geselle.
Wenn die Vogelwartgilde von Bingstadt Klagen darüber hat, wie amtliche Nachrichten in Cassarick behandelt werden, dann schlage ich vor, dass sie eine offizielle Beschwerde beim Händlerkonzil von Cassarick einreicht und um Ermittlungen ersucht. Ich bin überzeugt, dass sie feststellen wird, dass das Konzil den Vogelwarten in Cassarick vollstes Vertrauen schenkt und dass es sich weigern wird, einem so verleumderischen Vorwurf gegen uns nachzugehen.
Kim, Vogelwart, Cassarick
2
DRACHENKAMPF
Sonnenstrahlen waren durch die Wolken gestoßen. Der Nebel, der den Wiesenhang am rasch strömenden Fluss verhüllte, schmolz dahin. Sintara hob den Kopf, um zu der fernen Feuerkugel zu starren. Licht fiel auf ihre schuppige Haut, doch es wärmte kaum. Während der von der Sonne berührte Nebel noch in dünnen Schwaden emporstieg und sich auflöste, trieb der grausame Wind dicke graue Wolken aus dem Westen herbei. Es würde ein weiterer Regentag auf sie zukommen. In fernen Ländern glühte der herrlich raue Sand in der heißen Sonne. Eine Ahnenerinnerung vom Suhlen in diesem Sand und vom Scheuern der Schuppen stahl sich in ihr Bewusstsein. Sie und ihre Drachengefährten hätten wegziehen sollen. Sie hätten vor Monaten schon in einer funkelnden Wolke aus blitzenden Schwingen und peitschenden Schwänzen aufsteigen und in die ferne Wüste im Süden fliegen sollen. Die Jagd in den felsigen Hochländern, die die Wüste umschlossen, war immer sehr ergiebig. Dort würden sie nun auf die Jagd gehen, würden sich satt essen, die heißen Nachmittage verschlafen und danach zum strahlend blauen Himmel emporsteigen, auf den warmen Luftströmen segeln. Mit den richtigen Windströmungen konnte ein Drache völlig mühelos über der Erde schweben. Eine Königin wie sie würde nur leicht die Schwingen neigen, dahinsegeln und die schwereren Männchen beobachten, die sich unter ihr in der Luft bekämpften. Sie stellte sich vor, sie wäre dort, würde auf die Kämpfer herabsehen, wie sie zusammenprallten und sich anspuckten, wie sie umherschossen, zusammenstießen und sich gegenseitig in ihren Krallen verhakten.
Am Ende eines solchen Kampfes blieb nur noch ein einziger Drache übrig. Seine besiegten Rivalen würden zum Sand zurückkehren, um sich zu sonnen und zu schmollen, oder vielleicht zu den wildreichen Hügeln fliehen, um ihre wütende Enttäuschung an den Tieren auszulassen. Der siegreiche Drache würde nach oben steigen, bis er auf gleicher Höhe mit den Kreise ziehenden Weibchen wäre. Dann würde er sich eine aussuchen und sie umschwärmen. Daraus würde sich eine ganz andere Art von Kampf entwickeln.
Sintaras glänzende Kupferaugen waren halb geschlossen, der Kopf auf dem langen, kräftigen Hals erhoben und das Gesicht zur fernen Sonne gerichtet. Aus einem Reflex heraus breitete sie die nutzlosen blauen Schwingen aus. Eine Sehnsucht regte sich in ihr. Sie spürte, wie die Erinnerung an die Paarung ihr die Schuppen am Bauch und an der Kehle wärmte, und sie witterte den Geruch ihres eigenen Begehrens, der von den Drüsen unter ihren Flügeln ausströmte. Sie machte die Augen auf und senkte den Kopf. Sie empfand fast so etwas wie Scham. Eine wahre Königin, die der Paarung würdig war, hätte kräftige Schwingen, mit denen sie sich über die Wolken erheben konnte, die Sintara heute wieder zu ersäufen drohten. Im Flug würde sich der Duft ihres Moschus verbreiten und jeden Drachen im Umkreis vieler Meilen in brünstige Lust versetzen. Eine wahre Drachenkönigin säße nicht gestrandet hier an diesem aufgeweichten Flussufer in Gesellschaft unbeholfener, des Fliegens nicht mächtiger Männchen und noch nutzloserer menschlicher Hüter.
Sie verdrängte die Träume von prachtvollen Kämpfen und Paarungsflügen aus ihrem Bewusstsein. Ein missmutiges Knurren erschütterte ihren Rumpf. Sie hatte Hunger. Wo war Thymara, ihre Hüterin? Sie sollte doch für sie auf die Jagd gehen und ihr frisch erlegtes Wild bringen. Wo war das nichtsnutzige Mädchen?
Plötzlich spürte sie einen kräftigen Luftzug und bekam die kräftige Witterung eines Drachen in die Nüstern. Gerade rechtzeitig legte sie die halb ausgebreiteten Flügel wieder an.
Seine klauenbewehrten Pranken schlugen auf der Erde auf, und er schlitterte stürmisch auf sie zu, stoppte gerade noch ab, ehe er in sie hineinkrachte. Sintara ging auf die Hinterbeine und reckte den glänzenden blauen Hals, richtete sich zu ihrer vollen Höhe auf. Und dennoch überragte Kalo sie. Sie sah die Freude in seinen wirbelnden, funkelnden Augen, als ihm ihr Nachteil auffiel. Das große Männchen war gewachsen, seit sie in Kelsingra angekommen waren, hatte Muskeln und Kraft gewonnen. »Das war mein bisher längster Flug«, erklärte er ihr, während er seine breiten dunkelblauen Schwingen ausschüttelte, sodass Regentropfen auf sie herabprasselten. Dann klappte er sie sorgfältig ein und strich sie am Rücken glatt. »Von Tag zu Tag werden meine Flügel größer und kräftiger. Bald werde ich ein Herr der Lüfte sein. Was ist mit dir, Königin? Wann erhebst du dich in die Lüfte?«
»Wenn es mir gefällt«, entgegnete sie und wandte sich ab. Er roch widerlich lüstern. Nicht auf das wilde Freiheitsgefühl des Fliegens war sein Augenmerk gerichtet, sondern auf das, was beim Fliegen geschehen konnte. Das kam für sie nicht infrage. »Und das nenne ich nicht Fliegen. Du bist den Hang heruntergerannt und in die Luft gesprungen. Gleitspringen ist nicht Fliegen.« Streng genommen war ihre Kritik ungerecht. Kalo war fünf Flügelschläge lang in der Luft geblieben, bevor er aufgesetzt hatte. Scham und Wut wetteiferten miteinander, wenn sie sich ihren ersten Flugversuch in Erinnerung rief. Die Hüter hatten gejubelt, als sie in die Höhe gesprungen und ein Stück gesegelt war. Doch ihre Schwingen hatten nicht die Kraft, sie in die Höhe zu tragen. Sie war abgesackt, in den Fluss gestürzt, und die Fluten hatten sie mitgerissen. Zerschlagen und tropfnass war sie aus dem schlammigen Wasser gewatet, mit Prellungen am ganzen Leib. Denk nicht an diese Schmach. Und lass nie wieder jemanden Zeuge deines Scheiterns werden.
Mit der nächsten kalten Bö kam der Regen. Sie war nur zum Trinken an den Fluss gekommen. Jetzt würde sie in den schwachen Schutz der Bäume zurückkehren.
Doch während sie sich weiterhin von ihm abgewandt hielt, ließ Kalo den Kopf nach vorn schnellen. Er schnappte mit dem Maul fest nach ihrem Hals, direkt hinter dem Kopf, sodass sie ihn nicht beißen oder ihm Säure ins Gesicht spucken konnte. Sie hob eine Vorderpranke, um nach ihm zu schlagen, doch sein Hals war länger und stärker als ihrer. Er hielt sie weit von sich weg, sodass ihre Klauen nur ins Leere ruderten. Sie stieß einen wütenden Schrei aus, und er ließ sie los, machte einen Satz zurück, und ihr zweiter Angriff ging genauso ins Leere wie der erste.
Kalo hob die Schwingen und breitete sie weit aus, um sie zur Seite zu wischen, sollte sie auf ihn zustürmen. Seine Augen, silbern mit grünen Ranken darin, wirbelten vor unverschämtem Vergnügen.
»Du solltest das Fliegen probieren, Sintara! Du musst wieder eine richtige Königin werden, Herrscherin über See, Land und Himmel. Lass diese erdgebundenen Würmer hier und segle mit mir dahin. Dann jagen und töten wir und fliegen weit fort von diesem kalten Regen und den hohen Wiesen in die fernen Wüsten im Süden. Greife auf das Gedächtnis deiner Ahnen zurück und mach dir bewusst, was wir einmal sein werden!«
Die Stellen am Hals, wo ihr seine Zähne die Haut geritzt hatten, brannten, doch ihr verletzter Stolz schmerzte noch mehr. Ohne Rücksicht auf die Gefahr stürzte sie sich auf ihn, das Maul weit aufgerissen und mit pumpenden Giftsäcken, aber mit einem freudigen Brüllen sprang er einfach über sie hinweg. Als sie herumwirbelte, um sich ihm erneut entgegenzustellen, merkte sie, dass der feuerrote Ranculos und der azurblaue Sestican heranwalzten. Drachen waren nicht dafür gemacht, sich am Boden fortzubewegen. Sie hievten sich vom Fleck wie fette Rinder. Sesticans mit orangen Strähnen durchzogene Mähne stand von seinem Nacken ab. Als Ranculos mit halb ausgebreiteten, glänzenden Flügeln auf sie zustürmte, bellte er kämpferisch: »Lass sie in Ruhe, Kalo!«
»Ich brauche eure Hilfe nicht«, brüllte sie zurück, während sie sich abwandte und von den aufeinander zupreschenden Männchen entfernte. Ihre Gefühle schwankten zwischen Genugtuung darüber, dass sie sich um sie stritten, und Scham, weil sie es nicht wert war, dass sie um sie stritten. Sie vermochte sich nicht in die Lüfte zu erheben und allen ihre Anmut und Flinkheit vorzuführen. So geschickt und furchtlos sie war, würde sie es doch nicht mit demjenigen aufnehmen können, der bei dieser törichten Rauferei gewinnen würde. Tausend Ahnenerinnerungen an Brunftkämpfe und Paarungsflüge schwirrten in den Ecken ihres Bewusstseins umher. Sie schob sie beiseite. Sie drehte sich nicht noch einmal zu dem Gebrüll und dem Geräusch heftig schlagender Flügel um. »Ich brauche gar nicht zu fliegen«, rief sie verächtlich über die Schulter. »Es gibt hier keinen Drachen, der eines Paarungsflugs würdig wäre.«
Ein wütender Schmerzensschrei von Ranculos antwortete ihr. Die bestürzten Rufe und schrillen Fragen der menschlichen Drachenhüter, die aus ihren verstreuten Hütten hasteten und am Ort des Kampfes zusammenliefen, hallten durch den Regennachmittag. Idioten. Wenn sie sich einmischten, würden sie nur zertrampelt werden oder Schlimmeres. In derlei Dinge sollten Menschen sich nicht einmischen. Es wurmte sie, wenn sie sah, dass die Hüter sie wie Vieh behandelten, das man im Zaum halten musste, und nicht wie Drachen, denen man diente. Auch ihre eigene Hüterin, die mühsam ihren zerlumpten Mantel festhielt, damit er ihr nicht von buckligen Schultern rutschte, lief herbei und rief: »Sintara, ist alles in Ordnung mit dir? Bist du verletzt?«
Sie riss den Kopf nach oben und breitete halb ihre Schwingen aus. »Glaubst du etwa, ich könnte mich nicht verteidigen?«, herrschte sie Thymara an. »Glaubst du etwa, ich sei schwach und …«
»Aus dem Weg!«, rief ein Mensch, und Thymara reagierte sofort, kauerte sich nieder und hielt die Hände schützend über den Hinterkopf.
Sintara schnaubte vergnügt, als der goldene Mercor an ihr vorbeistürmte, die Flügel weit auseinandergefaltet. Mit seinen Pranken ließ er ganze Grassoden durch die Luft fliegen, obwohl er die Erde kaum berührte. Thymaras Hände hätten ihr keinen Schutz geboten, wenn die stachligen Flügel des Drachen sie auch nur gestreift hätten. Allein der Luftzug, den er verursachte, hatte Thymara umgerissen, und sie rollte ein Stück durchs nasse Gras.
Die Schreie der Menschen und das Brüllen der Drachen wurden von Mercors Fanfarenstoß übertönt, mit dem er sich in das Knäuel kämpfender Männchen stürzte.
Sestican wurde von Mercor überrannt und ging zu Boden. Sein ausgebreiteter Flügel bog sich gefährlich, als er über ihn abrollte, und Sintara hörte, wie er vor Schmerz keuchte. Ranculos war unter dem um sich schlagenden Kalo gefangen. Dieser wollte sich herumwälzen und Mercor mit den längeren Krallen seiner Hinterbeine empfangen. Doch Mercor hatte sich auf dem Berg aus miteinander ringenden Drachen auf den Hinterbeinen aufgerichtet. Plötzlich sprang er nach vorn und nagelte Kalos weit auseinandergefaltete Flügel mit seinen Pranken am Boden fest. Ein heftiger Schlag des derart gefangenen Drachen riss Mercor eine Wunde in der Brust, doch ehe er einen zweiten Prankenhieb einstecken musste, richtete Mercor sich höher auf. Zwar schnellte Kalos Kopf am langen Hals wie eine Peitsche herum, doch Mercor war klar im Vorteil. Sestican, der unter den beiden größeren Drachen eingeklemmt war, brüllte in hilfloser Wut. Über dem Kampf hing eine dicke Moschuswolke.
Mehrere ängstliche und wütende Hüter umringten die kämpfenden Drachen, kreischten und brüllten die Namen der Streithähne oder versuchten, die anderen gaffenden Männchen davon abzuhalten, sich ebenfalls ins Getümmel zu stürzen. Die kleineren Weibchen, Fente und Veras, waren ebenfalls erschienen, reckten die Hälse und traten, ohne auf die Warnungen ihrer Hüter zu achten, gefährlich nahe ans Geschehen heran. Baliper streifte mit schnalzendem rotem Schwanz am Rand des Kampfplatzes entlang, sodass die Hüter sich in Sicherheit bringen mussten und empört aufschrien, weil er sie alle in Gefahr brachte.
Der Kampf endete beinahe so unvermittelt, wie er begonnen hatte. Mercor riss den goldenen Kopf nach hinten und ließ ihn dann mit aufgerissenem Maul nach vorn schnellen. Die Schreie der Hüter und das entsetzte Gebrüll der gaffenden Drachen prophezeiten bereits den Tod Kalos im Säureregen. Doch im allerletzten Moment ließ Mercor das Maul zuschnappen. Blitzschnell fuhr er mit dem Kopf herab und spuckte keinen Nebel und auch keine Fontäne aus, sondern lediglich einen einzelnen Säuretropfen, mit dem er auf Kalos verwundbare Kehle zielte. Der blauschwarze Drache schrie vor Schmerz und Wut auf. Mit drei kräftigen Flügelschlägen entfernte sich Mercor und landete eine Schiffslänge von Kalo entfernt. Aus der länglichen Wunde an seiner Brust floss Blut, lief an seinem golden geschuppten Rumpf herab. Er schnaufte, seine Nüstern zitterten. Farben spielten auf seinen Schuppen, und die Panzerkämme um seine Augen waren aufgerichtet. Er peitschte mit dem Schwanz, und die Luft war von seinem herausfordernden Duft erfüllt.
Kaum stand Mercor nicht mehr auf ihm, hatte Kalo sich abgerollt und war auf die Beine gekommen. Er fauchte vor Wut und Schmach und eilte sofort zum Fluss, um sich die Säure vom Hals abzuwaschen, bevor sie noch tiefer eindrang. Carson, Fauchs Hüter, lief neben Kalo her, rief ihm zu, dass er stehen bleiben und ihn seine Verletzung behandeln lassen sollte. Doch der schwarze Drache beachtete ihn nicht. Etwas zerschunden und überrumpelt, aber nicht ernsthaft verletzt, kam Ranculos auf die Beine und richtete sich schwankend auf. Er schüttelte die Schwingen aus und legte sie langsam an, als würden sie ihm wehtun. Dann verließ er, so würdevoll er es humpelnd vermochte, den zertrampelten Kampfplatz.
Mercor brüllte dem zurückweichenden Kalo nach: »Vergiss nicht, dass ich dich hätte töten können! Vergiss das niemals, Kalo!«
»Eidechsenbrut!«, rief der fliehende dunkle Drache zurück, verlangsamte aber seine Schritte hinunter zum kalten Flusswasser nicht.
Sintara wandte sich von ihnen ab. Es war vorbei. Es überraschte sie nicht, dass es nur so kurz gedauert hatte. Kämpfe waren etwas, was Drachen wie die Paarung nur in der Luft abhielten. Wären die Männchen in der Lage gewesen zu fliegen, dann hätte der Wettkampf Stunden, wenn nicht sogar den ganzen Tag angedauert, und alle wären von Säure verätzt und blutig daraus hervorgegangen. Einen Moment lang stand ihr Bewusstsein im Bann von Ahnenerinnerungen an solche Kämpfe, und ihr Herz schlug vor Aufregung schneller. Die Männchen pflegten darin um ihre Aufmerksamkeit zu kämpfen, und am Ende, wenn nur noch einer als Sieger übrig blieb, musste dieser sie einholen und gegen sie bestehen, bevor er das Recht erlangte, sich mit ihr zu paaren. Sie segelten durch die Lüfte, stiegen höher und immer höher, während der Drache versuchte, ihre Schleifen, Rollen und kraftvollen Senkrechtflüge nachzuahmen. Und wenn es ihm gelungen war, wenn er es geschafft hatte, ihr im Flug nahe genug zu kommen, dann hatte er seinen Körper mit dem ihren verschränkt, der Rhythmus ihrer Flügelschläge hatte sich aneinander angeglichen …
»SINTARA!«
Mercors Bellen riss sie abrupt aus ihren Erinnerungen. Sie war nicht die Einzige, die sich umgewandt hatte, um zu sehen, was der Goldene von ihr wollte. Alle Drachen und Hüter auf der Wiese starrten ihn an. So wie sie.
Der gewaltige goldene Drache hob den Kopf und riss die Schwingen auseinander, dass es knallte. Der Wind trug erneut seinen Duft herbei. »Du solltest nicht provozieren, wenn du es nicht zu Ende bringen kannst«, tadelte er sie.
Sie starrte ihn an und spürte, dass die Wut ihre Farben heller leuchten ließ. »Das hatte gar nichts mit dir zu tun, Mercor. Du solltest dich nicht in Dinge einmischen, die dich nichts angehen.«
Er faltete die Flügel noch weiter auseinander und stellte sich mächtig auf den Hinterbeinen auf. »Ich werde fliegen.« Zwar brüllte er das nicht, aber seine Worte waren trotz Wind und Regen deutlich zu vernehmen. »Genau wie du. Und wenn die Zeit für Paarungskämpfe gekommen ist, werde ich siegen. Und ich werde mich mit dir paaren.«
Sie starrte ihn immer noch an, entsetzter, als sie es für möglich gehalten hatte. Es war undenkbar, dass ein Männchen eine so hanebüchene Behauptung aufstellte. Sie musste sich zwingen, sich nicht geschmeichelt zu fühlen, weil er gesagt hatte, dass sie fliegen würde. Als das Schweigen zu lange währte und ihr bewusst wurde, dass alle zu ihr herüberschauten und eine Antwort erwarteten, wurde sie wütend. »Das behauptest du«, entgegnete sie zahnlos. Auch wenn sie Fentes verächtliches Schnauben nicht gehört hätte, wäre ihr klar gewesen, dass sie damit niemanden beeindruckt hatte.
Sie wandte sich von ihnen ab und stapfte in Richtung des Waldes, dessen Bäume spärlichen Schutz boten. Es war ihr egal. Es kümmerte sie nicht, was Mercor gesagt hatte oder dass Fente sich über sie lustig gemacht hatte. Unter den Drachen war niemand, bei dem es sich gelohnt hätte, Eindruck zu schinden. »Das war ja wohl kaum ein richtiger Kampf«, höhnte sie leise.
»Wolltest du denn einen ›richtigen Kampf‹ anzetteln?« Plötzlich tauchte neben ihr ihre schnippische kleine Hüterin Thymara auf, die trabend mit ihr Schritt hielt. Ihr schwarzes Haar hing in zerzausten, verfilzten Zöpfen herab, an einigen waren hölzerne Amulette befestigt. Weil sie über den Hang gekullert war, hing feuchtes Gras an ihrem zerrissenen Mantel. Die Füße hatte sie in verschiedenfarbige Lumpen gewickelt und als Sohlen grob gegerbtes Rehleder daran befestigt. In letzter Zeit war sie dünner geworden. Und größer. Die Knochen in ihrem Gesicht standen mehr hervor. Die Schwingen, die Sintara ihr geschenkt hatte, wackelten beim Laufen unter ihrem Mantel. Obwohl ihre Frage barsch geklungen hatte, klang Thymara besorgt, als sie nun hinzufügte: »Bleib mal kurz stehen. Kauere dich hin. Lass mich deinen Hals anschauen, wo er dich gebissen hat.«
»Er hat mich nur leicht gebissen.« Sintara konnte kaum glauben, dass sie auf eine derart dreiste Frage eines bloßen Menschen überhaupt einging.
»Ich will es mir anschauen. Es sieht so aus, als hätten sich mehrere Schuppen gelöst.«