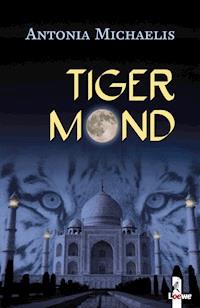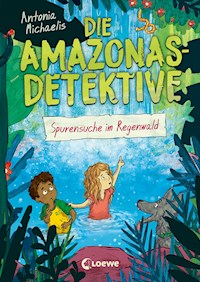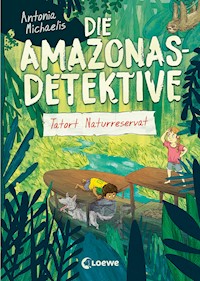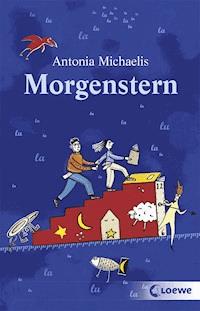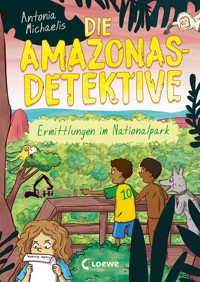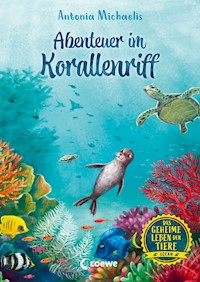Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Seit Karl Sonntag aus dem Waisenhaus geflohen ist, sucht er mit den Winzigen, einem Seefahrervolk, den geheimnisvollen 12. Kontinent. Auf diesem Eiland nämlich sind die Kinder der Seefahrer verschollen. Schnell findet Karl heraus, dass das nicht das einzige Geheimnis ist, das der mysteriöse "Uralte" verbirgt. Was hat es mit der geisterhaften Stimme auf sich, die überall und nirgends ist? Was mit den goldenen Bäumen, die sich sehnsuchtsvoll zum Meer biegen? Unversehens ist Karl in ein Abenteuer gepurzelt, aufregender als seine kühnsten Träume. Am Ende findet er mehr, als er suchte. Er findet Freunde, Verständnis und Wärme und ... das Wichtigste im Leben überhaupt. "Buch des Monats April 2007" (kinderbuch-couch.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für K.Wir waren dort.An einem glitzernd-klaren, kalten Tag,wo Traum und Wort im Meeresblauzu unsren Füßen lag, noch ungeschrieben.Und später, weiter fort, als ich begann,Dir vorzulesen, an grünem Ortvoll indisch-wunderlicher Schattenwesen,fiel der Strom aus, kurz vor Seite sieben.Und unsre Spur begann sich zu entweben.Nun trennt die Zeit uns. Auch der Raum.Vielleicht das Leben. Doch jenerklare Tag und die Geschichte sind geblieben.
Inhalt
1. Kapitel,in welchem ein Abenteuer beginnt, ohne dass ich es ahne. Zunächst bin ich sehr, sehr wütend und wandere aus. Schließlich geschieht etwas Überraschendes und erstaunlich Kleines.
2. Kapitel,in welchem ich eine Kapitänin kennenlerne. Ein Schiff fährt per Anhalter, ich entdecke erstaunliche Dinge unter Deck, und schließlich höre ich ein Märchen, das kein Märchen ist.
3. Kapitel,in welchem ein Kontinent zum zweiten Mal entdeckt wird. Eine Marzipantorte bekommt Fußspuren, und nur ich sehe den Mann in den Schatten.
4. Kapitel,in welchem wir Henk Olafsen nicht persönlich kennenlernen. Wir machen einen Fehler, und im Dunkeln ist es gut, dass ich so stark bin.
5. Kapitel,in welchem wir eine kleine Naturkatastrophe erleben. Der Krallenkopf ist nachts kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Dann machen wir Bekanntschaft mit den goldenen Bäumen.
6. Kapitel,in welchem wir eine Gartenparty auf einem Tisch feiern. Es werden viele geheimnisvolle Botschaften verschickt, und ich bekomme mal wieder einen Wutanfall. Am Ende mache ich eine ausgesprochen verblüffende Entdeckung.
7. Kapitel,in welchem ich jemanden finde, aber dafür geht jemand anderer verloren. Schließlich machen wir unerwartet enge Bekanntschaft mit einer Möwe, und ganz zum Schluss rettet uns ein Stück Streuselkuchen das Leben. Was aber auch nichts nützt.
8. Kapitel,in welchem wir keine Mäuse sind. Jemand macht Rührei, und der Uralte meldet sich zu Wort. Dann gibt es einen Herbststrauß und ein Seebeben.
9. Kapitel,in welchem ich auf jemandem lande. Ich finde noch mehr Plastikabfall und wundere mich. Olafsen fasst einen Entschluss, und zur Abwechslung bekommt einmal Sven einen Wutanfall.
10. Kapitel,in welchem zu unserer Verwunderung altes Metall vorkommt. Es gibt keine Seeungeheuer, und Olafsen fängt einen merkwürdigen Fisch. Schließlich gehe ich mal wieder verloren.
11. Kapitel,in dem sich Erstaunliches herausstellt. Ein aufblasbares gelbes Gummimonster kommt vor, und wir öffnen einen Reißverschluss.
12. Kapitel,in welchem Olafsen die Pfeife sinken lässt und mich ansieht.
Nachwort,das vielleicht ein 13. Kapitel, dafür jedoch zu kurz ist, und in dem das gelbe Gummimonster womöglich nicht zum letzten Mal aufgeblasen wird.
1. Kapitel,
in welchem ein Abenteuer beginnt, ohne dass ich es ahne. Zunächst bin ich sehr, sehr wütend und wandere aus. Schließlich geschieht etwas Überraschendes und erstaunlich Kleines.
Ich bin zwölf Jahre alt, und mein Name ist Karl.
Karl Sonntag.
Karl heiße ich, weil K der nächste Name auf irgendeiner Liste war, als man mich fand. Und Sonntag, weil ich an einem Sonntag im August gefunden wurde.
Es war auch ein Sonntag im August, an dem ich meinen besten Freund verlor.
Ich verlor ihn nicht, weil ich ihn irgendwo liegen ließ, so, wie man ein Portemonnaie verliert oder einen Haustürschlüssel. Ich verlor ihn, weil er in einem roten Auto wegfuhr.
Er drückte seine Nase lange an die Heckscheibe und winkte.
Ich stand unter einem Schirm und winkte auch. Und es regnete.
Und kurz darauf begannen all die seltsamen und unglaublichen Dinge zu geschehen, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie geschehen könnten.
Aber ich will der Reihe nach erzählen.
An jenem Sonntag standen Maria und ich also unter dem Schirm vor dem Kinderheim.
Maria ist schon erwachsen.
„Früher“, sagte ich zu ihr, „dachte ich immer, es gäbe irgendwo auch ein Erwachsenenheim.
Ein Kinderheim ist schließlich ein Heim für Kinder ohne Eltern. Und ein Erwachsenenheim, glaubte ich, wäre ein Heim für Eltern ohne Kinder.
Und ich dachte: Wenn man nur die beiden Heime zusammenlegen würde, dann wären alle froh und glücklich.“
Maria lachte. Sie hatte ihre Arme um mich gelegt und sah mit mir zusammen dem roten Auto nach.
„Ist es nicht schön“, sagte sie, „dass Achim Eltern gefunden hat?“
„Sehr schön“, sagte ich und sah grimmig in den Regen.
„Für dich finden wir auch noch welche“, sagte Maria.
„Quatsch“, sagte ich und bohrte mit der Spitze meines Turnschuhs kleine Mulden in den Kies, sodass der Schuh nass und dreckig wurde und der Kies löchrig und hässlich. „Wir finden keine. Du weißt doch genau, dass ich schon fünfmal zurückgegeben wurde.“
Da sah Maria in die Tropfenwelt hinaus und seufzte.
„Lass uns hineingehen, Karl“, sagte sie. „Es regnet zu sehr.“
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war kein Achim da, der mir die Decke wegzog. Es war auch kein Achim da, mit dem ich um die Wette die Treppen hinunterlaufen konnte, und kein Achim, mit dem ich beim Frühstück Brotkrümel-Wettpusten spielen konnte.
Nachmittags war kein Achim da, der unter den Apfelbäumen mit mir Fußball spielte, und abends war kein Achim da, der sich vor den Schatten fürchtete. Kein Achim, den ich beschützen konnte, weil er klein und schwach war und ich groß und stark.
Und so saß ich auf meinem Bett und merkte, wie nutzlos es war, ganz alleine groß und stark zu sein. Ich faltete einen Papierflieger, wie ich es mit Achim gemacht hatte. Aber es machte keinen Spaß, den Papierflieger alleine fliegen zu lassen. Da überkam mich eine plötzliche rote Wut, und ich zerknüllte den Papierflieger, bis er nur noch ein winzig kleines Knäuel war, und pfefferte ihn in die Ecke.
„Bleib du nur, wo du bist“, rief ich aus dem Fenster. „Ganz weit weg. Bleib bei deinen neuen Eltern, und freu dich an deinem neuen Leben. Mir ist das doch egal. Ich komm auch gut alleine klar. Schließlich bin ich Karl Sonntag und kann ganz alleine einen Klassenzimmertisch tragen.“
„Schrei doch nicht so rum“, sagte Jonathan. „Ich versuche hier, nicht game over zu werden in meinem Gameboy, Mann.“
„Dann werde doch woanders nicht gemowa“, sagte ich böse und stieß ihn im Vorbeigehen ein bisschen an, damit er auf die falschen Knöpfe drückte und all seine Leben auf einmal verlor.
Eine Woche später waren die Sommerferien vorbei, und die Schule ging wieder los.
Morgens im Bus fühlte ich mich komisch. Es kam mir vor, als guckten mich alle an. Ich hörte sie flüstern. Bestimmt sagten sie zueinander: „Das ist Karl, der jetzt ganz allein ist. Seht ihr, wie groß und stark er ist? Aber es bringt ihm gar nichts, ohne einen Freund, den er beschützen kann. Wie unsicher er von einem Bein aufs andere tritt!“
Ich setzte mich auf eine Bank, auf der noch keiner saß, und sah stur aus dem Fenster, als bemerkte ich das Getuschel der anderen nicht.
„Achim“, sagten sie wohl, „hat jetzt nämlich Eltern. Bloß Karl, der nicht. Da könnt ihr sehen, wie einer aussieht, der zu blöd ist, um Eltern zu finden …“
Ich weiß gar nicht, ob sie das wirklich sagten. Vielleicht stellte ich es mir nur vor.
In meinem Bauch wuchs die Wut zu einem kleinen roten Klumpen und lag mir im Magen, schwer wie Blei.
In der Schule saß jetzt Ina neben mir, nicht mehr Achim. Sie reichte mir schüchtern die Hand und lächelte. Ich versuchte, auch zu lächeln, aber mir war nicht danach, und so grinste ich nur grimmig. Ina sah etwas erschrocken aus.
„Vermisst du deinen Freund Achim sehr?“, flüsterte sie in der ersten Stunde.
Ich schüttelte den Kopf.
„Ich würde meinen besten Freund vermissen, wenn er weg wäre“, flüsterte Ina.
„Ich aber nicht“, antwortete ich trotzig.
„Du kannst es ruhig zugeben“, sagte Ina.
Da stieß ich wie aus Versehen ihr Federmäppchen vom Tisch, und alle Stifte ergossen sich in einem regenbogenbunten Schwall über den Fußboden. Sie warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu, und ich tat so, als guckte ich zufällig gerade in die andere Richtung.
In der Pause stand ich alleine in einer Ecke und kaute auf meinem Wurstbrot herum. Aber die Wurst schmeckte eklig – ich wusste gar nicht, warum.
„He, Karl“, sagte Eddy, der auch in meine Klasse ging. „Wo hasten deinen kleinen, schwachen Freund Asthma-Achim gelassen? Hat er sich kaputtgeschnauft?“
„Lass du nur Achim in Ruhe“, sagte ich und trat auf ihn zu. Ich war mindestens einen Kopf breiter als Eddy.
„Er ist doch gar nicht da“, sagte Eddy. „Wie soll ich ihn da in Ruhe lassen?“
„Und weißt du auch, warum? Weil er nämlich jetzt Eltern hat, zu denen ist er umgezogen“, antwortete ich. „Deshalb ist er nicht da. Ha.“
„Stimmt es“, fragte Eddy gedehnt, „dass sie dich schon siiieben Mal zurückgegeben haben?“
„Fünf Mal“, sagte ich. Das Wurstbrot klebte in meinen Fingern, in mir glühte der rote Wutball, und mir wurde ganz heiß.
„Fünf Mal von irgendwelchen Eltern zurückgegeben“, sagte Eddy zu Ronald, der neben ihm stand. „Hast du so was Dämliches schon mal gehört, Ronald?“
„Das war nur“, sagte ich, „weil bei den Eltern kein Kapitän dabei war.“
„Kein Kapitän?“, fragte Ronald.
„Jawohl, damit ihr es wisst“, erwiderte ich. „Kein Kapitän. Mein Vater ist nämlich Kapitän. Und ich werde auch mal einer. Und bis mein richtiger Vater mich findet, werde ich eben zurückgegeben. Ist doch logisch.“
„Ach was, Kapitän, sag bloß“, meinte Eddy. „Und woher weißt’n das?“
„Ich weiß es eben“, sagte ich.
Ich ging noch einen Schritt auf Eddy zu und zerdrückte das Wurstbrot in meiner Hand.
„Schon gut, schon gut, ist er eben Kapitän“, sagte Eddy und taumelte zurück. Aber es war zu spät. Die rote Wut war schon aus meinem Bauch in den Kopf hinaufgestiegen.
„Und das glaubst du mir wohl nicht, wie?“, rief ich.
Dann packte ich Eddy am Kragen und schmierte ihm die Reste meines klebrigen Wurstbrotes mitten ins Gesicht. Er konnte sich gar nicht wehren, weil ich viel stärker war als er, und so strampelte er nur und schrie um Hilfe. Als ich das Wurstbrot gleichmäßig auf ihm verteilt hatte, schubste ich ihn auf den Boden und ging weg.
An diesem Nachmittag rief mich die Klassenlehrerin zu sich.
„Ich hab es nicht extra gemacht“, sagte ich gleich, weil ich wusste: Sie meinte Eddy und das Wurstbrot. „Es ist bloß so passiert.“
„Warum denn, Karl?“, fragte sie.
Ich sah auf meine Schuhe.
„Wegen gar nichts“, sagte ich. Ich wollte nicht schon wieder über Achim reden und darüber, dass er nicht mehr da war. Oder über meinen Vater, den Kapitän, der auch nicht da war.
Die Lehrerin seufzte. Sie hatte graues Haar, hinten zu einem Dutt hochgesteckt, und ich überlegte, wie hübsch die rosa Schmierwurst meines Pausenbrots darin ausgesehen hätte.
„Es kommt nicht wieder vor“, murmelte ich und sah auf meine Turnschuhspitzen.
Ich nahm mir wirklich vor, dass es nicht wieder vorkommen sollte. Ich würde Eddy einfach nicht mehr zuhören. Aber wenn man ganz alleine ist auf der Welt, ist es schwer, den anderen nicht zuzuhören.
„Eins ist ja wohl sicher“, sagte Eddy. „Ob dein Vater nun Kapitän ist oder Wurstfachverkäufer. Er hat dich sicher nicht verloren. Der wollte dich auch loswerden, damit er endlich seine Ruhe hatte.“
In den nächsten beiden Woche musste ich Eddy viermal verhauen und Ronald zweimal. Ich wollte es nicht. Ich kämpfte dagegen an, ballte die Fäuste in den Taschen und versuchte, ruhig durchzuatmen. Aber die Kraft kam einfach so aus mir heraus. Wenn man zu stark ist, ist das manchmal nicht gut. Die Wut wurde ganz und gar selbstständig und kugelte in meinem Bauch umher, sobald ich in der Schule ankam. Ich konnte überhaupt nicht mehr richtig denken – die Wut verstopfte mein Gehirn von innen wie rote, warme Watte, und ich machte im Diktat 67 Fehler.
Das war am Freitag. In der Pause stießen die Mädchen sich an, und Ina flüsterte: „Da kommt der dicke Karl, der alles runterschmeißt und im Diktat 68 Fehler hatte.“
Sie glaubte, ich hätte sie nicht gehört. Aber ich bin ja nicht taub. Die Wut rollte wieder aus meinem Bauch in den Kopf. Und ich rannte plötzlich auf Ina und Nadine zu, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass wir alle drei auf dem Boden lagen.
Der Sportlehrer hielt mich am Handgelenk gepackt und zerrte mich hoch, und Nadine hatte Nasenbluten und heulte, und Ina schrie wie am Spieß und hielt sich eine Hand vor den Mund. Dann spuckte sie einen Zahn aus, der bestimmt vorher schon gewackelt hatte.
Und dann wollten alle mit mir reden.
Zuerst wollte der Sportlehrer mit mir reden, dann wollte die Klassenlehrerin mit mir reden, und dann wollte der Schuldirektor mit mir reden.
Sie alle sagten: „Wir müssen uns mal unterhalten“, und: „Setz dich“, und: „Was ist bloß los mit dir dieses Schuljahr?“
„Nichts“, sagte ich und sah auf meine Turnschuhspitzen.
„So geht das nicht weiter“, sagten sie. „Du passt nie auf, und du vergisst dauernd deine Hausaufgaben, und immerzu verhaust du andere Kinder.“
„Ja“, sagte ich, denn das war so.
„Warum?“, fragten sie. „Warum, Karl?“
Da zuckte ich die Schultern. Ich hätte es selbst gern gewusst, wieso das alles so war mit meiner Wut.
„Hast du nichts dazu zu sagen?“, fragten sie.
„Nein“, sagte ich jedes Mal und wippte auf meinen Turnschuhen hin und her. „Kann ich jetzt gehen?“
Im Bus malte ich mit dem Finger eine Windrose in den Dreck auf der Fensterscheibe.
So eine Windrose, die Norden und Süden anzeigt und Osten und Westen. Und ich dachte, dass der Kapitän, der mein Vater war, sicherlich nur den richtigen Wind brauchte, um mich zu finden. Dann dachte ich wieder, es wäre ja doch unwahrscheinlich, dass er zwölf Jahre lang nicht den richtigen Wind gehabt hatte. Und das machte mich sehr traurig. Die Blätter waren spätsommerlich grün, und der Himmel war spätsommerlich blau, und alles hätte sehr schön sein können. Aber mein Kapitänsvater saß irgendwo in einem Schaukelstuhl auf einer Veranda und hatte mich vergessen.
Oder vielleicht suchte er an den verkehrten Stellen?
Im Kinderheim wartete Maria auf mich. Sie stand in der Tür und sah mir entgegen.
„Karl, Karl“, sagte sie und schüttelte den Kopf. „Ich fürchte, wir müssen uns mal unterhalten.“
„Sag du das nicht auch noch“, knurrte ich und warf meine Schultasche ins Gras.
Maria bückte sich und hob sie auf.
„Komm, Karl“, sagte sie. „Lass uns nach hinten in den Garten gehen.“
„Warum?“, fragte ich. „Ändert sich etwa etwas davon, dass wir in den Garten gehen?“
Meine rote Wut war schließlich in mir, und ich würde sie mitnehmen, wohin auch immer ich ging. Hätte es einen Ort gegeben, an dem ich ihr entkommen könnte – ich wäre gerne dorthin gegangen, ehrlich. Wäre es nun der Garten gewesen oder das Haus oder von mir aus auch der Kühlschrank. Aber ich ahnte, dass es keinen solchen Ort gab.
Die Wut blieb immer bei mir.
Maria trug meine Schultasche und ging voraus, ohne etwas zu sagen.
Hinten im Garten wuchsen Apfelbäume; alte, knorrige Apfelbäume, die im Frühjahr beinahe platzten vor rosaweißen Blüten. Jetzt waren sie grün und hingen voller Äpfel.
Wir setzten uns auf die alte, etwas rostige Wippe, die dort stand, und Maria pflückte einen Apfel von dem Ast direkt über der Wippe. Ich pflückte auch einen, und eine Weile saßen wir nur so da und sahen die Äpfel an und schwiegen.
Aber man konnte spüren, wie es in der Luft knisterte.
„Willst du mir etwas erzählen?“, fragte Maria schließlich.
„Nö“, sagte ich und knetete den Apfel in meinen Händen. „Du mir?“
„Ja“, antwortete sie. „Ich will dir erzählen, dass die Schule angerufen hat. In den letzten beiden Wochen vier Mal. Die letzten drei Male war es deine Lehrerin.“
„Hm“, sagte ich.
„Willst du wissen, was sie gesagt hat?“
Ich schüttelte den Kopf. Ich wollte überhaupt nicht wissen, was sie gesagt hatte. Ich wollte mir die Ohren zuhalten und aus dem Garten weglaufen und nie mehr etwas von dieser Schule hören.
„Sie hat gesagt, etwas stimmt nicht mit dir“, fuhr Maria fort. „Und dass du gar nicht mehr aufpasst im Unterricht. Und dass du die anderen Kinder haust. Ich habe gesagt, dass das sicher nicht nur deine Schuld war –“
„Doch“, sagte ich trotzig. Mir war so nach Widersprechen.
Maria runzelte die Stirn. „Heute jedenfalls hat nicht die Lehrerin angerufen, sondern der Schuldirektor“, sagte sie. „Und der hat mir erklärt, dass es so nicht weitergeht. Er wollte mir nicht zuhören. Er findet, dass du nicht auf der Schule bleiben kannst, wenn du dauernd andere haust …“
„Er hat mich rausgeschmissen“, sagte ich.
„Na ja, nicht so direkt …“, meinte Maria. „Eigentlich …“ Sie drehte den Apfel in ihrer Hand hin und her und seufzte. „Eigentlich: ja“, sagte sie endlich. Und danach seufzte sie noch einmal und legte einen Arm um mich. „Karl“, sagte sie, „was machen wir bloß mit dir?“
Ich schüttelte ihren Arm ab. Ich brauchte ihren Arm nicht. Ich brauchte gar niemanden. „Es ist alles die Schuld des Kapitäns“, sagte ich. Denn das war es.
Maria sah mich verwirrt an. „Welches Kapitäns?“
„Erinnerst du dich nicht?“, fragte ich. Meine Wut verschwand beinahe vor lauter Erstaunen. Wie konnte sich jemand nicht an den Kapitän erinnern? Den Kapitän, der mein ganzes Leben bestimmte?
„Nein“, sagte Maria und zog die Augenbrauen zusammen. „Karl, wovon redest du?“
„Mein Vater“, sagte ich leise, und die Apfelbäume rauschten im Nachmittagswind wie die See, als ich das sagte. Und die Vögel schienen ein anderes Lied anzustimmen, ein Lied von der Ferne und von der Sehnsucht. Und die Grillen zirpten wie das Knarzen der Taue im Wind. „– mein Vater, der Kapitän … Er hätte besser auf mich aufpassen müssen. Er hätte mich nicht verlieren dürfen, damals am Strand.“
„Am Strand …“, wiederholte Maria verwirrt. Sie hatte es tatsächlich vergessen.
„Aber du hast es mir doch selber erzählt!“, rief ich und sah ihr in die Augen. Ihre Augen waren grau und etwas besorgt und außen mit vielen winzigen Fältchen verziert.
„Es war genau hier im Garten. Ich saß auf deinem Schoß, weil ich damals noch leicht genug war, um auf deinem Schoß zu sitzen. Und du hast mir davon erzählt, wie mein Vater, der Kapitän, mich am Strand verloren hat. Ich muss von seinem Schiff gefallen sein, denn ich wurde in einem Weidenkorb angespült, genau wie Moses, nur nicht so heilig. Und weil mein Vater, der Kapitän, nicht wusste, wohin das Meer mich getragen hatte, konnte er mich nicht finden. Er suchte überall nach mir, doch er fand mich nicht. Er sucht noch immer. Eines Tages wird er kommen, um mich abzuholen. Und er wird die Arme um mich legen und sich wundern, wie groß ich geworden bin und wie stark. Vielleicht wird er gar nicht aussehen wie ein Kapitän, weil er inzwischen einen anderen Beruf hat, damit er mich an Land besser suchen kann. Immer, wenn jemand kam, um mich mitzunehmen, dachte ich, diesmal ist es der Kapitän. Aber er war es nie. Und deshalb konnte ich mich auch nicht gut benehmen. Deshalb haben sie mich alle immer zurückgeschickt.“ Ich seufzte tief. „Erinnerst du dich jetzt?“
Das Grau in Marias Augen zitterte ein wenig – wie das Meer an einem windstillen Tag.
„Dass du das alles noch weißt“, flüsterte sie. „Dass du das alles noch weißt, Karl.“
„Na, aber sicher weiß ich es“, sagte ich, und dann wurde auch ich ganz plötzlich besorgt. „Was ist denn, Maria?“, fragte ich. „Warum machst du so ein trauriges Gesicht?“
Ein schrecklicher Gedanke drängelte sich in meinen Kopf. „Hast du etwas gehört, von meinem Vater? Ist ihm etwas passiert? Er ist doch nicht … er ist doch … er lebt doch noch? Weil ich nämlich auf ihn warten werde. Und ich gehe nicht mehr in die Schule. Ich warte einfach nur noch hier, bis er kommt.“
„Karl“, sagte Maria und legte ihre Hände auf meine Schultern. Ich schluckte, weil sie so ernst aussah. „Karl, hör mir jetzt gut zu. Damals, als ich dir all das erzählt habe, warst du noch sehr klein. So klein, dass du manche Dinge nicht verstehen konntest. Aber das ist neun Jahre her. Jetzt bist du groß. Und große Kinder müssen in die Schule gehen. Versprich mir, dass du wieder hingehen wirst, wenn wir eine andere Schule gefunden haben. Es nützt nichts, nur im Kinderheim herumzusitzen und auf den Kapitän zu warten.“
„Es dauert bestimmt nicht mehr lange“, widersprach ich. „So ein bisschen herumwarten kann ich schon noch.“
„Dein Vater, der Kapitän, wird nicht kommen“, sagte Maria ganz leise.
Und da hörten die Apfelbäume auf, zu rauschen wie die See, und die Amseln hörten auf, ein Lied von der Ferne zu singen, und die Grillen zirpten nicht mehr wie das Knarren der Taue im Wind.
„Deinen Vater, den Kapitän, gibt es nicht“, flüsterte Maria. „Ich habe ihn erfunden. Ich war noch ganz jung und ganz neu hier, und du warst das allererste Kind, das auf meinem Schoß saß. Du hast geweint, weil ein anderer Junge von seinen neuen Eltern abgeholt wurde und weil dich niemand haben wollte. Da habe ich dir die Geschichte vom Strand erzählt und von dem Korb, in dem du angespült worden bist wie Moses, und du warst nicht mehr traurig. Aber ich dachte … ich dachte, du hättest die Geschichte längst vergessen.“
Ich schüttelte den Kopf. Mir war ganz komisch. Ich fragte mich, ob ich spucken müsste, doch dann sagte ich stattdessen: „Ich weiß noch jedes Wort, Maria. Jedes. Wie – wie ist es in Wirklichkeit gewesen? Wie bin ich ins Kinderheim gekommen?“
„Das Meer, weißt du, ist sehr weit weg“, sagte Maria. „In Wirklichkeit. Sie haben dich von woanders hierhergebracht, ich glaube, aus einem Krankenhaus. Jemand hatte dich dort abgegeben. Aber ich weiß nicht, wer.“
„In einem Korb?“, fragte ich. „Lag ich wenigstens in einem Korb?“
„Vielleicht“, sagte Maria. „Keine Ahnung.“
„Und war ein Zettel an mir dran?“
„Nein.“
„Nicht mal ein ganz klitzekleiner Zettel? Auf dem vielleicht stand, man solle auf mich aufpassen? Oder, dass jemand mich wieder abholen würde? Später vielleicht, nachdem er von einer Reise zurück wäre?“
Maria zögerte. Dann schüttelte sie den Kopf.
„Beinahe hätte ich jetzt wieder etwas erfunden“, sagte sie. „Aber es ist wohl nicht gut, etwas zu erfinden. Es war kein Zettel da, Karl. Gar nichts.“
„Warum geben Leute ihre Kinder irgendwo ab, ohne einen Zettel an ihnen zu befestigen?“, fragte ich leise.
Maria antwortete nicht.
„Weil sie ihre Kinder nicht mehr wollen, richtig? Weil sie sie aus Versehen bekommen haben“, sagte ich. „Und weil sie sie dumm finden und zu nichts nutze. Deshalb. Mich wollten sie auch nicht. Sie fanden mich zu nichts nutze. So ist es doch, Maria, nicht wahr? So ist es doch?“
Ich merkte, dass ich richtig laut geworden war. Und dass ich sie gepackt hatte und sie schüttelte. Maria war eine zarte, kleine Frau, und ich war schon jetzt viel stärker als sie. Es erschreckte mich, wie hilflos sie sich in meinem Griff anfühlte, aber ich konnte nicht aufhören, sie zu schütteln. Die Wut war da, in mir, und sie machte mit mir, was sie wollte.
„Es tut mir leid, Karl“, flüsterte Maria. „Es ist alles meine Schuld. Ich hätte den Kapitän nicht erfinden dürfen.“
„Nein, das hättest du ja wohl mal wirklich nicht!“, rief ich. „Du hast mich angelogen. Und ich habe die ganze Zeit geglaubt, du hättest die Wahrheit gesagt! Aber die Wahrheit ist, dass niemand mich will und niemand mich mag! Nicht einmal du, obwohl es dein Beruf ist, uns hier im Kinderheim zu mögen!“
„Natürlich mag ich dich“, sagte Maria und wand sich in meinem Griff. „Karl! Natürlich mag ich dich!“
„Tust du überhaupt kein bisschen!“, schrie ich. „Sonst hättest du mich nicht so beschwindelt!“
Und dann ließ ich sie schnell los, weil ich Angst vor meiner eigenen Stärke bekam. Ich sprang auf und nahm meinen Apfel, der auf der Wippe lag, und warf ihn mit aller Kraft gegen den nächsten Baumstamm, wo er mit einem Krachen zerplatzte.
Danach rannte ich ins Haus, lief nach oben und legte mich auf mein Bett.
Ich wollte weinen, aber ich konnte nicht.
Ich lag nur so da, mit dem Gesicht zur Wand, und ballte die Fäuste und strengte mich an, still zu liegen. Denn sonst hätte ich alle Möbel im Zimmer zerschlagen müssen.
Weil ich meinen Vater, den Kapitän, nicht schlagen konnte – dafür, dass er nicht kam.
Weil es meinen Vater, den Kapitän, nie gegeben hatte.
Ich ging nicht zum Abendbrot hinunter.
Als Maria kam, um mich zu holen, tat ich so, als würde ich schlafen. Später kamen noch zwei andere von den Erwachsenen, und ich tat wieder so, als würde ich schlafen, und da seufzten sie und ließen mich schließlich in Ruhe.
Irgendwann hörte ich, wie Bert und Michael ins Bett gingen. Es gab vier Betten in unserem Zimmer. Eines war jetzt leer, denn das war Achims Bett gewesen.
Ich wartete, bis Bert und Michael schliefen. Dann öffnete ich die Augen. Es war still im Zimmer, ganz still. Nur Berts und Michaels Atemzüge schwebten im Raum, und das leise Licht des Mondes fiel herein und warf einen Baumschatten auf den Fußboden.
Ich betrachtete das Zimmer, als sähe ich es zum ersten Mal: die beiden Doppelstockbetten, den Linoleumboden, das Waschbecken in der Ecke, den Schrank.
„Mach’s gut, Zimmer“, flüsterte ich, so, dass es niemand hörte außer mir. Und dem Zimmer. „Leb wohl.“
Denn während alle dachten, ich schliefe, hatte ich einen Entschluss gefasst. Vorsichtig stand ich auf und öffnete den Schrank. Ich nahm nur zwei Sachen heraus: meine Zahnbürste und das Modellschiff, das ich zu meinem achten Geburtstag bekommen hatte.
Die beiden Sachen steckte ich in eine Plastiktüte und zog meinen dicken Wollpullover an. Dann schloss ich den Schrank wieder und öffnete das Fenster. Es quietschte, und Bert und Michael regten sich im Schlaf. Doch sie wachten nicht auf.
Ich ließ die Plastiktüte behutsam fallen, kletterte hinter ihr her und sprang kurz darauf ins Gras hinunter. Es war ein ganzes Stockwerk bis ins Gras, und ich landete ziemlich unsanft. Aber das Modellschiff in der Plastiktüte war heil geblieben, und das war wichtiger.
Ich klemmte mir die Tüte fest unter den Arm und lief durch den taunassen Garten.
Nachdem ich über den Zaun gestiegen war, drehte ich mich noch einmal um und sah zurück. Das offene Fenster im ersten Stock schwang im Wind hin und her. Der Wind strich auch durch die Kronen der Apfelbäume und durch das Gras, das bald wieder gemäht werden musste – und es war, als winkten mir das Fenster und die Bäume und das Gras zum Abschied.
Ich hob einen Arm und winkte ihnen zurück.
Und mein Herz war sehr schwer.
Doch ich konnte nicht bleiben. Ich konnte unmöglich irgendwo bleiben, wo mich alle Leute anlogen und niemand mich mochte.
Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte.
Doch ich ging.
Ich ging die ganze Nacht. Der Mond stand hoch über mir, und mein Schatten folgte mir über die Wiesen. Manchmal ging ich einen Weg entlang und manchmal einfach nur querfeldein. Meine Beine wurden schwer und müde, doch ich zwang sie, weiterzugehen.
Wenn sie am Morgen im Kinderheim feststellten, dass ich fort war, würden sie mich suchen. Und dann wollte ich möglichst weit weg sein. Um keinen Preis würde ich mich dorthin zurückbringen lassen, zu diesen Leuten, denen man kein Wort glauben konnte. Um keinen Preis würde ich wieder in irgendeine Schule gehen, wo die Lehrer mit ihren Diktaten auf mich lauerten.
Gegen Morgen, als der Mond längst untergegangen war und der Himmel eben ein wenig rot wurde, wusste ich plötzlich, was ich tun wollte. Es war ganz einfach. Ich würde es so machen wie die Jungen in den alten Büchern. Ich würde zur See gehen.
Als der Himmel komplett rot war und die Sonne als großer Ball auftauchte, fiel mir ein, dass ich nicht wusste, wo die See war. Das war ein Problem. Doch ich war zu müde, um eine Lösung zu finden. Meine Augen fielen schon beinahe beim Laufen zu.
Da kroch ich in ein Gebüsch, wo niemand mich sehen konnte, und entschied, erst einmal zu schlafen.
Als ich aufwachte, regnete es. Es regnete auch in mein Gebüsch, und ich fühlte mich ziemlich feucht an. Ich setzte mich auf und sah durch die Zweige hinaus. Draußen war alles grau. Bald wäre der Sommer vorbei, und der Herbst würde kommen. Der Herbst, das wusste ich, brachte die Herbststürme mit. Und sicher fuhren doch die großen Schiffe alle vor den Stürmen fort? Würde ich die See rechtzeitig erreichen, ehe die Herbststürme kamen?
Mein Magen knurrte.
Ich sah in der Plastiktüte nach, ob mir jemand ein Picknick eingepackt hatte. Zu Ausflügen bekamen wir sonst immer ein Picknick mit. Aber in meiner Plastiktüte waren nur zwei Dinge: die Zahnbürste und das Modellschiff. Kein Picknick.
Ich versuchte, ein wenig Gras zu essen. Schließlich, dachte ich, essen Kühe auch Gras, und dann geben sie Milch, und Milch macht satt. Daher musste Gras wohl auch satt machen, denn das ist logisches Denken, nicht wahr? Das Gras schmeckte jedoch furchtbar fad und faserig, und ich bekam nicht genug hinunter, um davon satt zu werden. Zum ersten Mal in meinem Leben taten mir die Kühe leid.
Ich stellte fest, dass sich mein Gebüsch direkt neben einem kleinen Bach befand, und ich setzte das Modellschiff in eine Bucht, wo das Wasser keine Strömung hatte. Dann betrachtete ich es eine Weile, wie es hin und her schaukelte. Es war ein schönes Schiff – mit zwei Masten und Aufbauten und Bullaugen, und es hatte sogar eine klitzekleine Galionsfigur vorne. Die Galionsfigur hatte ich selbst an den Bug geklebt, mit Alleskleber. Sie stammte aus einem Überraschungsei und war eine Plastikmöwe mit großen gelben Füßen.
Während ich das Schiff betrachtete und meinem Magen beim Knurren zuhörte und darauf wartete, dass der Regen aufhörte, nickte ich wieder ein.
Und als ich das nächste Mal aufwachte, hörte ich Stimmen.
Es waren sehr leise Stimmen wie von weit weg, aber gleichzeitig schienen sie ganz nah zu sein. Ich blieb sitzen und linste durch die Blätter nach draußen. Waren sie gekommen, um mich zurückzuholen? Aber – wo waren sie? Die Wiese war leer und grün, und auch auf dem Weg, den ich entlanggekommen war, konnte ich niemanden entdecken.
Ich lauschte angestrengt.
„Unglaublich!“, hörte ich jemanden sagen. „Es ist noch viel schöner als unser altes Schiff! Genau das, was wir brauchen!“
„Aber das ist nicht geheuer“, sagte eine andere Stimme. „Wir kommen hierher und finden einfach ein Schiff. Schiffe fallen doch nicht vom Himmel.“
„Ja“, sagte eine dritte Stimme. „Wo ist die Mannschaft?“
„Vielleicht sind sie alle an Land und kommen gleich wieder.“
„Aber hier gibt es nichts an Land. Gar nichts außer Wiesen und Regen. Wir sollten uns hier unter dem Huflattich unterstellen und das Schiff erst einmal beobachten.“
Unter dem Huflattich unterstellen?, dachte ich verwundert. Es wuchs eine ganze Menge von diesem grünen Zeug hier, das mich immer so ein bisschen an Regenschirme erinnerte. Und Maria hatte mal gesagt, es hieße Huflattich, was ich einen blöden Namen fand. Aber wie konnte man sich denn unter Huflattich unterstellen? Das war ja wohl unmöglich.
Ich drehte und wendete den Kopf – und dann, ja, dann sah ich sie.
Es waren ungefähr drei Dutzend, und sie standen tatsächlich am Rande des Baches unter einem großen Blatt. Abgesehen davon, dass sie jeder für sich nur so groß waren wie mein kleiner Finger, waren es ganz normale Menschen. Sie trugen Regenjacken und Jeans und Pullover und Gummistiefel, und manche hatten Rucksäcke auf, als machten sie eine Wanderung.
Gleich darauf dachte ich, dass sie wohl doch keine Wanderung machten. Denn mit ihnen standen eine Menge Kisten unter dem Huflattich, so, als zögen sie um. Ich sah, wie sie tuschelten und immer wieder auf mein Modellschiff zeigten. Es hatte genau die richtige Größe für sie.
Ich war sehr verwundert, denn ich hatte bisher nicht gewusst, dass es Leute auf der Welt gab, für die mein Modellschiff genau die richtige Größe hatte. Aber wenn man sein ganzes Leben in einem Kinderheim verbringt, kann man so etwas ja vielleicht auch nicht wissen.
Zuerst fühlte ich mich etwas schüchtern und verlegen. Doch dann dachte ich, dass es doch lächerlich war, sich schüchtern zu fühlen, wenn man so viel größer war als jemand anders.
Ich räusperte mich. „Äh, hallo“, sagte ich und bog den Huflattich ein wenig beiseite.
Die winzigen Leute zuckten alle gleichzeitig zusammen und legten die Köpfe in den Nacken, um zu mir emporzusehen. Ich war so groß, dass sie mich einfach bisher nicht bemerkt hatten.
„Ihr müsst keine Angst haben“, sagte ich.
„Ein Kind!“, rief ein winziger Mann mit rotem Vollbart. Er hörte sich nicht an wie einer, der oft Angst hat. „Seht nur, ein Kind! Ein Kind von den großen Leuten!“
„Oh ja, ein Kind“, sagte eine Frau mit blassblonden Haaren. Und sie klang ganz traurig dabei. „Es sieht ein bisschen aus wie Friedrich, findest du nicht?“
„Ich sehe überhaupt nicht aus wie Friedrich“, widersprach ich irritiert. „Ich sehe aus wie Karl. Weil ich nämlich Karl bin. Karl Sonntag. Und das dort ist mein Schiff.“
„Dein Schiff!“, rief der Mann mit dem roten Vollbart. „Es ist sein Schiff!“
Ein Raunen und Murmeln der Anerkennung lief durch die Reihen der winzigen Leute.
„Was für ein schönes Schiff“, sagte ein anderer Mann mit einem Südwester auf dem Kopf. „Ausgesprochen schön. Wie viele Knoten macht es?“
„Es macht überhaupt keine Knoten“, antwortete ich verwundert. „Es macht gar nichts. Es liegt einfach nur so da.“
„Soundso viele Knoten machen“, erklärte der Mann mit dem Südwester, „heißt, soundso schnell fahren. Du segelst wohl nicht mit deinem Schiff, dass du das nicht weißt?“
Was für eine komische Frage! „Wie soll ich denn?“, erwiderte ich. „Ich bin doch viel zu groß.“
„Ah ja“, meinte der Mann und legte nachdenklich einen Zeigefinger an die Wange. „Das stimmt.“
Er schien eine Weile nachzudenken. Schließlich sagte er: „Wo du doch ohnehin nicht auf deinem Schiff fahren kannst – würdest du es verleihen? Es ist nämlich so: Unser eigenes Schiff ist vor zwei Tagen gesunken. Ein wenig flussaufwärts von hier. Es ist eine etwas seltsame Sache mit uns. Wir sind in einen schrecklichen Sturm geraten, und unser Schiff wurde direkt vom Meer aus durch die Luft bis hierher gewirbelt. Und als der Wind es hier im Fluss absetzte, ging es von der Wucht kaputt und sank. Wir konnten nur ein paar unserer Sachen retten.“ Er zeigte auf die Kisten unter dem Huflattich.
„Wie schrecklich“, sagte ich entsetzt. „Und was tut ihr jetzt?“
„Wir müssen zurück zum Meer“, antwortete die Frau mit den blonden Haaren. „Dort wartet eine große Aufgabe auf uns … das ist eine lange und ziemlich komische Geschichte. Sicherlich mündet dieser Fluss irgendwann ins Meer, denn das tun alle Flüsse. Aber wir brauchen ein Schiff, um auf dem Fluss und über das Meer zu fahren.“
Das sah ich ein. „Und jetzt wollt ihr meins“, sagte ich und fragte mich, was für eine komische Geschichte das war, von der die Frau gesprochen hatte.
Die winzigen Leute nickten und sahen mich dabei verlegen an.
„Das heißt, wenn du es entbehren kannst“, fügte die blonde Frau hinzu.
Ich überlegte. „Eigentlich will ich auch zum Meer“, sagte ich und seufzte.
„Würdest du uns das Schiff geben, wenn wir dich mitnehmen?“, fragte sie.
„Wie das denn?“, wollte ich wissen. „Ich bin doch viel zu riesig für das Schiff.“
„Das“, sagte der Mann mit dem roten Vollbart, „kann man ändern.“
Ich musterte ihn zweifelnd. Ein Lächeln zog über sein winziges Gesicht. Es war ein Gesicht voller Falten, ein Gesicht, das das Wetter auf dem Meer gezeichnet hatte. Nie hätte ich geglaubt, dass der erste echte Seemann, dem ich begegnen würde, nur so groß wäre wie mein kleiner Finger. Und dass ich ihn unter einem Huflattichblatt anträfe.
„Du musst einen von unseren Schiffszwiebäcken essen“, sagte der bärtige Seemann. „Du hast Glück, dass wir eine Kiste mit Schiffszwiebäcken gerettet haben.“
Damit begannen die winzigen Leute, aufgeregt umherzuwuseln und zu suchen. Sie öffneten hektisch alle Kisten und suchten den Zwieback, und ich sah, was sie alles bei sich hatten: Dosen mit Ölsardinen, die für sie so groß waren wie Karpfen, und große Vorräte an Himbeeren, eine Kiste voller klitzekleiner Bücher und eine andere Kiste voller Streichholzköpfe, auf deren Deckel in kaum lesbaren Buchstaben FEUERWERK stand.
Schließlich rief jemand: „Ich hab ihn!“
Es war der einzige Junge zwischen all den winzigen Erwachsenen. Er schwenkte etwas in seiner Hand, das ungefähr so groß war wie eine sehr kleine Tablette. In der Kiste vor ihm waren noch mehr Tabletten, aber es waren natürlich keine richtigen Tabletten: Es waren winzig, winzig, winzig kleine runde Schiffszwiebäcke. Der Junge reichte mir den Zwieback, und ich nahm ihn ganz vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und führte ihn zum Mund.
Eine Sekunde zögerte ich. „Was muss ich tun, um wieder groß zu werden?“, fragte ich.
„Hm, tja“, sagte der Mann mit dem roten Bart. „Also, die Sache ist: Das wissen wir nicht. Wir sind schon immer klein. Das mit dem Zwieback ist eine alte Sage. Vielleicht funktioniert es gar nicht.“
„Man muss es darauf ankommen lassen“, meinte der Mann mit dem Südwester.
„Bitte“, sagte ich – und fühlte mich auf einmal wieder sehr entschlossen. „Dann lasse ich es darauf ankommen.“
Was, dachte ich, sollte schon schlecht daran sein, kleiner zu werden, wenn man dadurch auf einem Schiff zur See fahren konnte? Und was soll schon schlecht daran sein, klein zu bleiben? Wenn die großen Leute einen doch sowieso alle anlügen und von ihren Schulen werfen?
Ich schluckte den tablettengroßen Zwieback mit Todesverachtung hinunter.
Im nächsten Moment stand ich vor dem Mann mit dem roten Vollbart und sah zu ihm auf. Von unten sah sein Vollbart noch voller aus. Es regnete nach wie vor, doch ich wurde nicht mehr nass: Über mir wölbte sich das grüne Dach des Huflattichs.
Und dann sah ich die beiden Masten eines stolzen, wunderschönen Schiffes in den nassen Himmel aufragen.
„Lasst uns an Bord gehen“, sagte der bärtige Mann.
2. Kapitel,
in welchem ich eine Kapitänin kennenlerne. Ein Schiff fährt per Anhalter, ich entdecke erstaunliche Dinge unter Deck, und schließlich höre ich ein Märchen, das kein Märchen ist.
Es war aber gar nicht so einfach, an Bord zu gehen.
Ich hatte vergessen, die Gangway auszuklappen, als ich noch groß gewesen war. Die Gangway ist eine Art Brücke,über die man vom Land aus bequem auf ein Schiff steigen kann, wenn es vom Ufer ein kleines Stückchen weit weg liegt.
Das Schiff lag ein großes Stückchen weit weg.
Da sah ich, dass da neben dem Huflattich im Gras etwas lag, etwas langes weiß-rot Gestreiftes.
„Das ist meine Zahnbürste!“, rief ich und hatte eine Idee. Ich ging hinaus in den Regen und hob die Zahnbürste mit beiden Armen hoch. Beinahe musste ich lachen, denn wer braucht schon beide Arme, um seine eigene Zahnbürste festzuhalten. Sie war jetzt groß und unhandlich, doch schließlich gelang es mir, sie zum Ufer zu balancieren.
Ich sah, wie die winzigen Leute mich beobachteten und tuschelten.
„Das haben wir gleich“, sagte ich – ganz so, als trüge ich jeden Tag meterlange Zahnbürsten durch die Gegend. Damit streckte ich den geringelten Stiel aus, verhakte die Borsten hinter der Bootsreling und zog. Das Boot schien einen Moment zu zögern. Doch schließlich ließ es sich an Land ziehen. Im nächsten Augenblick war es so nah, dass ich an die Gangway herankam, um sie auszuklappen.
Triumphierend sah ich mich nach den winzigen Leuten um, die Zahnbürste in einer Hand wie ein riesiges Königszepter. Ein Glück, dachte ich, dass ich zwei so ausgesprochen nützliche Dinge mit auf die Reise genommen habe.
„Großartig“, sagte der Mann mit dem roten Bart. „Alle an Deck!“
Während die winzigen Leute ihre Kisten und Seesäcke auf mein Schiff trugen, kam er zu mir und schüttelte mir die Hand. „Vielen Dank, Karl“, sagte er. „Ich sehe schon: Du wirst ein hervorragender Seemann. Im Übrigen habe ich versäumt, mich vorzustellen. Ich bin Fred, der Smutje an Bord.“
„Smutje?“, fragte ich. „Was ist das?“
„Das ist der Schiffskoch“, sagte Fred und lächelte breit. „Der immer mit den merkwürdigsten Dingen etwas Essbares für die ganze Mannschaft herstellen muss. Und sobald wir in See stechen, werde ich uns einen wundervollen Zwieback-Vogelbeeren-Auflauf zubereiten.“
„Oh“, sagte ich. „Ich dachte, Sie wären der Kapitän.“
Fred lächelte noch breiter. „Den Kapitän“, sagte er, „wirst du gleich kennenlernen.“
Damit schob er mich über die Gangway.
Kurz darauf knarrten die Taue, die Maria damals aus rotem und grünem Nähgarn zurechtgeschnitten hatte, und die weißen Segel, für die sie mir drei ihrer guten Taschentücher geschenkt hatte, entfalteten sich wie die Flügel eines großen, schönen Schmetterlings. Die winzigen Leute arbeiteten alle zugleich auf „hau-ruck“ und zogen und zerrten und stemmten sich in die Seile.
Ich aber stand an der Reling, legte den Kopf in den Nacken und sah zu, wie sich der Regen verzog und der Wind die Segel blähte. Und da wurde es ganz warm in meinem Herzen, und es war mir, als müsste ich laut singen.
Denn wie lange hatte ich davon geträumt, an einer Reling zu stehen und den Wind im Gesicht zu spüren. Und nun war es nicht irgendein Schiff, an dessen Reling ich stand. Es war mein Schiff, mein stolzes, schönes Schiff mit der Überraschungsei-Galionsfigur und den roten Fallen und den grünen Schoten und den weißen, weißen Segeln.
So fuhren wir den Bach hinab, der jetzt ein breiter Fluss war, und der Wind schob uns übers Wasser dahin wie eine große, unsichtbare Hand. Meine Gestalt spiegelte sich unten auf den Wellen; ich konnte mir selber winken, was ich eine ganze Weile auch tat.
Wir fuhren noch nicht lange, als jemand mir auf die Schulter tippte.
Es war Fred, der Schiffskoch mit dem roten Bart. Neben ihm stand eine kleine, zierliche Frau mit zerzausten kurzen Locken und in einer gelben Öljacke.
„Ich hatte dir doch versprochen, Karl“, sagte Fred, „dass du unseren Kapitän kennenlernen sollst, sobald ein wenig Zeit dafür ist.“