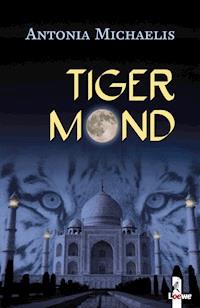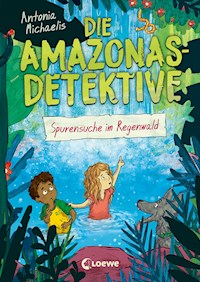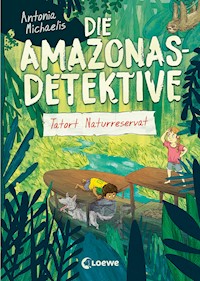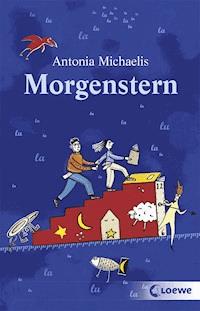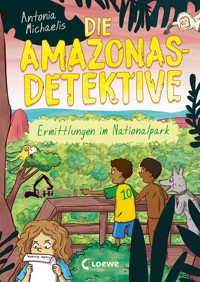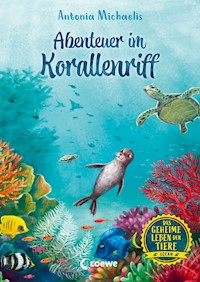6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem ebenso charmanten wie originellen Roman über eine Wahl-Familie der besonderen Art schafft Antonia Michaelis einmal mehr eine zeitlos anrührende Atmosphäre und verzaubert mit ihrer Poesie und ihrem ganz besonderen Ton. Voller Lebensklugheit, mit einem Ensemble von Träumern und Individualisten und vor allem mit ganz besonderen Katzen ist "Mr. Widows Katzenverleih" eine Liebes-Erklärung an die Katze als solche und ein Lesegenuss voller großartiger sprachlicher Bilder und Gedanken, die im Gedächtnis bleiben. In seinem alten Haus mit dem verwunschenen Garten mitten in der Großstadt verleiht der alte Mr. Widow samtpfotige Stubentiger an Menschen, die zu viel oder auch zu wenig haben, um das sie sich sorgen müssen. Je nach Bedarf verbreiten seine Katzen von Behaglichkeit bis Chaos vor allem eines: Glück. Eines Abends entdeckt Mr. Widow in einer Mülltonne neben einem Wurf neugeborener Kätzchen eine schwangere junge Frau, und auf einmal sieht er sein beschauliches Leben auf den Kopf gestellt. Denn vor irgendetwas scheint die junge Frau auf der Flucht zu sein … In diesem wunderbaren Roman rund um Katzen, Freundschaft und Liebe, Familien und ihre Geheimnisse beweist Antonia Michaelis erneut, dass sie keine gewöhnlichen Geschichten schreibt, sondern mit jedem Buch etwas Besonderes schafft, das lange im Kopf und im Herzen der Leser bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Antonia Michaelis
Mr. Widows Katzenverleih
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In seinem alten Haus mit dem verwunschenen Garten mitten in der Großstadt verleiht der alte Mr. Widow samtpfotige Stubentiger an Menschen, die zu viel oder auch zu wenig haben, um das sie sich sorgen müssen. Je nach Bedarf verbreiten seine Katzen von Behaglichkeit bis Chaos vor allem eines: Glück. Eines Abends entdeckt Mr. Widow in einer Mülltonne neben einem Wurf neugeborener Kätzchen eine schwangere junge Frau, und auf einmal sieht er sein beschauliches Leben auf den Kopf gestellt. Denn vor irgendetwas scheint die junge Frau auf der Flucht zu sein …
»Antonia Michaelis stellt die ganz großen Fragen unseres Lebens und lässt damit keinen Leser kalt.« Literaturkurier.de
Inhaltsübersicht
Widmung
0. Kapitel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
0. Kapitel
Für
die Katzen meines Lebens:
den Kater Murr, der meine Babyzeit begleitete und immer dann essen wollte, wenn ich gefüttert wurde (alle vier Stunden), weshalb er vermutlich der dickste Kater der Welt war,
die Katze Mauzi, die emanzipiert nachts die Kater verprügelte,
Micki, der sich am Teppichboden ständig elektrisch auflud und beim Streicheln im Dunkeln, wenn er auf meinem Bett schlief, knisterte und Funken sprühte,
Pfaff, der schnurren konnte wie die gleichnamige Nähmaschine,
Moritz, den ich als Minikätzchen an einem Waldparkplatz fand und bei zwanzig Grad minus einfing, woraufhin er sich hinter der Abdeckung des Autoradios verkroch (die Leute, die auf dem Parkplatz hielten und die ich bat, mir zu helfen, dachten alle, ich wollte sie überfallen – wer glaubt schon den Satz: »Können Sie mir helfen, ich habe eine Katze im Radio?«), und den ich dann vierzehn Stunden im Zug zu meinen Eltern transportierte, woraufhin die gesamte Deutsche Bahn einen Allergieanfall bekam,
Max, der in jüngeren Jahren aussah wie eine Kegelrobbe (weniger Robbe, mehr Kegel),
Ginger, die mich in Indien besaß und die lieber Hundefutter fraß (was exakt das Gleiche war wie Katzenfutter: Reis vom Vortag, nur eben im Hundenapf),
die winzige Katze Cat, der ich in Ghana diente,
den Piratenkater, den wir mit der Ruine übernahmen, die heute unser Haus ist,
den Kater Zopf, der dauernd davor bewahrt werden musste, in die heiße Bratpfanne auf dem Herd zu springen,
Krümel, die im Zimmer unserer Tochter ihre Jungen zur Welt brachte und später auf geheimnisvolle Weise verschwand,
Weißchen, die sozialste Katze der Welt, die zu unserem Baby raste, sobald es weinte, um es zu trösten (und die einen tragischen Tod fand, als sie ihren überfahrenen Neffen Keks auf der vielbefahrenen Straße wiederzubeleben versuchte),
Saba, die nach Berlin ausgewandert wurde und sich heute damit beschäftigt, verloren zu gehen und von ihren Menschen bei der Polizei oder beim Fundbüro abgeholt zu werden,
Schneewittchen, der Gurken frisst und bei dessen Geburt Alva sich sicher war, er wäre ein Mädchen,
und seine Gattin Zwerg, der er am Futternapf immer den Vortritt lässt.
0
Stellen Sie sich einen Winterabend vor. Einen Winterabend in einer Großstadt.«
Er sah mich an, als prüfte er, was ich mir vorstellte, als könnte er es durch meine Augen sehen. »Drinnen ein Kaminfeuer. Behaglichkeit. Ein altes Haus, in dem die Balken knarzen und die Mäuse unter den Dielen umherhuschen. Nein, streichen Sie die Mäuse wieder. Natürlich gab es keine Mäuse. Da waren zu viele Katzen. Ein Haus voller Katzen. Katzen auf jedem Treppenabsatz, jedem Sessel, man tritt leicht auf sie oder setzt sich auf eine, stellen Sie sich das vor. Und dann draußen dieser Abend: unwirtlich, unfreundlich, ungemütlich, alle Arten von un. Eisregen. Scharfe Böen, die um Hausecken fegen und Müll und Unrat mit sich tragen. Autos mit überfrorenen Scheiben. Kein Abend, an dem man hinausgeht, vor allem nicht in einer Stadt wie jener. Ein Abend voller heulender Schatten und Geister, ein Dickens-Abend. Irgendwann Anfang Januar, also keine Hoffnung auf Adventsstimmung in den Straßen. Nur noch Fetzen von alter Dekoration im Wind, trostlos. Werfen Sie noch ein wenig Hagel mit in den Topf, dann haben Sie ungefähr das Bild.«
»Danke«, sagte ich und sah sehnsüchtig zu dem leider sehr kleinen Ofen hinüber. »Ich habe es. Sehr anheimelnd.«
Er lachte. »Sie frieren ja! Sie zittern! Gut. Und nun stellen Sie sich einen Hinterhof vor. Irgendwo in der Stadt. Großstadt, sagte ich das schon? Die schlechte Sorte. Da ist eine Art Durchgang zur Straße, zwischen den Häusern, und durch diesen Durchgang kommt eine Gestalt. Beim Näherkommen sehen wir, dass es ein alter Herr ist, der sich schwer auf einen Stock stützt: ein schöner Spazierstock, aufwendig mit Schnitzereien verziert, aber in diesem Moment mehr ein Gehstock, eine Krücke. Der alte Herr hat ein steifes Bein, er zieht es hinter sich her wie einen Fremdkörper, mehr noch wie ein Gewicht an einer Kette. Das ist natürlich wieder sehr dickens, das steife Bein. Aber so ist es nun einmal, das ist die Situation, die wir haben. Als der Bewegungsmelder den alten Herrn und sein steifes Bein erfasst, fällt der fahle Schein einer alten Lampe auf den alten Herrn. Er kämpft sich Schritt für Schritt vorwärts, halb geduckt, stemmt sich gegen die stärker werdenden Böen, die den Abend zerreißen, und versucht, mit einem Arm sein Jackett zuzuhalten, dessen Knöpfe er nicht geschlossen hat: ein schwarzes Jackett, oder eine Anzugjacke, sehr klassisch. Darunter trägt er ein weißes Hemd und eine altmodische kastanienbraune Seidenweste mit einem Muster aus kleinen goldenen Lilien. Eine weitere Bö reißt das Einstecktuch aus der Westentasche, blütenweiß segelt es durch die Luft und wird vom Wind die Straße entlang entführt, reiht sich in den Tanz der Papiere und Plastiktüten, Blätter und Äste.
Der alte Herr hält kurz inne, hebt den Kopf mit dem silbergrauen Haar, kneift die Augen hinter seiner randlosen Brille zusammen und lauscht.
Da ist ein Geräusch im beginnenden Sturm, ein feines, zartes, klägliches Geräusch: das Miauen winziger, neugeborener Katzen. Es ist kaum auszumachen jetzt, zuvor war es lauter. Als der Wind noch nicht so stark war. Als die Kätzchen noch mehr Kraft hatten, um zu rufen.
Es war so stark oder die Ohren des alten Herrn so fein, dass er es vom Fenster im ersten Stock aus gehört hat, zwei Häuser weiter.
Der alte Herr findet das Geräusch wieder und folgt ihm unbeirrt durch den Hof, und dann sieht er, woher es kommt: aus einer der drei großen metallenen Mülltonnen. Diese Mülltonnen, Sie wissen schon, deren Deckel man mit Mühe aufschieben und nur mit einem ohrenbetäubenden Knall wieder schließen kann: archaische Relikte einer längst vergangenen Abfallkultur, in der die Leute offenbar vor allem große Möbel und kleinere Dinosaurier wegwarfen, so dass man riesige Tonnen brauchte.
Jetzt steht der alte Herr vor der Tonne, aus der das Rufen der Kätzchen dringt.
Er hebt den Spazierstock und hakt ihn zwischen Tonne und Deckel, um Letzteren aufzuhebeln. Ohne Stock ist der Deckel zu schwer für den alten Herrn.
Ungefähr in diesem Moment setzt der Hagel ein, den ich eingangs erwähnte. Sehr grobkörniger, sehr unangenehmer Hagel. Irgendwo in einem behaglichen Zimmer knistert ein Kaminfeuer, aber das Zimmer scheint in diesem Moment sehr weit weg.«
Er hielt inne und trank einen Schluck Tee. Das Café, in dem wir saßen, hatte sehr guten Tee. Es war die Sorte Café, in dem sich Reisende treffen, Weltreisende oder Kontinentreisende, Langstreckenreisende, die sich aufwärmen müssen in der Gesellschaft anderer Reisender. Gewöhnlich sind die Reisenden jung. Etwas abgerissen. Selten sind es alte Herren mit Westen. Das Café lag in den Bergen von Darjeeling, nahe einer Wanderstrecke für Trekkingfans, man konnte in den Hinterräumen ein Bett für die Nacht mieten; und ich schlief in diesen Tagen, der Kälte und des Ungeziefers wegen, meistens in meinen Kleidern.
»Sie haben ja ganz blaue Lippen, nur vom Zuhören!«, sagte der ältere Herr. »Wollen Sie meine Geschichte immer noch hören? Den Grund dafür, dass ich hier bin?«
»Natürlich«, sagte ich. Vielleicht sagte ich es nur, weil ich den Tag totschlagen musste, diesen Regentag, diesen Nebeltag, an dem man nicht einmal die angeblich so erstaunlich grünen Teeplantagen sah, in deren Mitte der schlammige kleine Ort lag.
»Übrigens ziehe ich Earl Grey sowieso vor«, sagte der ältere Herr, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Aber wenn Sie die Geschichte wirklich hören wollen, dann erzählen wir besser durch die Augen von jemand anderem.« Er streichelte nachdenklich den Knauf seines Spazierstocks. »Wir wechseln die Perspektive. Denn Sie sind jung, und ich bin alt, und wie soll ich Sie dies alles durch meine Augen erleben lassen? Wechseln wir die Perspektive, junge Frau. Bleiben wir nur noch kurz, ganz kurz, bei dem alten Herrn …
Er öffnete die Mülltonne, und ein Stück Licht von der Hoflampe fiel hinein.
Möglicherweise würde man es nie wieder herausfischen können.
Das Licht fiel auf einen ganzen Wurf junger Kätzchen, fünf oder sechs an der Zahl. Sie reckten ihre winzigen rosa Nasen hungrig und zitternd in die Luft und schrien und klagten der Welt ihr Leid. ›Wer‹, flüsterte der alte Herr, ›wirft denn neugeborene Katzen weg?‹
Aber er wusste, dass es vorkam, immer wieder.
Er beugte sich noch ein wenig weiter über die Tonne, um hineingreifen zu können. Und da sah er, dass noch jemand in der Tonne saß. Besser gesagt: Die kleinen Katzen saßen auf diesem Jemand. Auf seinem Schoß. Nein. Ihrem Schoß.
Es war eine gepflegte junge Frau mit kurzem schwarzem Haar, kleinen hellblauen Perlenohrringen und dunkel getuschten Wimpern. Jetzt sah sie zu dem alten Herrn empor und blinzelte ins Licht. ›Guten Tag‹, sagte der alte Herr und streckte die Hand aus. ›Widow mein Name. Archibald Widow.‹
Die junge Frau schüttelte seine Hand vorsichtig, als könnte sie bei einer zu heftigen Berührung zu Staub zerfallen, weil er schon so alt war.
›Sie werden erfrieren‹, sagte die junge Frau.
›Ich?‹
›Nein, die Katzen.‹ Sie wies auf die winzigen Wesen in ihrem Schoß. ›Erfrieren oder verhungern. Es ist schrecklich.‹
›Sind Sie … wegen der Katzen … in der Tonne?‹
Die junge Frau schüttelte den Kopf. ›Das war Zufall. Wir haben uns hier getroffen. Ich bin in die Tonne gestiegen, weil es hier windstill ist. Wärmer als draußen, wenn Sie verstehen.‹
Mr. Widow sah jetzt, dass neben ihr in der Tonne ein kleiner gelber Koffer auf den Zeitungen, zerknüllten Zetteln, kaputten Glühbirnen und Bananenschalen lag. Die Frau bemerkte seinen Blick.
›Mein Gepäck‹, sagte sie erklärend.
›Sie haben … Gepäck mit in diese Mülltonne genommen?‹, erkundigte sich Mr. Widow.
Die junge Frau zuckte die Schultern. ›Ich hatte es bei mir. Aber die Kätzchen …‹
›Sie werden weder erfrieren noch verhungern‹, sagte Mr. Widow. ›Seien Sie unbesorgt. Ich bin wegen der Kätzchen hier. Um sie zu holen. In meinem Haus gibt es so viele Katzen, da machen ein paar mehr auch nichts mehr aus. Man könnte sagen: Ich sammle sie. Wenn Sie so freundlich wären, sie mir zu reichen?‹
Die junge Frau nickte und gab Mr. Widow Katze um Katze, die er in den Taschen seines schwarzen Jacketts verstaute. Sie hatten aufgehört zu klagen – als wüssten sie genau, dass ihnen jetzt nichts Schlimmes mehr geschehen konnte und Dinge wie Wärme und Milch nicht mehr lange auf sich warten lassen würden.
›Und Sie?‹, fragte Mr. Widow. ›Bleiben Sie in der Tonne?‹
›Nun, ich … ich habe ehrlich gesagt im Moment keinen Platz zum Schlafen.‹
›Sie werden auch erfrieren‹, sagte Mr. Widow und streckte die Hand noch einmal in die Tonne. ›Kommen Sie. Sie können bei mir übernachten.‹
›Sind Sie sicher?‹
›Nicht ganz‹, sagte Mr. Widow ehrlich. ›Möglicherweise träume ich nur. Ich finde sonst selten junge Frauen in Mülltonnen. Aber falls Sie echt sind, sollten Sie wirklich jetzt aussteigen. Ich habe ein Gästezimmer, es ist warm dort, und ich werde Sie nicht nachts überfallen, denn ich bin über achtzig Jahre alt und zu bequem für Überfälle.‹
›Danke, ich … ich weiß nicht, ob ich das annehmen kann …‹
Aber sie stand bereits neben ihm, zitternd, blaulippig. Ihr Mantel war viel zu dünn für einen so kalten Abend, und ihre Beine steckten in einem kaum vorhandenen Hauch von Strumpfhosen unter einem kurzen Rock. ›Könnten Sie meinen Arm nehmen?‹, fragte Mr. Widow. ›Das Bein macht es nicht mehr, und es ist recht unbequem mit dem Stock.‹
›Natürlich.‹
Wir sehen die beiden zurückhumpeln, durch den Durchgang zur Straße, den Hinterhof und die Mülltonnen verlassen. Der Wind zerzaust ihre Kleider, ihr Haar, ihre Worte.
›Wie heißen Sie?‹, hören wir den alten Herrn noch fragen, ehe sie um die Ecke biegen.
Die junge Frau zögert. Als wäre sie sich nicht ganz im Klaren über ihren Namen.
›Nancy‹, sagt sie schließlich.«
»Und hier ist also die Person, durch deren Augen wir ab jetzt die Geschichte erleben?«, fragte ich.
»Richtig, hier ist sie«, sagte Mr. Widow mit einem leisen Lächeln und schnippte ein Katzenhaar von seinem Ärmelaufschlag. »Und hier ist der erste Satz der eigentlichen Geschichte: Nancy wusste nicht, ob es richtig war, mitzugehen.«
1
Nancy wusste nicht, ob es richtig war, mitzugehen.
Womöglich wäre es besser gewesen, in der Tonne sitzen zu bleiben und den Morgen abzuwarten, womöglich lieferte sie sich gerade einem Psychopathen aus, der nachts Mülltonnen nach Katzen und Frauen durchsuchte. Aber es war zu kalt, um darüber lange nachzudenken.
Sie hatte sich kurzzeitig gefragt, ob sie erfrieren würde. Wie das wäre.
Irgendwo hatte sie gelesen, dass einem ganz am Ende wieder warm wurde, durch einen Fehler in der Informationsübertragung, irgendwas mit den Nervenenden.
Es wäre womöglich in Ordnung gewesen.
An diesem Tag hatte ihr Leben ohnehin seine Bedeutung verloren. Nach dem, was geschehen war, war sie nach Hause gegangen, hatte ihre Hände gewaschen, geschrubbt eher, sich um ihr Haar gekümmert, sich umgezogen und ihren Koffer gepackt. Aber es hatte sich angefühlt, als packe sie den Koffer für eine sehr endgültige, letzte Reise. Oder für einen hübschen kleinen Sarg auf einem der eiskalten Stadtfriedhöfe, wo ordentlich aufgeräumte Leichen unter Tannengestecken und Plastikblumen vor sich hin faulten.
Sie werden dich finden. Bestimmt. Egal, wie weit du wegläufst.
Ja, ihr Leben war beendet.
Aber als der alte Herr in der goldgemusterten Weste die Tonne geöffnet hatte, hatte sie begriffen, dass ein neues begann.
Nancy war kein so schlechter Name.
Nancy … Müller. Warum nicht. Nancy Müller, Weltreisende, achtundzwanzig Jahre und sieben Monate alt, im Besitz von einem Koffer, drei Kilo Kleidern, die sie nie mehr tragen würde, und keinem Cent. Das Alter und die Besitzbeschreibung stimmten.
Die Böen fegten jetzt Hände voll scharfer Hagelkörner über den dunklen Gehsteig, und Nancy war dem alten Herrn, den sie untergehakt hatte, so nahe, dass sie ihn roch. Es war kein unangenehmer Geruch: eine Mischung aus Pfefferminz, Bergamotte, Sahnebonbons und Kaminfeuer, oder möglicherweise entsprangen diese Assoziationen ihrem Wunschdenken.
Die Katzen in Mr. Widows Taschen waren jetzt ganz still. Sie atmeten denselben Duft ein, dachte Nancy. Sie wussten, dass sie gerettet wurden. Nancy hatte ihnen nicht helfen können, hatte nur den Windschutz der Mülltonne mit ihnen geteilt, aber dieser alte Herr konnte helfen. Er war ein Heiliger der Januarnacht, und am liebsten hätte Nancy sich ebenfalls klein gemacht und wäre in seine Tasche gekrochen.
Gleichzeitig fühlte er sich neben ihr so zerbrechlich an, so unstet auf den Beinen, dass sie Angst hatte, er könnte fallen und wie Glas in tausend Stücke zerspringen, sobald sie seinen Arm losließ. Sie war sich unsicher, wer wen beschützte, sie ihn oder er sie, aber auf den wenigen Metern vom Eingang des Hofs bis zu Mr. Widows Haus bildeten sie eine seltsame Einheit.
Mr. Widows Haus.
Da stand es, sich in den nicht ganz dunklen Großstadthimmel erhebend.
Sie hatten an der Gartenpforte haltgemacht, die Mr. Widow jetzt öffnete, und einen Moment sah Nancy es nur an.
Ein Haus mit einer Gartenpforte, mitten in der Stadt! Der Gartenweg dahinter war nicht länger als zwei Meter, aber immerhin. Im Sommer blühten hier vielleicht bunte Blumen, und an den Sträuchern winkten grüne Blätter in einer sanften Brise. Jetzt zierten nur ein paar rote Hagebutten die winterlich kahlen Äste wie absichtlich darin aufgehängte Glasperlen.
Das Haus besaß zwei Stockwerke, und es war alt. Älter als Mr. Widow. Vielleicht hundert oder zweihundert Jahre – aber Nancy war nicht gut mit solchen Schätzungen. Vielleicht war es auch schon tausend Jahre alt, oder eine Million, vielleicht stand es seit Anbeginn der Zeit hier und wachte über die Nacht.
Sein spitzes Schindeldach ragte stolz in die Höhe, doch als Nancy die Bauten zur Linken und Rechten des Hauses betrachtete, musste sie unwillkürlich über den Stolz des Hauses lächeln. Es war, verglichen mit ihnen, winzig. Links saß der grobe, riesige Klotz eines Bürokomplexes, rechts hing ein drohendes Bauwerk von acht oder neun Stockwerken in der Nacht, die irgendein Firmenname zierte. Die ganze Straße – die ganze Stadt – bestand aus Häusern, die mindestens vier Stockwerke besaßen: alte hässliche Nachkriegsbausünden und neue Bauwerke mit Glasfassaden (genauso hässlich).
Mr. Widows Haus dazwischen war wie eine Erinnerung. Ein Stückchen Nostalgie.
Es war verwunderlich, dass niemand es abgerissen und etwas Größeres, Teureres an seine Stelle gebaut hatte.
»Das liegt daran, dass es uns gehört«, sagte Mr. Widow mit einem zufriedenen Lächeln, und Nancy zuckte zusammen. Offenbar hatte sie laut gedacht.
»Uns?«, fragte sie verwirrt.
»Mir und den Katzen«, antwortete Mr. Widow. »Kommen Sie jetzt. Es wird nicht wärmer hier draußen.«
Er schloss die Pforte mit einem leisen Klicken hinter ihr, und Nancy schluckte. Es war, als schlösse sich das Tor zu einer anderen Welt. Einer Welt aus Vergangenheit, Pfefferminzgeruch und Hemdkragen. Sie wusste nicht, ob sie hineinpasste.
Aber als Mr. Widow auch die Haustür aufschloss und diese zweite Tür hinter Nancy ins Schloss fiel, spürte sie plötzlich nur noch eine große Erleichterung. Sie lehnte sich an die Wand in dem vollgestopften kleinen Vorflur, lehnte einen Augenblick lang zwischen verschiedenen Gehstöcken, Angelhaken, Billardqueues und Mänteln an Haken und atmete tief durch.
Weiter als in eine andere Welt konnte man wirklich nicht weglaufen.
Sie war zum ersten Mal in den letzten acht Stunden – vielleicht zum ersten Mal überhaupt – sicher.
Später würde Nancy denken, dass in Mr. Widows Haus ein ganz eigenes Licht existierte. Es war gelb. Dunkelgelb. Und warm. Es war eine Art Licht, die man auf der Haut fühlen konnte, ein wenig wie Sonne im Sommer an einem Strand. In diesem Licht lagen die Katzen. Sie lagen überall – auf dem Sofa, auf den Sesseln, auf den verschiedenen Tischen und Tischchen, auf den Kommoden, sie badeten in dem Licht und ließen es auf ihrem Fell spielen.
Zuerst dachte Nancy, es ginge vom Kamin aus, wo ein Feuer knisterte, aber das stimmte nicht, denn das Licht war auch dort, wo der Schein des Kamins nicht hinfiel, und schließlich musste sie einsehen, dass es von sich selbst ausging. Es barg ein Geheimnis – wie die Augen der Katzen, die Nancy alle ansahen.
Sie stand in der Tür zu Mr. Widows Wohnzimmer, den dünnen Mantel über dem Arm, auf Socken; ihre nassen Schuhe hatten sie im Flur ausgezogen.
»Sind das … alles Ihre Katzen?«, fragte sie.
»O nein«, sagte Mister Widow. »Keine davon gehört mir.«
»Aber …?«
»Sie gehören alle sich selbst. Wir leben nur zusammen.«
»Eine … große WG«, sagte Nancy und lächelte. Und, als sie Mr. Widows verständnislosen Blick sah: »Wohngemeinschaft.«
Mr. Widow zuckte die Schultern. »Zu meinen Zeiten nannte man es Familie.«
Er ging an Nancy vorbei und füllte die Kätzchen aus seinen Taschen in einen Bastkorb auf dem Sofa um, der mit einer weichen Decke ausgelegt war. »Dann werde ich mal die Milch aufwärmen«, sagte er dann, so als fände er jeden Abend eine Handvoll Kätzchen, und verschwand, um in der Küche mit Geschirr zu klappern.
Nancy setzte sich neben den Bastkorb und begann, die winzigen Kätzchen mit dem Zeigefinger zu streicheln. Es waren acht, acht kleine, hilflose Wesen, die jetzt auf der Decke die Zitzen ihrer Mutter suchten und wenig effektiv begannen, an den Fusseln im Stoff zu saugen. Eines saugte an der Pfote seines Nachbarn.
Dann spürte Nancy etwas Warmes neben sich und sah auf. Und erschrak beinahe. Das Warme war ein riesiger grauer Kater, der sich an sie schmiegte. Aber auch alle anderen Katzen hatten ihre Plätze verlassen und waren zum Sofa herübergekommen, sie saßen auf den Kissen, der Rücken- und Armlehne, auf dem Boden davor und dem Fenstersims dahinter, von wo aus sie durch einen Wald aus Topfpflanzen spähten. Es waren dreißig oder vierzig Katzen in allen Farben: schwarz, gold, silber, rot, braun, gelb, weiß … Beinahe verwunderte es Nancy, dass es keine grünen Katzen gab. Ihre juwelengleichen Augen musterten abwechselnd Nancy und die Kätzchen, und die eine oder andere streckte sich und zeigte ihre Krallen, ein wenig wie ein höflicher Mörder, der ganz nonchalant mit seinem Messer spielt, um seine Macht zu demonstrieren.
Die schönste von ihnen, eine schlanke schwarze, deren Pelz beinahe blau schimmerte, saß ganz oben auf der Lehne und sah auf Nancy herab.
Du bist ihm also zugelaufen, ja, sagte ihr Blick. Du bist keine Katze.
»Das ist mir aufgefallen«, sagte Nancy. »Ich … bleibe nicht lang. Nur diese Nacht.«
Ach ja?, fragte die Blauschwarze lautlos. Mir sieht es aus, als würde es dir hier gefallen. Als würdest du dich gerne … einnisten. Es könnte sein, dass wir etwas dagegen haben.
Sie sprang von der Sofalehne auf Nancys Schulter, strich schnurrend um ihren Nacken herum zur anderen Schulter, kratzte kurz und wie aus Versehen einmal über Nancys Hals und landete dann auf ihrem Schoß.
Nancy saß stocksteif da. Es war vermutlich lächerlich, aber sie wagte nicht, sich zu rühren.
Die Blauschwarze begann, sich ohne Eile auf Nancys Schoß zu putzen. Dann schoss sie einen weiteren vernichtenden Blick auf Nancy ab.
Du hast einen Blutfleck auf der Bluse, bemerkte sie und putzte sich weiter.
Hast du gejagt?, fragte eine gelbe Katze zu Nancys Füßen. Keine von ihnen sprach laut, keine von ihnen sprach wirklich. Vermutlich war es nur Nancys müdes, durchgefrorenes Hirn, das sie die Sätze hören ließ.
»Ich … das war Nasenbluten«, flüsterte sie.
Sie hat eine Nase gejagt!, sagte eine kleine, dicke braune Katze. Hast du sie erlegt?
Dummkopf, sagte die Blauschwarze. Schwachsinn. Hör mal, du. Du hast auch Blut an deinen Händen.
Nancy sah ihre Hände an. Sie waren vollkommen sauber. Dann sah sie an ihrer Bluse hinunter und erinnerte sich, dass sie sich umgezogen hatte. Diese Bluse besaß keinen Fleck. Die andere hatte einen besessen. Aber die andere hatte sie in einen Mülleimer gestopft. Woher wusste die blauschwarze Katze …?
Wir wissen alles, sagte die blauschwarze Katze mit einem unhörbaren Lachen. Dann endlich sprang sie von Nancys Schoß, um um Mr. Widows Beine zu streichen, denn in diesem Moment kam Mr. Widow endlich mit der aufgewärmten Milch wieder.
Er lächelte Nancy zu und streichelte die Blauschwarze flüchtig. »Ich sehe, Sie haben sich schon mit der Königin von Saba angefreundet«, sagte er. »Möchten Sie mir erzählen, warum Sie keinen Platz zum Übernachten haben?«
Er begann, die Kätzchen, eins nach dem anderen, geduldig mit einer kleinen Flasche zu füttern, an der sie gierig saugten. »Ich … ich mache eine Art Weltreise«, erklärte Nancy. »Das Dumme ist, meine Handtasche mit dem Portemonnaie ist mir gestohlen worden. Heute früh. Sämtliche Karten, der Ausweis, mein letztes Bargeld, das Handy …« Sie zuckte die Schultern. »Bis ich das alles wiederhabe, kann es dauern.«
»Hm«, sagte Mr. Widow, und sie fragte sich, ob er ihr glaubte. »Ich dachte immer, nur jüngere Leute machen Weltreisen. Leute mit achtzehn. Ehe sie wissen, was sie mit dem Leben tun wollen.«
»Hm«, sagte Nancy.
»Haben Sie Hunger? Da sind noch ein paar Gurkenschnittchen vom Tee. Und da ist auch noch Tee vom Tee. Ein durchaus annehmbarer Earl Grey.«
Daher, dachte Nancy, der Bergamottegeruch. Sie hatte immer gefunden, dass Earl Grey nach Parfum schmeckte. In diesem Moment war eine Tasse warmes Parfum das Beste, was sie sich vorstellen konnte.
Eine halbe Stunde später saß sie vor einem Porzellanteller mit Schnittchen und hielt genau solch eine Tasse in der Hand, eine weiße Tasse mit rosa-goldenem Rand.
Der Kamin taute das Eis in ihr, und die Katzen hatten sich zurückgezogen. Selbst die Königin von Saba lag jetzt ruhig an ihrem Platz auf dem Bücherschrank, in der schmalen Ritze zwischen Schrank und Decke. Es war wahrscheinlich unbequem, aber es war unleugbar der höchste Punkt im Raum, der Punkt, von dem aus man auf alle anderen herabsehen konnte.
»Warum … haben Sie so viele Katzen?«, fragte sie vorsichtig.
»Wie gesagt, ich habe sie nicht«, entgegnete Mr. Widow aufgeräumt und warf einen stolzen Blick zu den satten, schlafenden Kätzchen im Korb hinüber. »Ich finde sie manchmal, aber ich habe sie nicht. Wenn Sie es genau wissen wollen … ich verleihe.«
Er verschränkte die Arme vor seiner goldbewesteten Brust, als hätte er nun alles sehr zufriedenstellend erklärt.
»Sie … verleihen?«
»Ja. Die Katzen.« Er runzelte die Stirn und sah sie an. »Haben Sie noch nie von einem Katzenverleih gehört?«
»Ich … Nein. Ehrlich gesagt nicht.«
»Nun, das liegt daran«, sagte Mr. Widow hochzufrieden, »dass es bis auf meinen keinen gibt. Dies ist die erste und einzige Katzenvermietung Deutschlands. Auch wenn sie von einem komischen alten Engländer geführt wird.« Er lachte ein warmes, gelbes, leicht zerknittertes Lachen. »Haben Sie das Schild an der Tür nicht gesehen? Mr. Widows Katzenverleih?
Ich vermiete die Katzen tage- und stundenweise. Manchmal für länger. So viele Leute in dieser Stadt hätten gern eine Katze und können keine haben! Und eine Menge Leute …« – er senkte seine Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern – »… brauchen eine Katze, ohne es zu wissen. Ich meine, ich zwinge natürlich keine Katze dazu, mit irgendwem mitzugehen. Die Katzen suchen sich das selber aus, wenn der Entleiher zum ersten Mal herkommt. Katzen kann man sowieso zu nichts zwingen.« Er trank einen Schluck Tee und sah noch immer sehr zufrieden mit sich aus. Aber dann bewölkte sich seine Stirn. »Eigentlich liefere ich auch Katzen frei Haus. Aber in letzter Zeit fällt es mir ein bisschen schwer, alles alleine hinzubekommen. Mit dem Bein und allem. Niemand wird wirklich jünger. Ich …« Er unterbrach sich. »Sehen Sie sich das an. Sie tut es schon wieder.«
Nancy folgte seinem Blick. Eine große Katze mit karamellfarbenen Streifen hatte sich in den Bastkorb gelegt, auf die Kätzchen. Allerdings sehr behutsam und so, dass alle acht Köpfchen unter ihrem weichen weißen Bauchfell hervorlugten.
»Das ist die Tibbytigerin«, erklärte Mr. Widow. »Sie hat auf einem Bauernhof gewohnt, ehe sie in die Stadt kam. Lange Geschichte. Hühner, Enten, Gänse … Die Umstellung auf Autos, Lärm und Abgase ist ihr mental nicht bekommen.« Er seufzte. »Na ja, immerhin hält sie die Kleinen warm. War bei den letzten, die ich gefunden habe, auch so.«
»Aber … was tut sie da?«, fragte Nancy.
»Sie brütet«, sagte Mr. Widow.
Nachts wachte Nancy auf und wusste nicht, wo sie sich befand.
Sie tastete nach dem gewohnten Körper neben sich, doch da war nichts. Nicht einmal Platz. Da war nur die Wand und eine rauhe, ungewohnte Tapete.
Sie lag einen Moment ganz still und sah an die Decke, an der ein Muster aus Ästen und wenigen Blättern spielte wie ein Musikstück. Das Licht, das die Schatten an die Decke malte, war das eines fahlen Mondes, und sie setzte sich auf und fand sich in einem sehr kleinen Raum wieder. Bis auf das Bett befanden sich darin ein Stuhl, eine von der Wand klappbare Schreibtischplatte und ein schmaler, hoher altmodischer Schrank aus dunklem Holz. Zwischen Bett und Fenster war nicht mehr als ein Meter Platz. Eine Tür, die schmaler war als die eigentliche Zimmertür, führte hinüber in ein ebenso winziges Bad; sie erinnerte sich jetzt, das Ganze war eine Art Einliegerwohnung, im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Einlieger konnte nicht viel darin tun als das, was sie gerade tat: liegen.
Die Erinnerung an die Katzen, Mr. Widow und die Mülltonne rieselte in umgekehrter chronologischer Reihenfolge zu ihr zurück, wie Sand, den man zuvor fortgeschoben hat. Danach kam die Erinnerung an das, was früher am Tag geschehen war, und sie schloss die Augen. Aber es nützt nichts, die Augen zu schließen vor einer Erinnerung.
Sie dachte an Kai. An seine Hände auf ihrer Haut. An seine Lippen. An die ganze verdammte Vergangenheit.
Auch er lag irgendwo allein.
Sie stand auf und tappte zum Fenster, das nach hinten hinaussah, zu Mr. Widows Garten. Der Garten war ebenso eingequetscht zwischen den größeren Gebäuden wie das Haus – und genauso eigensinnig. Die alten Bäume standen fest verwurzelt dort. Wir stehen hier schon hundert Jahre, schienen sie zu sagen, wir weichen nicht, nur weil ein Ding aus Stahl und Glas, aus Beton und Kälte seinen Schatten auf uns wirft.
Der Sturm hatte sich gelegt, nur eine sachte Brise war geblieben. Auf einem der Bäume schaukelte, von der Brise angestoßen, eine Katze wie ein großer schlafloser Vogel. Ihre brennenden gelben Augen waren auf Nancy gerichtet. Es war die Blauschwarze, die Königin von Saba.
Ich weiß alles, sagte sie durch die Scheibe.
Drinnen im Zimmer lauerten die Erinnerungen noch immer in den Schatten, zusammen mit den unbekannten Wesen der Nacht.
Nancy kroch mit rasendem Herzen zurück ins Bett und zog die Decke über sich. Etwas lag darauf, etwas Schweres. Sie setzte sich noch einmal auf und sah, dass es eine Katze war. Die kleine braune, die gefragt hatte, ob sie eine Nase gejagt hatte.
Sie sagte nichts, schnurrte nur und zuckte ab und zu im Traum mit den Pfoten.
Da fühlte Nancy, wie ihr Herz gleichmäßiger schlug, und sie schmiegte sich an die Katze und spürte ihre Wärme. Diese hier hatte sich Nancy ausgesucht, um bei ihr zu schlafen, diese hier hatte nichts gegen sie. Diese hier vertraute ihr. Sie vertraute ihr, wie das Baby in ihrem Bauch es tat, von dem noch keiner wusste außer ihr selbst. Nancy lächelte und sank wieder hinab in den Schlaf, in wirre Träume, die sie später vergaß.
2
Das Haus war still, als sie aufwachte.
Ein Sonnenstrahl stahl sich durchs Fenster und nistete auf ihrem Bett, und sie fing ihn mit der Hand und ließ das Licht durch ihre Finger rinnen wie warmes Wasser.
»Nancy«, flüsterte sie. »Guten Morgen, Nancy. Wie geht es weiter mit deiner Weltreise?«
Die kleine braune Katze lag nicht mehr auf ihrem Bett, doch die Tür war noch immer geschlossen. Hatte die Katze die Tür selbst geöffnet, indem sie auf die Klinke gesprungen war? Aber wer hatte die Tür wieder geschlossen?
Sie werden dich finden. Egal, wie weit du wegläufst.
Unsinn, keiner von ihnen war hier.
Sie stellte sich in dem winzigen Bad unter die Dusche (wobei sie erst über die Kloschüssel klettern musste, um die Duschtür von der anderen Seite öffnen zu können), drehte das Wasser auf eiskalt und rubbelte danach ihre Haut ab, bis sie rot und wieder warm war. Im Spiegel sah ihr eine junge Frau mit kurzem schwarzem Haar entgegen, die sie noch nicht kannte. Pechschwarz, beinahe blauschwarz war das Haar, wie das Fell der Königin von Saba. Die alles wusste.
Die Frau im Spiegel war eigentlich gar nicht so jung. Sie sah älter aus als achtundzwanzig, ihr Gesicht voller Schatten. Sie puderte die Schatten weg. Dann tuschte sie ihre Wimpern, trug einen Hauch von blassrosa Lippenstift auf und kletterte über die Kloschüssel zurück zur Badezimmertür. Möglicherweise war das Bad früher ein begehbarer Kleiderschrank gewesen.
Im Schlafzimmer trat sie ans Fenster, öffnete es weit und ließ die eiskalte Luft des Wintermorgens über ihren nackten Körper fluten wie eine Welle. Sie beobachtete, wie sich Gänsehaut auf ihren Armen und Beinen bildete, wie sich all die winzigen blonden Härchen aufstellten, als könnten sie mit genügend Anstrengung zu einem Fell werden wie das der Katzen und sie wärmen.
Beinahe fühlte sie das schmerzhafte Ziehen in ihrer Haut, den Wunsch ihres Körpers, sich zu verwandeln.
Sie fragte sich, ob es einmal möglich gewesen war. Ehe die Menschen begonnen hatten, vernünftig zu sein und Städte mit zehnstöckigen Bauten aus Glas und Stahl zu bauen. Auto zu fahren. Die Stille durch Dauerlärm und die Luft durch eine Mischung aus Gestank und Parfum abzutöten. Vielleicht hatte es davor eine Zeit gegeben, in der die Menschen sich verwandelten.
»Nein, natürlich nicht«, sagte sie laut und stützte die Arme aufs Fensterbrett. »Kai hätte gesagt, ich soll aufhören, solchen Unsinn zusammenzuträumen. Unsinn bringt einen nirgendwo hin. Es ist wichtig, klar und geradeaus zu denken und seinen Körper in Schuss zu halten. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper.«
Kai hatte die Griechen und Römer und ihre Statuen immer bewundert, diese muskulösen weißen Gliedmaßen, diese absolute Kontrolle. Mit ihrer Philosophie hatte er es nicht so, und wenn er Diogenes begegnet wäre, hätte er höchstwahrscheinlich versucht, sich mit ihm über Tennis zu unterhalten.
Es war ihm immer wichtig gewesen, dass die Frau an seiner Seite schön war. Schön und gut durchtrainiert, schlank, perfekt. Er hatte das Fitnessstudio, das Solarium und die Maniküre bezahlt, den Friseur, den Inhalt ihres Kleiderschranks.
Sie sah an sich herab, nackt, schutzlos, verwundbar. Und glücklich – für den Moment.
Draußen breitete sich der Garten unter dem Fenster aus wie eine eigene kleine Welt zwischen den hoch aufragenden Häuserwänden an allen Seiten. Er war noch schöner als bei Nacht. Die alten Bäume hatten sich glitzernde Kleider aus Rauhreif angezogen, und das Eis auf dem kleinen Teich funkelte, als wäre ein Stück der Sonne herabgesegelt und dort liegen geblieben. Gefrorene Wassertropfen hingen wie Juwelen im braunen Winterschilf am Ufer. Die Überreste hoher Blütenstauden standen im Gras wie Inseln, ihre feinen Ästchen und Samenkapseln bildeten Muster wie geheimnisvolle Schriftzeichen.
Tiefrote Hagebutten strahlten in der Hecke zur Linken, winzige goldgelbe Wildäpfel zierten einen Baum wie Weihnachtsschmuck. An einem anderen hing eine Hollywoodschaukel aus schnörkeligem weißem Schmiedeeisen, an einem weiteren Baum kleine silberne Fische, die sich fröhlich im Wind drehten.
Moment.
Fische?
Nancy beugte sich aus dem Fenster und kniff die Augen zusammen. Tatsächlich. Jemand, vermutlich Mr. Widow, hatte Ölsardinen an Bindfäden in die Äste gehängt. Darunter saß ein übergewichtiger roter Kater und versuchte, sie zu fangen. Er erwischte einen, arbeitete eine Weile daran, ihn von dem Bindfaden zu lösen, schaffte es schließlich und fraß ihn samt Schwanz. Dann machte er sich an den nächsten Fisch.
Am Teich, halb verborgen im Schilf, entdeckte Nancy jetzt zwei weiße Katzen, Rauhreifkatzen, perfekt getarnt. Die Feuchtigkeit in ihrem Fell ließ sie aussehen, als habe ein Kind sie mit Glitter aus seiner Bastelschublade bestäubt. Die beiden Glitzerkatzen beobachteten den fetten roten Kater und wie er sich mit den Fischen abmühte; sie schienen leise zu lachen.
Und dann sah Nancy Mr. Widow. Er stand in seinem dunklen Jackett neben der dunklen Silhouette eines Dings, dass einem Grabstein glich, hielt sich an dem Stein fest und versuchte, mit seinem Gehstock ein Vogelhaus zu angeln, das an einer langen Kette von einem Ast hing. Als es ihm gelang, zog er es heran, holte eine Handvoll Vogelfutter aus seiner Tasche, füllte das Haus und ließ es zurückschwingen. Danach wandte er den Kopf und sah zu Nancy herüber.
Nancy hob den Arm und winkte.
Mr. Widow winkte zurück.
»Guten Morgen!«, rief er. »Warum sind Sie nackt?«
»Ich … äh«, sagte Nancy, denn das hatte sie vergessen. Sie schloss rasch das Fenster und öffnete den Koffer. Ganz oben lagen ein T-Shirt und eine sackartige Trainingshose, die sie am Vortag in einem Discounter gekauft hatte. Alles andere war nutzlos. Als sie den Koffer gepackt hatte, war sie zu konfus gewesen, um daran zu denken, dass es nutzlos war. Niemand durfte sie in den alten Sachen sehen; sie würde sie in die Kleidersammlung stecken.
Sie schlüpfte in das T-Shirt und merkte, dass sie ein großes Kindershirt erwischt hatte. Es war unauffällig hellblau, aber auf der Vorderseite prangte ein riesiger grinsender grüner Frosch, der durch eine Nerd-Brille schielte und eine Colaflasche auf dem Kopf balancierte. Verdammt. Die Hose war froschlos und grau, jedoch mehrere Nummern zu groß. Eventuell war es eine Männerhose. Eine Hose für adipöse Männer. Nancy besah sich die drei Gürtel im Koffer: Es waren durchweg auffällige, glitzerige oder lederige breite Dinger. Kai hatte Gürtel sexy gefunden (vor allem ohne Hosen). Nancy löste die goldene Vorhangkordel vom Vorhang und fädelte sie durch die Schlaufen der Trainingshose. Dann zog sie die Turnschuhe an, die ebenfalls vom Discounter stammten – sie waren grün und passten also immerhin zum Frosch. Und schließlich verließ sie mit einem resignierten Seufzen das Zimmer.
Sie fand Mr. Widow im unteren Stockwerk in der Küche, wo er eben dabei war, umständlich die Tür zu einer Art Veranda zu schließen.
Nancy half ihm, und er ließ sich auf einen Küchenstuhl sinken.
»Es wird verdammt noch mal alles nicht leichter«, murmelte Mr. Widow. »Dieser Stock ist einem dauernd im Weg. Und das Bein … und der Rücken … Sie sehen ein Wrack vor sich. Ich kann Ihnen ein Frühstück anbieten, mit Speck und Eiern und frischem Kaffee und gebutterten Scones. Wenn Sie es machen.«
Eine halbe Stunde später saßen Nancy, Mr. Widow und an die dreißig Katzen in der Küche und frühstückten – Speck und Eier und frischen Kaffee und gebutterte Scones. Wobei es sich bei Scones um eine Art nach nichts schmeckender, stählerner kleiner Brötchen handelte, die Mr. Widow selbst gebacken hatte (Nancy fragte sich, wann. Letzte Woche? Letztes Jahr?) und die Nancy nur aufschnitt. Alles andere hatte sie gemacht, während Mr. Widow auf seinem Stuhl gesessen und sie dirigiert hatte.
Er blühte sichtlich auf, während er dirigierte. Im dritten Fach von unten ist der Speck … nein, nicht dahin die Teller für die Katzen! Vier müssen auf den Tisch, einer auf den Schrank, für die Königin von Saba, der Rest auf den Fußboden … Die kleineren Katzen bekommen keinen Milchkaffee! Da hinten, die große grüne Schale ist für den blinden Timothy, die findet er am ehesten.
Am Ende saß der blinde Timothy, ein großer schwarzer Koloss, in seiner Futterschüssel, acht statt vier Katzen wollten auf dem Tisch frühstücken, und die Speckpackung wanderte ganz alleine durchs Wohnzimmer, assistiert nur von den vier Beinen und dem fleißigen Maul eines hellgelben Kätzchens mit eingeknicktem Ohr. Mr. Widow fütterte die Katzenbabys mit Milch, den Korb auf dem Schoß haltend, während die Tibbytigerin zum Ausgleich auf den noch nicht gespiegelten Eiern auf der Anrichte saß, besessen von ihrem Wunsch, zu brüten.
Nancy fühlte sich etwas erschöpft, als sie ihren eigenen Milchkaffee trank. Es war nicht sehr viel Milch darin, für die Menschen war nur wenig übrig geblieben.
Mr. Widow würde einkaufen müssen.
»Wozu sind eigentlich die Fische draußen im Baum?«, erkundigte sie sich.
»Oh, das ist das Fitnessprogramm für den fetten Fridolin.« Mr. Widow lächelte. »Er liebt nichts so sehr wie Sardinen, und damit er sich bewegt, habe ich sie in den Baum gebunden. Sonst liegt er nur den ganzen Tag auf dem Teppich und döst, und der Arzt hat gesagt, er braucht Sport. Senkt die Blutfettwerte.«
»Mens sana in katzore sano«, murmelte Nancy so leise, dass Mr. Widow es nicht hörte.
Er glättete seine Weste, heute eine taubenblau gemusterte, entfernte ein wenig Ei und eine sehr kleine Katze aus seiner Krawatte und nickte zu dem Frosch auf Nancys Bauch hin. »Hübsches T-Shirt übrigens. Ich bin nicht auf dem Laufenden, was die heutige Mode angeht. Möchten Sie noch Orangenmarmelade?«
»Nein, danke«, sagte Nancy, da die Orangenmarmelade genauso ungenießbar war wie die Scones (allerdings bitterer). Sie nahm das große durchsichtige Glas mit dem Müsli und füllte ihre Schüssel zum zweiten Mal, um es mit Joghurt zu verrühren. Es war kein richtiges Müsli, sondern irgendeine Sorte von Kleinstgebäck in Blumenform, aber es schmeckte ähnlich wie das Gesundheitsmüsli, das Kai so geliebt hatte. Müsli zum Frühstück war ein Stück Gewohnheit. Niemand kann ganz ohne Gewohnheiten leben.
»Wohin reisen Sie als Nächstes?«, fragte Mr. Widow.
»Ich … habe mich noch nicht entschieden«, antwortete Nancy ausweichend. »Vielleicht sollte ich in der Stadt bleiben, bis sich die Sache mit der neuen Kreditkarte geklärt hat. An irgendeine Adresse müssen sie die ja schicken.«
Mr. Widow nickte und musterte sie nachdenklich durch seine randlose Brille.
Sie fragte sich, ob er ahnte, dass die Weltreise eine Lüge war.
Nach einer Weile griff er hinter sich, wo der Kühlschrank stand, und pflückte ein Stück Zeitung ab, das mit einem Magneten daran befestigt gewesen war. Er legte die Zeitung vor Nancy. Es war eine Seite mit Inseraten, und Mr. Widow hatte einen roten Kringel um eines davon gemacht.
Nancy las:
Suche Haushaltshilfe für Haushalt mit 40 Katzen,
Nichtraucher, 24 Stunden, 7 Tage.
Schönes Gästezimmer mit Bad vorhanden, 7 qm.
Wg. körperlicher Beeinträchtigung Hilfe rund um die Uhr eventuell erforderlich.
Gute Bezahlung.
Darunter standen Mr. Widows Name und eine Telefonnummer.
»Es hat sich niemand gemeldet, was?«, fragte Nancy und sah auf.
»Nein«, sagte Mr. Widow. »Seit einem halben Jahr nicht. Der Text steht jede Woche einmal in der Zeitung.«
»Vielleicht liegt es daran, dass es klingt, als wären die Katzen behindert«, sagte Nancy.
»Hm«, sagte Mr. Widow.
»Und die sieben Quadratmeter sind gelogen.«
»Nein. Nicht, wenn man den Stauraum unter dem Bett und die Fläche auf dem Bett einzeln zählt.«
»Vierundzwanzig Stunden, sieben Tage«, murmelte Nancy.
»Hm«, sagte Mr. Widow wieder. Eine der Katzen, eine hellgraue, nahm gerade auf seinem Kopf Platz. Mr. Widow schob ihren Schwanz beiseite, der ihm vor die Augen hing. »Wir gehen jetzt nicht raus, Pelzmütze! Später. Sie tut das immer, wissen Sie«, erklärte er. »Könnten Sie sie wegnehmen, bitte?«
Nancy lächelte, stand auf und nahm die Katze, die eingeschlafen war und schlaff in ihren Armen hin. »Wohin …?«
Mr. Widow zeigte auf ein Regalbrett neben der Tür. »Auf die Hutablage natürlich«, sagte er. »Also … was sagen Sie? Für eine Woche? Bis Ihre Kreditkarte kommt? Diese Adresse ist so gut wie irgendeine andere, um Kreditkarten dort hinzuschicken.«
»Bieten Sie mir gerade einen Job an?«, fragte Nancy.
»Hm«, sagte Mr. Widow zum dritten Mal.
Nancy schwieg einen Moment. In ihrem Herzen zersprang ein kleines glückliches Feuerwerk. Ja, sagte jemand dort, das ist es. Genau das. Du bleibst einfach eine Weile hier, bis du dir darüber im Klaren bist, was du tun wirst … Hier wird dich niemand finden. Es wird anstrengend, es wird stressig, du wirst wenig Privatsphäre haben, und möglicherweise ist der alte Mann verrückt, aber sie werden dich nicht finden.
Und du brauchst das Geld.
Dringend.
Glaub nicht, du kannst die Chefin hier werden, sagte die Königin von Saba vom Küchenschrank aus, wo sie über allen anderen thronte. Nancy sah zu ihr empor und schüttelte leicht den Kopf. Natürlich nicht. Ich bleibe auch nicht für ewig. Eine Woche, vielleicht zwei. Dann bist du mich wieder los.
Wollen wir hoffen, dass du dein Wort hältst, sagte die Königin lautlos. Sonst werde ich persönlich dafür sorgen, dass du durch die Hölle gehst. Vergiss nicht: Ich weiß, wer du bist. Wer du warst. Woher du kommst. Und was du getan hast.
»Warum glauben Sie, dass ich für den Job geeignet bin?«, fragte Nancy.
»Weil Sie mit den Katzen umgehen können«, sagte Mr. Widow. »Die kleine Braune, die auf ihrer Schulter sitzt, hat sich in Sie verliebt.«
Nancy hatte nicht einmal gemerkt, dass die Braune auf ihrer Schulter saß. Schuldbewusst streichelte sie sie. Sie sah aus wie Milchkaffee auf vier Pfoten.
»Sie heißt Milchkaffee auf vier Pfoten«, sagte Mr. Widow. »Aber wir nennen Sie nur Latte … Was ich sagen wollte, ist, Sie passen einfach zu den Katzen.« Er nickte zu Nancys leerer Müslischale hin: »Immerhin haben Sie zum Frühstück zwei Schüsseln Katzenfutter mit Joghurt gegessen.«
So kam es, dass Nancy an jenem Tag neben Mr. Widow im Garten stand und dabei zusah, wie er einen Einkaufszettel schrieb. In der Hand hielt sie eine Plastiktüte mit dem Inhalt ihres Koffers. Sie würde die Kleider auf dem Weg zum Einkaufen irgendwo unauffällig entsorgen, nur den zu dünnen, zu kurzen schwarzen Mantel, ein Relikt aus ihrer Vergangenheit, musste sie noch eine Weile behalten. Beim Discounter hatte es keine Mäntel gegeben. Vielleicht konnte sie den Mantel heute verlieren und Mr. Widow bitten, ihr eine Jacke zu leihen … oder das Fell einer Katze borgen, die es gerade nicht brauchte …
Mr. Widow benutzte als Unterlage für den Einkaufszettel das Ding, das aussah wie ein Grabstein. Darauf stand: IN EWIGEM GEDENKEN AN MEINE GELIEBTE ANGELIKA (2.4.1947–29.2.1990), und offenbar war es ein Grabstein.
»Warum«, fragte Nancy nach einer Weile, »schreiben Sie den Einkaufszettel im Garten? Wäre es drinnen am Tisch nicht bequemer?«
»Schon«, sagte Mr. Widow mit einem Seufzen und fuhr sich durch das schüttere silbergraue Haar. »Aber es ist nun mal so, dass ich mich ohne Angelika schlecht auf Einkaufslisten konzentrieren kann. Früher hat sie die Listen gemacht, wenn Sie verstehen. Wenn ich hier draußen schreibe, habe ich das Gefühl, sie würde mir über die Schulter sehen und verbessern, was ich schreibe.«
»Das ist … gruselig«, sagte Nancy.
Mr. Widow nickte. »Ja. Und deshalb gebe ich mir besonders viel Mühe, nichts zu vergessen.«
Er reichte ihr den Zettel, und sie sah ihn eine Weile an. Seine Frau, dachte sie, hätte überhaupt keine Chance gehabt, ihm über die Schulter zu sehen und irgendetwas zu verbessern. Mr. Widows Schrift war winzig und komplett unleserlich. Sie glich einer hübschen, altmodischen Borte an Gardinen.
Er sah, wie sie sich abmühte, und seufzte.
»Ja, ja, Sie können das nicht lesen«, knurrte er. »Ich weiß schon. Die Leute heutzutage lesen nur noch Computerschrift. Geben Sie schon her, ich lese vor, Sie können es noch mal notieren.« Er schob Nancy einen zweiten Zettel und seinen Stift hin. »Zwanzig Liter Milch, ein ganzer Schinken, sieben Packungen Eier …«
Sie schrieb eifrig mit, und jetzt hatte sie das Gefühl, die verstorbene Angelika sähe ihr über die Schulter.
»Ach, und vor den Einkäufen wäre noch eine Katze abzuliefern«, sagte Mr. Widow. »Am besten schreiben Sie die Adresse auf. Neumannstraße zwanzig, Bushaltestelle ehemalige Frohsinnstraße, es ist nicht schwer zu finden.«
»Moment«, sagte Nancy. »Ich liefere eine Katze ab?«
»Oh, ich dachte, wenn Sie schon unterwegs sind …«, sagte Mr. Widow leichthin. »Ich meine, ich weiß, das sollte nicht Teil Ihres Jobs als Haushaltshilfe sein, aber … eine Kundin von mir hat gestern noch spät angerufen, sie hat einen Anfall von Rheumatismus und kann das Haus nicht verlassen. Heute ist Dienstag, und dienstags leiht sie immer für vier Stunden eine Katze aus. Es ist eine sehr alte Dame, und Sie wissen ja, wie alte Leute sind. Abhängig von Gewohnheiten.«
»Ich … bringe ihr eine Katze vorbei? Wie? In einem Katzenkorb mit Luftlöchern?«
Mr. Widow warf ihr einen entsetzten Blick zu. »Um Gottes willen, nein! Möchten Sie in einem Ding transportiert werden, in dem Sie sich gerade einmal umdrehen können?«
»Na ja«, murmelte Nancy, »ich möchte vielleicht nicht darin transportiert werden, aber ich habe in so einem Ding geduscht …«
»Sie bringen die Katze einfach so bei der Dame vorbei, wie man ein Kind irgendwo vorbeibringen würde«, sagte Mr. Widow mit einem Anflug von Strenge in der Stimme, als verdächtige er Nancy, die Katze heimlich in einen Katzenkorb zu stecken, den sie in ihrem Koffer mitgebracht hatte.
»Der Ort, an den ich muss … ist nicht zu weit weg, oder?«, fragte Nancy. Sie war bereit, so ziemlich alles zu tun, um eine Weile bei Mr. Widow und seinen Katzen unterzutauchen. Alles, außer aufzutauchen.
»Ach, der Laden ist gleich an der nächsten Ecke«, sagte Mr. Widow zu ihrer Beruhigung. »Wirklich, nur die Straße rechts vom Haus runter, dann sind Sie da. Die Dame, die die Katze haben möchte, wohnt allerdings ein wenig weiter weg. Na, für Sie sollte das kein Problem sein, denke ich. Verglichen mit einer Weltreise.«
»Wo liegt denn diese … Neumannstraße?« Sie würde nicht quer durch die Stadt fahren, wo sie überall gesehen werden konnte. Zudem mit einer Katze im Arm, auffälliger ging es nicht. Nein, sie würde das nicht tun, auf gar keinen Fall.
»Ich gebe Ihnen einen Stadtplan mit. Es ist ganz leicht zu finden«, sagte Mr. Widow mit einem entwaffnenden Lächeln. »Sie müssen nur einmal quer durch die Stadt.«
Die Straße, an deren Ende der S-Bahnhof lag, war endlos. Sie lag nur fünf Minuten entfernt von der stillen Straße, in der Mr. Widow wohnte, und doch wie aus einer anderen Welt: lauter, schneller, voller.
Und so ungefähr alle Leute, die dort unterwegs waren, starrten Nancy an. Sie spürte ihre Blicke wie Brennnesseln auf nackter Haut. Irgendjemand hier würde sie erkennen. Irgendjemand hier wusste zufällig, wer sie war, und sagte es weiter, oder einer von ihnen war ihr, zufallsfrei, gestern Abend bis in diese Gegend gefolgt und folgte ihr noch immer, registrierte jeden ihrer Schritte.
Nein, sagte sie sich dann, dass die Leute sie anstarrten, lag lediglich an dem Frosch mit der Colaflasche auf dem Kopf, der unter ihrem zu dünnen Mantel hervorlugte, der einen schönen und schön kalten, viel zu weiten Ausschnitt hatte. Womöglich lag das mit dem Anstarren auch an der Tatsache, dass sie außer dem Frosch noch eine Katze trug, und zwar im Arm. Eine weiße Katze mit schwarzen Flecken und einer hübschen tiefrosa Nase. Sie hieß Kuh, und sie war die älteste Katze in Mr. Widows Sammlung. Mrs. Widow hatte sie damals noch gefunden, vor zwanzig Jahren, als winzig kleines Kälbchen. Verzeihung, Kätzchen.
Dass Kuh so alt war, war ein Vorteil, sie hing einfach auf Nancys Arm, froh, getragen zu werden und nicht selbst laufen zu müssen. Sie wünschte nur, die Leute würden aufhören zu starren.
Kurz vor der S-Bahn-Haltestelle duckte sie sich in einen winzigen Laden, der Tabak, Postkarten und Sonnenbrillen verkaufte, suchte die größte aus, ein verspiegeltes Monster, und bezahlte es mit dem letzten Kleingeld aus ihrem Portemonnaie. Dann suchte sie einen Mülleimer für das Portemonnaie – warum hatte sie das nicht gestern schon getan, als sie das Handy entsorgt hatte? Dieses angeblich gestohlene Portemonnaie mit dem angeblich gestohlenen Ausweis …
Sie warf einen letzten Blick auf die Person, die ihr von den Karten im Portemonnaie entgegenblickte: eine junge Frau mit roten Lippen, schulterlangen goldenen Locken und groß geschminkten Augen, Lidschatten, Mascara (keine Wimperntusche). Nur auf dem biometrischen Ausweisfoto war sie ungeschminkt, aber auch das sah Nancy Müller nicht im Geringsten ähnlich, da biometrische Fotos einem niemals ähnlich sahen.
Sie versenkte das Portemonnaie zwischen Bananenschalen, leeren Bierdosen und zusammengeknüllten Taschentüchern und atmete tief durch. Niemand aus ihrer alten Welt würde sie jetzt noch erkennen.
Und dann näherte sich jemand von hinten – und umarmte sie.
»Ich wusste, dass ich dich hier finde«, sagte die Stimme eines Mannes. »Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, einfach abzuhauen? Ich habe dich gestern den ganzen Tag gesucht.«
Wenn man auf Befehl ohnmächtig werden könnte. Wie Leute in Büchern und Filmen. Einfach umkippen. Aussteigen. Dem Rest der Welt das Handeln überlassen.
Nancy versuchte es. Sie hielt die Luft an und redete sich ein, dass ihr schwarz vor Augen wurde, aber es half nichts. Und da drehte sie sich um.
Der Umarmende ließ sie los, und sie blinzelte verwundert.
Vor ihr stand ein Mann, den sie noch nie gesehen hatte. Ein untersetzter Mann in einem braun-rot gemusterten Wollpullover, den er, dem Aussehen nach zu urteilen, möglicherweise selbst gestrickt hatte. Er hatte wirres, schütteres braunes Haar und blinzelte sie durch eine kleine runde Brille an.
Aber er hatte sie nicht umarmt.
Der, der das getan hatte, war ein großer grauer Wolfshund. Jetzt stellte er sich wieder auf die Hinterbeine, plazierte die Pfoten auf Nancys Schultern und leckte mit seiner riesigen Zunge einmal quer über ihr Gesicht.
»Lass das! Aus!«, rief der Mann. »Entschuldigen Sie. Er ist manchmal etwas stürmisch.«
Nancy wischte sich die Hundespucke mit dem Ärmel von der Wange und merkte, dass sie zitterte. Der Mann nahm den Hund an die Leine. Dann warf er einen Blick auf die Katze.
»Das erklärt es natürlich.«
»Das ist Kuh«, murmelte Nancy und sah zu der Katze, die unbeeindruckt auf ihrem Arm hing. Möglicherweise war sie blind und schwerhörig und hatte den Hund gar nicht bemerkt.
»Kuh«, wiederholte der Mann. »Sieht aber aus wie eine Katze.«
»Ich … warum haben Sie gesagt, Sie hätten mich den ganzen Tag gesucht?«, fragte Nancy, ihre Stimme plötzlich seltsam heiser. »Ich … kenne Sie überhaupt nicht.«
»Ich meinte den Hund.« Er grinste. »Er ist mir gestern entwischt. Wären Sie denn gerne den ganzen Tag gesucht worden?«
»Nein«, erwiderte sie, vielleicht etwas zu rasch. »Aber es gibt auch keinen Grund, mich zu suchen. Für niemanden. Ich bin nur eine ganz normale, langweilige Person, die nie etwas erlebt und die … Also ich meine, es lohnt sich nicht. Jemand, der mich findet, würde sich zu Tode langweilen.«
»Es ist nett, dass Sie mich davor warnen wollen, Sie zu suchen«, sagte der Mann etwas verwirrt. »Aber ich hatte es eigentlich gar nicht vor.«
Er nickte noch einmal freundlich, drehte sich um und verschwand, samt Hund, die Straße entlang. Die Katze namens Kuh drehte sich in Nancys Arm und sah zu ihr empor. In ihren doch nicht so blinden Augen stand eindeutig die Frage geschrieben, ob Nancy noch richtig tickte.
»Okay, okay«, murmelte Nancy. »Das war ein … irgendwie komisches Gespräch. Aber ich bin nervös. Das musst du doch verstehen. Ich meine, er hatte einen Hund!«
Ach, dieses große graue Ding?, fragten die Augen der Katze angeekelt. Ich dachte, es wäre ein Wildschwein oder irgend so was, was aus dem Zoo entlaufen ist. Da vorne ist die S-Bahn. Steigen wir da heute noch ein? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, auf deinem Arm herumzuhängen.
In der S-Bahn waren verdammt viele Menschen. Es war, als hätten sie sich alle verabredet, an diesem speziellen Tag S-Bahn zu fahren und Nancy zu beobachten.
Sie fand einen Sitzplatz, was an ein Wunder grenzte, und eigentlich wollte sie stehen bleiben, um fluchtfähiger und unauffälliger zu sein, aber ihre Arme wurden langsam lahm. Kuh hatte in ihrem langen Leben einige Pfunde angesammelt. So setzte Nancy sich, drapierte die Katze wie ein geflecktes Fell über ihre Knie und hielt die alte Zeitung, die auf dem Sitz gelegen hatte, halb vor ihr Gesicht, als wäre sie ganz darin versunken. Sie schloss die Augen und sah die junge Frau vor sich, die auf ihrer Krankenversicherungskarte abgebildet war, die nun im Müll lag. Sie sah, wie diese junge Frau in der S-Bahn stand, die rot nachgezogenen Lippen lächelten, das figurbetonte, kurze schwarze Kleid fiel am Saum in perfekten Falten um ihre Oberschenkel, sie warf den Kopf mit den goldblonden Locken zurück und lachte das leise, zufriedene Lachen einer schnurrenden Tigerin. An ihrer Seite stand ein gutaussehender Mann, groß, schlank, durchtrainiert, teure Lederjacke, teure Uhr. Da waren noch zwei, drei andere Männer, Männer, die sie hofierten. Und dann stieg sie aus, alleine. Die Männer sahen ihr nach, sie wussten, sie würde anrufen, wenn sie auf den Plan treten mussten. Natürlich waren sie meistens eher Auto gefahren, die verschiedensten Autos.
Das letzte war weiß gewesen. Ein weißer Mercedes mit beigefarbenen Sitzen. Nancy hatte es gemocht, es hatte etwas so … Sauberes an sich gehabt. Vielleicht hatte sie gehofft, dass Kai sich änderte. Dass alles sich änderte. Aber es war dumm gewesen, das zu glauben, nur weil jemand ein spießiges weißes Auto kaufte.
»Sag mal«, fragte eine Kinderstimme neben ihr. »Warum liest du die Zeitung eigentlich verkehrtrum?«
Nancy fuhr zusammen und öffnete die Augen. Die Stimme gehörte einem übergewichtigen Mädchen mit einer Colaflasche in einer und einem glupschäugigen lila Plüschhorror in der anderen Hand.
»Ich … das ist … ich mache das immer so«, sagte sie. »Ich übe, auf dem Kopf zu lesen.«
»Aber du stehst doch gar nicht auf dem Kopf«, sagte das Mädchen und gurgelte mit einem Schluck Cola.
»Ich nicht, aber die Colaflasche«, sagte Nancy und stand auf. Zum Glück war die nächste Haltestelle ihre.
»Häh?«, machte das Mädchen.
»Sie steht auf dem Kopf von dem Frosch«, erklärte Nancy. »Auf meinem T-Shirt.«
Dann nahm sie die Katze Kuh und machte, dass sie aus der S-Bahn kam. Sie musste aufhören, mit fremden Leuten unsinnige Gespräche zu führen. Sie hatte das früher nie getan, es war wie ein Virus, der sie gepackt hatte, seit sie in die Mülltonne gestiegen war, um dem Winterwind zu entkommen.
Die Person mit den goldenen Haaren und den roten Lippen hatte immer zu allen Leuten die richtigen Dinge gesagt. Die Dinge, die Kai von ihr erwartete.
Die alte Dame, zu der sie Kuh brachte, Frau von Siegen, lebte im fünfzehnten Stockwerk eines Bauwerks mit polierter Vorderfront, einer Überwachungskamera und drei lebensgroßen Topfpalmen im Eingangsbereich. Nancy fragte sich, ob die Kamera die Topfpalmen bewachte, die sonst entlaufen wären, denn sie war genau auf diese gerichtet. Oder vielleicht versteckten sich Einbrecher überdurchschnittlich oft in den Palmen.
Sie war schon in solchen Gebäuden gewesen, mehr als einmal. Die schnurrende Tigerin in Schwarz hätte ihre hochhackigen Schuhe ausgezogen, wäre auf irgendetwas Greifbares geklettert und hätte von der Seite her einen Kaugummi vor die Kameralinse geklebt.
Doch sie war Nancy Müller. Sie lächelte die Kamera an wie ein Schulmädchen, adjustierte ihre Frisur vor dem spähenden Auge wie vor einem Spiegel und streichelte die Katze, noch immer lächelnd.
Dann betrat sie den gläsernen Fahrstuhl.
Eispalast. Das war das Wort, das sie dachte, während sie lautlos nach oben glitt, dies ist ein Eispalast. Einer von vielen in dieser Stadt, einer von vielen auf dem Globus. Ein Palast aus Kälte und Sterilität, in dem man in perfekter Sicherheit lebt, in dem alle Flächen abwaschbar sind wie das Leben und das Geld, das die Menschen in den Eispalästen in siebenstelligen Summen verdienen.
»Es wäre wunderbar«, flüsterte sie, »so viel Geld zu haben.« Sie flüsterte, weil vielleicht eine weitere Kamera sie filmte, sie aufnahm, sie dokumentierte. »Aber was, wenn man erfriert?«
Die Katze Kuh hatte ihr Fell aufgeplustert wie ein Spatz sein Gefieder. Katzen erfrieren nicht, sagte ihr Schnurren.
Ja, dies war ein Eispalast, und die alte Dame, die die Tür öffnete, war selbstverständlich die Eiskönigin, nein, eine Kaiserin – eine Kaiserin aus Schnee. Ihr Haar war schneeweiß und schäumte in einer komplizierten Dauerwelle über ihren Kopf, an den Schläfen zurückgehalten mit dezenten silbernen Spangen, auf denen winzige Diamanten glitzerten, ihr Gesicht perfekt und genauso dezent geschminkt, ihr Körper eine schlanke, fast jugendliche Silhouette vor der leichten Helligkeit im Hintergrund der Wohnung. Nancy schluckte trotz ihrer Erwartungen. Nie hatte sie eine so würdevolle, so schöne Frau gesehen. Auch wenn sie offensichtlich weit über achtzig war.
»Oh«, sagte die alte Dame überrascht, und der Laut wirkte aus ihrem Mund wie das Zitat eines Dichters. Wohlklingend, ausgefeilt. »Sie bringen die Katze. Das ist nett. Arbeiten Sie neuerdings bei Mr. Widow? Kommen Sie doch herein.«
Nancy folgte der Schneekaiserin. Sie bewegte sich sehr langsam, man sah, dass sie Schmerzen hatte: Das Rheuma, das Mr. Widow erwähnt hatte. Doch ihre Langsamkeit und ihre Schmerzen ließen ihre Würde nur noch wachsen. Das Wohnzimmer, in das sie Nancy führte, war so groß wie ein mittlerer Tennisplatz. An den Wänden hing Kunst: Zeichnungen und Skizzen offenbar berühmter Künstler, schwarzweiß, kleinformatig, irgendwie edel. Auf dem Beistelltischchen waren Winterrosen in einer Vase drapiert, vollendete zartrosa Blüten mit geschwungenen Blättern. Nancy hätte schwören können, sie wären gefroren.
Die Wand gegenüber der Wohnzimmertür war komplett aus Glas wie der Fahrstuhl, und darunter breitete sich die Stadt aus, als besäße die Schneekaiserin sie ganz allein. Vor der Glaswand stand ein überdimensionales weißes Sofa. Darauf setzte sich die alte Dame jetzt, vorsichtig, auch das Setzen geschah in Zeitlupe. Sie schloss kurz die Augen, in einer stillen Kommunikation mit ihren schmerzenden Gelenken, nahm dann das Buch, das auf dem Sofa gelegen hatte, und schlug es auf.
»Und Sie sind …?«, fragte sie.
»Nancy. Nancy Müller.« Der Name klang dumm und gewöhnlich, wie ein Fleck auf dem makellos weißen Plüschteppich. Nancy setzte die Katze Kuh ab, die sofort aufs Sofa sprang. »Gabriele von Siegen«, sagte die Schneekaiserin. »Aber das wissen Sie ja von Mr. Widow.« Sie streckte ihre blasse, hagere Hand aus, und Nancy schüttelte sie vorsichtig.
»Wozu brauchen Sie denn die Katze?«
Die alte Dame streichelte Kuh, die zu schnurren begann und sich auf dem riesigen Sofa ausstreckte. Als wäre sie eine unendlich lange Katze; eine Katze, die immer länger werden konnte wie das Tuch, das der Zauberer aus dem Ärmel zieht.
»Ich lese ihr vor«, sagte die Schneekönigin. »Im Moment sind wir bei Wind in den Weiden.«
»Ach«, sagte Nancy.
»Sie werden denken, dass ich alles habe, was irgendjemand brauchen könnte«, sagte die alte Dame leise. »Aber ich habe niemanden, dem ich vorlesen kann. Früher hatte ich jemanden. Wir borgten uns Bücher in der Leihbücherei, jede zweite Woche ein neues, und ich las ihm vor, bis er mit dem Kopf in meinem Schoß einschlief …« Ihr Blick glitt durch Nancy hindurch in die Vergangenheit, während ihre Finger das Fell der Katze streichelten. »Ich streichelte sein Haar«, fuhr sie fort, »bis ich ebenfalls einschlief. Und wir träumten die Geschichten weiter, jeder auf seine Art.« Sie zuckte die Schultern und sog die Luft scharf ein, auch das Schulterzucken bereitete ihr Schmerzen. »Reich geheiratet und geerbt habe ich erst später.«