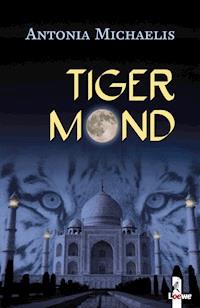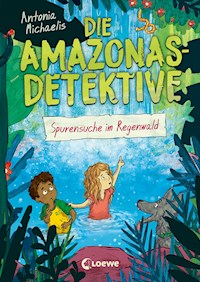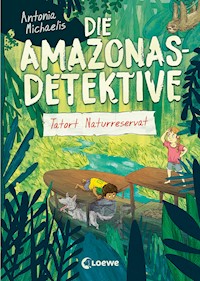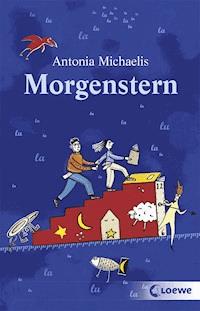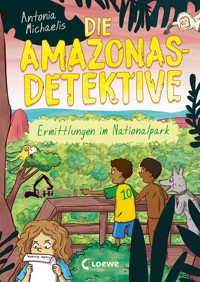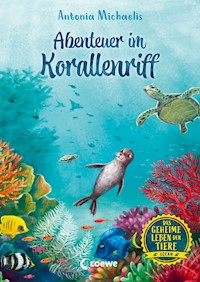Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In einer hellen Mondnacht steht in der kleinen Wohnung über dem Museum plötzlich die Schöne Gärtnerin vor Lucinda und erzählt ihr, dass sie aus ihrem Bild gestiegen sei, um ihre verschollene Schwester zu suchen. Lucinda glaubt, sie träumt. Doch sie träumt nicht: und so machen sich die beiden auf eine abenteuerliche Suche quer durch Europa. Schon bald gesellt sich ein merkwürdiger blinder Junge namens Mike zu ihnen. Und noch jemand hat sich an ihre Fersen geheftet: eine seltsame Frau, die vor nichts zurückzuschrecken scheint, um vor ihnen am Ziel zu sein. Literaturhaus Wien: Jury der Jungen Leser - Auswahlliste 2003
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Die Erschaffung der Eva
Beim ersten klaren Wort
Die ganze Stadt
Ein bisschen Ruhe
Die Hexe
Gemälde für junge Leute
Die Versuchung des heiligen Antonius
Die Phasen der Nacht
Das Farbenfloß der Medusa
Ein sehr sanftes Erdbeben
Die Rückkehr der Schönen Gärtnerin, 1967
Die Erschaffung der Eva
s war ja ganz leicht!
Man brauchte bloß das eine Bein auszustrecken, dann das andere … Man hatte es vermutlich schon immer gekonnt. Man hatte nur noch nie zuvor daran gedacht.
Zielstrebig züngelnd sah sie die Flammen auf sich zukommen gleich gierigen gelben Glutfingern mit rastlosen roten Rändern. Sie leckten bereits an ihrem Fuß.
Mit einem Aufschrei zog sie ihn zurück. Sie musste schnell machen, schnell … Keine Zeit verlieren! Dem Feuer ausweichen, hierhin und dorthin schlüpfen, zwischen den Brettern und den Ballen alter Leinwand hindurch …
Und endlich, endlich tat sie den letzten Sprung ins feuchte, dunkle Gras. Sie keuchte, und ihre Füße waren nass. Noch nie in ihrem Leben hatte sie gekeucht, und noch nie waren ihre Füße nass gewesen. Was für eine merkwürdige Erfahrung!
Sie konnte auch fühlen, dass sie an manchen Stellen beschädigt war. Das Feuer hatte sie nicht ganz ungeschoren davonkommen lassen. Bei Tage würde sie es sich ansehen.
Denn jetzt, jetzt war Nacht. Sie legte ihren Kopf in den Nacken und sah empor in einen Himmel voller Sterne. Die Gluttropfen, die das Feuer spie, gesellten sich zu ihnen. Der Himmel war ein Himmel über Paris, und das Feuer brannte in einem Garten in Paris, und die Gestalt, die reglos dort stand, war ein Kind dieser Stadt.
Tief atmete sie die Pariser Luft ein, eine Luft übervoll von Kunst und Licht und Leben wie die Luft anderer Orte mit den Sporen von Pilzen.
Und sie spürte, wie die Wut in ihr aufstieg. Er hätte sie also verbrennen lassen! Er hätte zugesehen, wie die Flammen sie fraßen. Was für ein Künstler war er, dass er ihre Schönheit nicht erkannte? Sie einfach fortwarf? Womöglich stand er noch immer oben am Fenster, Max Ernst, mit ihr, mit der anderen. Eva.
Sie erhob ihre kleine Faust gegen sie und sprach einen lautlosen Fluch.
Noch war sie schwach und unerfahren, sie wusste kaum, wie man die Füße voreinander setzt, und gewiss nicht, wie man sich rächt. Aber die Zeit würde kommen. Sie würde lernen, böse zu sein.
(1923)
Zunächst schien alles ganz gewöhnlich.
In der kleinen Wohnung über dem Museum wölbte sich blaues Licht auf den Teppichrändern. Auf Lucindas Schreibtisch lag eine Nachricht von Peter. Sie war bestimmt von Peter, denn er schrieb seine Nachrichten immer auf die Rückseiten von Kunstpostkarten. Wenn man Museumsdirektor ist, kann man seiner Tochter ruhig ab und zu Nachrichten auf Kunstpostkarten schreiben.
Lucinda streifte die Sandalen ab und kletterte auf den Schreibtisch, um den blauen Vorhang zurückzuschieben und das Fenster zu öffnen. Eine Hitzewelle schlug ihr entgegen. Draußen atmete Berlin den Beginn der Sommerferien ein und aus.
Die anderen saßen jetzt irgendwo in einem Eiscafé, und in den nächsten Tagen würden sie in kleinen Cliquen zusammen wegfahren. Ans Meer vielleicht. Abends würden sie in eine Menge Kneipen und Discos gehen und eine Menge Bier trinken …
Lucinda würde mit niemandem wegfahren. Sie würde Peters Nachricht lesen, ihr unscheinbares mausbraunes Haar kämmen und anschließend hinunter ins Museum gehen und ein wenig mit den Bildern sprechen. Wenn die anderen wüssten, dass sie mit Bildern sprach, dachte sie, würden sie sie für noch bescheuerter halten, als sie es ohnehin schon taten.
„Aber andererseits“, flüsterte Lucinda dem blauen Vorhang zu, der sich im Windhauch bewegte, „andererseits spreche ich vielleicht nur mit den Bildern, weil die anderen mich für bescheuert halten.“
Unten, auf der kleinen Straße, in der das Museum lag, ging eine Frau in heller Wildlederjacke und -hose vorbei. Lucinda schüttelte den Kopf. Wie konnte jemand bei dieser Hitze in Leder herumlaufen? Das lange, schwarze Haar floss an der Gestalt hinunter wie ein Wasserfall, und sie war so zierlich und so perfekt, dass Lucinda ihr einen Moment lang nachstarrte. Die Frau verlangsamte ihre Schritte und sah sich um. Suchte sie den Eingang zum Museum? Sollte Lucinda rufen? Denn wozu sonst käme ein Mensch in diese schmale, unscheinbare Seitenstraße?
„Unser Leben“, wisperte Lucinda in die Vorhangfalten, „ist auch eine Seitenstraße. Meins und das von Peter …“
Der Vorhang schüttelte sich.
„Du hast Recht: Wie pathetisch!“, sagte Lucinda, „Ja, das finde ich auch.“
Als sie wieder hinunter auf die Straße sah, war die schöne Fremde verschwunden.
Wie gesagt – bis dahin erschien alles ganz gewöhnlich. Aber dann drehte Lucinda die Karte um und las Peters Botschaft.
Und da hörten die Dinge auf, gewöhnlich zu sein.
Sie ist weg, stand auf der Rückseite der Karte.
Bitte komm herunter, Lucy. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Wer war weg?
Neben der einen, einzelnen Karte lag ein ganzer Abreißblock anderer Postkarten. Peter hatte vergessen, ihn wieder mitzunehmen.
Max Ernst, las Lucinda. Alle von Max Ernst. Sie drehte die Karte mit der Botschaft um und betrachtete das Bild darauf, während sie in ihre Sandalen schlüpfte.
Sie kannte dieses Bild. Es hing unten im Museum, eine Leihgabe, und gestern noch hatte sie mit der Frau darauf gesprochen. Nicht, dass die Frau geantwortet hätte …
Lucinda befand sich bereits auf der schmalen Treppe, die hinunter zum Museum führte, als sie merkte: Mit dem Bild auf der Karte stimmte etwas nicht. Nicht nur dass dieses hier schwarz-weiß war. Die Frauengestalt darauf sah auch ganz anders aus. Und es gab eine Landschaft im Hintergrund. Auf dem Bild im Museum gab es keine.
Verwirrt steckte Lucinda die Postkarte in ihre Hemdtasche und öffnete vorsichtig die Tür, die die Wohnung mit dem Museum verband.
„Eine Geheimtür“, hatte Peter immer gesagt, als Lucinda noch klein gewesen war. „Verrate sie niemandem. Falls wir einmal vor einem Ungeheuer fliehen müssen.“ Sie lächelte – doch nur eine Sekunde lang. Dann gerann das Lächeln auf ihrem Gesicht.
Normalerweise war das Museum an Wochentagen so gut wie leer. Aber jetzt war es mit einem Mal voll, voller Polizeibeamter in Uniformen. Sie schienen aus jeder Ritze zwischen den Bilderrahmen hervorzuquellen, sie krochen auf dem Boden herum und tasteten die Wände ab und klopften an den kleinen grauen Kästen der Alarmanlage herum. Lucinda machte auch zwei große Hunde aus und presste sich dicht an die Wand. Sie mochte keine Hunde. Sie mochte keine Hunde und keine großen Straßen und keine Polizisten und keine Lehrer. Und keine Bahnhöfe und keine hohen Häuser und …
Bisher waren das Museum und die Wohnung die einzigen sicheren Orte gewesen. Offenbar hatte sich das schlagartig geändert.
Sie musste herausfinden, was hier los war. Sie musste Peter finden.
Möglichst lautlos stieß sie sich von der Wand ab und schlich zwischen den Polizisten hindurch. Wenn sie sich nur still genug verhielt, bemerkte vielleicht niemand sie. Vor allem hoffentlich kein Hund.
„Aber hallo!“, rief da jemand direkt neben ihr und packte sie am Arm. „Was tut denn das Mädchen hier?“
Lucinda machte sich klein vor der lauten Stimme.
„Ich … ich …“, stotterte sie und spürte, wie das Blut ihr ins Gesicht schoss, als er ihren Blick suchte. Jemand aus ihrer Klasse hatte einmal gesagt, das Grau von Lucindas Augen wäre so unauffällig, dass man Angst bekommen konnte, unsichtbar zu werden, wenn sie einen damit zu lange ansah. Sie blickte auf ihre Füße hinunter. Warum dachte sie jetzt über ihre Augen nach? Und warum konnte sie vernünftige Dinge nur zu den Bildern sagen?
„Ich wollte nur –“
„Hier ist jetzt geschlossen“, dröhnte der Polizist unter einem Schnauzbart hervor. Lucinda fand, er sah auch ein bisschen aus wie ein Hund. Sie hätte ihn gerne gefragt, ob er keinen Maulkorb tragen müsste …
„Es steht doch groß und deutlich draußen dran, dass das Museum geschlossen ist …“, fuhr der Hunde-Beamte fort. „Kannst du nicht lesen, Mädchen?“
„Mein Vater …“, flüsterte sie. „Ist ihm … ist ihm etwas zugestoßen? Wer … wer ist weg?“
Der Polizist schnaubte verwirrt. „Wie – wer ist weg? Willst du mich hochnehmen oder was?“
Lucinda schüttelte den Kopf und sah auf ihre Füße, neben denen die Füße des Polizisten groß und feindselig in ihren Stiefeln standen. Ein anderes Paar Stiefel gesellte sich dazu.
Jetzt verhaften sie mich, dachte Lucinda. Und gleichzeitig: Was für ein Unsinn! Warum sage ich nicht einfach, dass ich hier wohne? Nein, Peter musste es sagen. Peter musste kommen und ihnen alles erklären. Sie konnte es nicht. Sie hatte so was noch nie gekonnt. Aber – wenn Peter gar nicht mehr hier war? Wenn sie Peter mitgenommen hatten? Was konnte er getan haben, um all diese grünen Uniformen anzulocken?
„Lucinda!“, sagte jemand über ihr. „Da bist du ja! – Hören Sie, das ist meine Tochter. Ich hatte sie gebeten herzukom- men …“
Peter legte ihr eine Hand auf die Schulter, und da hob sie ihren Blick von den Stiefel-Füßen und sah in sein Gesicht.
„Was ist passiert?“, flüsterte sie.
„Komm“, sagte Peter. „Ich zeige es dir.“ Seine Brille war verrutscht, und sein lichtes Haar ragte in alle möglichen Richtungen. Der hellblaue Schlips unter seiner Weste hing auf halb acht.
Lucinda ließ sich von seiner großen Hand führen und fühlte sich wieder klein. Als sie jetzt zurückblickte, sah sie, dass es nur drei waren. Drei Polizisten. Und der Hund war auch nur einer. Wie kam es nur, dass alles immer so viel größer und mehr und bedrohlicher wurde, sobald sie allein war?
Vor einem großen Stück weißer Wand blieben sie stehen.
„Hier“, sagte Peter, „sieh dir das an!“
Zwei Fenster flankierten das Stück Wand rechts und links; von draußen fiel der grüne Sommerblätterschatten einer Eberesche herein und blieb unentschlossen auf dem Boden liegen. In der Mitte der weißen Wand aber hing ein Bild, ein einziges, großes Bild, wie ein drittes Fenster in eine merkwürdige, scheinbar schwerelose Welt.
Peter rückte seine Brille zurecht, zupfte nervös an dem schiefen Schlips herum und machte alles nur noch schlimmer. Er schüttelte den Kopf und zeigte auf das Bild.
„Das kann doch nicht sein, oder? Das … das ist doch nicht möglich! Wie …?“
Lucinda brauchte nicht hinzusehen, um zu wissen, vor welchem Bild sie standen. Das Museum war der einzige Ort auf der Welt, an dem sie blind jeden Weg gefunden hätte.
„Die Schöne Gärtnerin!“, flüsterte sie. „Die Rückkehr der Schönen Gärtnerin von Max Ernst.“
Und dann sah sie es. Und verstand.
Sie war fort.
Das also hatte die Botschaft auf der Postkarte bedeutet. Lucinda wollte Peter fragen, warum das Bild auf der Karte so anders aussah …
„Es muss heute Nacht geschehen sein“, sagte Peter da. Seine Stimme war ganz platt und eindimensional. „Aber wie? Und was soll diese Fälschung? Ich meine … es ist nicht mal eine richtige Fälschung. Es ist … als würde sich jemand über uns lustig machen.“
Lucinda nickte langsam. Das Bild, das dort an der Wand hing, hatte das richtige Format für die Schöne Gärtnerin. Es hatte den richtigen Farbton, ein leises Grau, und die Männerfigur im Hintergrund war so durchscheinend wie immer.
Er bestand nur aus Linien, der dort im Bild, wie ein Spinn-weben-Gebilde, wie ein Gedanke. Vielleicht ein Gedanke der Schönen Gärtnerin – ja, alles war genau wie immer.
Bis auf eine einzige Sache.
Die Gärtnerin fehlte.
Lucinda spürte, wie es heiß und kalt durch sie hindurchlief, eine verrückte Wasserleitung in ihren Eingeweiden.
„Bist du … bist du sicher, dass jemand das Original gestohlen hat?“, fragte sie.
Peter warf in verzweifelter Ratlosigkeit die Arme hoch. „Das ist es ja eben!“, rief er. „Niemand kann es gestohlen haben! Die Tür war abgeschlossen wie immer …“
Er ging zu der Reihe von Fenstern hinüber und stemmte beide Arme gegen eine der Scheiben, als wollte er sie in seiner Verzweiflung herausdrücken. Lucinda erschrak. Doch natürlich gab das dicke Glas nicht nach. Man konnte die Fenster nicht einmal öffnen, sie hatten keine Griffe.
„Siehst du?“, rief Peter. „Siehst du? Es ist unmöglich! Keine der Scheiben hat auch nur den kleinsten Kratzer.“
„Peter“, sagte Lucinda leise und legte ihm die Hand auf den Arm.
Hinter ihnen räusperte sich einer der Polizisten. „Entschuldigung, ich wollte nur sagen, unser Techniker hat das Alarmsystem überprüft. Scheint vollkommen intakt zu sein. Und der Hund findet auch nichts. Keine Spur, nichts.“
Sie waren alle drei herübergekommen. Lucinda trat noch einen Schritt näher an ihren Vater heran. Die Grünuniformierten standen ihnen jetzt gegenüber wie eine einheitliche Masse. Höflich, aber misstrauisch.
„Gibt es noch einen anderen Zugang zum Museum?“, fragte einer von ihnen.
Peter schüttelte den Kopf. Dann nickte er. „Einen, ja. Die Treppe zu unserer Wohnung.“
„Ist dir klar, was du damit gesagt hast?“, fragte Lucinda wenig später. Die Uniformen waren gegangen; der Hund auch.
Lucinda und ihr Vater saßen inmitten von Postkartenständern und bunten Kunstbänden im Museumsshop am Kassiertisch und tranken starken schwarzen Kaffee. „Wie – gesagt?“, wollte Peter wissen.
„Na, damit, dass es noch diesen anderen Ausgang gibt. Über unsere Wohnung.“ Sie sah in ihren Kaffee, wo ihr Spiegelbild blass auf den schwarzen Wellen schwamm. „Es bedeutet, dass es nur einer gewesen sein kann – du.“
Sie trank einen Schluck. „Oder ich.“
„So ein Unsinn“, brummte Peter. „Wieso?“ Er schüttelte den Kopf. Seit sie ins Museum hinuntergekommen war, hatte er ungefähr hundertmal den Kopf geschüttelt.
„Du meinst … Du meinst, das denken sie?“
„Halten Sie sich zur Verfügung“, murmelte sie. „Hat der eine nicht genau das gesagt?“
Sie sah die steilen Falten auf Peters Stirn, sah, wie er mit seinen hageren Händen die Kaffeetasse umklammerte, bis die Knöchel weiß hervortraten. Und plötzlich tat er ihr unendlich Leid. Peter war immer groß und stark gewesen für sie, und nun sah er mit einem Mal nur noch müde aus.
„Das Verrückte ist“, sagte er leise, „sie ist schon einmal verschwunden.“
Lucinda starrte ihn an. „Was?“
„Die Gärtnerin. Dies hier ist das zweite Bild. Max Ernst hat vorher schon eines gemalt.“
„Wurde das erste … auch … gestohlen?“ Das auch kam ihr verkehrt vor, als sie es sagte.
Peter schüttelte den Kopf. „Nein. Ich glaube, die Nazis haben es zerstört.“ Er rührte eine Weile schweigend in seinem Kaffee, und Lucinda dachte an Max Ernst, der ein zweites Bild gemalt hatte, nachdem ihm das erste weggenommen worden war.
„Die Versicherung …“, flüsterte Peter in seine Kaffeetasse. „Es liegt verdammt nahe, auf die Idee zu kommen, dass ich … Oh verflixt. Aber ich war es nicht! Du weißt das, Lucy, nicht wahr?“
Sie stand auf und ging zu ihm, um die Arme um seinen Hals zu legen. „Natürlich. Natürlich weiß ich das.“
Sie hätte es ihm sagen können. Aber er hätte es ja doch nicht geglaubt.
Später stand sie alleine vor dem seltsam leeren Bild und betrachtete es lange.
Nein, Peter hatte es nicht ausgetauscht, und auch niemand sonst. Denn es gab noch eine andere Möglichkeit. Eine Möglichkeit, an die noch keiner gedacht hatte – außer ihr. Lucinda streckte ihre Hand nach dem Rahmen aus und zog sie im letzten Moment zurück. Die Alarmanlage hätte sofort losgezetert – genauso, wie sie losgezetert hätte, wenn jemand das Bild in der Nacht gestohlen hätte. Aber sie brauchte es nicht zu berühren, um sich sicher zu sein: Dies war dasselbe Bild, das seit Anfang der Ausstellung im Museum hing. Die Rückkehr der Schönen Gärtnerin.
Nur die Schöne Gärtnerin, die war nicht mehr darauf.
Sie war hinausgestiegen. Lucinda kannte den Grund nicht, doch es gab keinen Zweifel. Die Frauengestalt mit dem knopfförmigen Kopf und der Taube in ihrem Schoß hatte das Bild verlassen.
Aber warum? Was brachte eine Frau dazu, von der Leinwand zu verschwinden, mit der sie seit Anbeginn ihrer Existenz verschmolzen war?
Erst als Lucinda wieder oben am Fenster stand und den Vorhangstoff zwischen ihren Fingern hindurchgleiten ließ, fiel es ihr ein. Es war wie ein Schlag.
„Ich war es“, sagte sie überrascht. „Ich habe mit ihr gesprochen.“ Am Abend zuvor war Lucinda ganz alleine im Museum gewesen, niemand hatte sie hören können – und da hatte sie die Schöne Gärtnerin gefragt, warum sie nicht zur Abwechslung einmal aus ihrem Bild herauskam.
Erstaunt machte sie einen Knoten in den Vorhang. „Aber das war doch nicht ernst gemeint! Ich hätte nie gedacht …“ Sie schüttelte den Kopf. Nein, das konnte es nicht alleine sein. Womöglich hatte sie die Gärtnerin auf die Idee gebracht, doch es musste irgendeinen Grund geben, aus dem sie ihrem Vorschlag gefolgt war. Man stieg nicht einfach so aus einem Bild.
Draußen lag träge der Nachmittag herum und gab keine Antworten.
Unten im Museum rumorte Peter.
Lucinda seufzte in den verknoteten Vorhang. Sie wusste genau, dass Peter das Bild suchte. Und er wusste bestimmt genau, dass er es nicht finden würde. Sie hatte gesehen, wie er die Regale im Museumsshop beiseite geschoben und in die Mülltonnen vor dem Haus gelugt hatte …
„Armer Peter“, flüsterte sie. „Wenn er wenigstens jemand hätte, der ihn trösten könnte. Aber er hat nur mich. Und ich, ich kann niemanden trösten. Ich kann ja noch nicht einmal an einem Hund vorbeigehen oder auf einen hohen Turm steigen.“
Der Abend kam, und dann kam die Nacht. Lucinda saß mit überkreuzten Beinen auf ihrem Bett und grübelte. Peter war mit seinen Gedanken so weit fort, dass er das Abendbrot vergessen hatte. Er hatte auch vergessen, ihr Gute Nacht zu sagen. In seinem Arbeitszimmer brannte Licht. Sie hörte ihn auf und ab gehen.
Irgendwann tappte sie im Nachthemd in die Küche und machte Tee. Als sie die volle Tasse durch den Flur balancierte, kam ihr das lange, weiße Nachthemd in die Quere – sie sah es um ihre Füße geistern wie etwas, das nicht zu ihr gehörte. Überhaupt war das eine seltsame Nacht. Draußen hing der Mond in einem Baum fest.
Peter sah auf, als sie leise die Tür öffnete. Und mit einem Mal erschienen ihr seine Züge im Licht der kleinen Schreibtischlampe unendlich alt.
„Lucinda“, sagte er. Mehr nicht.
„Tee“, sagte Lucinda. Mehr nicht.
Es gab sonst nichts zu sagen.
Sie ging auf Zehenspitzen zurück über den dunklen Flur, durch dessen Fenster ein dünner Streifen Licht hereinfiel. Beinahe konnte man sich vorkommen wie eine Seiltänzerin. Eine Seiltänzerin auf Mondlicht. Staubkörner tanzten mit ihr auf dem unsichtbaren Seil, und über die Tapete war ein kleiner, blasser Käfer unterwegs. Lucinda erwog einen Augenblick, ob es sich lohnte, Angst vor ihm zu haben. Aber sie entschied, dass die Nacht viel zu merkwürdig war, um sich vor einem Käfer zu fürchten. Draußen raschelte der Wind in den Blättern einer nahen Baumkrone, und ein liebeskranker Kater sang auf irgendeinem Dach seine klagende Unmelodie. Unter den Dielen waren unzählige kleine Füße unterwegs, Bewohner der Dunkelheit mit gelben Augen und scharfen Krallen; in den Mauern des alten Hauses knackte und ächzte es – und dennoch hatte Lucinda zum ersten Mal in ihrem Leben keine Angst.
Ihr Mondschatten fiel lang gezogen auf die Wand. Er begleitete sie wie ein treuer Hund den ganzen Korridor entlang, und sie hatte beinahe das Gefühl, dass ihre Füße den Boden gar nicht mehr berührten. Was für eine überaus ungewöhnliche, geheimnisträchtige erste Sommerferien-Nacht! Eine Nacht voller Ahnung: Es würde etwas geschehen, bald, etwas, das zur Unwirklichkeit jener Nacht passte.
Es geschah, als sie ihr Zimmer betrat.
Kein Licht brannte, nur der Mond schien bläulich durch die Vorhangritzen –
Und da saß jemand. An ihrem Schreibtisch.
Lucinda blieb in der Tür stehen und wartete.
Die Gestalt dort am Schreibtisch hatte den Kopf gebeugt und war offenbar versunken in die Betrachtung eines kleinen Gegenstandes – nein: einer Postkarte. Es musste diejenige sein, auf der Peter ihr die Botschaft hinterlassen hatte. Lucinda erinnerte sich, dass sie sie dort hingelegt hatte, um sie sich später noch einmal genauer anzusehen: die Karte, die so sehr dem Bild im Museum glich und doch so anders war.
Die Person an ihrem Schreibtisch strich mit einer schlanken weißen Hand darüber, und dann neigte sie ihren Kopf noch tiefer und hauchte einen Kuss auf die Postkarte.
„Hab keine Angst“, flüsterte sie. „Ich werde dich finden.“
In diesem Moment musste Lucinda niesen, und die Person drehte sich um. Sie starrten sich eine Weile mit weit aufgerissenen Augen an. Das Gesicht der Gestalt am Tisch war kein richtiges Gesicht. Es bestand aus einem großen, ovalen schwarzen Knopf mit blauer Umrandung und zwei Löchern anstelle von Augen.
„Du bist …“, hauchte Lucinda.
Das Knopfgesicht nickte. „Die Schöne Gärtnerin“, sagte die Gestalt, als wäre das das Selbstverständlichste auf der Welt. „Du hast gewusst, dass ich kommen würde.“
Lucinda ging langsam zum Schreibtisch hinüber, ohne den Blick von der merkwürdigen Erscheinung zu nehmen. Ihren Oberkörper formten zwei geometrische Figuren wie die Flügel eines Schmetterlings, und in ihrem Schoß saß eine weiße Taube, die nun die Augen geschlossen hatte. Ab und zu gluckste der Vogel im Schlaf.
„Warum … warum bist du aus dem Bild gestiegen?“, fragte Lucinda benommen.
„Aber du hast es mir doch selbst vorgeschlagen!“, antwortete die Schöne Gärtnerin erstaunt. „Wundert es dich da so sehr, dass ich deinem Rat gefolgt bin? Du hast mir damit sehr geholfen – nun bin ich hier, um dich zu bitten, es noch ein weiteres Mal zu tun.“
„Wie …“, stotterte Lucinda, „aber was …?“
Die Schöne Gärtnerin hielt die Postkarte mit dem schwarz-weißen Bild hoch.
„Du hast sie hier“, sagte sie.
„Wen?“, fragte Lucinda verwirrt.
„Meine Schwester. In eurem Museumsshop habt ihr sicherlich einen Band über Max Ernst. Da wirst du bestimmt mehr über sie herausfinden können.“
Damit erhob sie sich mit einer einzigen, grazilen Fließbewegung von Lucindas Schreibtischstuhl und war im nächsten Moment nicht mehr zu sehen.
Lucinda stand eine Weile reglos und sah den Platz an, wo die Schöne Gärtnerin eben noch gesessen hatte.
In dieser überaus seltsamen Nacht erschien es ihr ganz selbstverständlich, dass sie tat, was eine gemalte Figur von ihr verlangte.
So müssen sich Schlafwandler fühlen, dachte sie, während sie die schmalen Stufen der Geheimtreppe hinunterstieg. Es gab keine Fenster und kein Licht hier, und das Nachthemd versuchte wieder, sie am Gehen zu hindern, aber sie setzte ihre Füße so sicher voreinander, als hätte sie ihr ganzes Leben nichts anderes getan, als in absoluter Finsternis steile Stufen hinunterzuklettern.
Als sie durch die Flure des Museums tappte, war da ein Huschen und ein Sausen um sie wie von unsichtbaren Füßen, und ab und zu erhaschte sie im Mondschein einen Blick auf einen weißen Taubenflügel, eine geometrische Schmetterlingsfigur oder einen blassen, zierlichen Fuß – aber ganz zeigte sich die Gärtnerin erst wieder, nachdem Lucinda die Tür zum Museumsshop hinter sich zugezogen hatte.
Dort hockte sie schon hinter der Kasse, die schlanken Arme um die angezogenen Knie geschlungen, und sah Lucinda entgegen. Sie hatte sogar die kleine Leselampe angeknipst, die am Regal mit den Büchern angebracht war.
Es dauerte nicht lange, bis Lucinda den richtigen Band gefunden hatte. Sie sah im Index unter Schöne Gärtnerin nach und fand zu ihrer Überraschung – oder vielleicht auch nicht – gleich zwei Seitenangaben. Das neue Papier raschelte zwischen ihren Fingern. Behutsam blätterte sie die Seiten um. Ja, dort war das Werk abgebildet, das im Museum hing – nur jetzt ohne die Gärtnerin. Und hier … hier war das schwarz-weiße Gemälde, das ihm so ähnlich sah. Die Frau darauf besaß einen ganz normalen Kopf, und im Hintergrund sah Lucinda eine Ebene – oder war es das Meer?
„1923“, las Lucinda halblaut. „Die Schöne Gärtnerin oder Die Erschaffung der Eva. Das Bild entstand in Paris, wurde später im Salon der Unabhängigen ausgestellt und –“
In diesem Moment quietschte die Tür zum Museumsshop leise, und jemand trat ein. Lucinda fuhr herum. Es war Peter, und er hatte ein Küchenmesser in der Hand.
Nun ließ er es sinken und blinzelte in das Licht der kleinen Lampe wie ein Maulwurf. „Was … was machst du denn hier?“, fragte er verwundert. „Ich dachte schon, unsere Einbrecher wären zurückgekehrt.“
Lucinda zeigte zum Kassiertisch und öffnete den Mund, um eine Erklärung zu versuchen – da sah sie, dass die Schöne Gärtnerin nicht mehr dort saß.
„Ich wollte nur … ich wollte etwas nachgucken …“, sagte Lucinda. „Ich habe das Buch ganz vorsichtig behandelt, keine Angst …“
Peter nahm sie am Arm und zog sie etwas unsanft hoch. „Komm jetzt, Lucinda“, wisperte er. „Was immer du hier tust. Von mir aus nimm das Buch mit nach oben, aber ich will nicht, dass jemand nachts irgendwen hier herumgeistern sieht. Verstanden?“
„Ja“, flüsterte Lucinda, „es tut mir Leid! Es war nur – ich konnte nicht schlafen, und das Bild ging mir nicht aus dem Kopf und …“
Peter löschte das Licht. Sie standen eine Weile in einer Mondscheinpfütze und schwiegen. Aber Lucinda fühlte die Spannung in der Luft.
„Warst du gestern Nacht auch hier?“, fragte Peter endlich.
„Nein.“
„Bist du dir ganz sicher?“
Er drückte ihren Arm, wie um die Wahrheit aus ihr herauszuquetschen, doch ihr kam es vor, als würde er ihr die Luft abdrücken. Also das war es. Er vertraute ihr nicht. Nicht mehr. An einem einzigen Tag war genug geschehen, um Peter an ihr zweifeln zu lassen.
Lucinda nahm das Buch unter den Arm und ging voran, die Treppe hinauf, ohne zu antworten. Jetzt stolperte sie zweimal über ihr Nachthemd.
Am nächsten Morgen erwachte sie erst spät. Sie fühlte sich gerädert.
Was war das nur gewesen, was sie geträumt hatte?
Die Sonne schien durch eine Ritze am Vorhang auf ihre Bettdecke, und mitten in dem Lichtstrahl lag ein aufgeschlagenes Buch. Lucinda setzte sich auf und betrachtete das Bild, das eine ganze Seite des Buches füllte. Es zeigte ein schwarz-weißes Gemälde mit einer Frau und im Hintergrund einem durchscheinenden Mann aus lauter Linien … Und da fiel ihr alles wieder ein. Das gestohlene Bild, Peter, ihr nächtlicher Ausflug – und die Gestalt am Schreibtisch. Lucinda schüttelte den Kopf. Bei Tageslicht erschien ihr das Erlebnis so unecht, so vollkommen unmöglich.
Heute Morgen sah alles wieder aus wie immer, es gab keine Geheimnisse und keine Seltsamkeiten. Der ganz alltägliche Lärm der nahen Straße drang mit dem Sonnenlicht des Berliner Sommers ins Zimmer.
Lucinda zog sich an, machte Frühstück und setzte sich mit dem Bildband über Max Ernst an den Küchentisch. Peter war schon weg. Hoffentlich hatte es nicht noch mehr Ärger gegeben.
„1924 ging Die Schöne Gärtnerin oder Die Erschaffung der Eva in den Besitz des Städtischen Kunstmuseums Düsseldorf über“, las Lucinda und trank einen Schluck Kaffee. „Dort beschlagnahmten es 1937 die Nationalsozialisten, um es in die berühmte Ausstellung der Entarteten Kunst einzugliedern, eine Schau, mit der sie versuchten, die moderne Kunst lächerlich zu machen und zu diffamieren. Vermutlich zerstörten sie es später, denn zum letzten Mal sah Max Ernst das Bild in einer Wiener Zeitung von 1937 mit Hitler und Goebbels davor in Parade-Stellung. Max Ernsts Wut über diesen Verlust legte sich nie ganz, und 1967 malte er schließlich eine neue, etwas abstraktere Version des Bildes.“
Deshalb also war das Bild auf der Postkarte und in dem Bildband schwarz-weiß. Es handelte sich um ein altes Foto des verschollenen Werkes.
Lucinda schüttelte betrübt den Kopf, klappte das Buch zu und seufzte. „Und nun ist die zweite Schöne Gärtnerin also auch verschwunden“, sagte sie zu ihrer Kaffeetasse. „Wer weiß, ob sie je wieder auftaucht.“
Das Museum war noch immer geschlossen. Lucinda nahm ihren Kaffee mit hinunter und wanderte durch die leeren Räume. Natürlich waren sie nicht wirklich leer.
Die Bilder waren da.
Die Besucher fehlten – aber was machte das schon aus?
Nein, dachte Lucinda, es war eigentlich überhaupt nicht, als wäre das Museum geschlossen. Es war, als hätte es aufgehört zu regnen.
Das Prasseln des heimlichen Fotoblitzlichts, die Flut der lauten Schritte, des Gekichers, die Pfützen unpassend greller T-Shirt-Farben waren fort.
Nur der ewige Straßenlärm brandete draußen ans Ufer des kleinen Vorgartens; sonst war es ganz still. Lucinda bemühte sich, leise aufzutreten. Sie wollte die Bilder nicht stören. Selbst die Luft zwischen ihnen war voller Ruhe und hatte nichts mit der lauten, hektischen Stadt gemein.
Und in dieser Stille und Ruhe versuchte Lucinda, ihre Erinnerungen an die Nacht wiederzufinden. War sie der Person mit dem Knopfgesicht tatsächlich begegnet?
Sie trat vor das Bild, auf dem genau jene Person jetzt fehlte, und betrachtete es lange.
„Wo bist du?“, flüsterte sie in den blauen Schatten, den der Sommer warf. „Warum bist du aus deinem Bild herausgekommen? Du hast gesagt, du bräuchtest meine Hilfe. Aber bei was? Was willst du von mir?“
Niemand antwortete. Der Kaffee in ihrer Tasse war kalt geworden, und das Bild der seltsamen Gestalt in Lucindas Kopf verdampfte mit den letzten Resten seiner Wärme. Es zog sich zurück, umgab sich mit Nebel, löste sich auf wie ein Traum, an den man sich zu erinnern versucht – ein Traum, den man eben noch wusste, und plötzlich lässt er sich nicht mehr greifen. Vielleicht war es nicht mehr gewesen als das. Ein Traum.
Lucinda suchte in ihrer Tasche nach der Postkarte, die sie am Vortag auf ihrem Schreibtisch gefunden hatte. Sie zog sie hervor und hielt sie ins Licht des späten Vormittags.
„Du hast sie hier“, hatte die Gestalt aus ihrem Traum gesagt. „Meine Schwester.“
Und es war wahr. Auf eine gewisse Weise war die Frau auf der Postkarte die Schwester der anderen Schönen Gärtnerin. Der Bildband hatte es bestätigt: Zwei Schöne Gärtnerinnen hatte Max Ernst in seinem langen Leben gemalt, zwei schöne Schwestern, eine ältere und eine jüngere.
Und wenn ihre Worte wahr gewesen waren, dachte Lucinda, war dann nicht auch die Gestalt wahr, die sie ausgesprochen hatte?
„Ich verfange mich“, sagte sie zu dem gärtnerinnenlosen Bild. „Ich verfange mich in einem Netz von Gedanken und Geschichten und Gärtnerinnen …“
In diesem Moment hörte sie die Eingangstür des Museums quietschen.
Aber war die Eingangstür nicht abgeschlossen? Lucinda stand still wie ein Bild und lauschte. Stimmen quollen herein, laute, aufdringliche Stimmen. Sie huschte um eine weiß gestrichene Ecke, lehnte sich mit dem Rücken an die Wand und wartete.
„Wo ist es?“, fragte eine der Stimmen. „Wir brauchen es in Großaufnahme … Ja natürlich … Glauben Sie, es taucht bald wieder auf? Vielleicht hat jemand es über Nacht zurückgebracht …“ Gelächter prallte an den Wänden ab, als die Stimmen sich näherten. Jetzt erkannte Lucinda eine von ihnen, eine leise, zurückhaltende, die in dem Gewirr der anderen Stimmen fast unterging: Peter.
„Bitte hier entlang“, sagte er. „Ja, dort …“
Das Deckenlicht des Museums erwachte mit einem Summen zum Leben, und Lucinda kniff die Augen zusammen. Die blauen Schatten flohen in die Ritzen, um mit ihr zusammen abzuwarten. Die Schatten waren so schüchtern wie sie.
„Am besten stellen Sie sich dorthin … nein, nicht so … drehen Sie sich mal.“
„Muss das denn sein? Ich wäre ehrlich gesagt lieber nicht mit drauf“, protestierte Peters Stimme ein wenig unsicher. Blitzlichter schnellten durch den Raum wie verirrte Sternschnuppen.
„Ganz groß auf der ersten Seite“, sagte jemand. „Immerhin ist es ein Bild von Max Ernst. Wunderbar. Wun-der-bar. Und natürlich muss der Herr Museumsdirektor mit drauf. Drehen Sie sich mal ein bisschen in diese Richtung … schön. Ganz perfekt. Das wird der Renner.“
Journalisten.
Das Wort tauchte in Lucindas Kopf auf wie eines der Blitzlichter, grell weiß und ohne Rücksicht. Und im selben Augenblick hörte sie eine der lauten Stimmen fragen: „Hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten eine 15-jährige Tochter? Die hätten wir natürlich auch gerne noch auf einem der Fotos – entsetzt angesichts des dreisten Diebstahls blabla … auch die Berliner Jugend interessiert Kunst … Sie wissen schon … so in der Art. Ihre Tochter würde doch bestimmt gerne mal in die Zeitung kommen, oder? Wo ist sie denn?“