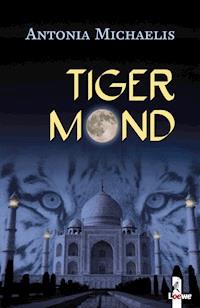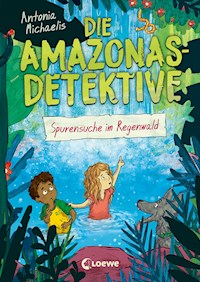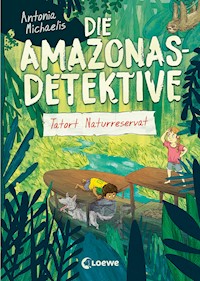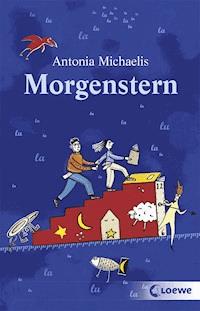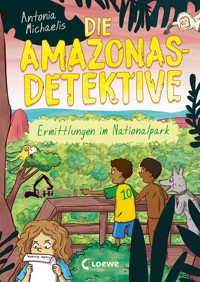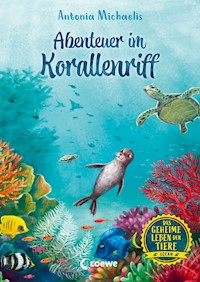Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Niemand weiß um Nepals Thronfolger, der einst unsichtbar auf die Welt kam. Gleichwohl liegen die Geschicke des Landes einzig in Jumars Hand: Er ist es, der sich auf den Weg in die schneebedeckten Berge macht, um den Aufständischen Einhalt zu gebieten, die seinen Vater stürzen wollen. Gleichzeitig schwebt jedoch noch eine andere Bedrohung über dem Land - die Schatten ebenso schöner wie beängstigender Drachen lassen die Menschen in Städten und Dörfern zu Bronzestatuen werden. Jumars Suche nach den Drachen und den Aufständischen wird schon bald zu einer Suche nach der Wahrheit. Und Jumar ahnt, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sein Volk zu retten. Er muss einen Weg finden, sichtbar zu werden …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 573
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Deutschland, Oktober
Nepal
IMMERGRÜNER NEBELWALD
Christopher träumt
Christopher verschwindet
Christopher erinnert sich (nicht)
Christopher flieht
SUBALPINE STEPPE
Niyas Worte
Niyas Rache
Niyas Lied
Niyas Hände
– ZWISCHENSPIEL –
OBERHALB DER SCHNEEGRENZE
Jumar, verstehend
Jumar, sehend
Jumar, sichtbar
Jumar, fort
ZENTRALES BERGLAND
Arne im Fluss
Arne im Staub
Arne in der Luft
Arne in einer letzten Erinnerung
Nepal, Dezember
Deutschland
Nachwort– for political and geographical correctness –
Für meinen Vater, der vielleicht die Worte zwischen den Zeilen lesen kann und der beinahe bei Schneesturm über den Thorung La gegangen wäre – dann aber zum Glück überzeugt werden konnte, einen Tag lang zu warten und seine Höhenkrankheit auszukurieren.
Und für Carolin, die das Atomhuhn suchen darf und die hübschen fünffingrigen Blätter, die wir nie geraucht, sondern beim Poon Hill gegen Schokolade eingetauscht haben.
Die Konsonanten sind für meinen Vater und die Vokale für Carolin.
DEUTSCHLAND, OKTOBER
Der Tag, an dem Arne verschwand, war golden.
Es war einer jener späten Oktobertage, an denen die Farben noch einmal aufflackern, ehe sie endgültig verblassen – einer jener Tage, an denen man glaubt, eine letzte Erinnerung an den Sommer zu spüren, obwohl Pullover und Cordhosen längst die Straßen bevölkern.
Christopher würde sich später immer an das Gelb der Kastanien im Schulhof erinnern und an das Blau des Himmels an jenem Tag – immer, wenn er an Arne dachte.
Jeder in der Schule hatte Arne gemocht.
Alle Mädchen ab der siebten Klasse waren in ihn verliebt gewesen, und mindestens zwei Drittel der Jungen hatten ihn bewundert. Christopher dagegen war jemand, dessen Existenz die meisten noch nicht einmal bemerkt hatten.
Manchmal, wenn jemandem sein Nachname auffiel, erntete er einen überraschten Blick: „Hagedorn? Bist du verwandt mit Arne Hagedorn? Bist du etwa sein kleiner Bruder?“
Und wenn Christopher nickte, schüttelten sie den Kopf, als wollten sie ihm bedeuten, dass er sich irrte. Sie sagten: „Dich haben wir uns ganz anders vorgestellt. Ihr seht euch aber auch gar nicht ähnlich.“
Nein, das taten sie nicht.
Arne war groß und breit und stark und hatte dieses weißblonde Haar und dieses Gesicht, das einfach niemand wieder vergaß. Christopher war klein und schmächtig und dunkel, und er hatte die Züge seiner Großmutter geerbt, die keiner von ihnen kennengelernt hatte und die vor einer Ewigkeit aus Nepal gekommen war, um einen großen, blonden Deutschen zu heiraten – einen wie Arne.
Weshalb es natürlich niemanden überrascht hatte, als Arne beschloss, nach der Schule für ein Jahr nach Nepal zu gehen.
„Auf der Suche nach seinen Wurzeln, so ein ernster Junge“, hatten sie gemurmelt und anerkennend genickt; ja, und arbeiten wollte er, in einem Waisenhaus. Das war Arne Hagedorn.
Nachdem bekannt war, dass er fortging, hatten sich auf einen Schlag alle Mädchen in ihn verliebt, die noch nicht in ihn verliebt waren, und er hatte versprechen müssen, Dutzende von E-Mail-Adressen auf seine Reise mitzunehmen.
So wie Christopher seinen Bruder kannte, würde er tatsächlich versuchen, allen zu schreiben, wenigstens ein einziges Mal. Arne tat solche Dinge. Er tat alles, was getan werden musste. Wenn jemand das Basketballturnier retten musste, war Arne zur Stelle. Wenn jemand die Schachmeisterschaft für die Schule gewinnen musste, gewann Arne sie. Selbst wenn jemand einen Streik gegen die Lehrer anzetteln musste, weil etwas Ungerechtes geschehen war, tat Arne es – und deshalb mochten alle Arne.
Christopher mochte Arne auch.
Arne war beinahe zwanzig. Er selbst war erst vierzehn. Er hätte sich niemals getraut, einem Mädchen eine E-Mail zu schreiben. Er traf beim Basketball keinen Korb, er hätte die Schachmeisterschaft vermasselt, und bei einem Streik gegen die Lehrer hätte er gekniffen.
Er bewunderte Arne, wie alle ihn bewunderten.
Wenn die Leute mit seinen Eltern sprachen, sagten sie: „Sie müssen sehr stolz sein auf ihren Sohn!“
Und wenn Christophers Eltern fragten: „Auf welchen?“, dann antworteten sie: „Na, auf Arne natürlich! Haben Sie denn noch einen Sohn?“
So waren die Dinge gelaufen.
Bis Arne an jenem goldenen Oktobertag verschwand.
Natürlich verschwand er nicht wirklich an jenem Tag. Er war schon vorher verschwunden, nur hatte es niemand gewusst.
Aber an jenem Tag bekamen Christopher und seine Eltern die Nachricht.
Das Waisenhaus, in dem Arne arbeitete, hatte ihm ein paar Tage freigegeben, und Arne war in den Himalaja gefahren, um zu wandern. Allein. Und jetzt, nach vier Wochen, hatten die Leute vom Heim endlich den Mut aufgebracht, eine Nachricht zu schicken, dass er nicht zurückgekehrt war. Drei Wochen lang hatten seine Eltern es auf das Internet geschoben, das E-Mail-Programm, Arnes abenteuerlichen Lebenswandel – „Er wollte nur für eine Woche weg“, sagte Christophers Vater ungefähr 27 Mal, „er wollte nur für eine Woche weg, und sie informieren uns nach vier Wochen, dass er nicht wieder aufgetaucht ist?“
Jetzt hörte man auch in den Nachrichten, dass die Lage in Nepal kritisch war. Es standen wieder mehr Panzer auf dem Durbar Square vor dem Palast. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts rieten sie einem davon ab, nach Nepal zu fahren. Was man tun sollte, wenn man schon da war, erklärten sie einem nicht. Vermutlich nach Hause fliegen. Vermutlich in der Hauptstadt bleiben. Vermutlich nicht alleine in die Berge wandern gehen. In den Bergen saßen die Maos. Die Kommunisten. Arne hatte Witze über sie gemacht und geschrieben, sie würden den Touristen ein zweites Eintrittsgeld für das Annapurnagebiet abnehmen und Flugblätter austeilen, auf denen sie in schlechtem Englisch erklärten, sie wären die eigentliche Regierung des Landes. Ansonsten wären sie höflich und zurückhaltend.
Seit zwei Wochen las Christopher alles über die Maoisten, was er finden konnte. Es war nicht viel, aber es barg eine beunruhigende Faszination. Christopher war klein und schwach und vielleicht nicht mutig, aber er war auch nicht dumm. In jenen Tagen des Wartens auf eine E-Mail von Arne fragte er sich zum ersten Mal in seinem Leben, ob Arne womöglich dumm war. Nicht im eigentlichen Sinn des Wortes. In einem anderen, weitgreifenderen Sinn, der beinhaltete, dass man alleine ins Annapurnagebiet wandern ging, wenn alle einem davon abrieten.
Und dann kam also jene Nachricht. Es war ein Donnerstagnachmittag.
„Man kann sich natürlich nicht sicher sein“, sagte Christophers Vater und drehte seine schmale Brille in den Händen. „Womöglich hat er sich einen Fuß verstaucht und sitzt in einem Dorf mitten im Nichts und bringt den Kindern der Einheimischen Französisch bei, während sie seinen Knöchel mit Urwaldblättern bandagieren. Das sähe ihm ähnlich.“
„Du bist übergeschnappt“, sagte Christophers Mutter. „Vollkommen übergeschnappt. Urwaldblätterbandagen! Sitzt da, in deinem Sessel, und redest über Urwaldblätterbandagen! Wir müssen doch etwas tun, irgendetwas! Ruf jemanden an, die Botschaft oder was –“
„Das habe ich schon getan“, sagte Christophers Vater.
„Dann ruf sie eben noch mal an!“, schrie seine Mutter und warf das Saftglas um, das sie eine Sekunde vorher auf den Tisch gestellt hatte. Christopher sah, wie ihre Hände zitterten, als sie die Scherben aufsammelte. Dann goss sie sich statt Saft ein halbes Glas voll Gin ein, und Christophers Vater stand aus seinem Sessel auf und nahm es ihr nach dem ersten Schluck weg, um es in den Ausguss zu kippen.
„Das nützt auch nichts“, sagte er.
„Sei doch nicht so verdammt ruhig!“, schrie seine Mutter. „Es kümmert dich wohl gar nicht, dass unser Sohn von irgendwelchen bewaffneten Kommunisten entführt worden ist! Es lässt dich vollkommen kalt! Das ist es, es lässt dich kalt, es –“
Und dann brach sie auf der Sofakante zusammen und löste sich in einen Wasserfall aus Tränen auf. Christopher stand nur da und sah, wie seine Eltern sich umarmten und versuchten, sich gegenseitig zu trösten, und fühlte sich so steif wie eine Statue. Er sagte sich, dass er noch etwas anderes fühlen musste – etwas außer der Statue, zu der er wurde. Schreck. Entsetzen. Trauer. Wut. Selbst ein heimliches Schuldgefühl, weil er keinen Schreck, kein Entsetzen und keine Trauer empfand. Aber da war nichts. Alle Gefühle in Christopher waren versteinert. Als hätte Arne sie mitgenommen – mit nach nirgendwohin.
Drei Tage lang geschah nichts. Dann hieß es, eine Splittergruppe der Maoisten hätte bekannt gegeben, dass sie drei Europäer in ihrer Gewalt hatten, aber es gab nirgends Bilder oder Namen, und es gab keine Verhandlungsbasis, denn die Maos konnten sich nicht über ihre Forderungen einigen.
Christophers Mutter schluckte Beruhigungstabletten wie Bonbons, und sein Vater telefonierte täglich stundenlang mit Leuten in Ämtern und Botschaften, die ihm nicht helfen konnten. In der Schule spürte Christopher jetzt die Blicke der anderen, die sich nicht zu fragen getrauten, doch er wich ihnen aus. Zu Hause wusch er das Geschirr ab, das sich im Haus inzwischen überall stapelte, und hängte die Wäsche auf, die er in einer muffig riechenden Waschmaschine fand. Irgendwann besorgte er sich in der Bibliothek einen Bildband über Nepal und zog sich damit in sein Zimmer zurück. Unter der Kruste der Statue, zu der er geworden war, begann es langsam zu brodeln. Vielleicht würde sie von innen schmelzen. Aber wenn sie explodierte, gab es niemanden mehr, der das Geschirr abwusch und die Wäsche aufhängte.
Wie wenig, dachte er, nützte es Arne nun, dass alle ihn mochten, denn offenbar war niemand bereit, wirklich etwas zu tun, um ihm zu helfen! Alle drehten durch, alle drehten sich um sich selbst, während er irgendwo alleine im Himalaja festsaß.
Christopher setzte sich auf sein Bett und ließ seine Finger durch die Seiten wandern: Berge, Schluchten, schneebedeckte Gipfel – ein trockenes Flusstal, Maultiere auf einer schmalen Hängebrücke. Großblättrige Bäume voller Schlingpflanzen, Wasserfälle, buddhistische Klöster mit leuchtenden Wandmalereien und bunte Gebetsflaggen über den braunen Hütten. Es gab nichts, was er tun konnte, und so träumte er sich die Seiten entlang, über die Berge und durch die Täler, an den blau mäandernden Flüssen vorbei und die blendend hellen Gletscher hinauf, um wenigstens auf eine Weise bei Arne zu sein. Als es Abend geworden war, aber niemand ans Essen dachte, als draußen die Perlenkette der Straßenlaternen in der Dunkelheit aufflackerte und der Oktober einen leisen Oktoberregen auf die Straßen niederschickte, waren Christophers Augen an einem Bild hängen geblieben: Es zeigte die grünen Wellen des tropischen Urwalds, dort, wo die Berge noch niedrig waren und die feuchtwarme Luft unbewegt zwischen den Bäumen stand. Im Vordergrund sah man einen Pfad, der in jene grüne Welt hineinführte, sich wand und schlängelte und endlich auf eine geheimnisvolle Weise im Unterholz verschwand.
Christopher sah das Bild lange an; so lange, bis seine Augen tränten und es davor verschwamm und alles, was er noch sah, die Farbe Grün war.
Grün.
GRÜN.
Grünes Zwielicht an einem Nachmittag im tropischen Urwald.
Etwas raschelte links von ihm im Dickicht. Er fuhr herum. Und in diesem Moment merkte er, dass seine Füße auf einem federnden Teppich aus Laub standen. Vor ihm schlängelte sich der Weg ins Unterholz. Er rieb sich die tränenden Augen. Aber es gab keinen Zweifel: Er war hier, im Wald. Eine Unzahl unbekannter Vögel lärmte, unsichtbar in den hohen Ästen, und die Zikaden zirpten so laut, dass man meinen konnte, man stünde direkt neben einem Elektrizitätswerk.
Das war unmöglich. Das konnte nicht sein.
Das war – aber nein. Vernünftig bleiben, lieber Christopher. Durchdrehen war etwas, das andere Leute taten. Es gab eine absolut plausible Erklärung.
Er träumte.
Es raschelte noch einmal zu seiner Linken, und Christopher sah, dass dort eine Spur in den Urwald führte: eine Spur aus umgeknickten Grasbüscheln und Ästen, die vom Weg wegführte. Er zögerte. Er war nicht Arne. Arne wäre der Spur gefolgt, einfach so, ohne Angst zu verspüren. Christopher hatte Angst. Auch wenn es vermutlich nur geträumte Angst war. Er verstand nichts von alledem, was geschah, und seine Hände waren feucht vor Nervosität. Dennoch ging er der Spur nach, Schritt für Schritt, ganz vorsichtig, und das Rascheln kam näher.
Und dann sagte eine ihm unbekannte Stimme vor ihm müde und verzweifelt:
„Lauf nicht weg. Bitte lauf nicht weg. Hilf mir. Bitte!“
Christopher schüttelte den Kopf, machte noch einen Schritt nach vorne, um zu sehen, ob er sich in der Entfernung verschätzt hatte … ob der Besitzer dieser Stimme irgendwo hinter einem Busch verborgen war …
Dabei stolperte er über jemanden.
Jemanden, der ungefähr so groß war wie er und der schrie, als Christopher auf ihn fiel.
Er rollte sich zur Seite und sah sich keuchend um.
Doch da war niemand.
NEPAL
Der Garten lag still im Morgenlicht, so still wie ein geheimer Gedanke.
Die Tempelbäume fächerten ihre weißen Blütenräder der Sonne entgegen, und die ersten Feuerlilien öffneten ihre Kelche eben dem kommenden Tag.
Ein Lizzard huschte als blassgrüner Streifen über die Mauer.
Aus Tausenden und Abertausenden von Blüten strömte ein verschwenderischer Duft, der sich unter der Glaskuppel fing wie eine Wolke, und draußen in der Stadt sagten sie, bisweilen würde es aus jener Wolke regnen, und der Regen fiele wie Tränen auf den Garten und überschwemmte die Wege, überschwemmte die Beete und Mäuerchen, und eines Tages würde er den Palast überschwemmen – eine Sintflut aus Blütenduft. Aber das war nur eines der Dinge, die sie sagten. Keiner von ihnen hatte den Garten jemals gesehen. Sie kannten nur seine hohen, unüberwindlichen Mauern. Und wenn sie darüber sprachen, was dahinterlag, senkten sie ihre Stimme zu einem Wispern.
Denn dort, im Garten, im Schutz der Mauern, im Schatten der Bäume, unter der gläsernen Kuppel, inmitten des Duftes, dort schlief die Königin.
Sie schlief nicht wie im Märchen. Sie schlief in der Realität. Und es war besser, man sagte es nicht so laut. Etwas war geschehen, und sie war in einen tiefen Schlaf gefallen, aus dem niemand sie erwecken konnte. Nicht einmal die Ärzte, die von weit her gekommen waren, in großen Flugzeugen übers Meer – nicht einmal die. Sie alle hatten nur den Kopf geschüttelt und waren wieder in ihre Flugzeuge gestiegen und zurückgeflogen, und vermutlich hatten sie den merkwürdigen Fall der nepalesischen Königin und ihres tiefen Schlafs inzwischen längst vergessen über den Zahlen und Formeln, die sie in ihre Abrechnungen eintragen mussten.
Die Königin schlief seit vierzehn Jahren.
An jenem Morgen aber, an dem der blassgrüne Lizzard über die Gartenmauer huschte, öffnete sich eine Seitentür des Palastes, um jemanden einzulassen, und etwas begann zu geschehen. Später sagten sie, man hätte es längst ablesen können an den Zeichen im Himmel und den Tönen in der Luft und auch an den Linien in irgendjemandes Hand. Oder vielleicht am Wetterbericht. Aber das sagen sie später stets.
Jumar Sander Pratap hörte das Klopfen zuerst. Der Gang, in dem sich die Tür befand, gehörte zu den Räumen der Bediensteten, und Jumar hatte dort nichts zu suchen, denn ein Thronfolger gehört nun einmal nicht in solcherlei Räumlichkeiten.
Aber es hatte Jumar noch nie gekümmert, wohin er gehörte und wohin nicht. Und es war schwer, ihm zu verbieten, sich hier oder dort aufzuhalten. Man konnte nie genau sagen, wo Jumar sich befand. Denn in den vierzehn Jahren, die er im Palast lebte, hatte kein Mensch Jumar je gesehen. Nicht einmal er selbst. Darüber sagten sie nichts, draußen in der Stadt.
Sie wussten nichts davon.
Keiner, kein Einziger in ganz Kathmandu wusste, dass es einen Thronfolger gab.
Denn es entbehrte nicht einer gewissen Peinlichkeit, einen Sohn zu haben, den man nicht sehen konnte. Man stelle sich vor: das Geschrei. Die Gerüchte. Und die ausländische Presse. Nein, es gehörte sich nicht, nicht gesehen zu werden, und so lebte Jumar nicht nur ungesehen, sondern auch unbekannt sein Leben zwischen den Mauern und Teppichen des Palastes – ein Leben, das mehr Schein war als Sein, oder vielleicht gerade Sein ohne Schein, und an dieser Stelle kam er immer durcheinander.
Sie hatten versucht, ihn sichtbar zu machen. Die Kleider, die seine Haut berührten, benahmen sich so empörend und unangemessen wie die Haut selbst und verschwanden vor den Augen der Bediensteten, sobald er sie überstreifte. Jede zweite Schicht Kleider aber, die mit der unangemessenen Haut keinen Kontakt hatte, blieb sichtbar, und so lief Jumar auf Anordnung seines Vaters als seidene Hülle seiner selbst durch die Palastgänge. Seit er als Fünfjähriger eine ganze Schüssel Reispudding entwendet hatte, musste er Handschuhe tragen, damit die leblosen Gegenstände, die er berührte, nicht ebenfalls ihre Sichtbarkeit aufgaben.
Aber was heißt Anordnung? Was heißt Befehl?
Wer kann einem Unsichtbaren befehlen? Womöglich streifte da jemand die zweite Schicht Kleidung bisweilen ab, um ungesehen durch den Palast zu streunen?
Nur die Außentüren, die Türen zur Stadt, blieben dem unsichtbaren Thronfolger verschlossen. Seit vierzehn Jahren gab es nur noch ein Minimum an Bediensteten im Palast.
Und dieses Minimum war dazu verdammt, seine Schlüssel zu den Außentüren um den Hals zu tragen. Und beim Öffnen und Schließen der Türen peinlich genau darauf zu achten, dass niemand mit ihnen hinausschlüpfte, hinein ins Gewirr der Stadt.
Man stelle sich vor: mit einer zweiten Schicht Kleidung – der Himmel bewahre! Die Schlagzeilen in den Köpfen der Leute!
Gesichtsloser gesichtet.
Unheimliches heimlich aus Palast entflohen.
Wer ist er, der mit dem blicklosen Blick? Den körperlosen Schritten? Der mundlosen Stimme?
Seit vierzehn Jahren war der Thronfolger Nepals ein Gefangener noch nicht entstandener Gerüchte.
Und wer den Schlüssel nach draußen trug – wer den Gesichtslosen gesichtet hatte, den Mundlosen hatte sprechen hören –, der trug auch ein Schloss vor dem Mund. Allerdings wiederum ein unsichtbares.
Aber kehren wir zurück in jenen Gang neben der Küche, in die Räume der Bediensteten, zurück zu dem Geräusch: Jumar blieb stehen und lauschte. Er wunderte sich und legte den Kopf schief – nicht, dass das optisch etwas an seiner Erscheinung geändert hätte – und lauschte weiter. Das Geräusch glich dem Kratzen eines Hundes. Es hatte etwas Verzweifeltes.
Er hatte gehört, dass es Unruhe gab, da draußen, dass sie wuchs – obgleich er nicht wusste, welcher Natur diese Unruhe war. Man hatte ihm gesagt, dass es gefährlich sein konnte, sich dieser Tage in der Nähe von Türen aufzuhalten. Jumar hatte noch nie in seinem Leben etwas Gefährliches getan. Die Welt, deren Teil er war, war voll von weichen Kissen und Musikstunden und Englischtexten und Sinuskurven auf Millimeterpapier, voll von Schwimmstil-Übungen im königlichen Pool (denn einzig bei dieser Sportart konnte man ganz ohne doppelte Kleidungsschicht seine Kooperation kontrollieren, da sich das Wasser bewegte), voll von Computerkursen und fremdsprachigen Briefpartnern und Büchern, aber nichts darin barg Gefahr.
Als er an jenem Tag (an dem der blassgrüne Lizzard … aber das wissen wir schon) das verzweifelte Kratzen an der Tür im Flur hörte, durchlief es ihn wie ein Hauch, gleichzeitig kalt und heiß, kurz: wundervoll. Und obwohl er wusste, dass er besser kehrtgemacht hätte, blieb er stehen und wartete.
Die Tür öffnete sich unerwartet plötzlich.
Der, der draußen gewesen war, hatte es endlich geschafft, sie aufzuschließen – und fiel Jumar in die Arme.
Jumar taumelte zurück, und genau in diesem Moment änderte sich seine Welt für immer. Er stürzte zusammen mit dem anderen Menschen zu Boden, und ein Geruch nach Schweiß und Dreck und Blut hüllte ihn ein, Dinge, die er noch nie gerochen hatte und deren Intensität ihm den Atem nahm. Dennoch begrüßte er sie – er begrüßte sie, wie man ein unbekanntes Land begrüßt, und als er sah, dass es sein alter Diener Tapa war, der halb auf ihm lag, und als seine Finger in klebriges, warmes Blut griffen, da mischte sich sein Entsetzen mit der Gier nach Neuem, nach dem Dunklen, nach dem Gegensatz von all dem, was er kannte. Später schämte er sich dafür, doch er konnte dieses Gefühl nicht leugnen.
„Tapa!“, keuchte Jumar und kämpfte sich hoch. Er schloss eilig die Tür und fiel neben dem alten Mann auf die Knie. „Was – wie –?“
Die Kleider des Alten hingen in Fetzen und waren an so vielen Stellen zerrissen und dunkel verfärbt, dass Jumar sich ernstlich fragte, ob all dies wirklich Blut sein konnte, das sich zuvor in Tapas Körper befunden hatte. Er schloss, dass nicht mehr viel darin war, und versuchte, den alten Mann zu stützen.
„Eure Hoheit“, flüsterte Tapa, „ich muss – ich muss Euren Vater sprechen.“
Jumar drehte das Gesicht des Alten zu sich, sah die aufgesprungenen Lippen und die verquollenen Augen, das trockene Blut, das seine Nasenlöcher verkrustete, und den Dreck, der sein schütteres Haar verklebte. Übelkeit stieg in ihm auf.
„Wer hat das getan?“, wisperte er.
„Sie“, antwortete der Alte heiser und zeigte in eine unspezifische Richtung. „Ich war bei meiner Tochter, in ihrem Dorf –“
„Ich weiß, Tapa, ich weiß.“ Jumar versuchte sich verzweifelt zu erinnern, ob er irgendwann einmal etwas darüber gelernt hatte, was man mit Verletzten tut, die einem in die Arme fallen.
„Sie waren dort, in dem Dorf. Jemand hat ihnen gesagt, dass ich im Palast arbeite – die Leute hungern, sagen sie, sie hungern, und im Palast gibt es zu viel Brot, zu viel – sie werden kommen, sie werden alles ändern, haben sie gesagt, es dauert jetzt nicht mehr lang. Sie werden Schluss machen mit solchen wie mir, die das Brot des Königs essen. Der König!“
Der Alte krallte sich an Jumars Hemd fest, zog sich daran hoch und kam wankend auf die Beine. „Ich muss den König sprechen. Man muss ihm sagen, wie es aussieht, in jenen Dörfern. Man muss –“
Er brach ab, rang nach Luft und griff nach der Wand, um nicht zu fallen. Seine Hand hinterließ einen Abdruck aus Blut und Dreck auf der reinen weißen Fläche.
Später sagten sie, der Abdruck müsste noch immer irgendwo nördlich der großen Küche zu finden sein, und man könnte ihn seltsamerweise nur nachts sehen, auch, wenn der Mond nicht schien. Es war eine schöne Geschichte für die Touristen, die man durch den Palast führte.
Tatsache ist, dass ein gewisser, bis dahin wohlbehüteter Schlüssel aus jener Hand zu Boden fiel. Er fiel mit einem leisen Klirren, kaum hörbar und doch so bedeutend.
„Er ist im Garten“, sagte Jumar, und zum ersten Mal bemerkte er eine gewisse Bitterkeit in seiner eigenen Stimme. „Im Garten, wo er stets ist um diese Zeit. Er gießt seine Pflanzen. Du weißt, dass er niemand anderem erlaubt, seine Pflanzen zu gießen.“
Der alte Tapa lächelte mit seinen aufgesprungenen Lippen. „Sie sagen, er hätte sie alle eigenhändig gepflanzt. Ist es wahr?“
„Ich fürchte, ja“, erwiderte Jumar. „Es ist das Einzige, das ich ihn je mit solcher Hingabe habe tun sehen. Er pflanzt sie für meine Mutter. Was – was wirst du ihm sagen?“
Aber Tapa schwieg, denn er brauchte den wenigen Atem, der ihm blieb, um durch die Gänge zu hinken, durch die Jumar ihn führte. Und auf ihrem Weg erinnerte sich Jumar, wie er in ebendiesen Gängen das Laufen gelernt hatte, denn damals war er es gewesen, der sich an Tapa festhielt – an seinen Hosenbeinen, so klein war Jumar gewesen und der alte Tapa noch nicht alt.
Tapa war es, den er später immer wieder gefragt hatte:
Warum, Bruder Tapa, bin ich nicht wie die anderen Leute? Warum kann man sie sehen und mich nicht? Nicht einmal ich selbst kann mich sehen, obwohl ich jeden Teil meines Körpers spüren kann!
Frage deinen Vater, hörte er Tapa in seiner Erinnerung.
Aber er antwortet mir nicht, hatte Jumar gesagt und an Tapas Hosenbein gezogen. Antworte du mir!
Und wieder Tapas Stimme: Ich habe keine Antwort.
Nun, da er ihn durch den Palast schleppte und das Gewicht des geschundenen Körpers schwer auf seiner Schulter lasten fühlte, war es, als schließe sich ein Kreis. Noch begriff Jumar nicht, was der Tod bedeutete und dass er nahe war, dass es der Tod war, der sich auf seine Schulter stützte. Noch waren da zu viele wild durcheinanderwirbelnde Gefühle in seinem Kopf unterwegs, und der Geruch der Gefahr und des Abenteuers dirigierte sie in einem verrückten Tanz.
Und ein Schlüssel lag schwer in seiner Tasche.
Jumar fand seinen Vater im Schatten einer Rosenhecke. Er stand gedankenverloren, den Wasserschlauch in einer Hand, und das Wasser lief unbeachtet in die dunkle, duftende Erde.
„Vater“, sagte Jumar.
„Sieh nur“, sagte der König. „Sieh nur, wie schön die Feuerlilien in diesem Jahr geworden sind. Sie sind schöner als je zuvor. Ich bin mir beinahe sicher, dass ihre glühenden Farben den Weg in die Träume deiner Mutter finden.“
„Vater!“, wiederholte Jumar. „Jemand will dich sprechen!“
„Später“, sagte der König ungehalten, „siehst du nicht, dass der Garten mich braucht? Meine Audienzen sind zwischen drei und fünf Uhr nachmittags, und jeder weiß das.“
Da fasste Jumar den König mit der freien Hand am Arm. „Vater!“, rief er ein letztes Mal. „Vergiss doch jetzt mal die Feuerlilien!“
Der König starrte auf seinen Arm, auf dem die unsichtbaren Finger seines Sohnes einen Fleck aus rotem Blut hinterlassen hatten – das Blut eines anderen, allzu sichtbares rotes Blut. Und endlich, endlich drehte er sich um.
„Du trägst die zweite Schicht Kleider nicht“, sagte er tadelnd. Aber in seiner Stimme lag noch immer mehr Abwesenheit als Tadel.
Der alte Tapa machte Anstalten, in eine Verbeugung zu fallen, doch Jumar zog ihn wieder hoch. „Mir scheint, dies ist keine Zeit für Gespräche über Kleiderschichten“, sagte er, „oder für Verbeugungen.“
„Ich – ich bringe Nachrichten von draußen“, stammelte der alte Tapa. „Ich dachte, jemand muss es dem König sagen. Die Leute draußen, mein König, Ihr wisst, dass sie hungern, und die Kommunisten, die alles ändern wollen, sind stark geworden – ich habe gesehen, wie stark sie bereits sind – sie sind viele, und ihre Worte sind groß –“
Jumar sah, wie der König sich umdrehte und mit dem Finger den Stiel einer Feuerlilie entlangfuhr. „Sie sind schön, meine Lilien“, sagte er, „schön, nicht wahr?“
Der alte Tapa verstummte perplex. „Die … Lilien?“, murmelte er verständnislos.
Da wandte sich der König wieder ihm zu, und er lächelte.
„Es ist alles in Ordnung“, sagte er. „Niemand braucht sich Sorgen zu machen. Wir haben Frieden in diesem Land. Kein Grund zur Beunruhigung. Kein Grund, mich in meinem Garten zu stören. Die Führer meines Heeres melden mir, dass sie die Situation im Griff haben.“
„Welche Situation?“, fragte Jumar.
„Ich pflege mich nicht nach derlei Kleinigkeiten zu erkundigen“, erwiderte der König und verschmälerte seine Augen ein winziges bisschen, als er in die Richtung sah, in der er seinen Sohn vermutete. Jumar machte den Mund auf und machte ihn wieder zu.
„Geht jetzt“, sagte der König. „Geht, und lasst mich allein.“
Aber wer ging, war er. Er nahm den Gartenschlauch auf und ging den Weg entlang, der zwischen den Rosenhecken ins Innere des Gartens führte, wo irgendwo verborgen in ihrem Pavillon seit vierzehn Jahren eine Frau schlief, die niemand erwecken konnte.
Und Jumar wusste, dass es seine Schuld war, dass sie schlief.
Denn nichts an ihren Eingeweiden oder in ihrem Kopf war krank. Sie hatten sie geröntgt, computertomografiert, kernspintomografiert, ihre Hirnströme gemessen und ihre Nervenleitgeschwindigkeit ausgerechnet. Da war nichts an ihr, das nicht stimmte.
Und das Wort Koma, das die Ärzte gern gebrauchten, war falsch.
Aber die Ärzte wussten nicht, dass die Königin ein unsichtbares Kind zur Welt gebracht hatte. Diese eine Tatsache hatte man ihnen verschwiegen. Sonst hätten sie es ihr wohl kaum übel genommen, dass sie es angesichts einer solch entsetzlichen, unbegreiflichen Tatsache vorgezogen hatte, die Augen vor der Welt zu verschließen und in einen niemals endenden Schlaf zu fallen.
„Es ist meine Schuld“, flüsterte Jumar. „Es ist alles meine Schuld, nicht wahr? Und deswegen wird er mir niemals zuhören. Wenn sie nicht schlafen würde, hätte er niemals diesen Garten um sie herum gepflanzt, diesen Garten unter der lächerlichen Glaskuppel, und er wüsste, was draußen geschieht, und niemand würde hungern.“
Er spürte, dass der alte Tapa nicht mehr lange stehen konnte, und so setzte er sich auf den Boden, mitten auf den sorgfältig gefegten Weg aus blank polierten Marmorplatten, und hielt den Alten in seinen Armen.
„Wenn ich immer getan hätte, was mein Vater befohlen hat … wenn ich immer die Handschuhe getragen hätte und niemals heimlich die zweite Schicht Kleider abgestreift … Tapa … glaubst du, ich wäre dann irgendwann sichtbar geworden? Meinst du, dann wäre die Königin aufgewacht?“
Tapa lächelte mit seinem zerschundenen Gesicht zu ihm auf, obwohl er nicht sehen konnte, wohin er lächelte. Aber daran war er seit vierzehn Jahren gewöhnt.
„Du sprichst wieder wie der kleine Junge“, sagte er, „der du vor langer Zeit warst. Natürlich nicht, mein kleiner Junge. Natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Weg gibt, sichtbar zu werden. Und ich weiß nicht, ob es einen gibt, der die Schuld trägt.“ Er wisperte jetzt, und noch immer wurde seine Stimme leiser. „Es ist nicht an uns, diese Dinge zu entscheiden.“
„Erzähle mir“, bat Jumar und beugte sich ganz nah zu ihm herunter. „Erzähle mir, was draußen geschieht. Erzähle mir von denen, die dich so zugerichtet haben!“
„Sie wollen den König stürzen“, flüsterte Tapa. „Sie sind viele, und sie gehen in die Dörfer und holen sich die Jungen, Starken, damit sie mit ihnen kämpfen. Sie werden immer mehr, und sie halten große Reden. Wenn die Leute Hunger haben, öffnen sich ihre Ohren weit für solche Reden. Die Aufständischen verstecken sich in den Bergen, und es ist selten, dass sie in ein Dorf kommen wie das meiner Tochter.“ Er stotterte, und Jumar sah, wie sich der Schmerz in seine Gesichtszüge verbiss und seine Stimme zerreißen wollte. „Noch ist es selten“, fuhr er mühsam fort. „In den Bergen, im Dschungel, dort sind sie sicher, und dort haben sie ihre Lager, in denen sie die Revolution vorbereiten. Die aus den Bergen ins Tal herabkommen sagen, man könnte dort ihre Schüsse hören, wenn sie üben.“
„Weshalb leiden die Leute Hunger?“, fragte Jumar. Auch das Wort „Hunger“ kam ihm vor wie ein Abenteuer. Er hatte noch nie Hunger gelitten. Er wollte wissen, wie es sich anfühlte, ob es wehtat und ob es die Gedanken veränderte.
„Hat dir nie jemand von den Drachen erzählt?“, fragte der alte Tapa.
Jumar schüttelte den Kopf. „Ich weiß nur, dass es keine Drachen gibt“, antwortete er. „Sie gehören zu den alten Märchen, und alles, was es gibt, sind Echsen. Eidechsen, Feuerechsen, Kragenechsen …“
„Jaha, so steht es in den klugen Büchern, die von weit her kommen“, sagte Tapa. „Aber es gibt sie, da draußen. In den Bergen. Noch trauen sie sich nicht in die Stadt, aber sie werden täglich dreister … sie …“
„Ja?“ Jumar beugte sich noch tiefer über den Alten. Er war kaum noch zu verstehen.
„Sie fressen die Farben. Die Reisfelder sind ohne Farbe, Hoheit, schwarz-weiß wie ein Zeitungsbild, und farbloser Reis macht … die Leute …“ Seine Stimme wurde leiser und geriet ins Stocken. „… nicht satt. Das ist es aber … nicht … allein. Sie…“
Jumar hielt sein Ohr ganz nahe an Tapas Mund.
„Was noch?“, flüsterte er. „Was tun sie noch?“
Doch der alte Tapa schüttelte den Kopf, ganz langsam. Das war das Letzte, was er tat.
Dann fiel sein Kopf zur Seite, wo ein unsichtbarer Arm ihn hielt, und sein Blick blieb für immer an der Glaskuppel hängen, die den Garten hoch oben vor Regen und Sturm abschirmte. Und vor den Gerüchten über das Rauschen von großen, unwirklichen Flügeln in ungesehenen Momenten.
„Tapa!“, flüsterte Jumar. „Tapa!“
Er schüttelte den alten Mann, erst sanft, dann stärker.
Aber er erinnerte sich nicht, wie man Leute wiederbelebt, obgleich er es in einer fernen Theoriestunde des Schwimmlehrers gelernt haben musste, und in diesem Moment begriff er, dass es bisweilen sinnlos war, Dinge in Theoriestunden zu lernen.
An diesem Morgen lernte Jumar Sander Pratap, Kronprinz des Königreichs mit den höchsten Bergen der Welt, seine erste Lektion in der Praxis: Er lernte, den Tod zu begreifen.
Aber den Tod kann man nicht begreifen, und so schrie Jumar lange und laut ohne Sinn. Die Ohren des Königs waren verschlossen für den Schmerz seines Sohnes, so wie sein Herz verschlossen war für alles, was sein Sohn tat und dachte. Doch die blassgrünen Lizzards im Palastgarten erschraken und huschten alle gleichzeitig in ihre Mauerritzen.
Sie trauten sich erst Stunden später wieder heraus.
Doch da lag der Palastgarten verlassen, und auch der Palast lag verlassen, obgleich niemand es zunächst bemerkte: verlassen von einem Unsichtbaren. Nur eine offene Seitentür zeugte von seinem Fortgehen.
Die Stadt empfing Jumar mit offenen Armen, doch falls sie seine unsichtbaren Schritte spürte, so scherte sie sich weder um das uralt-adelige Blut, das in seinen Adern floss, noch um seine Unerfahrenheit. Sie schleuderte ihm ihren Gestank, ihren Staub, ihre Hitze und ihre Farben ohne Rücksicht ins Gesicht.
Jumar spürte ihre Ohrfeigen und begrüßte sie.
„Ich bin frei“, flüsterte er in den Wind, der Unrat und Papierfetzen durch die Straßen fegte. „Ich bin frei. Ich, der Thronfolger Nepals, ich, Jumar, bin kein Gefangener mehr. Ich bin sogar noch viel freier als jedes andere Geschöpf auf der Welt. Ich kann tun und lassen, was ich möchte, und verdammt will ich sein, wenn ich je wieder wünsche, sichtbar zu werden!“
Er streifte die Handschuhe ab und genoss es, die Luft an seinen Fingern zu spüren.
Die Tauben flogen erstaunt vor seinen Füßen auf, berührt von etwas, das sie nicht sehen konnten. Dann die Tempel, unübersichtlich über den Durbar Square verteilt, jenen großen Platz, an dem der Palast lag. Die streunenden, narbenbedeckten Hunde, die im Schatten der Tempelstufen schliefen. Die Bettler. Die Betenden. Die Menschen, die Menschen, die Menschen. Er hatte sie oft gesehen, von oben, aus den Fenstern des Palastes oder von seinem Dach aus, doch wie anders es sich anfühlte, mitten unter ihnen zu sein! Sie drängelten und schubsten, schrien und lachten, beteten und feilschten – und wann immer einer von ihnen mit Jumar zusammenstieß, freute er sich über den verwirrten Ausdruck auf ihren Gesichtern. Er erklomm die Stufen eines der Tempel und setzte sich ganz oben vor die uralte, dunkelhölzerne Konstruktion aus zerfallender Schnitzerei. Von dort aus konnte er dem Palast in seine Fensteraugen sehen. Er sah auch die drei Panzer, die davor standen, und die Soldaten seines Vaters, die in verborgenen Nischen auf den Vorsprüngen im ersten Stock kauerten, ihre Gewehre seit Wochen ins Leere gerichtet, und ihm wurde kalt.
Schließlich räusperte er sich und hielt eine kleine Rede.
So, wie es nur jemand tun kann, der vierzehn Jahre zählt und dessen Herz voll ist von Trauer und Wut und Rache und Abenteuerlust. Und leer, was alle übrigen Erfahrungen betrifft.
„So“, sagte er leise, und das Blut sang in seinen Adern in einem wundervoll neuen, beunruhigenden Rhythmus, „so, und nun wird alles anders. Da sitzt du in deinem Garten, mein Vater, und gießt deine Blumen und hast keine Ahnung von nichts, tatenlos sitzt du da wie ein alter Mann. Und der bist du. Du hast dich selbst alt gemacht. Aber ich, Jumar Sander Pratap, ich werde nicht tatenlos bleiben. Hah! Ich werde hinaufgehen in die Berge und den Anführer der Aufständischen finden, und ich werde ihn töten, so wie seine Leute den alten Tapa getötet haben. Ich bin unsichtbar, und keiner weiß von mir, und es wird ein Leichtes sein, mich bei ihnen einzuschleichen. Ich habe einen wasserdichten Rucksack aus den Staaten und darin eine norwegische Qualitäts-Taschenlampe und eine Decke aus feinstem Kaschmirgewebe. Indische Streichhölzer habe ich eingepackt und eine belgische Limonadenflasche voll Wasser und englisches Scotch Tape und eine Tüte einheimisches Fruchtgummi. Außerdem eine Kassette voll Geld. Ich habe an alles gedacht. Ich werde auch die Drachen finden und dafür sorgen, dass die Menschen keinen Hunger mehr leiden müssen. Damit du es nur weißt, mein Vater. Ich werde sie finden und besiegen, egal wie. Und dann wirst du einsehen müssen, dass ich mehr bin als ein dummes Kind, das im Palast seine Schulstunden absitzt und dem man nicht zuzuhören braucht. Dann wirst du aufhören, meine Existenz zu verleugnen. Du wirst zu den Menschen sagen: Seht nur, was für einen mutigen Sohn ich habe, und dann kannst du dich in deinen Garten setzen und ein Buch lesen, von mir aus, vielleicht eines über die Pflege von Rhododendron“ – hier musste er ein wenig lachen bei seiner Rede – „denn dann werde ich es sein, der das Land regiert. Und du wirst mir den Schlüssel geben, den Schlüssel zu einem gewissen Zimmer, denn wenn ich zurückkehre nach Kathmandu, dann werde ich erwachsen sein.“
Zu diesem Zeitpunkt wusste Jumar Sander Pratap nicht, wie recht er hatte.
Die Tauben nahmen seine Rede gleichgültig hin und pickten weiter am Fuße der Tempelpagode nach den bunt eingefärbten Reiskörnern, die von der einen oder anderen Opfergabe übrig geblieben waren. Die Hunde gähnten und kratzten sich die Flöhe tiefer ins Fell. Und die Menschen schubsten sich weiter gegenseitig über den Durbar Square.
Nur ein alter Bettler hörte Jumars Rede.
„Was für klingende Worte“, sagte er, und Jumar fuhr herum, denn er hatte nicht gemerkt, dass der Alte neben ihm Platz genommen hatte. Er hielt einen Stock zwischen seinen krummen, zerschundenen Knien und schien zu alt und zu gebrechlich, um auf Tempelpagoden herumzuturnen.
„Lass mich das Gesicht sehen, das zu diesen Worten gehört“, verlangte er und streckte seine Hand aus. Jumar wollte zurückweichen, doch die knochigen, braunen Finger hatten ihr Ziel bereits gefunden und wanderten nun aufmerksam über die junge, glatte Haut.
Verwundert suchte Jumar in den Augen des Bettlers nach einer Erklärung. Erst als er sah, dass diese Augen weiß waren und keine Iris besaßen, begriff er: Der Alte war blind. Für ihn war Jumar nicht weniger zu sehen als irgendjemand anderer.
„Ein Gesicht ohne Spuren“, sagte der Alte und lächelte. „So hat der König ohne Zukunft einen Sohn mit einem Gesicht ohne Spuren. Ich mag es, wenn die Ironie in den Dingen so leicht zu begreifen ist.“
Jumar sprang auf und schüttelte verwirrt den Kopf.
„Ich begreife überhaupt nichts!“, sagte er. „Darf ich Euch eine dumme Frage stellen?“
„Es gibt nur dumme Fragen“, antwortete der Bettler.
„Könnt Ihr mir sagen, wie ich in die Berge komme?“
Der Bettler lachte. „In welche Berge, mein Junge? In welche Berge?“
„Dorthin, wo sich die Aufständischen verstecken“, sagte Jumar.
Der Bettler legte den mageren Finger an die Lippen. „Nicht alles in dieser Stadt muss man laut sagen“, erklärte er. „Und wenn einer so genau wüsste, wo du da hinmusst, dann wäre manchem geholfen. Der, der es wüsste, aber, lebte gefährlich. Ich für meinen Teil würde in einen Bus nach Norden steigen. Im Norden, sagen sie, ist schon besetztes Gebiet. Dorthin traut sich kein Polizist mehr und kein Soldat. Nur die Drachen trauen sich dorthin.“
Da durchlief es Jumar von innen heiß wie nach einer zu schnell zerkauten Chilischote.
„Gibt es sie denn?“, wisperte er.
„Wen?“, fragte der blinde Bettler. „Die Polizisten? Oder die Soldaten?“
„Die Drachen“, flüsterte Jumar.
Der Bettler schwieg.
Und schließlich schluckte Jumar die Reste der nicht verschluckten Chilischote hinunter und fragte: „Wo finde ich einen Bus nach Norden?“
„Wie wäre es mit dem Busbahnhof?“, fragte der Bettler zurück.
Jumar machte den Mund auf, um zu fragen, wo der Busbahnhof war. Wozu, dachte er, hatte er eigentlich vier Jahre lang bei einem Privatlehrer Geografieunterricht gehabt, wenn er nicht einmal wusste, wo in seiner eigenen Stadt der Busbahnhof war? Die Busbahnhöfe, die Jumar kannte, befanden sich in den Filmkulissen von Hollywood.
Als er vom Tempel kletterte und jemand anderen nach dem Busbahnhof fragte, erhielt er keine Antwort, sondern nur einen erschrockenen Blick. Schließlich quetschte er sich mit zwei Frauen und einer Menge Gepäck in eine Rikscha und schickte ein Stoßgebet an alle Götter Nepals und an Buddha und sicherheitshalber auch an den Christengott, dass sie zum Busbahnhof fuhr.
Wenigestens eine der drei Parteien erhörte ihn.
Und so saß der Thronfolger Nepals am Nachmittag jenes Tages (an welchem der blassgrüne Lizzard über die Mauer des Palastgartens huschte) mit angezogenen Knien im hinteren Teil eines überfüllten Busses zwischen einem Schaf, drei großen Holzkisten und einer Frau, die ihr Kind unter seinen neugierigen Blicken abwechselnd mit der linken und der rechten ihrer wohlgeformten Brüste stillte.
Einmal – und nur aus Gründen der extremen Enge – streifte seine bloße Hand die Bluse der Frau, und da wurde der Stoff ganz und gar unsichtbar. Aber nur für eine halbe Sekunde. Danach zog Jumar die Handschuhe schnell wieder über. Er schwor sich jedoch, sie nie mehr auszuziehen, wenn er nicht absichtlich etwas verschwinden lassen wollte.
Die Männer im Bus jedoch fragten sich, ob doch etwas Wahres an dem Sprichwort war, dass man mit seinen Blicken eine Frau ganz und gar entkleiden könne – und sei es nur für eine halbe Sekunde.
An diesem Tage aber machte sich ein Gerücht auf den Weg von Kathmandu hinaus ins Land, über die grünen Reisterrassen hinauf in die Berge: das Gerücht, dass der König einen Sohn besaß, von dem bisher niemand gewusst hatte. Und dass er auf dem Weg war, auf dem Weg zu seinem Volk. Und dass er alles ändern würde, was bis dahin gewesen war.
Flüsternd, wispernd, raunend – Gerüchte reisen schneller als der Wind, schneller in jedem Fall als die Busse, die die Stadt in ihrem holprigen, schlecht gefederten Galopp verlassen, und so überholte das Gerücht den unsichtbaren Thronfolger lange, lange bevor er davon wusste.
Es ließ sich in den Bergen nieder, machte es sich in den Lehmhütten der Dörfer und auf den Feldern bequem und setzte sich in den Staub der Gassen, um auf ihn zu warten. Aber das Gerücht war mit blinden, weißen Augen geboren worden, und es wusste nicht, dass der Thronfolger unsichtbar war.
Als der Bus den ewigen Stau um Kathmandu verlassen hatte, war Jumar fest eingeschlafen. Er erwachte sehr viel später davon, dass der Bus mit quietschenden Reifen hielt. Die Frau mit den wohlgeformten Brüsten war ausgestiegen. Jumar drängte das Schaf zur Seite, um aus dem Fenster zu sehen. Draußen war es Nacht, und die Nacht war leer. Es schien keinen Boden darin zu geben. Jumar erschrak. Aber dann begriff er, dass er in ein Tal hinunterblickte. In das Tal Kathmandu Valley. Der Bus stand in einer der Serpentinen, und Jumar befand sich auf dem Weg in die Berge. Die nächsten drei Stunden ruckte der Bus nur millimeterweise vorwärts, und sein unsichtbarer Passagier bewegte sich zwischen diesen Rucken in einem Nebel zwischen Träumen und Wachen – er sah seinen Vater durch den Nebel schweben, sah den Pavillon im Garten auftauchen und das weiße Bett seiner Mutter, sah in den Nebelschwaden ihr schlafendes Gesicht – doch es verwandelte sich in das blutverschmierte Gesicht des alten Tapa mit den verquollenen Augen und den aufgesprungenen Lippen. Die Lippen öffneten sich, als wollten sie noch etwas sagen, etwas über die Drachen. „Das ist noch nicht alles“, hörte er im Nebel seines Traumes Tapa flüstern, „es gibt noch etwas, was du wissen musst … alle aussteigen!“
Jumar fuhr hoch, doch es war nicht Tapa, der die Leute jetzt unsanft von ihren Sitzen scheuchte, es war ein Polizist in blaugrauer Uniform. Jumar drängte sich mit den Leuten aus dem Bus und merkte, wie gut es tat, seine Beine zu strecken. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er lange und unbequem still gesessen.
„Interessant“, bemerkte er zu sich selbst, „sehr interessant.“
Die kühle Nachtluft streichelte seine Wangen, und sie trug die aufregenden Gerüche von Benzin, verbranntem Gummi und Schafsdung. Die Kolonne der Fahrzeuge erstreckte sich bis weit hinter die nächste Kurve, und gleich darauf sah Jumar, weshalb sich die Fahrzeuge hier im Nichts stauten: Vor ihnen lag einer der Kontrollpunkte, von denen er gehört hatte.
Hier also kontrollierten die Leute seines Vaters, ob sich Kommunisten im Bus befanden oder ob jemand den Kommunisten etwas brachte – Waffen, Papiere, Munition.
Er sah, wie sich die Leute in eine Schlange stellten, um an einem kleinen Tisch vorüberzugehen, wo zwei weitere Polizisten ihre Taschen öffneten und den Inhalt herauszerrten. Sie wühlten in der gefalteten Wäsche und schienen unzufrieden zu sein, weil sie nichts fanden. Jumar bekam allein vom Zusehen einen schlechten Geschmack im Mund und war froh, als der Bus schließlich weiterfuhr und er seinen Platz zwischen dem Schaf und den Kisten wieder einnehmen konnte.
Es war Zeit, dass jemand die Polizeikontrollen abschaffte. Es war Zeit, dass sie unnötig wurden. Das Schaf sah mit traurigen Augen durch ihn hindurch, und in seinen senkrechten Pupillen spiegelte sich nichts.
Am nächsten Morgen erwachte Jumar davon, dass das Schaf ihn trat, als es auf dem glatten Boden des Busses ausrutschte. Er fuhr hoch und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Der Bus war beinahe leer. Eben hatte er am Rand eines Flusstals gehalten, und auf der anderen Seite dieses Tals sah Jumar einen Pfad, der sich hinauf in die Berge schlängelte. Er sah nur seinen Anfang. Einen vielversprechenden Anfang zwischen dem üppigen Grün der Reisfelder und dem Gelb von blühenden Bäumen.
Er schaffte es gerade noch, aus dem Bus zu springen, ehe dieser wieder anfuhr.
Der Pfad, sagte Jumar sich, war der Beginn seiner Reise. Und er legte den Kopf in den Nacken und sah empor zu den Bergen, die sich in ihrem grünen Kleid von dichtem Wald vor ihm erhoben. Ein seltsames Gefühl riss an seinem Magen.
„Hunger“, sagte Jumar und lächelte. Er war es gewohnt, mit sich selbst zu sprechen, denn obwohl sein Leben bis dahin ein behütetes und einfaches gewesen war, war es auch ein einsames gewesen. Niemand spricht gerne lange mit Leuten, die er nicht sehen kann. Und niemand spricht gerne lange mit einem Thronfolger. Wie häufig die Leute sich mit Thronfolgern unterhalten, die man nicht sehen kann, lässt sich leicht ausrechnen, vor allem, wenn man einen so präzisen Mathematikunterricht genossen hatte wie Jumar.
Jumar hatte in seinem Mathematikunterricht nicht gelernt, wie man sich ernährt, wenn man nicht alle fünf Stunden eine warme Mahlzeit an einem Tisch mit Blick zum Garten serviert bekommt. An der Straße standen ein paar hölzerne Bretterbuden, in denen Teigpasteten verkauft wurden. Interessiert betrachtete Jumar die Fliegen, die sich auf den Pasteten sammelten, und sah zu, wie ein kleines Kind auf dem Boden einer Bretterbude neben der Schale mit dem Teig den Inhalt seiner Windel verschmierte. Er schluckte. Er schluckte ein zweites Mal. Dann scheuchte er die Fliegen fort, nahm eine Teigpastete und sah, wie sie verschwand, als er sie berührte. Die Frau, die die Pasteten gedankenverloren betrachtet hatte, stieß einen kleinen spitzen Schrei aus.
Jumar war derlei Reaktionen nicht gewohnt, da man im Palast wusste, dass alle toten Gegenstände, die er mit der bloßen Haut berührte, ebenfalls unsichtbar wurden. Er ließ die Pastete fallen, und sie wurde wieder sichtbar. Die Frau schrie noch einmal, und er zuckte zusammen.
„Jetzt ist es aber genug“, sagte er dann laut und nahm die Pastete mit Todesverachtung zum zweiten Mal auf. Er biss hinein, und zu seiner Verwunderung schmeckte sie gar nicht schlecht. Eine der blauen Plastikwasserflaschen nahm er ebenfalls mit, denn immerhin, sagte sich Jumar, war er der Thronfolger, und er hatte ein gewisses erbliches Anrecht auf jene blaue Plastikflasche. Dann fiel ihm ein, dass er eine Kassette voll Geld aus dem Palast mitgenommen hatte, und er legte einige Münzen auf die hölzerne Theke.
Die Frau sah die Flasche vor ihren Augen verschwinden, sah, wie die Münzen sich materialisierten, und schüttelte den Kopf noch lange, nachdem der unsichtbare Thronfolger nicht mehr da war. Aber natürlich machte es für sie keinen Unterschied, ob er da war oder nicht.
Ungesehen, unbemerkt, unbegleitet machte sich Jumar auf den Weg ins Flusstal hinunter, wanderte über eine metallene Hängebrücke, die unter seinen Füßen schwankte, durchquerte die Reisterrassen und befand sich gleich darauf auf dem Weg hinauf in den Wald.
Das grüne Dickicht aus übergroßen Blättern und Lianen schloss sich um ihn wie ein Meer, und er sagte wieder: „Interessant.“
Eine halbe Stunde später betrat er ein Gebüsch, um einer selbst für Thronfolger notwendigen Tätigkeit nachzugehen. Auf seinem Rückweg zu dem Pfad, dem er gefolgt war, biss etwas in seinen Fuß.
Er schnappte vor Erstaunen nach Luft und sah an seinem Bein hinunter. Da war etwas, das sich darum geschlossen hatte wie die Kiefer eines kleinen, starken Tieres. Jumar zog an dem Fuß, kam aber nicht weiter. Es tat weh. Er kniete nieder und bog die grünen Stauden zur Seite, die seinen Fuß und das kleine Tier verbargen. Es war nichts zu sehen. Jumar tastete eine Weile.
„Interessant“, sagte er zum dritten Mal an diesem Tage. Das Tier war kein Tier, sondern eine Konstruktion aus rostigem Metall, fest im Boden verankert und mit einem Federmechanismus versehen. Er versuchte, die eisernen Kiefer mit den Händen auseinanderzubiegen, doch sie saßen zu fest. Und die winzigen Zähne daran bohrten sich tiefer und tiefer in die Haut seines Knöchels.
Im Geiste ging er die vielen nützlichen und internationalen Dinge durch, die er in seinem Rucksack mitgenommen hatte: belgische Limonade. Einheimisches Fruchtgummi. Eine norwegische Taschenlampe. Was er jetzt gebraucht hätte, wäre ein Schweizer Messer gewesen. Aber er hatte kein Schweizer Messer.
„Hee!“, rief er. „Hee! Ist da jemand, der mich hört?“
Es war niemand da.
Nach einer Weile wurden Schritte auf dem Weg laut, und er rief wieder, lauter, verzweifelter. Kurz darauf teilten sich die Zweige, und ein Mann mit einem Tragegestell voller Kisten auf dem Rücken starrte Jumar ins Gesicht.
Doch er sah ihn nicht. Natürlich sah er ihn nicht. Niemand sah ihn. Und er sah nicht einmal die Falle, die durch den Kontakt mit Jumars Haut ihr optisches Dasein eingebüßt hatte.
„Bitte“, sagte Jumar, „befreien Sie mich aus diesem Ding. Ich bin hineingetappt, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte … aber es ist nun mal passiert, und alleine schaffe ich es nicht.“
Der Mann starrte ihn weiter an und schüttelte den Kopf. Dann taumelte er rückwärts, drehte sich um und rannte fort. Jumar hörte es in den Kisten auf seinem Rücken klappern, und er hörte, wie sich seine Schritte durchs Unterholz entfernten.
Dann hörte er lange, lange Zeit nichts mehr.
Und er sagte sehr lange Zeit nicht mehr „interessant“.
Immergrüner Nebelwald
(Höhe: 1400 – ca. 2700 m)
Flora: Großblättrige Alpenrose (Rhododendrongrande), Rhododendron (Rhododendronarboreum), schmarotzende Baum-Or-chideen (Agapetes serpens), Wacholder(Juniper communis), Eiche, verschiedeneBaumfarne, Riesenbambus, Mais, Reisim Terrassenbau
Fauna: Wilder Eber, Braunbär, Lemurenaffe,Moschusochse, Muli, gemeiner Blutegel,verschiedene Schmetterlingsgattungen
CHRISTOPHER TRÄUMT
„Wer, wer bist du?“, keuchte Christopher. „Wo bist du?“
„Mein Name ist Jumar“, antwortete eine Stimme aus der Luft. „Und ich würde sagen, wo ich bin, hast du gerade gemerkt. Streck deine Hand aus.“
Christopher zögerte. Was würde er fühlen, wenn er gehorchte? Schuppen, Fell, Klauen, Zähne? Dies war ein Albtraum, es konnte nicht wirklich sein.
„Streck deine Hand aus“, wiederholte die Stimme etwas ungeduldig. Sie schien es gewohnt zu sein, dass man ihr gehorchte.
Christopher fühlte, wie eine andere Hand seine nahm und führte, und gleich darauf spürten seine Finger Haut, Haar … ein Gesicht.
„Siehst du?“, fragte die Stimme – was eine unsinnige Frage war. Natürlich sah Christopher nichts. „Ich bin genauso da wie du. Man kann mich nur nicht sehen.“
„Wie– wieso nicht?“
Die Stimme seufzte. „Keiner weiß das. Ich wurde so geboren. Es hat seine Vor- und Nachteile. Im Übrigen bin ich der Sohn des Königs.“
„Aha“, sagte Christopher verständnislos. „Bitte – welches Königs?“
„Na – des Königs!“, rief die Stimme. „Woher kommst du denn, dass du nicht weißt, wer der König ist!“
„Aus meinem Zimmer“, antwortete Christopher wahrheitsgetreu. „Eben saß ich noch auf meinem Bett, und dann stand ich hier im Urwald.“
„Du spinnst“, sagte die Stimme. „Aber Hauptsache, du hilfst mir. Ich bin in eine Falle geraten, so ein Eisending. Frage mich, was für Tiere sie damit fangen. Man müsste die Feder irgendwie aufbiegen … hier, spürst du sie? Sie ist unsichtbar geworden, weil sie meine Haut berührt. Das ist eines der anderen ärgerlichen Dinge, die geschehen.“
Die Hand führte Christophers Finger über raues, rostiges Eisen, und er fasste in etwas Feuchtes: Blut. Christopher zuckte zurück.
„Ich kann kein Blut sehen“, sagte er.
„Na fein“, sagte Jumar, „du siehst ja auch keins, es ist schließlich unsichtbar. Wenn du hier mal ziehen würdest, dann ziehe ich auf der anderen Seite …“
So zogen sie gemeinsam an den Eisenkiefern der Falle, mühten sich ab und rangen gemeinsam nach Atem, und schließlich spürte Christopher, wie sich die Eisenstücke bewegten, Millimeter für Millimeter. „Es – es funktioniert“, keuchte Jumar. „Weiter! Weiter!“
Christopher kniff die Augen zu, biss die Zähne zusammen und zog mit aller Kraft. Er stellte sich vor, es wäre sein Bruder Arne, der in der Falle saß, stemmte seine Beine in den Boden und zog… „Warte“, hörte er Jumar flüstern, „so müsste es gehen. Noch ein wenig …“
Christopher fühlte, wie ihn die blutfeuchte Haut streifte.
„Lass los“, sagte Jumar. „Aber vorsichtig. Sie wird wieder zuschnappen.“
Gehorsam zog Christopher seine Finger zurück, und vor ihm klickte es metallisch. Gleich darauf lag eine eiserne Falle vor ihm auf dem Blätterboden. Als er die aufeinandergreifenden Zähne vorsichtig berührte, fühlte er Blut daran kleben – unsichtbares Blut. Und jetzt sah er auch den Schuh, der daneben lag. Doch kaum hatte er ihn entdeckt, da löste sich der Schuh auch schon in nichts auf. Alles, was von ihm blieb, war das leise Geräusch einer sich schließenden Schnalle.
Sein unsichtbares Gegenüber hatte den Schuh wieder angezogen.
„Bitte“, sagte Christopher, „erkläre mir – alles, was du berührst, wird unsichtbar?“
„Nur die unbelebten Dinge“, antwortete Jumar. „Und Wasser, zum Beispiel, bleibt, wie es ist. Erde und Stein auch. Es ist eine Frage des Ausprobierens. Wenn ich barfuß ginge, würden vermutlich die toten Blätter auf dem Boden verschwinden. Aber der Weg würde bleiben, wo er ist. Meistens trage ich übrigens Handschuhe. Damit die Sachen, die ich hochhebe, nicht verschwinden. Zum Schuheanziehen ist es allerdings unpraktisch.“
„Interessant“, sagte Christopher.
„Tu mir einen Gefallen“, meinte Jumar, „und sag dieses Wort eine Weile nicht mehr.“
Eine halbe Stunde später saßen sie gemeinsam auf einem Felsen am Wegesrand und blickten in ein Tal hinab, durch das sich ein Fluss in leuchtend blauem Gewand schlängelte.
Eigentlich saß Christopher alleine dort. Aber neben ihm gab es eine Stimme, die ihm eine unglaubliche Geschichte erzählte.
Eine Geschichte von einer schlafenden Frau und einem Garten unter einer riesigen Glaskuppel, von Drachen, die in den Bergen lebten und Farben fraßen, von einem sterbenden Diener und von einem König, der sein Land vergessen hatte. Es wäre ein Märchen gewesen, wären nicht die Flugzeuge darin vorgekommen und die Ärzte und die Computerkurse des Thronfolgers und die Panzer.
„Und nun erzähle du mir etwas über dich“, sagte die Stimme ohne Gesicht. „Ich weiß noch immer nichts als deinen Namen. Wieso bist du hergekommen?“
Das liegt daran, dass du die ganze Zeit über redest, dachte Christopher.
„Ich heiße Christopher“, antwortete er etwas steif.
„Und wieso bist du hergekommen, Kri… Kissen… Kischo…?“, fragte Jumar.
„Christopher“, verbesserte Christopher, um Zeit für eine Antwort zu gewinnen.
„Krischnofer. Wieso bist du hier?“
Ich weiß es nicht, wollte Christopher antworten. Doch dann sagte er etwas anderes.
Er sagte: „Ich glaube, ich bin gekommen, um meinen Bruder zu finden. Arne. Er ist schon neunzehn, und er war eine Weile in Nepal, um in einem Kinderheim zu arbeiten. Er tut solche Dinge. Alle haben ihn gern.“
„Und wo ist er jetzt?“
Christopher seufzte. „Das“, sagte er, „weiß keiner so genau. Sie glauben, die Maoisten haben ihn entführt. Aber sicher ist sich keiner. Er wollte im Annapurnagebiet wandern gehen, ganz alleine … er ist nicht zurückgekehrt.“
Jumar schwieg eine Weile. Er schwieg so lange, dass Christopher begann, an seiner Existenz zu zweifeln. Vielleicht saß er doch alleine auf dem Felsen über dem unverschämt blau glitzernden Fluss?
Er streckte die Hand aus – und spürte, wie eine andere Hand sie drückte.
„Ich bin unterwegs“, sagte Jumar, „um das Lager der Aufständischen zu finden. Und du bist unterwegs, um deinen Bruder zu finden. Und vielleicht ist beides ein und dasselbe. Warum gehen wir nicht zusammen?“
Christopher lächelte. „Hat jemand behauptet, dass wir nicht zusammen gehen? Ich meine, natürlich ist dies ein Traum, und ich werde bald daraus aufwachen, aber solange ich ihn träume, kann ich ihn ebenso gut mit dir zusammen träumen.“
Das war ein sehr schöner Satz, fand Christopher, und es war eigentlich schade, dass keines der Mädchen aus seiner Schule ihn gehört hatte – jener Mädchen, die ihre Tage stets damit verbracht hatten, einen von Arnes schönen Sätzen abzubekommen.
Der Weg wurde steiler, und grobe, steinerne Stufen schlichen sich hinein. Zuerst ging Jumar voran, doch Christopher stieß andauernd gegen ihn. Es war nicht besonders praktisch, unsichtbar zu sein.
So führte Christopher, und hinter sich hörte er Jumars schweren Atem und manchmal das Knacken eines Astes unter seinen Sandalen. Wenn der Weg eben war, sprachen sie miteinander. Solange Christopher sich nicht nach Jumar umdrehte, konnte er sich vorstellen, es wäre ein ganz normaler Mensch, mit dem er unterwegs war, und das war in jedem Fall ein besseres Gefühl, als dauernd mit einer Stimme zu sprechen, die mitten aus der Luft kam.
„Wo befindet sich dieses Lager der Aufständischen?“, fragte Christopher. „Weißt du den Weg dorthin? Wie weit ist es?“
„Oh, wir werden uns erkundigen“, antwortete Jumar. „So genau weiß ich natürlich nicht, wo es ist, und vielleicht ist es nicht leicht zu finden. Aber es ist irgendwo hier in diesen Bergen.“
„Ach was“, meinte Christopher, „da kann es sich ja nur um Wochen handeln, bis wir hinkommen.“
Vielleicht war es gut, dass er nicht wusste, wie viel Wahrheit in seinen Worten lag.
„Sag mal“, fragte Jumar später, „wie kommt es eigentlich, dass du so … normal aussiehst? Hast du nicht erzählt, du wärst aus Holland oder Schweden oder so?“
„Deutschland“, verbesserte Christopher.
„Alles das Gleiche“, sagte Jumar. „Wieso bist du nicht groß und blond?“
„Du meine Güte! Nicht alle Deutschen sind blond und trinken rund um die Uhr Bier vor dem Fernseher!“
„Aber du siehst aus wie die Leute hier“, beharrte Jumar. „Ich habe oft am Fenster gestanden und die Touristen beobachtet, die über den Durbar Square gingen. Und ich kenne eine Menge von euren Filmen. Die Leute darin sind groß und plump und bewegen sich mit der Eleganz von Elefanten.“
„Tatsächlich? Und ich?“
„Du bewegst dich ganz normal, finde ich. Du hast die richtige Größe, und dein Gesicht ist nicht seltsam sondern auf die richtige Art geformt.“
Christopher seufzte. „Da, wo ich herkomme, sehen die Leute das anders. Ich hatte diese Großmutter. Sie kam aus Nepal.“
„Sprichst du deshalb unsere Sprache?“
„Eure Sprache?“ Bisher hatte Christopher überhaupt nicht darüber nachgedacht. Sprach er nepali? Anfühlen tat es sich wie deutsch.
„Es muss an diesem Traum liegen“, murmelte er verwirrt. „Es ist ja nichts weiter. Nur ein Traum. In Träumen kommt das schon einmal vor, dass man plötzlich fremde Sprachen spricht. Es wird wirklich höchste Zeit, dass der Morgen kommt und ich aufwache.“
Der Morgen jedoch kam nie, und die Auswüchse von Christophers Traum sollten für lange Zeit immer dunkler und beunruhigender werden, und der Strudel an Ereignissen, in den sie ihn rissen, weigerte sich standhaft dagegen, durch das Licht eines Sonnenstrahls in seinem Zimmer zu verblassen.
Im Gegenteil: Der Traum, der keiner war, wurde wilder und wilder.
Nach einer schier endlosen Zeit des Aufstiegs gaben die riesigen, schlingpflanzenbehangenen Bäume den Blick auf eine Hochebene frei, und ein hellgrüner Ozean aus Reisfeldern erstreckte sich vor ihren Blicken. In der Ferne lagen die braunen Dächer eines Dorfes. Ein Windhauch strich über die Reispflanzen, und als sich die Halme unter seinen sachten Fingern bogen, war es, als kräusle sich eine ungewöhnlich grüne Meeresoberfläche. Christopher blieb stehen und lauschte. Da war das Rieseln von Wasser, und dann war da noch ein Geräusch in der Luft – war das der Wind in den Zweigen des Urwaldes?
Jumar sah ihn lauschen. „Was du hörst, ist die Bewässerung der Felder“, sagte er. „Der Reis steht im Wasser, und das Wasser läuft in Rinnen von einem Feld zum nächsten. Ich habe das System in einer meiner Unterrichtsstunden gelernt –“
Christopher legte den Finger an die Lippen. „Das ist es nicht“, flüsterte er. „Hörst du jenes andere Geräusch? Über uns, in der Luft?“
„Der Wind“, sagte Jumar gleichgültig, und seine Stimme wanderte an Christopher vorbei, aus dem Wald hinaus auf die Reisfelder. „Oder die Zikaden. Du machst dir zu viele Gedanken. Komm! Da vorne ist ein Dorf, und vielleicht finden wir dort etwas Essbares. Ich bin am Verhungern.“
Christopher zögerte. Das Geräusch in der Luft war jetzt näher herangekommen. Es war wie ein winziges Zischeln, ein leises Rascheln, ein beunruhigendes Knistern, das sich heimlich heranschlich. Im Grün der Reisfelder sah er die bunten Tupfen einzelner Arbeiter, und auch sie richteten sich jetzt auf, um zu lauschen. Da war ein Zischen und Flattern in der Luft, als näherte sich ein Schwarm Vögel, ein riesiger Schwarm Vögel, Hunderte, Tausende –
Der Wind war stärker geworden und die vielen winzigen Stimmen des Waldes verstummt.
Christopher sah auf. War dort nicht etwas wie ein Umriss hoch oben über den Wipfeln der Bäume zu erahnen, in dessen Schatten er stand? Bewegte sich da nicht eine große Gestalt über ihn hinweg?