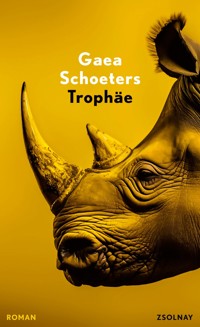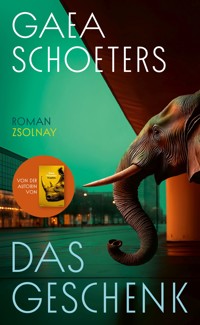
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach »Trophäe« der neue Roman von Gaea Schoeters – über die unausweichlichen globalen Fragen aus europäischer Perspektive Elefanten mitten in der Großstadt, und es werden immer mehr. Was geht hier vor? Rasch muss der Bundeskanzler erkennen, dass die Tiere nicht aus dem Zoo entkommen, sondern ein Geschenk des Präsidenten von Botswana sind. 20 000 Elefanten hat er nach Deutschland geschickt, nachdem die deutsche Regierung ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen beschlossen und damit den armen Regionen Botswanas die Lebensgrundlage entzogen hat. »Ihr Europäer wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Vielleicht solltet ihr es einmal selbst versuchen …« Gaea Schoeters nähert sich nach ihrem Sensationserfolg »Trophäe« den existenziellen Themen des globalen Zusammenlebens aus einer anderen Richtung – und mit blitzgescheitem Humor. Ein neues Lese- und Nachdenkvergnügen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Elefanten mitten in der Großstadt, und es werden immer mehr. Was geht hier vor? Rasch muss der Bundeskanzler erkennen, dass die Tiere nicht aus dem Zoo entkommen, sondern ein Geschenk des Präsidenten von Botswana sind. 20 000 Elefanten hat er nach Deutschland geschickt, nachdem die deutsche Regierung ein Einfuhrverbot von Jagdtrophäen beschlossen und damit den armen Regionen Botswanas die Lebensgrundlage entzogen hat. »Ihr Europäer wollt uns vorschreiben, wie wir zu leben haben. Vielleicht solltet ihr es einmal selbst versuchen …«Gaea Schoeters nähert sich nach ihrem Sensationserfolg »Trophäe« den existenziellen Themen des globalen Zusammenlebens aus einer anderen Richtung — und mit blitzgescheitem Humor. Ein neues Lese- und Nachdenkvergnügen!
Gaea Schoeters
Das Geschenk
Roman
Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing
Paul Zsolnay Verlag
Dedicated to Europe, whatever that is.
Dedicated to courage, whatever that is.
Dedicated to fiction, whatever that is.
»Zur Rettung des Rechtsstaats bin ich bereit, alles zu opfern, sogar den Rechtsstaat.«
Hans Christian Winkler
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Gaea Schoeters
Impressum
Inhalt
Eins
: Paukenschlag
Zwei
: Verzweiflung
Drei
: Veränderung
Vier
: Verrat
Danksagung
Eins
Paukenschlag
Tag 1
Der Elefant steht am Flussufer. Zögerlich prüft er mit der Rüsselspitze das Wasser, das kälter ist als sonst. Kurz lässt er unbehaglich die Ohren rotieren und schaut sich um, als würde er irgendwas oder irgendwen suchen. Er stößt ein leises, tiefes Grollen aus, erhält aber keine Antwort. Erneut widmet er sich dem Wasser, beschnüffelt die Oberfläche, entrollt seinen Rüssel vollständig, taucht die Spitze unter und saugt die kühle Flüssigkeit auf. Wirft dann den Kopf in den Nacken, führt die Rüsselfinger zum Mund und trinkt gierig. So bleibt er stehen — mit der Spitze im Mund und genüsslich geschlossenen Augen hinter den sanft zitternden Wimpern. Sein Körper entspannt sich, er beugt ein Knie, lehnt lässig auf dem linken Fuß. Die aufgehende Sonne färbt das Tier gelbgrau ein; nur die Stellen, an denen die Haut nass ist, setzen sich dunkel vom Rest ab. Die Wassertropfen, die aus dem Mundwinkel spritzen, glitzern im Sonnenlicht. Dann erstarrt der Elefant für ein paar Sekunden, lässt den Rüssel fallen und saugt die Luft ein. Ein unbekannter Geruch weht ihm entgegen. Auf der Suche nach dem Ursprung hebt er den Rüssel etwas weiter hoch, die dunkle, nasse Spitze bewegt sich forschend umher. Im Gegenlicht zeichnen sich die langen Haare auf der Haut und am Kinn deutlich vor dem hellgrauen Himmel ab. Plötzlich dreht er den Kopf: Da! Bedrohlich und erhaben richtet er sich auf, spreizt die Ohren und blickt zur anderen Uferseite, aus dessen Richtung der Geruch kommt. Der Geruch und das Geräusch sich nähernder Schritte.
Der Mann auf der anderen Seite sieht ihn nicht. Angetrunken und selbstverliebt schreitet er die Uferpromenade am Wasser entlang. An der Flusskrümmung bleibt er stehen. Obwohl noch nichts in Stein gemeißelt ist und er weiß, dass er sich zu früh freut, übermannt ihn ein grenzenloser Siegestaumel. Er angelt sein iPhone aus der Innentasche des Jacketts, entsperrt es und streckt den Arm aus, um ein Selfie zu machen. Bemerkt dann, dass sein Krawattenknopf locker ist, lässt das Handy wieder sinken und macht ihn fest. Ordnung ist nicht nur das halbe Leben, sondern stellt auch den kürzesten Weg zur Macht dar, davon ist er überzeugt. Wieder richtet er die Kamera auf sich selbst und schaut in die Linse. Diesmal ist er mit dem Anblick zufrieden. Er fährt sich ein letztes Mal durch die Haare, verzieht das Gesicht zu einem selbstgefälligen, triumphierenden Lächeln und kneift die Augen halb zu — ein Tipp seines Medientrainers. Wirkt sympathischer. Dann betätigt er den Auslöser. Hinter ihm glänzt die Glaskuppel des Reichstags im Licht der aufgehenden Sonne. Wenn das, was der Journalist ihm da eben erzählt hat, stimmt, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er da drinnen das Sagen hat, statt lediglich toleriert zu werden. Dann ist die gleißende Kugel sein Spielball, und der weiße Kubus des Bundeskanzleramts, der in der Ferne über seiner linken Schulter hervorlugt, sein zukünftiges Büro.
Er lässt das Mobiltelefon wieder in die Innentasche gleiten und geht weiter am Wasser entlang. Vor seinem geistigen Auge sieht er sich schon auf dem Balkon der siebten Etage stehen, mit Blick über die ganze Stadt. Die ihm gehört. Ihm und den anderen Deutschen. Als er am ARD-Hauptstadtstudio vorbeikommt, grinst er voller Vorfreude — tja, sie werden ihn wohl bald anrufen und einladen müssen. So ein Ergebnis kann nicht ignoriert werden. Fast am S-Bahnhof angekommen, fällt sein Blick auf zwei unter der Eisenbahnbrücke schlafende Obdachlose. Die behelfsmäßige Plane, die sie vor dem unter der Brücke durchpfeifenden Wind beschützen soll, hat sich gelöst und flattert wie ein verzweifelter Vogel über ihren Köpfen. Mit bösartiger Freude kickt Holger Fuchs eine ihrer leeren Bierflaschen weg — laut klimpernd zerschellt sie an den Brückenpfeilern.
»Aufgewacht, Leute. Jetzt weht ein neuer Wind in Deutschland, und zuallererst werden wir die Stadt durchfegen. Ihr könnt schon mal einpacken.«
Vom Lärm alarmiert, dreht sich einer der Männer um und richtet sich halb auf — bereit, sich selbst und seine Habseligkeiten zu verteidigen. Fuchs geht schnell weiter und läuft beschwingt die Treppe hoch, gerade rechtzeitig, um in die einfahrende S-Bahn zu springen, die ihn in weniger als zwanzig Minuten nach Hause bringen wird.
Der Obdachlose hat sich in seinem Schlafsack aufgesetzt und sucht in der Plastiktüte mit Wertgegenständen, die er sich nachts immer an die Brust presst, nach seinen Zigaretten. So wie jeden Morgen, bevor der Alkohol die ungeschönte Realität des Tages abschwächt, sieht er die Welt unangenehm scharf. Zwischen den Brückenpfeilern stöbern Ratten herum, zwei von ihnen zerren an den Enden einer Brotkruste, als hinge ihr Leben davon ab. Tut es vielleicht auch. Eine dritte ist in eine weggeworfene Burgerverpackung gekrochen, nur der Hintern mit dem nackten Schwanz hängt heraus; ihre Hinterpfoten stemmen sich gegen den Rand, um besser ziehen zu können. Kurz beobachtet er sie amüsiert, dann konzentriert er sich wieder auf die Suche, aber die Zigaretten sind nicht auffindbar. Frustriert wirft er die Tüte zur Seite und öffnet den Reißverschluss des Schlafsacks. Die Ratten zischen weg, nur die in der Burgerverpackung lässt sich nicht stören und futtert gierig weiter. Widerwillig reibt sich der Mann den Schlaf aus den Augen und schlägt sich anschließend ein paarmal auf die Schultern, um die Kälte der Nacht aus seinem Körper zu vertreiben. Mit mäßigem Erfolg. Jeden Morgen erinnern ihn seine steifen Knochen daran, dass er in einem Land auf der Straße geschlafen hat, das dafür zu kalt ist. Genau wie die dumpfen Kopfschmerzen und der Gestank nach Pisse und schalem Bier, der, ganz gleich, wie stark der Wind weht, unter der Brücke hängen bleibt, ihn jeden Morgen unsanft an seine elendige Existenz erinnern. Sein Blick fällt auf den Müllbeutel mit Plastikflaschen, die er gestern Abend noch gesammelt hat, und deren Pfandgeld er gleich einsacken kann. Automatisch überschlägt er die Summe: fünfundzwanzig Cent, fünfzig, ein Euro, zwei Euro … plus die leeren Bierflaschen … zwei Euro sechzehn … knapp vorbei am Kaffee. Enttäuscht lässt er den Blick über das Wasser wandern — sogar jetzt, nach all den Jahren, gelingt es dem Fluss, seine Wehmut zu schmälern. Aber was ist das? Er packt seinen Kumpel, der noch schläft, an der Schulter und rüttelt ihn wach.
»Ein Elefant. Da steht ein Elefant im Fluss.«
Ohne die Augen zu öffnen, schiebt sein Kumpel die Hand weg.
»Ich weiß nicht, was du gestern geraucht hast, aber anscheinend bekommt dir der Stoff nicht gut. Schlaf weiter.«
»Na, schau doch selbst!«
Aber da hat sich der andere schon wieder die Decke über den Kopf gezogen — ein unnachgiebiges Bündel Widerwille. Der Obdachlose krabbelt aus seinem Schlafsack und geht so leise wie möglich zum Ufer. Dort hockt er sich auf den Asphalt und beobachtet atemlos das Schauspiel im Wasser.
Mitten in der Spree badet ein Elefantenbulle. Gemächlich lässt er seinen behäbigen Körper ins Wasser sacken, geht in die Knie und verschwindet unter der Wasseroberfläche. Kurz denkt der Mann, er hätte sich das gerade eingebildet, der Alkohol muss sein Gehirn vernebelt haben, doch da taucht das Tier schon wieder auf; die großen Ohren hängen ihm wie zwei dünne, feuchte Putzleder am Kopf. Fröhlich rollt der Elefant sich im Wasser hin und her. Dann erscheint neben ihm aus dem Nichts ein weiterer Rüssel, wie ein Periskop. Ein zweiter Elefant erhebt sich aus dem Fluss. Leise grollend begrüßen sich die beiden Kolosse und schlingen ihre Rüssel umeinander. Drücken sich im Flussbett vor und zurück. Kämpfen sie? Nein, ihre Kopfstöße wirken nicht aggressiv, sie scheinen eher zu spielen. Neckisch legt der eine den Rüssel über die Schulter des anderen und drückt seinen Kopf unter Wasser, woraufhin sein Gegenüber freudig prustend wieder auftaucht. Der andere gönnt ihm keine Verschnaufpause, stemmt sich auf seinen Rücken und tunkt seinen Kopf mit den Vorderbeinen erneut unter, aber diesmal wehrt sich sein Kontrahent. Mit erhobenem Rüssel versucht er, den Kopf über Wasser zu halten, die Stoßzähne zum Himmel zu richten, bis er einsehen muss, dass der andere stärker ist, oder jedenfalls schwerer; er lässt sich gelassen ins Wasser sacken und schwimmt ein paar Meter weit weg. Um sich dann jäh umzudrehen und einen Gegenangriff einzuleiten. Minutenlang hält das träge Wassermassenwrestling der Kolosse an, bis einer der Elefanten plötzlich ein verrostetes Fahrrad aus dem Wasser fischt. Triumphierend schwenkt er es über dem Kopf und schleudert es dann in großem Bogen von sich weg, ans Ufer. Laut trompetend schüttelt er den Kopf. Das Fahrrad landet ein Stück entfernt auf der Promenade; ein sich nähernder Radfahrer muss eine Vollbremsung hinlegen. Fluchend bleibt er stehen und versucht herauszufinden, wo das Fahrrad plötzlich herkam, doch als er begreift, was sich dort im Flussbett abspielt, wirft er sein eigenes Bike zur Seite, schnappt sich sein Handy und fängt an zu filmen. Oben auf der Brücke donnert währenddessen die S-Bahn vorbei und bringt frühe Pendler zur Arbeit. Die Stadt erwacht.
*
Bundeskanzler Hans Christian Winkler weiß nichts von alledem. In seinem Haus am Wannsee verlief der Start in den Tag genauso ruhig wie immer. Als der Wecker klingelte, ist er sofort aufgestanden, ohne die Schlummertaste zu betätigen, hat sich rasiert, geduscht und angezogen und betritt jetzt im Hemd die Küche, wo seine Frau gerade frischen Kaffee auf den Tisch stellt. Neben seinem Teller liegen die Tageszeitungen — er legt viel Wert darauf, sie in Papierform zu lesen und nicht einfach auf seinem Smartphone durch die Überschriften zu scrollen. Winkler glaubt an Gründlichkeit. Gründlichkeit und Routine. Solange man alles, was davon abweicht, schnell genug wieder in die geordneten Bahnen lenkt, bleibt die Welt auf Kurs, und das Leben somit auch. Während er sich Kaffee einschenkt, zieht er die erste Zeitung zu sich. Zufrieden entdeckt er sich auf der Titelseite — ein Foto seiner ruhigen und entschlossenen Ansprache vor dem Parlament. Der Bundestag hat sein Elfenbeingesetz mit deutlicher Mehrheit verabschiedet und damit die Bedingungen für den Import von exotischen Jagdtrophäen beträchtlich verschärft. Eine Maßnahme, an der niemand Anstoß nehmen sollte, die er den Grünen aber als Gefallen verkaufen kann, damit sie im Gegenzug die Bauern mit neuen Stickstoffsteuern nicht so sehr malträtieren. Eine Hand wäscht die andere. Das zeichnet nun einmal einen guten Führungsstil aus. Er überfliegt den Artikel. Das Foto ist zwar kleiner als erhofft, aber im Text kommt er gut weg. Schutz bedrohter Tierarten, damit punktet man immer. Er trinkt einen Schluck Kaffee und schlägt die Zeitung auf — seine Hand bleibt in der Luft hängen. Eine ganze Doppelseite, auf der die aktuellen Umfrageergebnisse analysiert werden — und auch ohne sie zu lesen, erkennt er schon an der Grafik, dass seine Partei alles andere als gut abschneidet.
Zehn Kilometer nordöstlicher öffnet Holger Fuchs auf seinem Tablet die gleiche Zeitung mit einem Klick und betrachtet die Grafik. Auf seinem Gesicht ist unverhohlener Triumph abzulesen. Während er weiterliest, tastet er nach seinem Smartphone, das zum Aufladen auf der Küchenzeile liegt. Jetzt hält ihn nichts mehr davon ab, das Selfie zu posten. Schnell tippt er seinen Status ein: Zuerst übernehmen wir den Reichstag und dann das Bundeskanzleramt. Ohne genau hinzusehen, tippt er auf »Foto hinzufügen« und scrollt durch seine Galerie zu dem Bild von heute Morgen. Aber bevor er es hochlädt, zoomt er nochmal ran, um sicherzugehen, dass er zwar kämpferisch, aber nicht zu verbissen aussieht. Image ist alles, jeder Fehler kann fatal sein. Und dann sieht er es: Unter der Fußgängerbrücke am Spreeufer, die Osten und Westen verbindet, steht ein Elefant. Kein Kunstwerk, keine Statue, sondern ein echter Afrikanischer Elefant in Angriffshaltung. Diese verfickte KI. Wütend schiebt er das Tablet zur Seite und ruft seinen Social-Media-Manager an. »Mein Handy wurde gehackt. Ein Deepfake. Wie kann das sein?!«
Am Wannsee versucht Frida Böhm-Winkler unterdessen, ihren Mann zu beruhigen, der deprimiert die Zeitung anstarrt und mit Daumen und Zeigefinger seine Augenbrauen massiert, was er öfter tut, wenn er sich Sorgen macht — ein Tic, der ihm nach all den Jahren in der Politik seine charakteristischen struppigen Augenbrauen beschert hat.
»Das ist nur eine Umfrage. Sieh es als Motivation, als zusätzlichen Grund, sich da gemeinsam dahinterzuklemmen und das Ruder herumzureißen. Vielleicht tut das der Koalition ja gut.«
Verärgert schaut Winkler seine Frau an. »Ist das dein Ernst?«
Frida ignoriert den scharfen Ton und reagiert mit der unverwüstlichen Ruhe, mit der sie ihre Ehe die letzten dreißig Jahre durch jede turbulente Phase gelotst hat. »Jetzt werden sie ja wohl alle begreifen, dass die Lage ernst und die Zeit der politischen Spielchen vorbei ist.«
Trübsinnig schüttelt Winkler den Kopf. »Ich befürchte, das mit den Spielchen geht jetzt erst so richtig los.«
In dem Moment klingelt sein Handy. Er wirft einen Blick auf den Bildschirm und seufzt. »Da fängt’s schon an.«
Winkler trägt seine Tasse zur Spüle und nimmt den Anruf entgegen. »Otto, guten Morgen. Na ja, was heißt schon gut, viel schlechter hätte der Tag ja gar nicht anfangen können … Was sagst du? Ein Elefant? Im Spreebogenpark? Ist das ein Scherz? Soll mich das aufheitern, oder was? Nicht der einzige? Was? Ich höre dich nicht, die Verbindung … Nein, ja, okay, ich komme.« Er legt auf, dreht sich um und schnappt sich das Jackett vom Stuhl, über den er es ordentlich gehängt hatte.
Frida beobachtet ihn amüsiert. »Was war das denn für eine Geheimsprache?«
Winkler schüttelt verunsichert den Kopf. »Keine Ahnung. Anscheinend wurden Elefanten an der Spree gesichtet. Wahrscheinlich aus dem Zoo ausgebrochen. Ich habe das nicht so ganz verstanden, Otto saß noch in der U-Bahn, und die Verbindung war dauernd weg. Wie auch immer, ist nicht mein Problem. Das fällt in den Zuständigkeitsbereich der Stadt. Keine Ahnung, warum der alte Haas das nicht selbst klären kann. Wenn ich mich jetzt auch noch um ausgebrochene Elefanten kümmern muss … Ist Klaus schon da?«
Seine Frau wirft einen Blick durchs Fenster, entdeckt den Dienstwagen vor dem Haus und nickt. Winkler küsst sie flüchtig auf die Wange und will gehen, aber sie hält ihn auf. »Warte kurz. Ich fahre mit. Elefanten in Berlin, das will ich nicht verpassen.«
*
Als Winkler die Innenstadt erreicht, dämmert ihm langsam, dass die ausgebrochenen Elefanten sehr wohl ein Problem darstellen, das die Befugnisse des Bürgermeisters übersteigt. Beim Losfahren war im Radio noch von vier Tieren die Rede gewesen, alle in der Nähe der Spree gesichtet. Vielleicht waren sie zum Wasser gegangen, auch wenn Winkler nicht verstand, wie sie dahin gekommen sein sollten, ohne dabei gesehen worden zu sein — Berlin schläft nie. Zehn Minuten später hatte der Reporter einen schleunigst herbeorderten Biologen interviewt, der feststellte, dass es sich um Afrikanische Elefanten handelte. Woraufhin ihn Frida, die neben ihm auf der Rückbank saß, verwundert darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die nicht aus dem Zoo kommen konnten, denn dort gab es nur die kleinere asiatische Variante. »Das kannst du natürlich nicht wissen, du hattest ja nie Zeit, mit den Kindern in den Zoo zu gehen.«