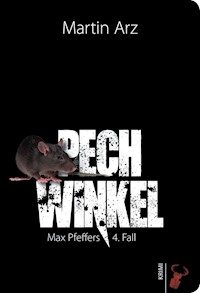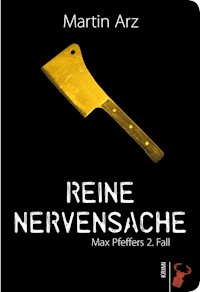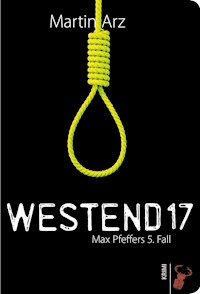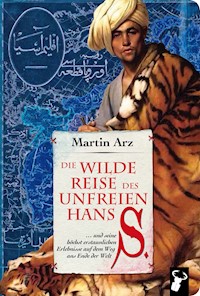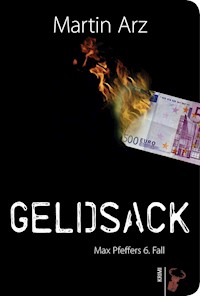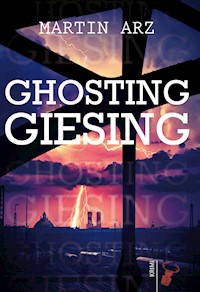Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirschkäfer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Warum musste ein Kunsthändler grausam sterben und was hat Afrika mit dem Mord zu tun? Max Pfeffer von der Münchner Kripo steht vor einem spannenden Rätsel. Er muss sich mit einer dunklen Epoche der deutschen Geschichte auseinandersetzen, denn die Wurzeln des Verbrechens gehen zurück in die Zeit, als über Kamerun die Flagge des Deutschen Kaiserreiches wehte. Damals schenkte ein schwarzer Fürst einem deutschen Kolonialpionier ein Mädchen als Sklavin …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Arz
Das
geschenkte
Mädchen
Martin Arz schrieb zunächst als freier Autor für zahlreiche Magazine. Dann arbeitete er mehrere Jahre als PR-Berater, bevor er sich ganz den Künsten widmete: der Malerei und dem Schreiben. Seine Gemälde waren bereits auf vielen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.
»Das geschenkte Mädchen« ist der erste Max-Pfeffer-Krimi. »Reine Nervensache«, der zweite Pfeffer-Krimi, liegt ebenfalls im Hirschkäfer Verlag vor. 2009 erschien »Die Knochennäherin«, Pfeffers dritter Fall, im Berliner Quer Verlag. Kriminalrat Pfeffer ermittelte außerdem im Frühjahr 2010 in Deutschlands erstem Twitter-Krimi »Der Tote vom Glockenbach«, der über Twitter publiziert wurde. Vor Max Pfeffer schickte Arz seinen abgebrühten Hobbydetektiv Felix in vier Kriminal-romanen auf Verbrecherjagd. Arz lebt und arbeitet in München.
Pfeffer-Krimis im Hirschkäfer-Verlag als E-Books und in 3-D:
• Das geschenkte Mädchen – Ein Fall für Max Pfeffer (2011)
• Reine Nervensache – Max Pfeffer ermittelt wieder (2010)
• Pechwinkel – Max Pfeffers 4. Fall (2011)
Handlung und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen
Ereignissen oder Personen wäre rein zufällig.
E-Book-Ausgabe, Juni 2012
Cover und grafische Gestaltung von Hirschkäfer Design
© Hirschkäfer Verlag, München 2012
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist
ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in
elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-940839-24-4
Besuchen Sie uns im weltweiten Netz:
www.hirschkaefer-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
»Nun wollen wir in Schiffen über das Meer fahren,
da und dort ein junges Deutschland gründen,
Wir wollen es besser machen als die Spanier,
denen die neue Welt ein pfäffisches Schlächterhaus,
anders als die Engländer, denen sie ein Krämerladen wurde.
Wir wollen es deutsch und herrlich.«
Richard Wagner
(in einem Extrablatt des »Dresdner Anzeigers«, 14.6.1848)
»Tanga la njou di ma nyongise la iscru.«
(»Die Spur des Elefanten verdeckt die Spur der Zwergantilope.«)
Sprichwort der Duala, Kamerun
»Die ganze Kolonialgeschichte ist ja ein Schwindel,
aber wir brauchen sie für die Wahlen.«
Otto von Bismarck
(im September 1884 zu seinem engsten Mitarbeiter im Auswärtigen Amt)
Inhalt
Kapitel 01
Kapitel 02
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
Kapitel 09
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
PS
01 Damit hatte er nicht gerechnet. Gewiss, man konnte ihm alles Mögliche vorwerfen – Habgier, Gerissenheit, Besserwisserei zum Beispiel. All das hätte ihm sogar noch geschmeichelt. Aber eins hatte er sich noch nie vorhalten lassen müssen: Naivität. Nein, naiv war Sönke Westphal noch nie gewesen. Der allerletzte Funken Naivität, den er einmal in sich gehabt haben mochte, war spätestens bei seiner Rückkehr aus Kamerun erloschen. Dachte Westphal jedenfalls bis zu diesem Augenblick, in dem er langsam verblutete.
Er hätte damit rechnen müssen, verdammt noch mal. Vielleicht schon damals, als die junge Frau in seinen Laden gekommen war und ihm das Foto gezeigt hatte, das seine Habgier hatte aufflammen lassen. Leider hatte die junge Frau nichts als das Foto, also war seine Habgier schnell wieder erloschen. Doch als dann vor ein paar Wochen der Mann mit genau dem auf dem Foto abgebildeten Objekt zu ihm gekommen war, war Westphals Habgier geradezu explodiert, und er hatte alle Vorsicht über Bord geworfen.
Das hatte er nun davon.
Es war naiv von ihm gewesen, so hoch zu pokern. Er hätte wissen müssen, mit wem er sich einließ. Stattdessen hatte er sich in den letzten Tagen an dem klirrend kalten Januarwetter erfreut, seinen Stuhl an das Schaufenster gerückt, damit ihn die Strahlen der Wintersonne an der Nase kitzeln konnten, und hatte in Gedanken das viele Geld gezählt, das ihm so sicher schien. Er hatte sich großartig gefühlt, wie ein kleiner König, wie man sich halt so fühlte, wenn mal eben so ein paar Millionen ins Haus standen. Wenn dann ein junges Mädchen in seinen Laden gekommen war, um eines dieser Pseudo-Nkisis zu erstehen, hatte er aus lauter Übermut ein wenig geflirtet – zumindest, wenn es hübsch war. Aber waren nicht alle Mädchen hübsch, die bei ihm etwas kauften? Und es waren immer junge Mädchen, die scharf auf die Pseudo-Nkisis waren, jene im allgemeinen Sprachgebrauch als »Nagelfetisch« bezeichneten kleinen afrikanischen Holzfiguren, die Westphal von einem Großhändler in Belgien zu einem Spottpreis bezog und für das Zigfache verhökerte. Die Ware war gut, sauber gearbeitet, mit rostigen Nägeln bestückt (laut Vertrag mind. 13, max. 16 Stück) und sogar mit einem Hauch künstlicher Patina überzogen. Trotzdem Plunder und eigentlich weit unter seiner Würde. Er verkaufte die Dinger für neununddreißig Euro, und die jungen, hübschen, flirtbereiten Mädchen, die auf alles Afrikanische standen, weil Ethnoramsch momentan so hip war, gaben gern ihr Geld dafür aus.
Geld, auf das er im Moment noch angewiesen war. Denn die jungen Dinger hatten kaum ein Auge für die echten Schätze, die er in seiner Galerie für afrikanische Kunst anbot. Wertvolle Kultobjekte aus allen Regionen Afrikas, die er als Koryphäe für afrikanische Plastiken mit Kennerblick zusammengetragen hatte, um sie an Sammler zu verkaufen. Natürlich hatte er einen festen Stamm von sehr betuchten Sammlern, gelegentlich kamen sogar Kustoden von Völkerkundemuseen aus ganz Europa zu ihm, wenn er ein besonders rares Stück im Angebot hatte, er wurde von Auktionshäusern um Gutachten gebeten, doch es reichte einfach nie, um den Lebensstandard zu erreichen, den sich Westphal immer erträumt hatte.
Aber seit der Mann mit dem Objekt seiner Begierde kurz vor Weihnachten in seinen Laden gekommen war, schien das alles für Westphal Makulatur. Ihm war durchaus die Komik der Tatsache bewusst, dass es ausgerechnet die Ndjamele waren, die für seinen Wohlstand sorgen würden. Er hatte sich köstlich über diesen Treppenwitz des Lebens amüsiert, während er mit nagelfetischkaufenden Girlies flirtete und in seinen Träumen im Reichtum schwelgte.
Zu früh gefreut, dachte er sich bitter, während er beide Hände gegen seinen Bauch drückte, um das herausspritzende Blut zurückzuhalten. Der Mann mit dem Stilett hatte nur eine kurze, beinahe flüchtige Handbewegung gemacht. Die Klinge war in Westphals Unterleib gedrungen und ebenso schnell wieder herausgezogen worden, als tunke man ein Buttermesser in einen Topf weicher Margarine. Von wegen Sammler! Westphal hatte sich schon gewundert, als die beiden Männer seinen Laden betreten hatten, denn sie sahen gar nicht nach wohlhabenden Kunstinteressierten aus, auch wenn sie in teures Tuch gehüllt waren und sich gewählt auszudrücken wussten. Aber bei den jungen Leuten konnte man ja nie wissen. Vermutlich, so hatte Westphal gedacht, irgendwelche Berufserben oder Börsenyuppies, die mal ein paar Zigtausend für was Exotisches ausgeben wollten. Telefonisch hatten sie sich als Sammler ausgegeben, die am Erwerb einer sitzenden Ife-Figur aus Kupfer interessiert waren. Ein absolutes Museumsstück, schwer beschädigt zwar, aber zweifelsfrei frühes vierzehntes Jahrhundert. Eine Kostbarkeit, die Westphal für einen Spottpreis den ahnungslosen Erben eines jüngst verstorbenen Sammlers abgeluchst hatte. Eine Preziose, die es gerechtfertigt hatte, dass Westphal seinen Laden zugemacht und den Besuch ins Hinterzimmer gebeten hatte, wo er die Statue zur Begutachtung schon auf einem mit schwarzem Samt bedeckten kleinen Tisch hindekoriert hatte.
»Darf ich?«, hatte der kleinere der beiden Männer noch höflich gefragt, bevor er die Figur vorsichtig in seine Hände genommen und mit einem staunenden Zögern über das Gewicht der Plastik hochgehoben hatte – um sie besser betrachten zu können, wie Westphal zunächst noch gedacht hatte. Komisch, auch das hatte Westphal noch gedacht, dass die Herren ihre Handschuhe nicht ausziehen, andererseits auch klar, denn bei der Eiseskälte draußen … Doch der Mann hatte die Figur nur deshalb hochgehoben, um sie Westphal besser auf den Schädel schlagen zu können. Dann war alles sehr schnell gegangen. Westphal hatte gar keine Zeit gehabt, die Sternchen zu zählen, die vor seinen Augen irrlichterten. Die Männer hatten ihm auch nicht gegönnt, bewusstlos zu werden, sondern sofort klargemacht, in wessen Auftrag sie kamen, und warum man leider in Zukunft keinerlei Wert mehr auf die Geschäftsbeziehung zu ihm legen würde. Genauer gesagt, dass niemand mehr in Zukunft mit Westphal eine Geschäftsbeziehung haben werde. Sie hatten dabei leise und wohlakzentuiert gesprochen, ganz anders als die Typen, die in Fernsehkrimis immer die Drecksarbeit erledigten. Besonders der große jüngere Mann, der so schnell und urplötzlich seine Worte mit dem Stiletteinsatz unterstrich. Der kleinere hatte immer noch die Ife-Figur in den Händen, drehte und wendete sie, stets ein Glimmen der Bewunderung in den Augen.
»Bitte«, keuchte Westphal und löste eine Hand von seinem Bauch, weil er das Blut, das von der Platzwunde am Kopf in sein linkes Auge rann, wegwischen wollte. Da das Blut aber sofort stärker aus seinem Bauch schoss und dabei dem Stilettmann auf die hochglanzpolierten Schuhe tropfte, was der mit einem verärgerten Seufzer zur Kenntnis nahm, kniff Westphal lieber sein Auge zu und presste die Hand wieder auf den Bauch. »Nehmen Sie die Figur. Nehmen Sie sie! Ich schenke Sie Ihnen, sie ist mehr Geld wert, als Ihnen Ihre Auftraggeber zahlen! Nehmen Sie sie und gehen Sie, bitte!«
»Aber Herr Doktor«, sagte der Stilettmann mit süffisantem Lächeln. »Wollen Sie uns etwa bestechen?«
Doktor Sönke Westphal – auf seinen Titel hatte er stets enormen Wert gelegt, hatte er ihn sich doch hart mit einem schrecklichen Jahr der Feldforschung bei den Ndjamele erarbeitet, jenem wenig erforschten kleinen Volk im mittleren Hochland Kameruns. Nach einem Jahr der Entbehrungen, des Hausens in einem ehemaligen Ziegenstall (mehr hatten ihm die Dorfältesten nicht zugestanden) und der Demütigungen, denn die Ndjamele sahen in ihm eine Art Kuriosum, einen Freak, der ihnen zur Belustigung diente – ja, tatsächlich hatte sich Sönke Westphal damals der Eindruck aufgedrängt, dass man ihn erforschte und nicht umgekehrt –, war Westphal mit der festen Überzeugung zurückgekehrt, dass diese Primitivlinge es eigentlich gar nicht verdient hatten, durch seine Arbeit Einzug in die Wissenschaft zu halten. Dabei hatte er sich so bemüht, den Eingeborenen nicht mit der Arroganz des besserwissenden Europäers gegenüberzutreten. Gewiss, die Ndjamele waren längst oberflächlich christianisiert und in die Strukturen der modernen Welt eingegliedert, doch dass ein Weißer freiwillig in einem Ziegenstall hauste, ihnen in die Kochtöpfe guckte, ihnen im stümperhaften Französisch Löcher in den Bauch fragte, zu Dingen, die für sie ganz selbstverständlich waren und keinerlei Erklärung bedurften, und dass dieser Weiße bei ihren Festen auch noch wie ein aufgescheuchtes Huhn mit Fotoapparat und Tonbandgerät herumlief, das war für sie eindeutig das Verhalten eines geistig Minderbemittelten. So hatten sie ihn auch behandelt.
Nun klang das »Doktor«, dieser mühsam erlittene Titel, aus dem Mund des Mörders wie blanker Hohn.
»Nennen Sie es, wie Sie es wollen«, stöhnte Westphal. Allmählich schwanden ihm die Kräfte. Ich verblute, wenn ich nicht schnell zu einem Arzt komme, dachte er, also verpisst euch endlich, ich habe meine Lektion gelernt. »Nur, lassen Sie mich bitte endlich in Ruhe. Bitte!«
»Winseln steht Ihnen nicht«, antwortete der Stilettmann ungerührt. Dann wandte er sich an seinen Kompagnon. »Gefällt Ihnen die Figur wirklich?«
»Sehr!«, erwiderte der Kleine. »Sehen Sie die feinen Ziselierungen hier an den Beinen. Das soll wohl ein Hosenmuster darstellen. Und schauen Sie mal, wie fein und realistisch die Gesichtszüge gearbeitet sind. Man möchte nicht meinen, dass es sich dabei um eine afrikanische Plastik handelt, die sonst doch eher einen extrem expressiven Charakter haben.«
Sie siezen sich! Mein Gott, da stehen zwei brutale Mörder und reden sich mit Sie an, dachte Westphal. Ich verblute und die beiden Bestien siezen sich, diskutieren über die unbestreitbare Qualität einer Ife-Figur und das auch noch in politisch korrekter Ausdrucksweise. Hilfe! »Hilfe!«, röchelte er laut.
»Glauben Sie, dass Sie hier jemand hört?«, fragte der Stilettmann und ließ dabei seinen Blick nicht von der Gesichtspartie der Figur. »Sehen Sie nur diese Lippen«, fuhr er dann fort. »Also, ich würde an Ihrer Stelle das großzügige Angebot von Doktor Westphal annehmen und die Figur behalten.«
»Meinen Sie?«, sagte der Kleine. »Das könnte man als Diebstahl auslegen. Nein, so schwer es mir fällt, ich lasse sie hier. Da habe ich meine Prinzipien.«
Er stellte die Figur vorsichtig auf den Tisch zurück.
Höfliche Bestien, die sich siezen und Prinzipien haben, dachte Westphal und wunderte sich über seinen Galgenhumor. Gleich würde es mit ihm vorbei sein. Abgestochen wie eine Sau. Es war gar nicht so, wie er es sich immer vorgestellt hatte. Von wegen ein Film würde vor seinem inneren Auge ablaufen und ihm sein Leben im Schnelldurchlauf präsentieren, charmant moderiert von einem ätherischen Engel. Auch kein Tunnel aus Licht weit und breit. Keine Sphärenklänge, keine Himmelschöre, nichts als das Schweigen der beiden Männer und das schnelle »platsch platsch platsch«, das sein Blut machte, wenn es auf dem Linoleumboden auftraf. Aische, seine Zugehfrau – die eigentlich gar nicht Aische hieß, sondern Fetmeh, aber weil seine erste türkische Zugehfrau Aische geheißen hatte, hatte er auch deren Nachfolgerin immer so genannt, und es hatte sie nie gestört – würde sich morgen gar nicht über die Sauerei freuen.
Westphal fiel wieder die Frau ein, die ihn damals mit dem vergilbten Foto besucht hatte und seinen Rat als Fachmann wollte. So hatte der ganze Schlamassel angefangen. Er hatte ihr die Wahrheit gesagt, nachdem er sich sicher war, dass sie wirklich nur ein Foto und nichts weiter hatte. Die Frau, sie war eine rassige Schönheit, das fiel Westphal nun wieder ein, hatte ihm aufmerksam zugehört, sich ein wenig in seinem Laden umgeschaut und zielsicher eine prächtige Mutter-mit-Kind-Plastik der Ndjamele aus dem Regal genommen. Sie hatten ihn ja eigentlich nie wirklich verlassen, die Ndjamele. Denn bevor er von seiner Feldforschung zurück nach Hause gekehrt war, hatte er ihnen noch einige herrliche Figuren abgekauft, und all die Jahre immer wieder Arbeiten von ihnen bezogen, die sich gut an Sammler verkaufen ließen. Auch wenn er von den Ndjamele sonst nie etwas gehalten hatte, ihre Kunst hatte eine Qualität, die ihresgleichen suchte. Nein, hatte die rassige junge Frau damals zu ihm mit traurigem Lächeln gesagt, zweieinhalbtausend Euro, nein, das könne sie sich beim besten Willen nicht leisten. Er sah sie jetzt noch vor sich, die Frau mit ihren langen dunklen Locken, den leuchtenden braunen Augen und dem sinnlichen Mund, wie sie in ihrem leichten Sommerkleid, das ihre Figur äußerst vorteilhaft betonte, dastand und die Mutter-mit-Kind-Statue an ihren Busen drückte, als plötzlich alles ganz hell wurde. Starkes Gegenlicht umhüllte die Frau. Klasse Weib, dachte Westphal, wie macht sie den Trick mit dem Licht nur? So kommen ihre Kurven prächtig zur Geltung.
Die sinnlichen Lippen öffneten sich. »Komm«, hauchte sie verführerisch. »Komm mit mir.«
Nichts, was ich lieber täte, dachte sich Westphal, beachtete nicht mehr die Männer, die nun eine kleine Holzstatuette, die Westphal bei näherem Hinsehen sicher sehr bekannt vorgekommen wäre, in die Blutlache stellten, und trat in das Licht.
02 »Ganz schöne Sauerei, was, Chef?«, sagte Kommissar Paul Freudensprung zu seinem Vorgesetzten, rieb sich die Augen und umrundete vorsichtig die große Blutlache.
»Hmmm«, brummte Max Pfeffer und kratzte sich nachdenklich am Kinn. »Der arme Kerl ist offenbar langsam verblutet.«
»Pfeffer!«, mischte sich die schwergewichtige Rechtsmedizinerin ein, die neben der Leiche kniete und bei der Arbeit munter vor sich hin rauchte. Pfeffer war sich fast sicher, dass die Spurensicherung den Tatort eigentlich noch nicht zum Rauchen freigegeben hatte. Doch die Pathologin rauchte immer und überall, sobald die Spurensicherung erste Anzeichen von Arbeitsende gab. »Willst du jetzt meinen Job machen? Wie und woran er gestorben ist, werde ich dir schon rechtzeitig mitteilen.«
»Schon gut, Pettenkoferin. Was ist los, Paul?« Pfeffer wandte sich wieder an Freudensprung. »Du siehst heut wieder aus, als hättest du eine Megaparty hinter dir. Fasching?«
Freudensprung rieb sich erneut die verquollenen Augen. »Nix ist los, Chef«, antwortete er übel gelaunt. »Hab nur schlecht geschlafen.«
»Schon wieder?«
»Schon wieder!«
»Wenn du irgendwelche Probleme hast …«
»Jaja, schon gut.« Paul Freudensprung winkte ab und grunzte. »Alles bestens, hab eben momentan Schlafprobleme.«
Max Pfeffer zuckte mit den Schultern. »Gut, zurück zur Arbeit. Wo ist die Frau, die ihn gefunden hat? Die Putzfrau, richtig?«
»Sitzt nebenan und heult«, sagte Freudensprung. »Kein Wunder, bei dem Anblick. Sie heißt Fetmeh Yilmaz, auch wenn sie dir gleich erzählen wird, dass du Aische zu ihr sagen kannst.«
Pfeffer umrundete die ausgeblutete Leiche und ging in das Nebenzimmer, eine kleine Teeküche. Selbst hier standen auf den Hängeschränken und den Ablagen afrikanische Plastiken unterschiedlicher Größe. Ein großer, offener Karton versperrte fast den Weg. Darin kleine Nagelfetische en masse, die auf Pfeffer richtig antik und wertvoll wirkten. Er hob einen heraus und drehte ihn in den Händen. Vielleicht ein gutes Geburtstagsgeschenk für den Kleinen, dachte Pfeffer, als er sich an der Kiste vorbeiquetschte. Neben dem neuesten Tomb-Raider-Spiel natürlich, das der sehnlichste Wunsch seines jüngeren Sohns war. Das virtuelle Busenwunder Lara Croft ballernd und tittenschwingend auf dem Computerbildschirm und ein unheimlicher Nagelfetisch auf dem Nachtkästchen. Der Kleine würde vor Freude an die Decke hüpfen.
Mit der Figur in der Hand näherte sich Pfeffer vorsichtig der Frau, die in der Ecke auf einem Stuhl zusammengekauert saß und einen Becher Kaffee mit den Händen umkrallte.
»Frau …«
»Yilmaz, Fetmeh«, unterbrach ihn die Frau mit schriller Stimme und sah zu ihm hoch. Sie mochte Ende dreißig sein, vielleicht Pfeffers Jahrgang, doch sie sah älter aus. Sie trug eine blaue Kittelschürze und ein farblich mutiges Kopftuch. Ihre Augen waren gerötet, aber trocken. Sie schluckte. »Sie können aber Aische zu mir sagen.« Ihr Deutsch war fast perfekt.
»Danke, Frau Yilmaz, ich glaube nicht.« Pfeffer ging in die Hocke, um mit der Sitzenden auf einer Augenhöhe zu sein. Psychologisch nie verkehrt. Bei Augenkontakt auf einer Höhe lügt es sich schlechter. Das mit dem In-die-Hocke-Gehen hatte er immer bei seinen beiden Söhnen gemacht, als sie ihn dabei noch nicht körperlich überragt hatten – lange her. »Frau Yilmaz, ich bin Kriminalrat Max Pfeffer von der Münchner Mordkommission.« Er hielt ihr pro forma seinen Ausweis unter die Nase. Gewohnheit. »Erzählen Sie mir bitte alles, was Sie wissen. Wann und wie haben Sie den Toten …«
»Doktor Westphal«, rief Fetmeh Yilmaz dazwischen.
»Wann und wie haben Sie Doktor Westphal gefunden. Lassen Sie bitte nichts aus.«
Sie ließ nichts aus. Pfeffer bereute beinahe, dass er sie dazu aufgefordert hatte. Nun, sie habe einen Schlüssel, weil sie meistens ganz früh zum Putzen komme, bevor der Laden aufmache. Ab und zu auch abends, nach Geschäftsschluss, gegen halb acht, denn Doktor Westphal würde selten länger als sieben seine Galerie offen haben. Je nachdem, wie es ihre anderen Putzstellen zuließen. So wie heute. Und da sei er gelegen und alles voller Blut, so entsetzlich viel Blut. Wie sie das nur je wieder wegkriegen solle! Nein, über das Geschäft und die Kunden von Doktor Westphal wisse sie nichts, gar nichts. Ja, Doktor Westphal sei nicht verheiratet gewesen. Keine Frau, keine Freundin, jedenfalls keine, von der sie wisse.
»Wissen Sie, Herr Kriminalrat«, sagte die Putzfrau, »man soll nie etwas Schlechtes über die Toten sagen und ich schäme mich auch dafür, aber Doktor Westphal war kein sehr guter Mann. Verstehen Sie?« Pfeffer verstand nicht. »Ein guter Mann hat eine Frau und eine Familie, für die er sorgt. Für ihn gibt es die Frau und keine andere Frau.«
»Und Herr Westphal hatte also andere Frauen? Obwohl er nicht mal eine hatte?« Pfeffer versuchte sich in die Argumentationslogik der Zugehfrau hineinzuversetzen. Klar, der Tote war ein Schürzenjäger.
»Er hatte nur andere Frauen.« Fetmeh Yilmaz richtete sich gerade auf, drückte das Kreuz durch und klemmte die Hände mit dem Becher zwischen ihre Beine. Tratschposition. »Er hat sogar mir nachgestellt, aber ich bin eine anständige Frau! Aber meine Vorgängerin, Aische, die hat hier nicht mehr arbeiten wollen, weil er sie so sehr belästigt hat. Und Aische ist sehr hübsch. Sie ist meine Nichte. Die Tochter meines zweitältesten Bruders Mehmet und die Schwester von Levent Demir. Sie wissen schon, der TV-Star.« Pfeffer wusste nicht, aber er nickte. »Da habe ich die Stelle übernommen. Meine Familie …«
»Ist Ihnen aufgefallen, ob was fehlt?«, unterbrach Pfeffer sie schnell, bevor sie auch noch ihre Familienverhältnisse detailliert vor ihm ausbreiten konnte. Sie hatte bestimmt eine große Familie mit Namen, die sich Pfeffer nicht würde merken können, selbst wenn er es gewollt hätte.
»Was fehlt?« Die Putzfrau starrte ihn verwundert an. »Oh, ich weiß, dass die Sachen hier viel wert sind. Auch wenn ich nicht verstehen kann, dass jemand für diese alten, hässlichen und schmutzigen Figuren viel Geld ausgibt.« Pfeffer nickte zustimmend und unterdrückte ein Lachen. »Ich habe Doktor Westphal ja immer angeboten die Sachen zu waschen, ich hätte sie richtig sauber bekommen. Picobello, so sagt die eine Frau immer, für die ich auch putze. Picobello sauber. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was picobello bedeutet, aber ich hätte die schmutzigen Figuren hier richtig picobello sauber gemacht. Doch Doktor Westphal hat ständig ›Unterstehen Sie sich‹ gerufen. Aische hat immer gesagt …«
»Danke, Frau Yilmaz, Sie haben mir sehr geholfen«, verabschiedete sich Pfeffer hastig. »Wenn Ihnen vielleicht doch noch etwas einfällt, rufen Sie mich bitte an.« Er überreichte ihr seine Visitenkarte und ließ Fetmeh Yilmaz in seine rehbraunen Kuschelaugen fallen. Wenn es etwas an ihm gab, das bei Frauen nie seine Wirkung verfehlte, dann waren es seine dunklen, samtigen Augen. Und sein volles Haar, das, obwohl er die Vierzig noch vor sich hatte, bereits vollständig ergraut war. Sein Friseur versuchte seit Jahren, ihm eine »Auffrischung« der alten Haarfarbe unterzujubeln. Angeblich ganz natürlich. Keine Tönung, nur ein Mittel, das die Farbpigmente wieder reaktiviert. So wie es der Kanzler macht. Doch Max Pfeffer stand zu seinem Grau, das im krassen Kontrast zu seiner beinahe faltenlosen Haut stand. Der Kriminalrat war nicht ganz Einsfünfundachtzig und nicht unbedingt der Allerattraktivste, da machte er sich nichts vor. Manchmal, ziemlich selten, litt er ein wenig darunter. Im Sommer konnte er vielleicht einen gewissen Frauentyp mit knapper Kleidung beeindrucken, die seine sehr athletische Figur und vor allem seinen wirklich präsentablen Hintern betonte. Aber egal welches Wetter und wie dick die Kleidung – der Kuscheleffekt seiner dunklen Augen wirkte auf Frauen immer, und sei es nur, dass er sie verwirrte. Nur, dass Pfeffer sich so rein gar nichts aus Frauen machte.
03 »Ich habe sein Filofax gefunden«, rief Freudensprung mit Triumph in der Stimme und versuchte in dem ledergebundenen Kalender zu blättern. Weil er noch die dünnen Einmalhandschuhe trug, um keine Spuren zu vernichten, konnte er nur Seitenblöcke umblättern.
»Sehr gut«, lobte Pfeffer und kam sich dabei vor wie ein Oberlehrer. Dann verteilte er die Aufgaben an sein Team. Besonders wichtig war ihm, dass eine Inventur gemacht wurde. Vielleicht Raubmord, was heißt vielleicht – Pfeffer nahm sich nacheinander ein paar Figuren aus einer Vitrine, drehte sie um und musterte die Preisschildchen. Da standen Worte wie »Dogon«, »Ewe«, »Idoma« oder »Tschokwe« – Worte, die Pfeffers Miene zu einer Maske des blanken Unverständnisses erstarren ließ, jenem Gesichtsausdruck, den er sonst nur angesichts seiner Stadtwerkeabrechnung aufzusetzen pflegte. Die Summen auf den Etiketten reichten von zwei- bis zehntausend Euro. Eine kleine Terracotta-Figur, die ein kryptisches »Nok« auf dem Preisschild stehen hatte und die Pfeffer stark an die comicartigen Töpferarbeiten seines jüngsten Sohnes erinnerte, sollte gar mehr als zwölftausend Euro kosten. Viel Geld, also mit ziemlicher Sicherheit Raubmord.
»Das wäre doch was für unsere Frau Scholz. Bella, machst du das?« Pfeffer warf seiner jungen Kollegin die Tonfigur zu. Annabella Scholz fing die kleine Kostbarkeit mit einer Hand auf. »Alle Figuren zählen. Und herausfinden, was uns die Figur in der Blutlache sagen will, sofern sie was zu sagen hat und nicht nur zufällig da herumsteht.« Pfeffer deutete auf die Holzpuppe neben der Leiche. »Versuch jemanden aus Westphals Familie aufzutreiben. Irgendwelche Verwandtschaft wird er ja wohl gehabt haben. Eltern, Geschwister, Cousins. Lieferscheine checken, Kontoauszüge, Geschäftsverbindungen, das ganze Pipapo eben.«
Annabella Scholz, die immer etwas zu salopp und jugendlich-cool gekleidet war, um in Paul Freudensprungs Augen wirklich attraktiv zu sein, nickte und fuhr sich durch ihre blondierte Mähne. Dann warf sie Pfeffer die Nok-Figur zurück.
Er brauchte beide Hände, um die Preziose sicher zu fangen. Der Kriminalrat fühlte sich auf einmal so unendlich müde. Das ganze Pipapo eben. Immer Routine, immer ein Toter, immer im Dreck wühlen. So viel Motive gab es nicht. Geld oder Liebe. Ausnahmen bestätigten die Regel. Pfeffer wünschte sich manchmal was richtig Kniffliges, einen Fall, der größere Dimensionen hatte. Etwas zum Festbeißen und Routinevergessen. Natürlich machte ihm jeder Fall irgendwo Spaß, sofern man bei Mord von Spaß reden konnte. Sicherlich war jeder Fall für ihn eine Herausforderung, mal dauerte es länger, bis sie den Täter schnappten, meist ging es jedoch recht schnell. So, wie es in diesem Fall sein würde. Vermutlich reichte es schon, den Kalender des Toten zu filzen. In spätestens zwei bis drei Wochen würden sie dann bestimmt herausfinden, dass entweder eine eifersüchtige Gespielin zum Messer gegriffen hatte, die ihnen dann schluchzend gestehen würde: »Ich konnte nicht anders, dieses Schwein …«, oder sie würden einen Verwandten in Geldnot verhaften, der beim Klauen einer wertvollen Figur, die er dann an einen Hehler verschachern wollte, von Doktor Westphal überrascht worden war. Pfeffer gähnte innerlich.
»Schau nicht so gelangweilt drein, Maxl«, sagte die Rechtsmedizinerin und ließ ihre Gummihandschuhe spielerisch in Richtung Pfeffer schnalzen. »Stell lieber das Tonpüppchen wieder hin, sonst machst du es noch kaputt. Sieht mir verschärft nach Nok aus.«
»Das steht da auch drauf. Du kennst dich aus mit so was, Pettenkoferin?« Pfeffer war ehrlich erstaunt.
»Ich fresse nicht nur Kuchen in mich rein, Maxl«, kokettierte Doktor Gerda Pettenkofer mit ihrer gewaltigen Leibesfülle. »Hab neulich was gelesen, dass diese Nok-Sachen sauviel wert sind und jetzt auch in den Louvre aufgenommen wurden. Chirac höchstpersönlich hat ein paar solcher Figuren von einem belgischen Händler erstanden und dem Louvre geschenkt. War ein ziemlicher Skandal in Frankreich, denn wie sich schnell herausstellte, waren diese Figuren aus einem Museum in Nigeria gestohlen und …« Die Rechtsmedizinerin brach ab, weil Pfeffer sie mit demonstrativem Desinteresse anstarrte.
Pfeffer und Kunst, da prallten oft genug zwei Welten aufeinander. Wenn es um Jazz, vor allem Nu- und Acid-Jazz ging, war er in seinem Element. Doch bei Malerei und Bildhauerei stieg er freiwillig aus, gut, zugegeben, er hatte in den letzten Jahren hauptsächlich durch seinen Freund Tim dazugelernt – aber egal, was er vor allem liebte, waren die Kabbeleien mit Doktor Gerda Pettenkofer.
»Louvre?!«, wiederholte die Pathologin betont langsam. »Mona Lisa. Museum. Paris. Kultur. Du verstehen?«
»Nö. Kann man das essen?« Pfeffer zündete sich eine Zigarette an. »Und wer oder was ist Nok? So jemand wie Picasso? Ein afrikanischer Picasso?«
»Ach, Maxl!« Gerda Pettenkofer seufzte und verdrehte die Augen. »Das ist ein afrikanisches Volk. Oder war eins. Ausgestorben oder so. Ehrlich, ich habe nix damit zu tun! Die Sachen sind deshalb so viel wert, weil sie antik sind und bei Ausgrabungen gefunden wurden. Frag mich nicht, wo und wann. Okay?! Mehr weiß ich nicht. Echt nicht! Ihr könnt mich ruhig weiter mit euren Gestapo-Verhörmethoden fertig machen, ihr Bullenschweine!« Gerda machte eine trotzig abwehrende Handbewegung wie ein jugendlicher Hobbydealer, der schon nach wenigen Minuten Verhör weichgeklopft war und noch einmal den coolen Macker markierte, bevor er detailliert seine Hintermänner verpfiff. »Scheißbullen. Ich sage keinen Ton mehr! Gib mir lieber ’ne Kippe.«
»Du siehst auch ganz schön fertig aus, Gerda.« Pfeffer schmunzelte und gab ihr noch Feuer zur Zigarette. »Faschingsparty? Oder probierst du wieder eine neue Diät aus?«
»Weder noch, Maxl«, seufzte die Medizinerin und blies eine Kette von unförmigen Rauchringen aus, die ungelenk durch den Raum eierten, bevor sie sich auflösten. »Das mit dem Abspecken habe ich längst aufgegeben. Mir schmeckts einfach zu gut. Und letzten Herbst hast du nicht mal bemerkt, dass ich fünfundzwanzig Kilo abgenommen hatte. Ne, ich musste schon heute früh um fünf raus. Deine Kollegen haben eine völlig verkohlte Leiche in der Isar bei Wolfratshausen gefunden.«
»Verkohlte Leiche unter Wasser. Dann tippe ich auf Selbstmord.«
Die Pettenkoferin lachte dröhnend. »Ach, Maxl. Sah jedenfalls verdammt nach Profiarbeit aus. Wir werden vermutlich eine Ewigkeit brauchen, bis wir die Leiche identifiziert haben, wenn uns nicht die Vermisstenkartei weiterhilft. Und bei dem hier«, sie deutete auf die Leiche von Doktor Westphal, »tippe ich auch auf Profiarbeit. Sauber mit einem Stich die Bauchschlagader durchtrennt. Wenn es ein Mord im Affekt gewesen sein sollte, hat der Täter halt einfach Glück gehabt. Oh, pardon, so sollte ich nicht reden. Aber ich schätze, es war ein Profi, der wusste, was er tat. Genauer Bericht erst in zwei Tagen. Das Bündel verkohlter Knochen aus der Isar geht momentan vor.«
04 Helene biss sich unschlüssig auf die Unterlippe. Was sollte sie sagen, wenn sie der Alten gegenüberstand? Sie inhalierte tief, pumpte die Lungen voll eisige Luft. Beim Ausatmen beobachtete sie den Kältenebel, der aus ihrem Mund strömte. Herrliches Wetter für einen Winterspaziergang. Die Sonne strahlte grell, der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Eigentlich könnte sie jetzt einfach weitergehen, hinunter zur Isar und in den Isar-Auen ein wenig herumbummeln. Vielleicht sah sie ein paar sportliche Ski-Langläufer oder herumtollende Hunde. Oder sie könnte auch ein wenig tagträumen, wie sie es manchmal tat. Sich Szenen aus den Aufzeichnungen von Leopold Konrad Frese vor ihr geistiges Auge rufen und ausschmücken. So wie die Szene mit der Schwarzen im europäischen Straßenkostüm, Frau Häuptling. Helene kannte die Stelle – wie auch zahlreiche andere – fast auswendig und malte sich aus, wie die große, würdevolle ebenholzfarbene Königin im raschelnden Seidenkleid, das Gesicht umrahmt von feinen Spitzen, auf dem Kopf ein Wagenrad von einem Hut, mitten im smaragdgrünen Urwald auf eine sonnenumschmeichelte Lichtung trat. Papageien jeglicher Couleur umschwirrten die majestätische Erscheinung …
Helene tagträumte und ging ein paar Schritte an dem Haus vorbei. Sie war sich durchaus bewusst, dass ihre Phantasien immer kitschtriefender und exotischer wurden. Schluss damit, sagte sie zu sich selbst. Helene gab sich einen Ruck und kehrte um. Sie hatte einen Plan gehabt, und nur weil die Sonne schien, konnte sie ihn nicht einfach so aufgeben. Dazu hatte sie viel zu lange auf diese Gelegenheit gewartet. Sie hatte sie herbeigesehnt, ihr ganzes Leben schon. Zumindest so lange sie denken konnte und seit ihre Mutter die Geschichten erzählt hatte. Sie würde klingeln und alles andere würde sich schon irgendwie ergeben. Mehr als rausschmeißen kann sie mich nicht, dachte Helene. Und was, wenn sie mich tatsächlich rausschmeißt? Dann stehe ich wieder da, wo ich die ganze Zeit schon stehe. Oh Gott, ich muss so dringend pinkeln wie noch nie in meinem Leben!
Helene überquerte die Straße und lief schnell zu dem Café, das schräg gegenüber lag, um ihre aufkommende Panik in die Kanalisation zu spülen. Als sie wieder auf die Straße trat, ging es ihr zwar keinen Deut besser, doch sie machte sich vor, endgültig zu dem entscheidenden Schritt entschlossen zu sein.
Das Haus, in dem die Alte lebte, war völlig anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Helene hatte nicht erwartet, mitten in der Innenstadt, mitten im Glockenbachviertel, ein kleines Zweifamilienhaus vorzufinden. Ein richtiges Hexenhaus mit schäbigem Dach und schmutzigbrauner Fassade. Die alten Holzfensterrahmen waren hellblau gestrichen. An der Straßenseite rankte sich das laubfreie Geäst eines Knöterichs bis unter die Dachrinne. Helene öffnete das Gartentor und betrat einen Garten in der Größe eines Handtuchs, der zwischen dem Hexenhaus und dem benachbarten Wohnhaus lag. Gebrochene Steinplatten bis zur Eingangstür, daneben ein Müllcontainer, die blaue Tonne für Altpapier und die braune für Bioabfall. Helene wäre beinahe auf den vereisten Platten ausgerutscht und drückte Halt suchend viel zu lange auf die Klingel.
Nichts rührte sich im Haus. Womöglich war die Alte gar nicht daheim. Helene fühlte Enttäuschung und Erleichterung gleichzeitig. Sie läutete erneut. Dann wurde drinnen eine Kette vorgeschoben, dann noch eine, schließlich öffnete sich die Tür einen Spalt breit. Ein altes, runzeliges Gesicht presste sich in den Spalt. Hellwache, wasserblaue Augen musterten Helene von oben bis unten. Die Tür wurde wieder geschlossen, erneutes Rasseln von zwei Ketten, dann wurde die Tür weit aufgerissen. Eine kleine, uralte Frau lächelte Helene an. Sie trug eine rosafarbene gestärkte Kittelschürze, ihre Beine steckten in dicken steingrauen Wollstrümpfen, sie trug keine Schuhe. Ihre silbergrauen, sorgsam ondulierten Haare bildeten einen seltsamen Kontrast zu der Hausmütterchenkleidung.
»Grüß Gott, Frau Frese«, begann Helene und suchte gleichzeitig verzweifelt nach Worten. Sie hatte sich alles Mögliche ausgedacht, erst wollte sie sich als Spendensammlerin vom Roten Kreuz oder von der Heilsarmee ausgeben, dann als eine neue Mitarbeiterin der Anwaltskanzlei Beck, die noch etwas wegen des Testaments besprechen wolle, dann als eine freiwillige Helferin vom Katholischen Frauenbund … Jetzt schoss ihr auf einmal durch den Kopf, dass sie sich als Studentin ausgeben sollte. Ethnologie, Spezialgebiet Westafrika, auf der Suche nach Informationen über die Ndjamele.
»Na, Sie sind aber ganz schön früh dran!«, unterbrach die Alte sie. »Ich hatte erst in einer Stunde mit Ihnen gerechnet. Na, Kind, kommen Sie mal rein. Immer rein in die gute Stube.« Sie lachte fröhlich und machte Helene Platz.
Zögernd betrat Helene das Haus. Ihre Gedanken fuhren Karussell. Warum begrüßte die Alte sie, als hätte sie Helene erwartet?
»Immer geradeaus und dann letzte Tür links in die Küche!«, rief die Greisin. Helene folgte dem Flur, der mit einer abenteuerlich gemusterten, ockerfarbenen Sechziger-Jahre-Tapete tapeziert war, und ging in die gemütlich warme Küche. Die Vorhänge an den Fenstern mochten vor Menschengedenken einmal weiß gewesen sein. Die Unordnung in dem Raum bestürzte Helene. Hatte die Alte keine Haushaltshilfe? Keine Putzfrau? Überall standen offene Lebensmittelpackungen herum, auf den Ablagen türmten sich Dosen und Einweckgläser, offene und noch verschlossene. Vermutlich lebte in einigen der Inhalt, Helene wagte gar nicht daran zu denken.
»So, Frau …« Die Alte war fast lautlos hinter Helene getreten, obwohl sie sich beim Gehen auf einen Stock mit Silberknauf stützte.
»Marwitz. Helene Marwitz ist mein Name.«
»Frese. Emmy Frese ist mein Name«, erwiderte die Alte und schüttelte Helene herzlich die Hand. »Komisch. Marwitz, hm? Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ich diesen Namen auf meiner Liste habe.« Emmy Frese nahm umständlich am Küchentisch Platz und griff sich eine aufgeschlagene Zeitung, die den Abschluss einer Getränkeverpackungspyramide bildete. Dabei segelte ein kleiner weißer Zettel auf den Boden. Die Alte bemerkte es nicht. »Komisch, wo ist denn der Zettel mit den Namen? Na, wie dem auch sei, Frau Marwitz, Sie sind die Erste und soll ich Ihnen was sagen? Sie gefallen mir. Ich hätte zwar kein so junges Ding erwartet, und noch dazu ein so hübsches Ding, aber Sie gefallen mir!«
Helene fühlte sich wie das Opfer von Versteckte Kamera. Was ging hier vor sich? »Ich verstehe nicht ganz«, sagte sie leise.
Emmy Frese schlug mit dem Handrücken auf die Zeitung. »Sie wollen sich also bei mir als Haushaltshilfe bewerben?« Ihr Blick schwirrte wie eine aufgescheuchte Motte durch die Küche. »Oh Gott, ich weiß, was Sie jetzt denken! Die Alte lebt hier mitten im Müll und braucht nun eine Doofe, die das Ganze mal auf Vordermann bringt. Geben Sie’s ruhig zu.«
Helene gab es nicht zu, obwohl sie genau das dachte und ihr allmählich dämmerte, worum es hier ging.
»Neinneinnein«, fuhr die Alte fort. »Ganz so ist es nicht. Sehen Sie, ich habe nur damit angefangen, mal die Küche auszumisten. Alles raus, was ich nicht brauche oder was längst unbrauchbar ist. Da käme mir natürlich schon eine Hilfe recht. Aber Sie müssen nichts machen, was nicht auch in der Zeitungsannonce steht. Da bin ich ganz korrekt.« Emmy Frese bedeckte ihr Gesicht mit der Zeitung.
Helenes Verwirrung war perfekt. Wollte die Alte jetzt ein Nickerchen machen?
»Hier ist ja meine Annonce«, sagte die Greisin und hielt sich die Zeitung weiterhin ohne Abstand vor das Gesicht. Blind wie ein Maulwurf, erkannte Helene. »Suche Haushaltshilfe, 2-3 x wöchentlich, f. Einkaufen und leichte Hausarbeiten. Kein Putzen. Ja, genau. Eine Putzfrau habe ich nämlich.«
Helene musste sich zurückhalten, um nicht in die Knie zu sinken und ein paar Ave Maria zu beten. Die Chance, auf die sie ihr Leben lang gewartet hatte, war ganz unverhofft da. Sie wollte lachen oder weinen. Vor Erleichterung und Glück, dass ihr der Zufall so leicht die Tür geöffnet hatte. Sie musste Emmy Frese nicht unter fadenscheinigen Vorwänden plumpe Fragen stellen. Durch eine gütige Fügung des Schicksals würde sie als Haushaltshilfe das Vertrauen der Alten gewinnen und könnte im Laufe der Zeit alles herausfinden, was sie wissen wollte. Die Alte brauchte nicht zu erfahren, dass Helene die Annonce nie gelesen hatte. Sie hatte es geschafft. »Strike« oder »Full House« oder wie sie in den amerikanischen Filmen bei solchen Gelegenheiten immer zu sagen pflegten.
Alle gedanklichen Planspiele, die sie wieder und wieder insgeheim geprobt hatte, waren hinfällig. Dabei hatte sie an nichts anderes mehr gedacht, seit sie vor drei Tagen von ihrem Chef gebeten worden war, ihm doch bitte schnellstmöglich die Akte Prestl zu bringen.
»Wird sofort erledigt«, hatte sie zurückgesäuselt und sich damit einen abschätzigen Blick ihrer Kollegin Gitti eingehandelt, die an diesem Tag zum ersten Mal von ihrer Beschäftigung (Fingernägellackieren) aufgesehen hatte. Helene kannte ihre Kollegin genau. Schleimerin, hatte Gitti sicher in dem Moment gedacht. Doch Helene pflegte nie zu schleimen, sie hatte sich nur zur Angewohnheit gemacht, besonders freundlich zu sein, wenn sie schlechte Laune hatte. Wie an diesem Tag. Also hatte sie gesäuselt, als sie Kaffee servierte, als sie Klienten Termine zuwies und als sie gebeten wurde, die Akte Prestl schnellstmöglich herauszusuchen. Und säuselnd hatte sie ihren Tag zu Ende bringen wollen, der ewig kaugummikauenden Gitti zum Trotz. Helene war zum Aktenschrank gegangen, hatte die Schublade mit den Hängeregistern »Pa – Se« herausgezogen und Prestl gesucht. Die Akte war nicht zu finden gewesen. Jedenfalls nicht unter »Pr«, dort hatte sich die Akte »Frese« befunden. Gitti und ihre Ablage. Da hatte sie vermutlich wieder mal nur die neueste Farbpalette für Fingernagellack im Kopf und sich gedacht: »Pr« oder »Fr«, wo ist da der Unterschied? Klingt doch total ähnlich, da kann man sich schon mal vertun.
Frese. Ausgerechnet Frese. Helene hatte die Akte gebannt angestarrt. Der Mädchenname ihrer Großmutter, der Name, der in allen Geschichten ihrer Mutter eine zentrale Rolle gespielt hatte. Frese. Nun, es gab in München einige Träger dieses Namens, wenn auch vergleichsweise wenige, wenn man mal an Schmidt oder Müller dachte. Wenn sich Helene jemals wirklich dahinter geklemmt hätte, wäre sie früher oder später auf den Richtigen oder die Richtige gestoßen, sofern er oder sie überhaupt noch lebte. Sie hatte es nie getan, sich nie wirklich auf die Suche begeben, es immer verschoben auf ein andermal.
Aber wenn das Schicksal schon mit Zaunpfählen um sich schmiss, musste man was tun. Zum Beispiel den Akt öffnen und nachschauen, ob es vielleicht der richtige Frese war. Ein paar Blätter Schriftverkehr zwischen der Anwaltskanzlei Beck und Emmy Frese, Palmstraße 7, München, aus den achtziger Jahren. Ein versiegelter Umschlag, das Testament. Und dann die Kopie einer Geburtsurkunde für Emmy Wilhelmine Bertha Frese, geboren am 23. März 1904 in Buëa, Deutsch-Kamerun; Vater: Leopold Konrad Frese, Kaufmann und Plantagenbesitzer aus München; Mutter: Bertha Sieglinde Frese, geborene Wartmann, Krankenschwester und Kaufmannsgattin aus Berlin; Eltern des Vaters, Eltern der Mutter, etc. Helene war für einen Augenblick schwindelig geworden. Kein Zweifel, das war die richtige Frese. Sie lebte offenbar noch, denn das Testament war noch nicht geöffnet worden, und sie lebte gar nicht so weit von Helene entfernt. Ebenfalls im Glockenbachviertel. Vielleicht waren sie sich sogar schon im Supermarkt begegnet.
Jetzt, drei Tage später, wusste Helene, dass sie sich noch nie an der Käsetheke gesehen hatten. Die kleine Alte mit dem verwitterten Gesicht wäre ihr sicherlich aufgefallen.
»Kreislaufprobleme?«, hatte Gitti gefragt, als Helene sich kurz gegen den Schreibtisch gelehnt hatte, um sich vom positiven Schock ihrer Entdeckung zu erholen.
»Geht schon wieder«, hatte Helene geantwortet und Gitti hatte sich nahtlos weiter ihren Fingernägeln gewidmet.
Helene lächelte Emmy Frese, geboren 1904 in Buëa, Deutsch-Kamerun, freundlich an. Sieht ja noch ganz schön fit aus, dabei ist sie schon fast hundert Jahre alt, dachte sie sich. In dem Alter zählte man sicher nur noch die Tage. Zeitverlust konnte sie sich also nicht leisten.
»Wissen Sie«, sagte Helene deshalb, »ich arbeite als Rechtsanwaltsgehilfin. Aber ich dachte mir, ich könnte noch ein kleines Zubrot verdienen. Ein paar Stunden die Woche. Sie wissen ja«, Helene seufzte melodramatisch, »München ist ein ganz schön teures Pflaster.«
Emmy Frese seufzte solidarisch mit und winkte mit ihrer welken Hand wissend ab. »Wem sagen Sie das. Und eine junge, so hübsche Frau wie Sie hat bestimmt viele Verehrer, für die Sie sich schön machen wollen. Oh, ich weiß, was all die Sachen kosten, die wir Frauen so brauchen.« Sie zwinkerte verschwörerisch.
Verehrer! Was für ein schönes Wort für die Flops, die Helene in der letzten Zeit um sich gehabt hatte. Mal kürzer, mal länger. Einzige Ausnahme war Bert, mit dem sie fünf Jahre in trauter Zweisamkeit gelebt hatte, bis sie dann herausfand, dass die Zweisamkeit schon seit längerem eine Dreisamkeit war. Trotzdem hatte sie ihn geliebt und war nach der Trennung monatelang mit Grabesmiene herumgelaufen, wobei sie im Beruf zu einer neuen Höchstform im freundlichen Säuseln aufgelaufen war. Nun gut, über Bert war sie endlich hinweg, trotzdem war er im Vergleich zu den anderen Flitzpiepen der reinste Gott gewesen. Helene hätte der Alten da Geschichten erzählen können – von wegen Verehrer. Seit der Trennung von Bert hatte es nur zwei One-Night-Stands gegeben.
»Anwaltsgehilfin, so, so«, sagte Emmy Frese.
Beschwingt machte sich Helene auf den Nachhauseweg. Dreimal die Woche für jeweils zwei Stunden in der Nähe von Emmy Frese, einkaufen, aufräumen, ihr Vertrauen gewinnen und alles erfahren, was Helene wissen wollte. Dazu noch etwas Geld verdienen, auch wenn sie es nicht brauchen würde, wenn alles nach Plan liefe. Dann würde sie nämlich nie mehr Geldsorgen haben. Sie lief die Arndtstraße entlang, dann durch den schmalen Park, durch den der Westermühlbach fließt. Der Glockenbach, nach dem das Viertel benannt ist, verläuft schon seit Jahrzehnten unterirdisch. Selbst der kleine vereiste Abhang, der zum Alten Südlichen Friedhof hinauf führt und den sie sonst bei winterlichen Straßenverhältnissen mied, weil sie schon zweimal dort ausgerutscht und böse hingefallen war, schreckte sie diesmal nicht. Bald bin ich reich, reich, reich, dachte sie bei jedem Schritt, alles wird gut, gut, gut.
Auf dem Weg, der, eingesäumt von den hohen Mauern, die die beiden Teile des Friedhofs trennen, den direkten Durchgang von der Pestalozzistraße zur Thalkirchner Straße ermöglicht, spielten ein paar Kinder. Wie immer, wenn Helene diesen Weg ging, und sie ging ihn möglichst oft, denn es gehörte zu einer Art Ritual, ständig mit der Vergangenheit konfrontiert zu werden, blieb sie kurz vor der Gedenktafel für die im Krieg gefallenen Soldaten stehen. Zielsicher fiel ihr Blick auf das untere rechte Eck, auf dem die in den Kolonialkriegen Gefallenen geehrt wurden. Bisher war sie nach einer kurzen Pause immer stumm weitergegangen. Diesmal öffnete sie den Mund und hauchte »Danke« in die frostige Nachmittagsluft.
05 Eisiger Wind peitschte den Schneeregen über die Straße. Der Wetterdienst hatte Fön und Sonnenschein mit »für die Jahreszeit zu warmen Temperaturen« vorausgesagt. Von wegen! Pfeffer schlug den Kragen seines Mantels hoch, als sie sich dem Haus näherten. Es war noch früh am Morgen und er war schon seit Stunden auf den Beinen. Frühstück für die Kinder machen, eine halbe Stunde Joggen und ins Büro hetzen – so sah seit Monaten sein Sportprogramm aus – dann den Tagesablauf mit den Kollegen absprechen und die paar Personen abklappern, deren Namen in Westphals Filofax zu finden waren. Außer zwei Tassen Espresso und einem halben Päckchen Zigaretten hatte er noch nichts gefrühstückt. Wie fast jeden Morgen. Auch eine Möglichkeit, schlank zu bleiben.
Pfeffer zündete sich eine neue Zigarette an und sah zwei Gestalten nach, die durch die Graupelschauer die Straße hinunterwankten. Sie waren als Afrikaner verkleidet, schwarze Trikots mit Baströckchen und Lockenperücken. Vermutlich gab es die Kostüme beim Schnäppchenmarkt zum Sonderpreis. Die beiden erinnerten Pfeffer daran, dass Faschingszeit war. Das war an ihm bisher völlig vorbeigerauscht. War Weihnachten nicht erst vorgestern gewesen?
Er hatte sich noch nie etwas daraus gemacht, auch damals nicht, als er noch eine funktionierende Familie gehabt und seinen kleinen Kindern beim Kostümebasteln geholfen hatte. Nun fanden seine halbwüchsigen Söhne Fasching krass ätzend und konkret uncool. Gott sei Dank, dass sie nicht im Rheinland lebten, wo man dem Grauen nicht entgehen konnte.
»Gehst du mit deiner Irene auf Fasching?«, fragte er seinen Kollegen Freudensprung, während er auf die Klingel am Tor des gutbürgerlichen Einfamilienhauses drückte.
»Nö«, antwortete Freudensprung schlecht gelaunt.
»Nicht? Du bist doch mit deiner Frau all die Jahre immer …«
»Dieses Jahr eben nicht«, raunzte Freudensprung.
»Entschuldige, dass ich mit dir spreche«, sagte Pfeffer gereizt und klingelte noch einmal. »Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen, Paul? Seit Tagen bist du unausstehlich.«
»Nix ist mir über die Leber gelaufen«, brummelte Freudensprung und fuhr sich durchs Haar, das auf seinem Kopf immer mehr die Flucht nach hinten antrat. Seine Frau Irene hatte ihm regelmäßig alle möglichen und unmöglichen Haarwachstumsmittelchen mitgebracht. Kollegin Annabella Scholz nannte seine Geheimratsecken stets »dramatisch«. Freudensprung konnte Anspielungen auf seine schwindende Haarpracht nicht leiden. Genauso wenig konnte er es leiden, wenn er wegen seines Namens »Gaudihupf« oder der Kürze halber meist nur »Gaudi« genannt wurde. Bella zog ihn damit ständig auf. »Na los, Frese-Mayer, mach endlich die Tür auf! Mir frieren die Eier ab.«
Wie auf Kommando krächzte eine Stimme aus der Gegensprechanlage: »Ja bitte?«
»Frau Sabine Frese-Mayer? Können wir bitte kurz mit Ihnen sprechen? Kripo München.«
»Was wollen Sie? Ist meinem Mann etwas passiert, oder hat er wieder etwas angestellt?«, quäkte die Stimme.
»Keine Sorge«, sagte Pfeffer betont freundlich. »Wir haben nur ein paar Fragen an Sie und Ihren Mann. Lassen Sie uns bitte für einen Moment rein.« Pfeffer spürte, wie seine Zehen vor Kälte taub wurden.
»Warten Sie«, antwortete die Frauenstimme. »Mein Mann ist nicht da und ich muss zu einem Businesstermin nach Berlin. Ich komme gleich raus, mein Taxi müsste jeden Moment da sein.«
»Scheiße!«, fluchte Freudensprung und hüpfte von einem Bein auf das andere.
Es dauerte noch einige Minuten, bis sich endlich die Eingangstür öffnete und eine perfekt gestylte Frau im dunklen Kaschmirmantel auf den Waschbetonweg trat. Ein kuscheliger Pelzkragen umschmeichelte ihr Gesicht. In den warm behandschuhten Händen trug sie einen kleinen Koffer und eine Aktentasche aus Krokolederimitat.
»Worum geht es?«, fragte sie die beiden Kriminalbeamten und winkte mit einem »Jajaja« gelangweilt ab, als Pfeffer ihr seinen Ausweis- unter die Nase hielt.
»Frau Frese-Mayer, kennen Sie einen Doktor Sönke Westphal?«
»Nicht, dass ich wüsste. Sollte ich?«, entgegnete sie leicht schnippisch. Der Wind brachte keine Strähne ihres betont auf lässig frisierten Haares durcheinander.
»Er war Experte für afrikanische Kunst«, sagte Freudensprung.
»War?« Frau Frese-Mayer zog eine Augenbraue hoch. Es sah nach einer lange und sorgfältig einstudierten Mimik Marke »Sag mir lieber gleich, was du zu verheimlichen versuchst« aus.
»Er wurde gestern tot aufgefunden, Frau Frese-Mayer. Ermordet, um genauer zu sein.« Pfeffer bemühte sich genauso gelangweilt zu reden wie sein Gegenüber.
Keine Reaktion bei der Frau. »Bedauerlich«, sagte sie mit einem Schulterzucken. »Doch leider kann ich Ihnen beim besten Willen nicht weiterhelfen. Ich kannte ihn nicht. Ah, da kommt ja endlich mein Taxi.« Ein zartbeiger Mercedes hielt an.
»Und Ihr Mann? Könnte er Doktor Westphal gekannt haben?«, fragte Pfeffer und half der Frau beim Verstauen des Koffers auf der Taxirückbank.
»Schon möglich. Georg kennt die seltsamsten Menschen. Aber das müssen Sie ihn selbst fragen.« Sie stieg in den Wagen.
»Wann ist Ihr Mann denn mal zu Hause?« Pfeffer musste sich beherrschen, um nicht noch »Lassen Sie sich halt nicht alles aus der Nase ziehen« hinzuzufügen.
»Mein Mann ist gestern für zwei Tage zum Skifahren nach Zürs gefahren. Da müssen Sie sich also noch ein wenig gedulden. Und wenn er wieder da ist, dann erreichen Sie ihn am besten bei seiner Großtante. Da kann er sich durchschmarotzen und nach Herzenslust besaufen. Seine beiden Lieblingsbeschäftigungen.« Sie zog mit einem Ruck die Autotüre zu. Pfeffer wollte sie schon fast wieder aufreißen, als Frau Frese-Mayer das Fenster einen Spalt herunterließ und »Emmy Frese, Palmstraße 7. Glockenbachviertel. Schönen Tag noch!« rief, während das Taxi losfuhr.
»Jetzt schließ endlich das verdammte Auto auf, ich habe schon Frostbeulen«, grummelte Paul Freudensprung.
»Hör zu, Paul«, sagte Pfeffer, als sie endlich im warmen Wagen saßen. Er steckte den Schlüssel ins Zündschloss, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Freudensprung sah seinen Chef verwundert an. »Deine Laune geht uns allen auf den Sack. Entweder du sagst mir jetzt, was los ist, oder ich werde dich auf irgendeinen popeligen Fall ansetzen. Dann kannst du dich alleine am Schreibtisch austoben und vermiest uns anderen nicht das Leben.«
Freudensprung verschränkte auch die Arme, lehnte sich zurück und schwieg.
»Wie lange kennen wir uns jetzt?« Pfeffer bemühte sich um einen versöhnlichen Ton und zündete sich eine Zigarette an. »Wir sind schon zu lange befreundet, als dass wir uns noch was vormachen könnten, oder? Du hast mir damals sehr geholfen, als ich vor den Trümmern meiner Ehe stand. Du weißt alles über mich, ich weiß mit Sicherheit viel über dich, oder irre ich mich? Was ist los mit dir?« Freudensprung schwieg. »Du kannst mir zigmal erzählen, dass du nur schlecht geschlafen hast. Mann, ich sehe doch, dass es dir beschissen geht. Ist es wegen Irene? Habt ihr Krach?«