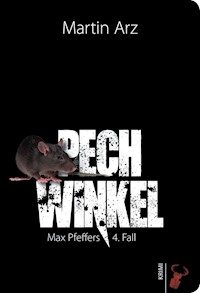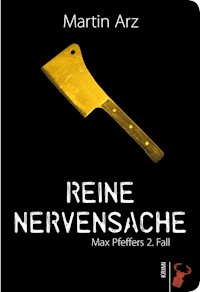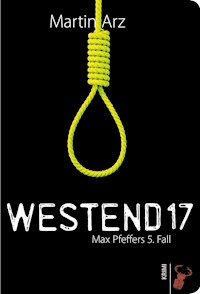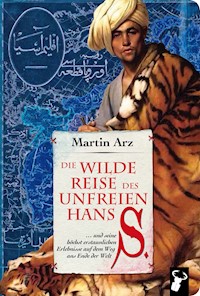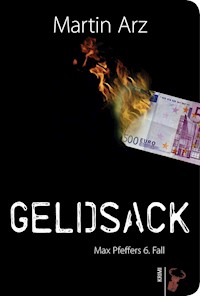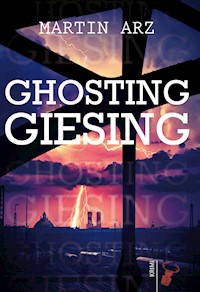12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hirschkäfer Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
München 1945 – in den Ruinen der Stadt geht es für viele ums nackte Überleben. Jeder schaut, wo er bleibt. Der Schwarzmarkt blüht. Auch eine Clique von 14- bis 16-jährigen Rumtreibern möchte ein Stück vom großen Kuchen abhaben. Man kennt sich vom Pfadfinderclub der Stadtpanther. Nach kleinen Diebstählen und lästigen Jugendstrafen werden die Stadtpanther von ihrem Anführer zu einer straff organisierten Bande nach dem Vorbild amerikanischer Syndikate aufgebaut. Wie bei der Mafia gilt für alle Mitglieder das Gesetz des Schweigens. Verrat wird mit dem Tod bestraft. Der Boss kennt keine Gnade und in den Isarauen kann man leicht Leichen verschwinden lassen. Nach kleineren Aktionen wird der ganz große Coup geplant, er soll allen ein sorgenfreies Leben ermöglichen. Doch es gibt immer wieder Schwierigkeiten, nichts läuft so glatt, wie es in den amerikanischen Gangsterfilmen dargestellt wird. Dann fallen Schüsse in einem Kino … Basierend auf den Gerichtsakten erzählt Martin Arz in diesem packenden Roman nach Tatsachen die Geschichte der gefürchteten Pantherbande, die München in den Nachkriegsjahren mit einer Verbrechensserie überzog.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch beruht auf wahren Begebenheiten. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte wurden die handelnden Personen umbenannt.
Dieses Buchprojekt wurde unterstützt durch:
Juni 2023
Cover und Illustrationen: Coriander Pinxit
Grafische Gestaltung von Hirschkäfer Design/Coriander Pinxit
© Hirschkäfer Verlag, München 2023
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.
e-book ISBN 978-3-940839-94-7
Besuchen Sie uns im Internet:
www.hirschkaefer-verlag.de
Inhalt
18. Oktober 1951: Filmpalast, Maximilianstraße, Augsburg
26. Oktober 1951: Polizeipräsidium München, Ettstraße
Herbst 1943: Kinderlandverschickungslager Aindling
Winterferien 1943/44: Münchner Waisenhaus, München-Neuhausen
Winterferien 1943/44: Danziger Freiheit, München-Schwabing
Winterferien 1943/44: Herzogstraße, München-Schwabing
Winterferien 1943/44: Clemensstraße, München-Schwabing
Winterferien 1943/44: Clemensstraße, München-Schwabing
Winterferien 1943/44: Fraunhoferstraße, München-Isarvorstadt
Januar 1944: Kinderlandverschickungslager Aindling
Februar 1944: Kinderlandverschickungslager Aindling
18. Juli 1944: Kinderlandverschickungslager Aindling
November 1944: Kaufhaus Roman Mayr, Marienplatz, München
30. April und 1. Mai 1945: München
Sommer 1945: Danziger Freiheit, bald Münchner Freiheit, München-Schwabing
Sommer 1945: Kleinhesseloher See im Englischen Garten, München-Schwabing
Sommer 1945: Gabriel Filmtheater, Dachauer Straße, München-Maxvorstadt
Weihnachten 1945: München
Weihnachten 1945: Reichenbachbrücke, München-Isarvorstadt
Frühjahr 1946: Bavariaring, München-Ludwigsvorstadt
Frühjahr 1946: Simmernschule, Simmernstraße, München-Schwabing
Frühjahr 1946: Rotkreuzplatz, München-Neuhausen
Mai 1946: Herzogstraße, München-Schwabing
Mai 1946: Palmstraße, München-Isarvorstadt
Juni 1946: Englischer Garten hinter der Lodenfrey-Fabrik, München-Schwabing
Sommer 1946: Waldeckstraße, München-Untergiesing
Sommer 1946: Palmstraße, München-Isarvorstadt
Sommer 1946: Münchner Freiheit, München-Schwabing
Sommer 1946: Möhlstraße, München-Bogenhausen
Sommer 1946: Clemensstraße, München-Schwabing
Oktober 1946: Waldeckstraße, München-Untergiesing
Herbst 1946: Glockenbachviertel, München-Isarvorstadt
Herbst 1946: Palmstraße, München-Isarvorstadt
23. November 1946: Großtankstelle der Zentralwerkstätten, Brienner Straße 50, München-Maxvorstadt
24. November 1946: Habsburgerplatz 5, München-Schwabing
24. November 1946: Habsburgerplatz an der Ecke Ainmillerstraße, München-Schwabing
24. November 1946: Polizeipräsidium München, Ettstraße
26. November 1946: Palmstraße, München-Isarvorstadt
15. Februar 1947: Amerikanisches Militärgericht
20. Mai 1947: Amtsgericht Wasserburg, Marienplatz 7, Wasserburg am Inn
November 1947: Münchner Freiheit, München-Schwabing
November 1947: Clemensstraße, München-Schwabing
2. August 1948: Viktualienmarkt, München
11. September 1948: Theresienwiese, München-Ludwigsvorstadt
Herbst 1948: Münchner Freiheit, München-Schwabing
1. November 1948: Schutthügel Oberwiesenfeld, München-Milbertshofen
11. November 1948: Waldeckstraße, München-Untergiesing
März 1949: Schuttberg Oberwiesenfeld, München-Milbertshofen
Juni 1949: Gärtnerplatz, München-Isarvorstadt
Juni 1949: Englischer Garten südlich vom Aumeister, München-Schwabing
Juni 1949: Fraunhoferstraße, München-Isarvorstadt
1. Juli 1949: Möhlstraße, München-Bogenhausen
Juli 1949: Oberstdorf im Allgäu
13. August 1949: Nördlicher Englischer Garten, München-Großlappen
15. August 1949: Nördlicher Englischer Garten, München-Großlappen
August 1949: Fraunhoferstraße, München-Isarvorstadt
Herbst 1949: Gästeheim, Ecke Robert-Koch-/Graf-Seyssel-Straße, Geiselgasteig
29. Oktober 1949: Marienplatz, München
November 1949: Nördlicher Englischer Garten, München-Großlappen
März 1950: Münchner Freiheit, München-Schwabing
März 1950: Schuttberg am Luitpoldpark, München-Milbertshofen
Mai 1950: Schuttberg am Luitpoldpark, München-Milbertshofen
Juli 1950: Kurfürstenplatz, München-Schwabing
Sommer 1950: Münchner Freiheit, München-Schwabing
Herbst 1950: Schuttberg am Luitpoldpark, München-Milbertshofen
30. Januar 1951: Ecke Clemens-/Bismarckstraße, München-Schwabing
Februar 1951: Münchner Freiheit, München-Schwabing
Februar 1951: Schuttberg am Luitpoldpark, München-Milbertshofen
20. Februar 1951: Hauptzollamt, Landsberger Straße 122-132, München-Schwanthalerhöhe
April 1951: Englischer Garten südlich vom Aumeister, München-Schwabing
Juni 1951: Schuttberg am Luitpoldpark, München-Milbertshofen
Juli 1951: Herzogstraße, München-Schwabing
August 1951: Waldeckstraße, München-Untergiesing
September 1951: Flaucher, München-Sendling
6. Oktober 1951: Gärtnerplatz, München-Isarvorstadt
12. Oktober 1951: Reichenbachbrücke, München-Isarvorstadt
13. Oktober 1951: Alter Botanischer Garten, München-Maxvorstadt
14. Oktober 1951: Leopoldstraße, München-Schwabing
14. Oktober 1951: Gästeheim, Ecke Robert-Koch-/Graf-Seyssel-Straße, Geiselgasteig
14. Oktober 1951: Langobardenstraße 12, München-Harlaching
15. Oktober 1951: Grünanlage neben der Reichenbachbrücke, München-Au
17. Oktober 1951: Münchner Freiheit, München-Schwabing
18. Oktober 1951: Filmpalast, Maximilianstraße 30, Augsburg
19. Oktober 1951: Ecke Donnersberger-/Landsberger Straße, München-Schwanthalerhöhe
20. Oktober 1951: Ursulakirche, München-Schwabing
23. Oktober 1951: Ursulakirche, München-Schwabing
27. Oktober 1951: Ecke Friedrich-/Franz-Josef-Straße, München-Schwabing
26. Oktober 1951: Polizeipräsidium München, Ettstraße
29. Oktober 1951: Münchner Freiheit, München-Schwabing
Oktober, November 1951: Polizeipräsidium München, Ettstraße Corneliusgefängnis, Ecke Baader-/ Corneliusstraße, München
November, Dezember 1951: Polizeipräsidium München, Ettstraße Corneliusgefängnis, Ecke Baader-/ Corneliusstraße, München
23. Mai 1953: Justizpalast, Prielmayerstraße, München-Maxvorstadt
5. November 1974: Johann-Clanze-Straße, München-Sendling
Nachwort
Danke:
Originalzitate sind:
Zahlen und Informationen zu München in den Jahren 1943 bis 1974 stammen aus:
Literatur zur Pantherbande:
Romane von Martin Arz im Hirschkäfer Verlag
18. Oktober 1951 Filmpalast, Maximilianstraße, Augsburg
Cary Grant, was für ein schneidiger Mann! Und die Ingrid Bergman sah einfach unglaublich glamourös aus in ihren eleganten Abendkleidern. Seit der Film ›Weißes Gift‹ in ihrem Kino angelaufen war, stahl sich Gunda bei jeder Vorstellung in den Saal, um mit dem feschen Traumpaar auf der Leinwand in eine schönere Fantasiewelt zu entfliehen. Sicher, der Film war dramatisch und die Schurken, die die arme Ingrid bedrohten, richtig widerlich, doch da gab es eben diesen unwirklich attraktiven Cary, der am Ende seine Ingrid retten konnte. Ach, Cary Grant! Da kamen Dieter Borsche, für den sie durchaus schwärmte, und auch O. W. Fischer, der nun wirklich sehr attraktiv war, nicht gegen an. Gunda fieberte jedes Mal der Kussszene entgegen. So lange hatten sich in einem Film nie zwei Menschen geküsst.
»He, Gunda.«
Gunda hörte das Flüstern ihrer Kollegin von der Kasse. Nein, nicht jetzt. Sie riss sich so ungern von der Leinwand los. Und bis zur Kussszene dauerte es noch mehr als eine halbe Stunde.
»Gunda.« Berta von der Kasse zupfte Gunda am Ärmel. »Du hast Kundschaft bei den Männern.« Berta schlüpfte wieder durch den dicken Vorhang nach draußen.
»Na jut«, seufzte Gunda Fietkau. »Dat Jeld muss verdient werden.« Dass sie aus Ostpreußen kam, hörte man ihr immer noch ein wenig an, auch nach all den Jahren, die sie seit der Flucht schon in Augsburg lebte. Sie verließ den Kinosaal so leise und unauffällig wie möglich, ging durch das Foyer und die Treppen hinunter zu den Toiletten. Dass ein Besucher den Saal verlassen hatte, war ihr gar nicht aufgefallen. Die zehn Pfennig Toilettengebühr konnte sie sich freilich nicht entgehen lassen. Gunda Fietkau aus Blandau war eine sogenannte Anstandsdame, ein schönes Wort für Klofrau. Anstandsdame im Filmpalast an der Augsburger Maximilianstraße. Sie schielte in die Herrentoilette. Bei den Pissoirs war niemand zu sehen. Sie steckte den Kopf in den Raum. Eine der Kabinen war abgeschlossen. Also setzte sie sich auf ihren Stuhl im Vorraum und wartete. Sie nahm die aktuelle Kristall-Illustrierte vom Tisch, die mit König Paul von Griechenland und Königin Friederike auf dem Titelbild, und blätterte darin herum. Die Königshäuser waren immer interessant. Auch in der Wiederholung, hatte sie doch die Zeitschrift längst ausgelesen. Nun las sie den Bericht, wie sich alle gekrönten Häupter Europas in Hannover zur Welfen-Hochzeit trafen, erneut. Warten. Es dauerte lange. Zu lange, nach Gundas Geschmack.
»He, allet in Ordnung bei Ihnen«, rief sie schließlich in die Herrentoilette. Keine Antwort. Dann ein Seufzen. Gunda Fietkau kniff angewidert die Augen zusammen. Schon wieder so ein Perverser! Es war nicht das erste Mal, dass Männer in der Toilette länger als nötig blieben. Denn von den Klofenstern aus konnte man den Frauen, die auf der Straße vorbeigingen, unter die Röcke schauen. Und sie, die Gunda, durfte dann häufig genug diese schleimigen Hinterlassenschaften der triebhaften Kerle wegwischen. Männer. Alle pervers. Die Monate auf der Flucht Richtung Westen hatten ihr nur zu deutlich vor Augen geführt und zweimal schmerzhaft spüren lassen, was diese selbst ernannte Krone der Schöpfung für Abschaum war.
Sie klopfte an die Kabinentür. »He, du Lorbass«, ihre ostpreußischen Schimpfworte sorgten meist für Heiterkeit. »Pack dat Dingens wieder ein! Und dann raus.« Wieder ein Stöhnen.
»So, jetzt isset aber man jut, Pomuchelskopp.« Sie klopfte gegen die Tür. Dann bückte sie sich, um unter dem Türspalt hineinzusehen. Sie sah seine Beine, die Schuhe zeigten in ihre Richtung. Also saß er doch auf dem Lokus, denn um den Frauen unter die Röcke zu schauen, musste man auf die Schüssel steigen. Womöglich hatte er Verdauungsprobleme. Gunda Fietkau jedoch roch nichts. Es müffelte ohnehin in den Toiletten, da half alles Putzen nichts, jedoch war es eben nicht zu überriechen, wenn mal ein größeres Geschäft getätigt wurde. Seltsam. Sie zog sich auf ihren Stuhl zu ihrer Kristall-Illustrierten zurück. Eine Frau eilte zur Toilette. Es passierte selten, dass während der Vorstellung Leute aufs Klo gingen. Die Frau kam heraus und legte die zehn Pfennig in Gundas Teller. Freundliches Nicken beidseitig.
Gunda seufzte. Sie würde die Kussszene verpassen! Rund zehn Minuten später kam ein Herr, der schnell auf die Pissoirs zusteuerte. Als er kurz danach ihr die zehn Pfennig in den Teller legte und freundlich nickte, sprach sie ihn an.
»Verzeihung, der Herr, aber darf ich Sie was bitten? Da, die eine Kabine, die ist schon sehr lange verschlossen. Könnten Sie bitte mal unten reinschauen?«
»Wie bitte?« Der Mann sah sie an, als wäre sie nicht mehr ganz dicht. »Ich möchte den Film nicht verpassen!«
»Ich fürchte, da ist ein Lorbass drin …«
»Ein was?«, fragte der Mann amüsiert. »Lorbass?«
Wie hieß das doch gleich hier? Gunda kniff die Augen konzentriert zusammen. »Ein Lümmel, ein Perverser, der womöglich unanständige Sachen macht.«
»Verstehe.« Der Mann zog die Brauen kraus, ging zur Kabine und bückte sich. Er richtete sich schnell wieder auf. »Da liegt einer!«, rief er.
Gunda Fietkau eilte hinzu und bückte sich ebenfalls. Tatsächlich lag auf dem Kachelboden ein junger Mann, den Oberkörper halb gegen die Schüssel gelehnt.
»He, Sie!«, rief Gunda. »Ist Ihnen nich jut? Machen Sie auf.« Der junge Mann reagierte nicht. Sein Brustkorb hob sich schwer. Er lebte also.
»Haben Sie nicht einen Schlüssel, um die Kabinen von außen zu öffnen?«, fragte der Herr.
»Sicher.« Darauf hätte sie auch selbst kommen können. Sie wühlte in den Taschen ihrer Kittelschürze. »Hier.« Sie holte den Vierkantsteckschlüssel hervor und setze ihn am Schloss an.
In diesem Moment hallten drei Schüsse aus der Kabine. Gunda Fietkau schrie spitz auf, ließ vor Schreck den Schlüssel fallen und duckte sich automatisch. Der Herr griff sich an die Brust.
»Herr Jesus!«, rief Gunda Fietkau und bückte sich nach dem Vierkantschlüssel. Blut lief aus der Kabine und umhüllte den Schlüssel. Gunda zog ihre Hand weg und murmelte zitternd: »Dat lang ich nicht an.«
Der Herr bückte sich, nahm mit spitzen Fingern den blutigen Schlüssel und beeilte sich, die Tür zu öffnen.
26. Oktober 1951 Polizeipräsidium München, Ettstraße
»Werner Hofmann, geboren am 19. April 1930 in München, Boss«, sagte Kriminaloberassistent Uwe Rößlein und legte seinem Vorgesetzten das Vernehmungsprotokoll auf den Schreibtisch. »Von der Mutter in die Fürsorge gegeben, aufgewachsen im Waisenhaus, kaufmännische Lehre. Zigfach vorbestraft. Drei Schüsse in die linke Brust zwischen Rippe fünf und sechs mit einer Selbstladepistole. Eine Walther PPK, Kaliber 7,65 mm. Eindeutig mit der Absicht, sich selbst zu töten, Boss.«
Kriminalhauptkommissar Klaus Brabant schmunzelte. Sein Assistent liebte alles Amerikanische und fand es ungeheuer modern, ihn, den Vorgesetzten, mit dem modernen Wort ›Boss‹ anzureden. Die jungen Leute. Brabant gönnte es ihnen, dass sie nun in einer freien Gesellschaft leben und sich entwickeln konnten. »Okay«, sagte Brabant betont lässig und amerikanisch gedehnt, und Rößlein lachte.
»Nicht schlecht, Boss«, sagte er. »Sie lernen das schon noch mit den Amis.«
»Na, ein sauberes Bürschlein«, sagte Brabant, nachdem er den Aktendeckel aufgeschlagen hatte und die erste Seite zu den Personalien überflogen hatte. »Werner Hofmann, wohnhaft bei seiner Mutter in der Waldeckstraße 50. Ist das nicht am Candidplatz, Rößlein? Giesing? Üble Gegend, ganz üble Gegend.« Uwe Rößlein nickte bestätigend. »Arbeitsscheu und bereits viermal wegen Diebstahls, schweren Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs und Hausfriedensbruchs vorbestraft. Das erste Mal mit sechzehn für sechs Monate in den Bau gewandert. Was für ein Herzchen. Ach, da schau her. Vater und Mutter waren Vetter und Base. Da sieht man wieder, wo das hinführt.« Kriminalhauptkommissar Klaus Brabant brummelte vor sich hin, während er weiterlas. »Und der werte Herr Vater saß auch schon wegen Diebstahls im Kittchen. Mutter ist … na was wohl … Hausfrau. Ach, da schau her. Der Herr hat eine Braut …«
»Ja«, sagte Rößlein. »Helga May, ist fünf Jahre älter als er, arbeitet als Krankenschwester bei der Kinderärztin Frau Doktor Fleming in der Waldfriedhofstraße 71. Der Hofmann trug zwei Abschiedsbriefe bei sich, einen an seine Mutter, einen an seine Braut. Wollen Sie die sehen?«
»Später, das hat Zeit. Haben Sie die Mutter und vor allem die Braut schon vernommen?«
»Nein, das mit der Braut wissen wir ja erst seit heute. Ich denke, Boss, wir haben den ganz großen Fisch.«
»Haftbefehle sind alle raus?«
»Ja. Natürlich.«
Die Haftbefehle waren ausgestellt auf:
G e r b e r Oskar (geb. 16.10.1930)
sowie
B e c k e r Franz Josef (geb. 09.08.1931)
F r i e b e l Josef (geb. 01.11.1930)
H a s l b e c k Georg (geb. 07.02.1931)
K r ö g e r Berthold (geb. 11.05.1932)
S e b a l d Roland (geb. 09.12.1929)
Z e c h Alfons (geb. 04.05.1929)
»Na gut«, sagte Brabant und seufzte, »noch nicht einmal alle volljährig.« Er blätterte im Akt weiter. »Dann wollen wir mal sehen, in was sich der Herr Werner Hofmann da hineinmanövriert hat …«
»… dass somit auch wir Menschen, die wir so oft und so gern uns selbst belügen, in Wahrheit ganz windige und tief tragische, zwiespältige Wesen sind, das Gute sowie auch das Böse in uns selbst in gleichem Maße tragen …«
Oskar Gerber in einem Brief an seinen Onkel Hans Seraph Gerber
Herbst 1943 Kinderlandverschickungslager Aindling
»Komm schon, Schorsch, das tut nicht weh.« Alle lachten, bis auf Georg, dem die Röte in die Wangen stieg. Mehr aus Wut, weil sie über ihn lachten, als aus Scham, weil er zu feige war. Er war nicht feige! Er war, wie alle anderen auch, am Marterpfahl gestanden und hatte alles ausgehalten! Nur die Fingerkuppe – Blut! Das mochte er gar nicht. Blut war bislang keines geflossen, und er hasste es, wenn er sein eigenes Blut fließen sah.
»Also gut.« Georg Haslbeck streckte seine rechte Hand aus, Handfläche nach oben und kniff die Augen zu, als die Messerspitze in seine Ringfingerkuppe stach. Sie hatten sich bewusst einen Finger ausgesucht, an dem eine Verletzung nicht so dramatisch war. Ein kleiner Blutstropfen fiel in das Glas. Oskar, der Georgs Hand festhielt, drückte ein bisschen am Finger herum, bis seiner Meinung nach genug Blut in das Glas getropft war. Als Oskar losließ, zog Georg seine Hand schnell zurück und steckte den blutenden Finger in den Mund.
»So«, verkündete Oskar feierlich und hielt das Glas in die Höhe. Das flackernde Licht des Lagerfeuers tauchte die Gesichter der Burschen in warmes Orange. Sie hatten sich alle indianermäßig zurechtgemacht. Gut, dass es ein relativ warmer Nachmittag war, man konnte den Herbst zwar regelrecht riechen, doch das Thermometer zeigte immer noch 16 Grad. Da mussten sie mit ihren dünnen ›Indianer‹-Hemdchen nicht allzu sehr frieren. Sie hatten sich indianische Symbole auf die Gesichter gemalt und mit allen möglichen Federn, die sie gefunden hatten, Kopfschmuck gebastelt. Oskar hatte als ihr Häuptling den eindrucksvollsten – neben den üblichen Tauben-, Gänse- und Hühnerfedern zierten zwei lange Fasanenfedern seinen Kopf. Die anderen Burschen sahen Oskar gespannt an. Er ließ die Spannung steigen und schwieg. Alfons Zech, vierzehn Jahre alt, Berthold Kröger, elf, Kurt Reicherts, dreizehn, Georg Haslbeck, zwölf, und er, Oskar Gerber, dreizehn. Fünf Buben aus München starrten auf das Glas in Oskars Händen. Das Lagerfeuer knisterte.
»Trinkt nun von dem Heiligen Gral«, deklamierte Oskar mit dramatischem Timbre. »Trinkt von unserem Blut, damit der Bund für alle Zeiten besiegelt ist und wir für alle Zeiten nach Sitte der edlen Indianer Blutsbrüder sind. Manitu sei unser Zeuge.« Er nahm einen kleinen Schluck aus dem Glas, in das alle ein paar Tropfen Blut gegeben hatten. Damit die Flüssigkeit für alle zum Trinken reichte, hatten sie Wasser hinzugegeben. Er gab das Glas an seinen Nebenmann Berthold weiter. Als alle getrunken hatten, nahm Oskar das Glas und leerte den Rest über ein kleines Holzpferd, das sie auf einer Stoffserviette neben das Lagerfeuer platziert hatten. »Billie ist unser Zeuge«, sagte Oskar. Das Holzpferd namens Billie gehörte Berthold, sein Großvater hatte es geschnitzt und dem Buben zum fünften Geburtstag geschenkt. Für den kleinen Berthold, der mit der Schande leben musste, der ledige Balg einer Zugehfrau zu sein, sein wertvollster Schatz. Während das Blut-Wasser-Gemisch über Billies Rumpf rann und vom Holz aufgesaugt wurde, wurde allen feierlich ums Herz.
Oskar ergriff erneut das Wort: »Wir sind nun der Panther-Bund, Kameraden. Panther fürs Leben!« Auf die Idee mit den Panthern waren sie gekommen, weil sich eine Gruppe Jungs aus der Klasse über ihnen die Tiger nannten. Da war Panther nur recht und billig.
»Der Panther-Bund«, riefen alle im Chor. »Panther fürs Leben!«
»Wir schwören, dass wir für uns einstehen und auf unser aller Wohlergehen schauen. Und ganz wichtig: Schweigen ist unser Motto«, sagte Oskar.
Alle nickten feierlich. Oskar sah allen in die Augen. Alle hielten seinem Blick stand. Dass er ihr Anführer war, stand von Anfang an fest. Selbst der ältere Alfons Zech, der eigentlich die Indianergruppe ins Leben gerufen hatte, akzeptierte ihn als Häuptling. Das lag nicht daran, dass Oskar die Aufsicht für ihre Stube innehatte, sondern weil der Bursche mit dem kantigen Schädel eine beinahe aggressive Autorität ausstrahlte. Deshalb war Oskar Gerber auch vom Hauptlagermannschaftsführer zum Stubenaufseher auserkoren worden. Und Alfons hatte noch einen Grund, Oskar die Häuptlingsrolle gerne zu überlassen: Er hatte es nicht so mit dem Denken. Der Oskar schon, der war schlau.
Die Jungen kannten sich fast alle schon lange. Sie gingen gemeinsam auf die Simmernschule in Schwabing, nur der Kurt besuchte die Klenzeschule in der Isarvorstadt. Im Sommer 1943 waren sie das erste Mal bei der Kinderlandverschickung dabei, gleich mit den Sommerferien. Die Achtklässler wurden in den Ferien als Erntehelfer eingesetzt. In den Jahren zuvor hatte man nur die Kinder aus Norddeutschland nach Bayern verfrachtet, »Sommerfrische für Kinder auf Weisung des Führers«, nannte man das offiziell, was in Wahrheit eine vorsorgliche Umquartierung war, um die Kinder vor Fliegerangriffen in Sicherheit zu bringen. Nun flogen die Alliierten immer näher, im März war München schwer bombardiert worden, am 7. September erneut. Da die Erweiterte Kinderlandverschickung eine freiwillige Aktion war, zu der es die Zustimmung der Eltern bedurfte, begann man nun, ganze Schulklassen zu verschicken. ›Wenn ihr die Hilfe der KLV nicht in Anspruch nehmt, seid ihr am Ende schuldig, wenn eure Kinder den Bomben des Feindes zum Opfer fallen‹, hieß es inzwischen. »Auch eure Jungen, durch die Fürsorge des Staates dem unmittelbaren Zugriff barbarischer Luftpiraten entzogen, lernen so, sich in guter Kameradschaft ineinander zu schicken«, tönte die Propaganda aus den Radios. Das erhöhte den Druck auf einzelne Eltern enorm, und aus Angst vor Repressalien wagte es kaum jemand, der Kinderlandverschleppung, wie man es unter der Hand längst nannte, zu widersprechen. Auch in der Simmernschule schickte man Klassen in eines der vielen KLV-Lager, die von der Hitlerjugend geleitet wurden. So kamen die Buben nach Aindling, einen Marktflecken mit knapp dreitausend Einwohnern nördlich von Augsburg, wo es zwar ein kleines Krankenhaus und eine Schule gab, ansonsten sich jedoch Fuchs und Hase Gute Nacht sagten.
»Und jetzt?«, fragte Berthold, der Jüngste unter ihnen, der wie ein Lausbub aus einem Film aussah.
»Wie und jetzt?«, gab Oskar die Frage zurück.
»Na, was machen wir jetzt als Panther? Immer nur Indianer spielen?«, fragte Berthold. »Oder mal was Gscheits?« Er grinste abenteuerlustig und strich Billie über den feuchten Rücken. Obwohl erst elf, war er wagemutiger und unerschrockener als die meisten anderen Panther.
»Wir könnten für unser Wohlergehen sorgen«, sagte Alfons und grinste.
Auch Oskar verzog seinen Mund zu einem Schmunzeln. »Und was schlägst du vor?«
»Na ja«, antwortete Alfons gedehnt. »Wir bekommen zwar gut zu essen hier und so …« Er klopfte sich auf den Bauch. Alfons, der Älteste der Gruppe, war auch mit Abstand der Größte. Ein dünner Schlaks, der seinen Körper noch nicht richtig unter Kontrolle zu haben schien. Arme und Beine schlackerten immer irgendwie herum. Seine Hosen und Hemden waren immer zu kurz für seine langen Glieder. »Aber ich hätte ganz gerne was von dem frischen Apfelsaft, den der Kramer im Schuppen hat. Der ist wieder nur für die Großkopferten. Oder sie verkaufen es eh gleich nach München.« Er war schon beim Metzger eingestiegen, das wussten alle, und hatte dort Rauchfleisch geklaut. Apfelsaft klang auch gut.
»Au ja!«, riefen Kurt und Georg unisono. »Lasst uns beim Kramer einbrechen und ein paar Flaschen holen.«
»Und wie habt ihr euch das vorgestellt?«, fragte Oskar.
»Na, Schuppen aufbrechen, also das Schloss, rein, so viele Flaschen nehmen, wie wir tragen können und wieder raus«, antwortete Alfons. Die anderen nickten und redeten durcheinander, wie toll das wäre und überhaupt. »Zack, bumm. Fertig.«
»Zack, bumm. Ihr seid so blöd!«, seufzte Oskar schließlich und schüttelte leicht den Kopf. »Ich dachte, ihr habt ein bisschen mehr im Hirnkasterl. Wenn wir beim Kramer einsteigen und klauen, dann merken die das sofort. Und die müssen nur eins und eins zusammenzählen, dass das Jungs aus dem Lager waren. Dann werden sie uns draufkommen, und wir werden bestraft, was uns im Prinzip egal sein kann, aber! Aber! Dann werden wir am Ende heimgeschickt! Und das sollte uns nicht egal sein. Das wars dann mit dem angenehmen Leben hier, mit genug Essen und immer frischen Klamotten und keinen Fliegerbomben und so weiter – und vor allem ohne die Alten!«
»Ach, ich vermisse meine Alten schon …«, sagte Kurt Reicherts leise. Die anderen lachten höhnisch.
»Was schlägst du also vor?«, kam Alfons Zech auf das Thema zurück. Erfahrungen mit kleineren Diebstählen hatten sie alle. Sie waren gelegentlich auf gemeinsamen Klautouren in Münchner Kaufhäusern gewesen. Nichts Großartiges, Süßigkeiten, Groschenromane, Stifte. Ab und zu in Keller eingebrochen. Was man halt als Strolch so machte. Das hatte sie schon in der Schule zusammengebracht. Es stand für alle außer Frage, dass sie etwas anstellen wollten. Es blieben nur die Fragen nach dem Was und dem Wie.
»Wir müssen herausfinden, wie der Schuppen verschlossen ist«, sagte Oskar, »und dann …«
»Da ist ein stinknormales Vorhängeschloss dran«, unterbrach ihn Berthold.
»Kann das einer von euch so knacken, dass es nicht kaputtgeht?«, fragte Oskar. Alle schüttelten den Kopf.
»Moment«, sagte Berthold, »ich bin mir sicher, dass das ein einfaches Überfallscharnier ist, das an die Holzwand geschraubt ist.«
Oskar grinste. »Seht ihr. Schon gelöst.«
»Und wie?«, fragte Georg und strich sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht.
»Wir brauchen nur einen Schraubenzieher.«
»He, Gerber!«, rief Emil Kratzert vom Waldrand her und schlenderte langsam zu den Jungs, die ihr Lagerfeuer zwischen Feld und Wald nahe einem Holzstoß gemacht hatten. Emil richtete seine Uniform, steckte noch schnell das Hemd komplett in die Hose. Er hatte wie so oft den Nachmittag im Hochsitz am Waldrand verbracht. Der Hochsitz war von unten nicht einsehbar. Emil, das wussten alle, traf sich da heimlich mit seinem Gspusi, der drallen Dagmar, der Tochter vom Anger-Bauern. Emil Kratzert war der örtliche Hauptlagermannschaftsführer der Hitlerjugend. Ein schneidiger Bursche mit strahlend blauen Augen und dichtem blondem Haarschopf, einer der wenigen, der in seiner Uniform tatsächlich so arisch-schnittig aussah, wie das die Propagandaplakate suggerierten. Emil wusste, wie er aussah und nutzte das nach allen Regeln der Kunst aus. Vor der drallen Dagmar waren schon andere Dorfschönheiten mit ihm auf dem Hochsitz gewesen. Man munkelte sogar, dass die Gattin des Bürgermeisters … Man sagt ja nix! Der Emil kam nun näher und grinste.
»Na, Indianerspiele?«, fragte er, zog sich dann ordentlich die Kniestrümpfe hoch und stellte sich, mit den Händen in die Hüften gestemmt, neben Oskar.
Oskar Gerber nickte. Er war Pimpf und gehörte zu den Kindern, deren Eltern man nicht von den Vorzügen der KLV überzeugen musste. Sein Vater, das wussten alle, war Chemigraf beim ›Völkischen Beobachter‹, kriegswichtig und treuer NSDAP-Parteigänger. Daher nicht an der Front, wie die Väter der meisten anderen Burschen am Lagerfeuer.
»Packt mal langsam zusammen, und macht das Feuer aus. Abendessenszeit. Ich lese euch heute nach dem Essen wieder was vor, in Ordnung, Burschen?« Emil blickte in die leuchtenden Augen der Jungs.
»Fritz Steuben oder Karl May?«, fragte Oskar.
»Den Winnetou haben wir doch schon durch«, sagte Emil.
»Dann Old Surehand!«, schlug Georg aufgeregt vor, wieder fiel ihm eine Strähne seines Blondschopfs in die Stirn.
»Nein, Schorsch. Der kommt schon noch früh genug. Nein, Burschen, ich habe gestern mit der Post aus München ein weiteres Buch vom großen Dichter der Mannhaftigkeit bekommen: ›Der Sohn des Manitu‹ …«
»Ah, Tecumseh!«, riefen Alfons und Kurt begeistert unisono. »Das kenn ich schon«, murrte Georg. »Das hab ich zu Hause.« »Schnauze«, sagte Oskar bestimmt.
Sie liebten alle die Abenteuer von Tecumseh, dem Häuptling der Shawnee, die Fritz Steuben geschrieben hatte. Tecumseh, das bedeutete ›Der sich duckende Berglöwe‹, der wie sein Vater Pukeshinwah zum Panther-Clan der Shawnee gehörte. Nicht ganz zufällig hatten sich die Burschen zum Panther-Bund zusammengeschlossen. Tecumseh hatte es, im Gegensatz zu Winnetou und den Indianern bei Karl May, wirklich gegeben. Das wussten sie. Ein tapferer Krieger und großer Feldherr, der sein Volk gegen die Unterdrücker anführte und bis an sein Lebensende versuchte, eine schlagkräftige Allianz aller Indianerstämme Nordamerikas zusammenzuführen. Ein Volk ohne Heimat, genau wie die Deutschen nach dem Versailler Vertrag. Es gab so viele Parallelen zwischen den Rothäuten, die sich gegen die Überfremdung wehrten, und dem deutschen Volk. Und Emil gelang es immer, die Gemeinsamkeiten von Rothaut und Arier herauszuarbeiten. Zwei edle Rassen, die in ihrer Existenz bedroht werden und um ihr kulturelles Erbe kämpfen.
»Gerber, du sorgst dafür, dass das Feuer ordentlich ausgemacht wird. Der Wald ist trocken. Wir wollen nichts riskieren, gell?« Emil drehte sich um und stapfte, ein Liedchen pfeifend, davon. Oskar war stolz darauf, von Kratzert mit dem Nachnamen angesprochen zu werden, und nur er! Als Einziger von allen im Lager. So machten das Männer unter sich. Kinder sprach man mit Vornamen an. Natürlich duzten alle den Emil und nannten ihn beim Vornamen, denn er sollte für sie ja kein Kommandant sein, sondern der große Bruder, zu dem man mit allen seinen Sorgen und Nöten kommen durfte, zu dem man bewundernd aufblickte, der immer für einen da war.
»Meinst du, er hat uns beobachtet?«, fragte Kurt, nachdem Emil außer Hörweite war.
»Schmarrn«, antwortete Oskar. »Der Hochsitz, auf dem er es mit der Dicken treibt, steht so, dass man uns hier nicht sehen kann. Das habe ich ausgekundschaftet. Was glaubst du, warum wir hier unser Lager haben?«
Der Markt Aindling besaß kein wirkliches Lager für die Kinderlandverschickung. Hier waren nur knapp achtzig Kinder im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren untergebracht. Man hatte für die Jungen die Schule umfunktioniert. Die Hälfte der Klassenräume war mit Stockbetten vollgestellt worden, der Unterricht fand daher beengt in Gemeinschaftsklassen statt. Die Turnhalle diente ebenfalls nur zur Hälfte der Leibesertüchtigung, man nutzte sie zugleich als Speise- und Aufenthaltssaal. Es gab eine Betreuerin von der NS-Frauenschaft, Dörte Schopf, quasi die Lagermama, deren Hauptaufgabe darin bestand, vor allem die kleineren Buben bei zu starkem Heimweh zu trösten und mit ihnen herumzuglucken. Sie kam aus Norddeutschland, was praktisch war, denn dann musste man nur gschertes Bairisch reden, wenn man etwas sagte, was sie nicht verstehen sollte. Dörte Schopf war hanseatisch kühl und pragmatisch, hatte meist »einen Stock im Arsch«, wie Oskar gerne sagte, war aber bei den Jungs durchaus beliebt. Sie wohnte in einem Zimmer in der ehemaligen Hausmeisterwohnung.
Die Knaben hatten zwei Lehrer. Den kriegsversehrten Jost Rabel, dem das linke Bein fehlte, und den greisenhaften Magnus Dietz, den man wegen Personalmangels aus dem Ruhestand reaktiviert hatte. Der alte Lehrer Dietz war verhasst. Er stammte aus Aindling und wohnte mit seiner ebenfalls greisenhaften Frau in einem kleinen Haus ein paar Straßen weiter. Dietz wirkte zwar stets leicht verwirrt, was vermutlich an seinem enormen Alkoholkonsum lag – die Fahne roch man schon bevor er den Raum betreten hatte –, er war jedoch gefürchtet, weil er ebenso rabiat wie häufig grundlos den Rohrstock schwingen konnte. Und Magnus Dietz verschwendete immer wieder Unterrichtszeit, indem er nicht den vorgegebenen Stoff durchnahm, sondern von seinen Erlebnissen im Weltkrieg schwadronierte und dabei jedes Mal die Mauser hervorholte, seine alte Pistole, die er immer mit sich in seiner Aktentasche trug. »Eine C96 mit Kaliber 7,63 mm, so was wird heute gar nicht mehr gebaut«, sagte er immer, und die Jungs verdrehten die Augen. Am Anfang hatte noch einer der Burschen, die auf Waffen standen, Bemerkungen wie »Weil die Mauser halt gegen die Luger 04 abgestunken hat« geflüstert, inzwischen ignorierte man Dietz’ Waffengesabbel. Ob er überhaupt eine Waffe mit sich herumtragen durfte, stand auf einem anderen Blatt. Nachfragen wollte niemand.
Den Lehrer Jost Rabel hingegen mochten die Jungs gerne, auch wenn der oft traurig und abwesend aus dem Fenster starrte. Rabel wohnte beim Bauern nebenan, man hatte ihm ein Zimmer zugewiesen. Wie Hausmama Dörte Schopf und die Lagerköchin hatte auch HJ-Mannschaftsführer Emil Kratzert in der ehemaligen Hausmeisterwohnung sein Zimmer. Zwei weitere betreuende Hitlerjungen schliefen mit den Jungen in den Gruppenräumen. Die hießen beide Gernot, der eine Schmidt, der andere Schmitt, sie wurden also Gernot eins und Gernot zwo genannt. Gernot eins war ein dicklicher Faulpelz, der sich am liebsten um nichts kümmerte. Gernot zwo war dumm wie Stroh und dürr wie ein Zaunpfahl, und er konnte fies sein, richtig fies, er war der klassische Nach-oben-Buckler-und-nach-unten-Treter. Vor Emil katzbuckelte er immer übertrieben devot. Gernot zwo, das hatte Oskar von Anfang an im Gefühl, würde für sie problematisch werden können. Wie Oskar hatte auch Gernot zwo ein paar Jungs um sich gesammelt, drei Jungs, um genau zu sein, und zu einer Art Bande eingeschworen. Noch war es höchstens zu Pöbeleien gekommen. Gernots Bande war zwar zahlenmäßig unterlegen, aber die Burschen waren älter und damit deutlich stärker als die Panther. Gernot zwo, so ging das Gerücht, hatte was mit der Hildegunde laufen, einer der Aufseherinnen des Mädchenlagers.
Die Mädchen bewohnten Räume im nahe gelegenen Gasthof zur Post, betreut vom Bund Deutscher Mädchen. Die meisten Jungs waren noch in dem Alter, in dem sie Mädchen blöd fanden. Sie sahen die Mädchen eh nur bei gemeinsamen Wanderungen.
Reichsjugendwettkämpfe, Bannerwettkämpfe, überhaupt alle möglichen Wettkämpfe, mittwochs Geländespiel der HJ, donnerstags HJ-Heimabend. Sport und Drill. Zucht und Ordnung. Dazu lauschige Abende um das Lagerfeuer mit Musik. Der kleine Berthold spielte Gitarre und begleitete die Lieder ab und an. ›Weiße Trommel‹ oder ›Es zittern die morschen Knochen‹ oder ›Nur der Freiheit gehört unser Leben‹ – Propagandamusik. Die trügerische Hitlerjugend-Idylle bestimmte den Alltag der Kinder. Gelegentlich fuhren sie mit Bussen gemeinsam nach Augsburg ins Kino. Im Filmpalast lief immer noch ›Münchhausen‹ mit Hans Albers, da durften sie zu ihrem größten Bedauern nicht rein, weil der erst ab 18 freigegeben war – es gab Badeszenen mit barbusigen Frauen! Sie sahen stattdessen im Emelka-Palast oder in den Karolinen-Lichtspielen ›Romanze in Moll‹ mit Helmut Käutner – das fanden die Mädchen toll, die Jungs eher blöd, ebenso wie die Verwechslungskomödie ›Geliebter Schatz‹. Bei ›Kohlhiesels Töchter‹ mit Heli Finkenzeller amüsierten sich alle und in ›Germanin – Die Geschichte einer kolonialen Tat‹ lernten sie, dass sich selbst die primitivsten Buschbewohner Afrikas nach den glorreichen Tagen unter deutscher Kolonialmacht zurücksehnten, statt weiterhin unter der brutalen Knute Großbritanniens zu leiden.
Zwischen all den Aktivitäten gab es genug freie Zeit. Die Mitglieder der Panther-Bande nutzten diese, um indianische Fähigkeiten zu erlernen, tarnen, anschleichen, Spuren lesen, Schmerzen aushalten. Sie alle waren schon am Marterpfahl gestanden, einer abgestorbenen Kiefer im Wald, so im Gestrüpp verborgen gelegen, dass sie so schnell nicht zu finden war. Alle hatten sie, an den Pfahl gebunden, Demütigungen, Schläge, kleine Brandwunden mit Zigaretten (alle rauchten heimlich) und Ameisen, die mit Honig auf ihre Körper gelenkt wurden, ertragen – und als Krönung, dass alle den jeweiligen Delinquenten anpinkelten. Die Panther hatten beschlossen, noch härter als Kruppstahl und zäher als Leder zu sein. Flinker als Wiesel waren sie ohnehin. Das wollten sie auch diesen Abend unter Beweis stellen. Alfons Zech, Berthold Kröger, Kurt Reicherts, Georg Haslbeck und Häuptling Oskar Gerber hatten etwas vor.
Emil Kratzert las nach dem Essen die ersten zwei Kapitel aus ›Der Sohn des Manitu‹, dem siebten Band der Tecumseh-Reihe.
»So, ab ins Bett!«, rief Emil schließlich und klatschte in die Hände. »Wascht euch vorher Gesicht und Hände. Zähneputzen nicht vergessen!«
Mitternacht. Oskar schlug seine Bettdecke zurück und stand leise auf. Er hatte sich nicht ausgezogen, seine Schuhe hielt er in der Hand. Er schlich zu den Betten seiner Kameraden. Alle waren wach, bis auf Kurt. Sie hielten ihm vorsichtshalber den Mund zu, als sie ihn weckten.
Draußen auf der Straße zogen sie ihre Schuhe an. Die drei roten Fahnen mit dem Hakenkreuz im weißen Kreis knatterten vor dem Schulgebäude leicht im Wind. Die Nacht war nicht mondklar, dennoch sahen sie genug, um den Weg zum Kramer zu finden. Wie sie es geübt hatten, schlichen sie von Hausecke zu Hausecke, jeden dunklen Schatten zum Verstecken ausnutzend. Außer einer Katze begegneten sie niemandem. Den Zaun zum Hinterhof des Kramerladens überwanden sie spielend mit Räuberleitern. Schließlich standen sie vor der Tür zum Lagerschuppen.
Alfons zückte den Schraubenzieher. »Na, großartig«, fluchte er leise, »hier ist es so dunkel, dass ich die Schlitze von den Schrauben nicht sehe.«
»Ich habe eine Taschenlampe dabei«, sagte Georg. »Soll ich …«
»Untersteh dich«, zischte Oskar. »Damit uns der ganze Ort sieht? Was glaubt ihr, warum ich eine Decke dabeihabe.« Er hatte sich eine Wolldecke um die Hüften gewickelt, die er nun abnahm und ausbreitete. Er hielt sie über sich, Georg und Alfons. »So«, flüsterte er, als sie drei im Dunkeln hockten. »Jetzt die Taschenlampe an und das Schloss abgeschraubt.«
Sie öffneten die Tür. Es roch herrlich nach reifen Äpfeln. Als sie im Inneren des Schuppens waren, achtete Oskar darauf, dass die Taschenlampe erst dann für einen kurzen Orientierungsblick angemacht wurde, als die Tür geschlossen und der Türrahmen mit der Decke verhängt war.
Zweimal ließ Georg seine Taschenlampe kurz aufleuchten, dann hatten sie die Flaschen mit dem frischen Apfelsaft gefunden.
»Jeder nur zwei«, befahl Oskar. »Es soll nicht auffallen. So. Habt ihr alle? Dann, Schorschi, noch mal kurz Licht …« Als die Taschenlampe aufleuchtete, arrangierte Oskar die Flaschen im Regal so, dass die fehlenden nicht auffielen.
»Ich habe hier was viel Besseres gefunden als Apfelsaft«, kicherte da Berthold.
»Was?« Georg leuchtete zu dem Elfjährigen, der eben eine Flasche ansetzte und einen ordentlichen Schluck trank. Schon konnte man es riechen.
»Verdammte Scheiße«, fluchte Oskar. »Ist das Schnaps? Kirsch?«
»Jep«, machte Berthold und trank noch mehr. Er hatte bereits ein gutes Drittel des Kirschschnaps weggetrunken als wäre es Wasser.
»Du kapierst gar nichts, oder?«, fluchte Oskar giftig.
»Was?«, lallte Berthold. »Apfelsaft ist doch Kinderkram …«
»Es geht nicht um Apfelsaft, du Arschloch.« Oskar hielt seine Stimme so leise er vor Wut noch konnte. »Der Apfelsaft ist doch scheißegal. Es geht um die Panther, um uns als Gruppe. Wir machen gemeinsam etwas. Wir halten zusammen. Das hier war eine Feuertaufe. Oder sollte es sein! Und du Arschloch hast alles versaut!« Oskar musste sich beherrschen, um nicht laut zu werden. Das konnte doch nicht wahr sein! Er war von Dummköpfen umgeben. »Der Apfelsaft ist natürlich ein Witz. Es geht um uns. Um uns! Verstehst du das nicht? Versteht ihr alle das nicht?« Oskar packte Berthold am Kragen. Georg knipste die Taschenlampe aus. Man hörte einen dumpfen Schlag und einen unterdrückten Schmerzensschrei.
»Jeder zwei Flaschen Saft«, flüsterte schließlich Oskars Stimme in der Dunkelheit. »Und den Schnaps nehmen wir auch mit. Eine angesoffene Flasche zurücklassen, fällt wirklich auf! Georg, kurz Licht, damit wir die Tür finden.«
Im Licht sahen sie nicht nur die Tür, sondern auch das geschwollene Auge von Berthold und wie sich der Bub mit dem Ärmel Rotz von der Nase wischte. »Schorschi, Fonsi, ihr stützt den Säufer. Fehlt noch, dass er rumtorkelt und die halbe Nachbarschaft aufweckt.«
Sie befestigten die Schrauben wieder, nichts würde auf einen Einbruch hinweisen. Sie schlichen zurück. Plötzlich kam ihnen jemand entgegen. Die Jungs versteckten sich schnell im Dunkel des nächsten Hauseingangs. Georg hielt den betrunkenen Berthold sicherheitshalber fest im Klammergriff. Die Gestalt torkelte vorbei und rülpste herzhaft. Jetzt erkannten die Panther einen ihrer Lehrer. Es war der greise Magnus Dietz, der stockbesoffen den Heimweg suchte. »He, issa wer?«, brummelte der Alte. »Chab ne Waffe. Kommnur her! Ne Maus, Mauserl. Dings. Ne zeh sechsunneuzig. Verdöng. Chwar in Verdöng! Im Schüzngram.« Er taumelte weiter. Sie warteten noch ein paar Augenblicke, bis Dietz weit genug weg war, und setzten ihren Weg fort. Sie schafften es unbemerkt zurück bis zum Eingang des Schulhauses. Berthold musste sich unterwegs einmal übergeben. Sie zerrten ihn auf Oskars Geheiß schnell zum Straßengraben, denn eine Kotzlache mitten auf der Straße würde bei den Erwachsenen vielleicht Fragen aufwerfen. Als sie die Treppen zur Eingangstür hinaufgingen, löste sich eine Gestalt aus dem Dunkel der benachbarten Büsche.
»So, Burschen, jetzt will ich eine gute Geschichte hören«, sagte die Gestalt. Sie erkannten seine Stimme. Gernot zwo.
»Selbiges könnte ich sagen«, antwortete Oskar gelassen.
»Ach, da wird aber einer frech.« Gernot zwo lachte höhnisch auf. »Das wird dich teuer zu stehen kommen, Gerber. Dich und deine ganze Indianerbande …« Hinter ihm im Gebüsch raschelte es. Dann hörte man Schritte und ein leises »Autsch«.
»Ich würde sagen Einstand«, sagte Oskar. »Du lässt uns in Ruhe, und wir sagen niemandem was von deinen Schäferstündchen mit Hildelein.«
»Du hältst dein dreckiges Maul, Gerber.« Gernot zwo packte Oskar am Hals und drückte ihm die Luft ab. Oskar trat dem älteren Jungen hart gegen das Schienbein. Mit einem Schmerzensruf ließ Gernot zwo Oskar los.
»Hier.« Oskar hielt Gernot zwo die angebrochene Flasche Kirschbrand hin. »Nimm, und das wars dann.« Seine Jungs standen wie festgegossen hinter ihm und trauten sich kaum zu atmen. Oskar gab ihnen ein Zeichen. Sie schlichen die Treppen hoch und verschwanden im Eingang des Schulhauses.
»Du …« Gernot zwo wollte eine Verwünschung aussprechen, es fiel ihm keine ein. Er starrte ihnen hinterher. Sein Blick fiel auf die Flasche, die er in der linken Hand hielt. Er öffnete sie, schnupperte daran und trank erst vorsichtig, dann nahm er einen kräftigen Schluck. »Oh ja«, keuchte er. »Das ist gut … Grad noch mal Glück gehabt, Gerber. Haste grad noch mal Glück gehabt …«
Winterferien 1943/44 Münchner Waisenhaus, München-Neuhausen
Weihnachten! Werner Hofmann ballte wütend die Fäuste in der Jackentasche und senkte den Kopf. Wie er das hasste. Wie er alles hasste. Diese Menschen, die Nonnen, die anderen Kinder, die ganze Dekoration, die Lügen, alles. Er hasste einfach alles und vor allem, dass ihn keiner verstand. Dass er so verdammt einsam war. Das hasste er am allermeisten, konnte aber auch nichts dagegen tun, denn er hasste alle anderen. Also gab sich niemand mit ihm ab. Er war oft wütend und traurig zugleich. Er nannte es seine traurige Wut.
Im Speisesaal stand ein großer Weihnachtsbaum, den die Kinder gemeinsam geschmückt hatten. Zuvor hatten sie Sterne und Engerl aus Silberfolie gebastelt. Am Abend sollte es für alle Würstl mit Kartoffelsalat geben. Klassisches Weihnachtsessen. Werner sah die Lichter durch die Glasscheiben der Eingangstür. Werner wickelte sich den Schal enger um den Hals und hüpfte von einem Bein auf das andere. Ihm wurde langsam kalt. Wo blieb sie nur? Seine Mutter! »Die Mama«, wie sie früher die Englischen Fräulein mit seligem Lächeln immer genannt haben, wenn die Mutter mal geruhte vorbeizuschauen. Die Englischen Fräulein hatten inzwischen nicht mehr das Sagen im Heim. Das hatte nun die Partei. Die Nonnen waren noch als Hauswirtschafterinnen und Betreuerinnen da, aber den Ton gaben der Grabscher und seine Leute an. Der Grabscher – er hieß nicht so, sie nannten ihn so. Weil er sie begrabschte, wann und wo er nur konnte. So wie eben, als Werner Hofmann vor die Tür ging, um draußen auf seine Mutter zu warten. Da hatte der Grabscher ihm noch schnell über den Po gestreichelt und »Jaja, die Mama. Viel Spaß bei der Mama an Weihnachten.« gesagt.
Ja, das war der absolute Hohn, fand Werner. Die Mama. Er nannte sie nie so. Höchstens Mutter. Einen Kosenamen hatte sie sich nicht verdient. Werner war der einzige Junge im Waisenhaus, der kein Waise war. Er hatte eine Mutter und auch einen Vater. Zumindest Erstere lebte. Und dennoch musste er hier aufwachsen. Er war ein ungewollter Nachzögling. Die Mutter war bei seiner Geburt schon fast vierzig gewesen. Die Mutter arbeitete nicht, hatte früher mal als Packerin Geld verdient. Aber sie hielt es nie irgendwo lange aus – man hielt sie nie irgendwo lange aus. Sie galt als ›verhaltensauffällig‹ und ›zu irrationalen Handlungen neigend‹. Sie wurde untersucht, nein, schizophren, wie es der Hausarzt vermutete, war sie nicht.
Die Mutter trank viel, dann wieder gar nicht. Der Vater hatte auch viel getrunken, daran konnte sich Werner noch erinnern. Der Vater war Gärtner gewesen und hatte immer wieder mal wegen Diebstählen und Hehlereien eingesessen. Im Frühjahr 1941 war der Vater dann in Frankreich gefallen, so sagten sie zumindest, denn das hörte sich besser an, als dass er im Feldlazarett an einer Lungenentzündung gestorben war. Mit Vaters Tod steigerte sich Werners Elend. Er war das jüngste von vier Kindern aus dieser Ehe, dazu hatte die Mutter noch zwei aus einer ersten Ehe. Doch mit den Halbgeschwistern hatte er keinerlei Kontakt. Von seinen älteren Schwestern lebten zwei, Maria war mit achteinhalb Jahren an Bauchfellentzündung gestorben. Dann waren da noch die Erika und die Anneliese. Anneliese war der ›Hausdeifi‹, der Hausteufel, wie die Mutter zu sagen pflegte. Sie führte ein strenges Regiment, dem sich auch die Mutter zu unterwerfen hatte. Anneliese war höchst cholerisch und gewaltbereit. Aktuell saß Anneliese wegen Diebstahls ein.
Der kleine Werner war noch nicht geboren, da war er schon unwillkommen. Die Mutter unternahm hochschwanger einen Selbstmordversuch. Dass der kleine Werner nach seiner Geburt höchst unwillkommen war, bemerkten auch die Nachbarn. Die Verwahrlosung der Kinder nahm mit jedem Jahr zu. Mutter Hofmann kochte nicht gerne, eigentlich kochte sie so gut wie nie, und die Kinder wussten sich oft nicht anders zu helfen, als zu stehlen. Werner, so sagte die Mutter zumindest, war mit zehn Jahren Bettnässer. Nach dem Tod des Vaters hatten die Behörden genug. Die Fürsorge nahm Mutter Hofmann den elfjährigen Werner weg und steckte ihn ins Waisenhaus – weil kein anderer Platz für ihn zu finden war. Ab und an besann sich die Mutter, dass sie noch einen Sohn hatte und besuchte ihn. Zum Geburtstag zum Beispiel, manchmal. Und dieses Jahr an Weihnachten hatte sie sogar beschlossen, den Buben für zwei Tage mit nach Hause zu nehmen. Nach Hause bedeutete die kleine verdreckte Wohnung in Untergiesing, in der er sich das Zimmer mit seiner Schwester Erika teilen musste. Untergiesing, das war kein Ort, sondern eine Sozialprognose.
Werner freute sich nicht. Er wäre allerdings auch nicht lieber im Heim geblieben. Egal wo er war, er fühlte sich fremd, nur die traurige Wut blieb ihm. Im Heim hatte er keine Freunde, obwohl er mit vielen Kindern seit Jahren zusammenlebte. Er galt als schwierig. Er wurde gemieden. Er zog Ärger an. Er zog Prügel an. Der Grabscher und seine Leute von der Partei konnten genauso gut prügeln wie die Nonnen.
Da kam seine Mutter angehetzt. Er sah den Nebel ihres Atems in der frostigen Luft.
»Mei, Bub«, rief die Mutter und stieg die Stufen zu ihm hoch. Das letzte Mal waren die beiden sich im April zu seinem Geburtstag begegnet. Sie kniff ihm in die Wangen. Etwas, was sie noch nie gemacht hatte. Vermutlich hatte sie es in einem Film gesehen. Die Mutter war älter geworden, die Haut ihrer Wangen war nicht nur von der Kälte gerötet. »Mager schaugst aus, Bub. Kriegst du ned genug zum essen? Mei, du, des is jetzt blöd. Woaßt, hast dich ja so aufs Christkind bei uns daheim gefreut. Aber der Erika gehts nicht gut. Woaßt.« Sie sah Werner mit ihren versoffenen Augen an. Er wusste, was nun kommen würde und schloss die Augen für einen Moment. Fäuste ballen. Fäuste entspannen. »Des is … also es ist einfach besser, wenn du ned mitkommst. Besser für uns alle. Feier schön hier mit deinen kleinen Freunden. Wir sehen uns dann ein andermal. Versprochen.« Sie log schlecht. Sie wollte mit ihren Säuferkumpanen feiern. Das war klar. Sie kniff Werner noch einmal in die rechte Wange und drehte sich zum Gehen. Sie hielt kurz inne. »Mei, fast vergessen.« Sie holte etwas aus ihrer Handtasche und drückte es Werner in die Hand. Eine Tube Senf. »Frohe Weihnachten.« Sie eilte die Treppe hinunter. »Mei, Bub, des is auch für mich nicht einfach!«, rief sie über die Schulter. Im Mädchentrakt des Heims sangen sie schon Weihnachtslieder.
»Ist deine Mama jetzt ohne dich weg?« Der Grabscher stand plötzlich hinter Werner und tätschelte dessen Po.
»Schaut so aus.« Werner zuckte gleichgültig mit den Schultern und ging ins Haus zurück.
»Mach dir nix draus«, sagte der Grabscher, der ihm gefolgt war. »Feierst du eben mit uns hier. Leider waren die Würstel abgezählt. Da ist nix mehr für dich da. Aber Kartoffelsalat gibt es noch genug. Musst also nicht hungern, Hübscher.«
Werner hörte öfter, dass er ein ganz ein Hübscher sei. Er glaubte es nicht. Hübsche Menschen wurden geliebt. Das sah man im Kino. Sie wurden nicht als Kind von Männern zu Dingen gezwungen, an die sich ein Hübscher hinterher nicht mehr erinnern wollte, weil sie so widerlich waren. Immerhin blieb der Grabscher nur beim Grabschen …
Winterferien 1943/44 Danziger Freiheit, München-Schwabing
Zu Weihnachten hatten diejenigen Heimaturlaub, deren Eltern beziehungsweise deren Mütter, denn fast alle Väter waren an der Front, nicht ausgebombt waren. Sie durften oder mussten nach München. So auch Oskar Gerber, der eigentlich gar keine Lust auf zu Hause hatte. Das Schweigen der Eltern, die sich nichts zu sagen hatten und nebeneinanderher lebten. Vor allem aber das vorwurfsvolle Schweigen ihm gegenüber, denn er hatte sie so oft enttäuscht und das alles gekrönt, indem er es nicht auf das Gymnasium schaffte. »Genug im Hirnkasterl hätte er, aber er ist einfach faul, stinkfaul!«, wie der Lehrer seinen Eltern gegenüber damals betont hatte. Es war wohl diese eine Enttäuschung zu viel. Nie entsprach er ihren Vorstellungen – im Gegensatz zu seinem drei Jahre älteren Bruder Richard. Der entsprach allem, was sich Eltern wünschten. Die elterliche Zuneigung richtete sich alleine auf Richard. Mittlerweile war es Oskar egal. Ja, er liebte seine Mutter, irgendwie, weil man das halt so machte, schließlich war die Mutter das höchstoffizielle Objekt der Glorifizierung. Zum Vater war Oskars Verhältnis schwieriger. Der Vater flößte ihm einen Heidenrespekt ein, er war streng. Watschen gehörten früher selbstverständlich dazu. Doch mit den Enttäuschungen und dem Schweigen nahmen auch die körperlichen Züchtigungen ab. Selbst dazu hatte sein Vater keine Lust mehr. Zeitweise sehnte sich Oskar nach einer saftigen Fotzn, nur um wenigstens eine Art der Aufmerksamkeit zu bekommen. Solche Momente gingen jedoch wieder vorbei. Dann war er froh, außerhalb des elterlichen Radars zu sein, denn er konnte tun und lassen, was er wollte. Zuwendung – wer brauchte die schon!
Weihnachten. Die Türplakette des Winterhilfswerks zeigte allen Nachbarn, dass die Gerbers Solidarität mit den Not leidenden Volksgenossen lebten und sich an der Sammlung beteiligt hatten. Gut, es gab reichlich zu essen, die Mutter kochte passabel und dank der Anstellung des Vaters beim ›Völkischen Beobachter‹ gab es ausreichend Lebensmittel. Sogar die guten Knacker am Heiligabend. Der Vater zeterte, weil der Führer schließlich zu weniger Fleischkonsum aufgerufen und den Vegetarismus propagiert hatte. Dann aß er die Knacker doch mit großem Appetit.
Die Geschenke – Schwamm darüber. Keiner hatte sich wirklich Mühe gegeben. Immerhin bekam Oskar neben einem Schal und einer Mütze (gekauft, nicht von der Mutter gestrickt, denn die strickte nicht) ›Der schwarze Mustang‹ von Karl May, der letzte May-Band, der ihm noch in seiner Sammlung gefehlt hatte. Oskar las für sein Leben gern und hatte ein großes Bücherregal. Von der Oma gab es Geld.