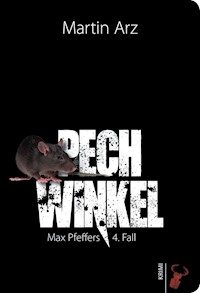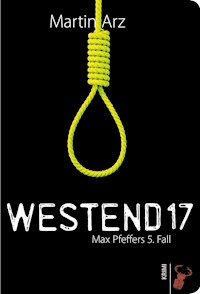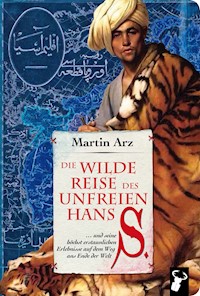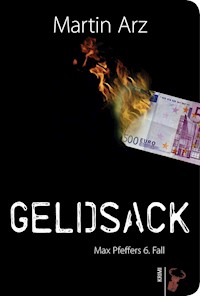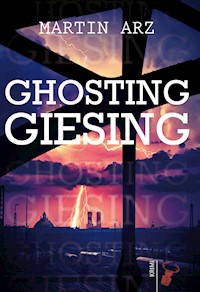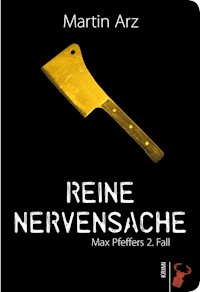
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hirschkäfer Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein körperloser Toter hält die Öffentlichkeit in Atem. Der Münchner Kriminalrat Max Pfeffer hat nur den abgetrennten Schädel eines erfolgreichen TV-Produzenten und äußerst dürftige Anhaltspunkte, um den Fall zu klären. Pfeffer legt sich mit den Mächtigen an - denn eine heiße Spur führt mitten hinein in die Schaltzentrale des Vatikans. Und Pfeffer lässt sich auf ein gefährliches Spiel mit Tatverdächtigen ein. Er muss erkennen, dass Abenteuer am Abend teuer werden und eine Begegnung mit der Muttergottes das ganze Leben aus der Bahn werfen kann. Ehe Max Pfeffer sich versieht, steckt er mitten in seinem ganz persönlichen Alptraum. Und er muss sich beeilen, daraus aufzuwachen, denn wer immer den TV-Produzenten köpfte, hat es nun auf das abgesehen, was Pfeffer liebt: seine Familie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Arz
Max Pfeffer ermittelt wieder
Martin Arz, geboren 1963 in Würzburg, studierte Theaterwissenschaft, Völkerkunde und Kunsterziehung. Als freier Autor schrieb er für zahlreiche Magazine. Dann arbeitete er mehrere Jahre als PR-Berater für den weltgrößen Fast-Food-Konzern, bevor er sich ganz den Künsten widmete: der Malerei und dem Schreiben. Seine Gemälde waren bereits auf vielen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen. »Reine Nervensache« ist der zweite Kriminalroman mit Max Pfeffer aus der Feder von Martin Arz. Im Januar 2004 erschien »Das geschenkte Mädchen«, der erste Pfeffer-Krimi, im September 2009 »Die Knochennäherin«, Pfeffers dritter Fall. Kriminalrat Pfeffer ermittelte außerdem im Frühjahr 2010 in Deutschlands erstem Twitter-Krimi »Der Tote vom Glockenbach«, der über Twitter publiziert wurde. Vor Max Pfeffer schickte Arz seinen abgebrühten Hobbydetektiv Felix in vier Kriminalromanen auf Verbrecherjagd. Arz lebt und arbeitet in München.
Pfeffer-Krimis im Hirschkäfer-Verlag als E-Books und in 3-D:
Das geschenkte Mädchen – Ein Fall für Max Pfeffer (2011)
Reine Nervensache – Max Pfeffer ermittelt wieder (2010)
Pechwinkel – Max Pfeffers 4. Fall (2011)
Handlung und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Ereignissen oder Personen wäre rein zufällig.
E-Book-Ausgabe, Juni 2012
Cover und grafische Gestaltung von Hirschkäfer Design
© Hirschkäfer Verlag, München 2012
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-940839-25-1
Besuchen Sie uns im Internet:
www.hirschkaefer-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: HEROLD Auslieferung Service GmbHwww.herold-va.de
Inhalt
Intro
Kapitel 01
Kapitel 02
Kapitel 03
Kapitel 04
Kapitel 05
Kapitel 06
Kapitel 07
Kapitel 08
Kapitel 09
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
PS
intro
»Bist du bereit?«
»Was glaubst du?«
»Was ich glaube? Du fragst mich allen Ernstes, wasICHglaube?«
»Entschuldige. Das habe ich nicht so gemeint! Ich wollte nur …«
»Wozu machen wir das ganze, wenn du immer noch von Glauben redest?Untersteh dich, weiterhin deine beschränkten Sichtweisen auf mich zu projizieren. Von Glauben kann hier wohl nicht die Rede sein, findest du nicht auch?«
»Verzeih mir, ich wollte nur …«
»Findest du nicht auch?!«
»Natürlich. Verzeih, bitte, verzeih.«
»Gut, wenn du willst, werden wir uns noch ausführlich darüber unterhalten, wasDUglaubst. Ich sehe Defizite, die manche erschüttern würden. Und entschuldige dich nicht immer. Ich verzeihe, das dürfte dir nur zu bekannt sein. Nun sag mir, ob du bereit bist.«
»Ja! Absolut!«
»Du musst nicht schreien. Ich höre alles, sogar deine Träume. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist mein Werkzeug. Ich wünsche vorerst kein Fanal. Das muss klar sein. Nur einen kleinen, nun, nennen wir es Schlag auf den Hinterkopf, der ihr Denkvermögen anregt.«
01 Wenn man sie gefragt hätte, hätte sie klipp und klar »Nein« gesagt. Aber man hatte sie nicht gefragt. Dabei war ihr der junge Mann sofort mehr als komisch vorgekommen – was heißt komisch, gruselig, richtig eklig hatte er auf Nathalie gewirkt, als sie ihn an der Tankstelle das erste Mal wahrgenommen hatte.
Später, sehr viel später, als alles endlich vorbei und nichts mehr wie bisher war, sollte ihr die Szenerie und ihre »wahnsinnig negativen Vibes«, wie sie es dann auszudrücken pflegte, wieder einfallen.
Es war bereits kurz nach halb neun abends. Der Regen hatte nachgelassen, die gelben Neonlichter der Jet-Tankstelle spiegelten sich in den trüben Pfützen. Für einen kurzen Moment sah es so aus, als würde die Sonne es sogar noch einmal durch die Wolkendecke schaffen, bevor sie ganz unterging – sie schaffte es nicht. Der Himmel verdunkelte sich wieder mit schwarzen, tiefhängenden Gewitterwolken. Nathalie blickte durch das regennasse Seitenfenster des Minivans und bekam eine Gänsehaut. »Guck mal, der Typ da«, rief sie und gab Frank, der vor ihr auf dem Beifahrersitz lümmelte und eine Zigarette drehte, einen Schubs, woraufhin Frank mit einer unkoordinierten Bewegung gut die Hälfte der sorgsam auf dem Papier gestapelten Tabakkrümel im Wageninneren verteilte.
»Spinnst du?«, rief er und wischte sich Tabak von der Hose. »Mann, kannst mich doch nicht einfach so schubsen, wenn ich …«
»Sorry«, entgegnete Nathalie. »Aber guck dir doch mal den Typen da an!« Sie deutete auf den Mann, der mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze und triefend vor Nässe an der Ausfahrt der Tankstelle stand. Unter den rechten Arm hatte er eine kleine Reisetasche geklemmt. Er musterte die wenigen Autos, die tankten. Obwohl Nathalie seine Augen nicht sehen konnte, lief ihr eine Gänsehaut den Rücken hinunter. Irgendwas stimmte mit dem Kerl nicht, dessen war sie sich ganz sicher. Intuition – mehr nicht, aber auch nicht weniger.
»Wenn ich einen richtig trashigen Splattermovie über einen durchgeknallten Massenmörder drehen würde, der Nachts mit einem abgehackten Kopf in der Reisetasche per Anhalter durch die Prärie gondelt und so scary-movie-mäßig weitermetzelt, dann würde ich den Typen da nehmen«, sagte sie. Und trashige Splatterfilme hatte sie mehr als genug gesehen, damals, als sie vierzehn war und mit dem unglaublich erwachsen wirkenden Markus gegangen war. Noch mehr als an Schockerfilmen war Markus allerdings an Nathalies Unschuld interessiert gewesen, doch das war dem Mädchen erst nach drei Wochen aufgefallen und sie hatte schnell die Konsequenzen gezogen, weil sie ihre Unschuld vorerst behalten wollte. Zuvor hatten sie sich nachmittagelang die schlechtesten Billigproduktionen reingezogen, hatten unzählige Köpfe in Großaufnahme und Zeitlupe rollen, kilometerweise Eingeweide aus aufgeschlitzten Bäuchen quellen und hektoliterweise Blut in alle Richtungen spritzen sehen. In fast der Hälfte dieser Filme hatte es einen wahnsinnigen Axtmörder gegeben, der dann mit abgetrennten Leichenteilen durch die Lande gezogen war. Und nicht selten waren diese Typen so gestylt gewesen wie der Kerl vorne an der Straße. Dunkle Regenjacke, die Kapuze so tief ins Gesicht gezogen, dass man die Augen nicht sehen und das blasse, unrasierte Kinn nur erahnen konnte.
Frank sah kurz in die angegebene Richtung, rollte dann mit geübten Fingern das Zigarettenpapier um den Tabak und zuckte mit den Schultern. »Sonst gehts dir aber noch gut?!« Er tippte sich an die Stirn. »Du spinnst echt, Nathalie. Das ist nur irgendein armer Tramper, den es ordentlich geduscht hat beim letzten Gewitter.« Er befeuchtete vorsichtig die Gummierung des Papers mit der Zunge und vollendete seine Selbstgedrehte. Zufrieden sah er die Zigarette an, so zufrieden, als hätte er ein einzigartiges, wertvolles Kunstwerk geschaffen. Er öffnete die Wagentür und stieg aus. »Rauch draußen«, murmelte er überflüssigerweise und ging kurz zu Benni, der immer noch neben der Zapfsäule darauf wartete, dass der Van endlich vollgetankt war.
Die beiden Jungs tauschten ein paar Sätze aus, die Nathalie nicht hören konnte. Benni sah kurz in den Wagen hinein und als er Nathalies Blick bemerkte, warf er ihr einen kleinen Luftkuss zu. Dann grinste er. Das Mädchen musste lächeln, sie revanchierte sich mit einem hingehauchten Kuss. Frank war unterdessen vor zur Straße gegangen, wo er sich die Zigarette anzündete. Die Blicke des nassen Kapuzenmannes folgten ihm, wie Nathalie mit Argwohn bemerkte. Sie musste schließlich über sich selbst lachen. Ein echter wahnsinniger Axtmörder würde im wirklichen Leben sicherlich nicht als wandelndes Splattermovieklischee durch die Nacht reisen.
Frank schlenderte ein wenig an der Straße entlang, inhalierte bei jedem Zug an der Zigarette so tief, als sei es seine letzte. Dabei achtete er darauf, dass jede seiner Bewegungen möglichst lässig aussah. Standbein, Spielbein, Drehung nach rechts, dabei ein klein wenig den Rücken rund machen, gerade so viel, dass er keinen Buckel bekam, damit die mächtigen Brustmuskeln stärker unter dem engen T-Shirt hervortraten. Drehung nach links, dabei den Hintern anspannen, ein wenig recken, damit die Ärmel höher rutschten und die Ausläufer seines großen Tribals, das er sich von Bizepsansatz zu Bizepsansatz quer über die Schulter hatte tätowieren lassen, sichtbar wurden. Seine Eltern hatten angesichts dieser »Verstümmelung« tobend das Geld für den Führerschein gestrichen, doch Frank war lieber ohne Auto als ohne Tätowierung …
Seine sorgsam einstudierten Posen, die seinen Körper in jeder Sekunde optimal zur Geltung bringen sollten, gingen Nathalie auf die Nerven. Auch der Kapuzenmann machte nun ein paar kurze Schritte hin und her, dabei behielt er Frank fest im Visier. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Frank den Blick erwiderte und freundlich lächelnd hinübernickte. Sofort kam der Kapuzenmann mit seiner kleinen Reisetasche zu Frank und sie begannen zu plaudern. Nathalie öffnete die Wagentür und beugte sich hinaus.
»Benni«, rief sie ihrem Freund zu, der eben den Zapfhahn zurück in die Halterung der Säule steckte und nach seinem Geldbeutel kramte. »Benni, hör mal bitte. Wenn Frank mit diesem Typen da ankommt … also, ich meine, den nehmen wir bitte nicht mit. Auf keinen Fall. Versprochen? Den finde ich nicht so prickelnd!«
»Hey, Süße.« Benni, der ihr nicht ganz folgen konnte, beugte sich zu ihr herunter und gab ihr einen herzhaften Kuss. Sein Dreitagebart, der ihm etwas so wahnsinnig Verwegenes gab, kitzelte an ihrer Oberlippe. »Wo brennts denn?«
»Frank hat da diesen komischen Tramper an der Backe.« Sie deutete hinter sich zur Straße hin. Benni hob den Kopf und spähte in die Richtung.
»So what?«
»Ich finde den Typen voll daneben! Bitte versprich mir …«
»Ich hab Jo gesagt, dass wir ihn bis Vierkirchen mitnehmen können!«, rief da Frank und näherte sich mit großen Schritten dem Van, den sich Benni von seinem Onkel für diesen Abend geliehen hatte, weil Bennis Golf in der Werkstatt war. »Ist doch kein Problem, oder!«
»Äh …«, Benni stockte und sah zu Nathalie hinunter, die ihm einen kurzen flehenden Blick aus ihren braunen Augen zuwarf. Dann musterte er seinen Kumpel Frank und den Mann mit der tief ins Gesicht gezogenen Kapuze. Der Tramper mochte Anfang zwanzig sein, sein Gesicht lag zwar im Schatten der Kopfbedeckung, doch selbst Nathalie konnte beim näheren Hinsehen keinerlei Spuren von Wahnsinn und Mordlust darin erkennen. Eher erinnerte er sie mit seiner seltsam ausdruckslosen Miene und den müden Augen an einen bedröppelten Hund. Nathalie strich sich eine Strähne ihrer naturblonden wilden Mähne aus dem Gesicht und lehnte sich mit einem Seufzer zurück.
Benni sagte: »Nö, ist kein Problem, oder Nathalie? Vierkirchen liegt ja fast auf der Strecke. Ich zahl nur noch schnell, dann kanns losgehen.«
»Ich möchte vorne sitzen«, sagte der Kapuzenmann, der nach Franks Angaben Jo hieß. Seine Stimme war dunkel und kratzig, aber angenehm. Ihr Klang machte bei Nathalie noch mehr an negativen Eindrücken wett als sein Hundeblick. Doch er sagte »ich möchte«, fordernd, befehlend, nicht »darf ich« oder »kann ich«, schon gar kein »bitte«. Nathalie überlegte, ob es auch den Jungs aufgefallen war. Wohl kaum. Sie war froh, dass Jo nun vorne saß und Frank neben ihr. Es beruhigte sie.
»Willst du deine Tasche nicht lieber hinten in den Kofferraum tun?«, fragte Frank, beugte sich vor und griff nach dem Gepäckstück, das Jo auf seinem Schoß hielt. Mit einem heftigen Ruck seines linken Arms verhinderte Jo, dass Frank die Taschenhenkel fassen konnte.
»Nein«, sagte er barsch und eine Spur zu aggressiv. Seine Stimme überschlug sich fast. »Hände weg von meiner Tasche!« Nach einer kurzen Pause hängte er noch ein halbherziges »Bitte« dran.
»Schon gut, Mann! Keine Folklore.« Frank lehnte sich zurück und grinste. »War ja nur ein Vorschlag. Hast wohl einen Goldschatz dabei?! Könntest aber wenigstens deine Kapuze abnehmen, nur so aus Höflichkeit.«
»Nein«, kam es erneut aggressiv von vorne.
Benni hatte endlich gezahlt und stieg wieder in den Wagen. Bevor er den Motor anließ, fiel sein Blick auf die schmutzige Reisetasche auf Jos Schoß. »Komm, ich tu die noch in den Kofferraum«, sagte Benni und hatte die Griffe schneller in der Hand, als Jo zunächst reagieren konnte.
»Nein!«, zischte Jo und schnappte seine Tasche. Eine kurze, absurde Rangelei um das durchnässte Gepäck entstand, bis Benni, verblüfft von Jos heftiger Reaktion, die Griffe losließ und »Mann, schon gut« sagte. »Anschnallen, es geht los.«
Auf der Fahrt, die sie zunächst auf der Bundesstraße Richtung Dachau führte, versuchte Frank ein Gespräch in Gang zu bringen.
»Hast echt Glück, dass wir fast in dieselbe Richtung müssen, Jo. Wir sind auf dem Weg zu einem Kumpel, dessen Eltern haben sich in der Nähe von Weichs einen voll geilen alten Bauernhof gekauft. So richtig heimatfilmmäßig, das Teil. Von siebzehnhundertnochwas. Angeblich. So voll mit Holzverkleidung und fetten Geranien am Balkon und so. Na, dem seine Alten haben Kohle wie andere Leute Silberfischchen.« Frank lachte blöde.
Jo grunzte grimmig, die Bauernhöfe von Franks Freunden schienen ihn mäßig zu beeindrucken.
»So was kostet heute eine Menge. Noch dazu im Einzugsgebiet von München«, plapperte Frank munter weiter. »Da macht er heute eine Grillparty. Bestimmt voll cool. Party all night long und morgen wird die Schule geschwänzt. Aber Kacke, dass es ausgerechnet heute so ein Gewitter geben musste. Dabei war das bisher doch der absolute Hammersommer. Jeden Tag über dreißig Grad und kein Wölkchen am Himmel. Und das seit Mai, aber grad heute, wenn die Party steigt, muss es pissen. Na, hat ja zum Glück auch wieder aufgehört und es ist immer noch pisswarm draußen. Voll thailandmäßig. Warst du schon mal in Thailand?«
Mehr als ein Grunzen kam nicht vom Kapuzenmann.
»Und du?«, unternahm Frank einen erneuten Anlauf. »Was machst du so in Vierkirchen? Wohnst du da?«
»Hmmm«, antwortete Kapuzenjo unbestimmt.
»Jo. Was soll das eigentlich für ein Name sein?«, fragte Frank weiter. »Ist das eine Abkürzung für Josef? Joe oder Sepp war dir wohl zu prollig?«
»Stimmt«, sagte Jo kurz angebunden und sah aus dem Fenster.
»Mann, kapier doch endlich, dass dein neuer Freund nicht reden will. Lass ihn in Ruhe«, sagte Nathalie zu Frank, bevor der zu einer neuen Frage ausholen konnte. Ihre anfänglichen Bedenken gegen den Tramper hatten sich zerstreut. Obwohl ihr aufgefallen war, dass er unangenehm roch – nach Muff, nach nassem Hund. Sie war sich sicher, dass nur er diesen Geruch mit in den Wagen gebracht haben konnte, denn die drei Jugendlichen hatten sich für die bevorstehende Grillparty zurecht gemacht und eingeduftet. Frank neigte in fast allem zur Übertreibung, so auch beim Einsatz seines Lieblingsduftwassers Acqua di Giò. In einem völlig finsteren Raum voller Leute würde man Frank absolut zuverlässig herausriechen. Und Benni, mit dem Nathalie erst seit zwei Wochen ging, hatte heute das sündteure Vetiver von Etro aufgelegt. Sie liebte den Duft, er törnte sie an, besonders in Kombination mit Bennis Dreitagebart. Nicht mehr lange, und sie würde seinem Drängen nachgeben und ihm das schenken, was sie Splatterfilm-Markus verwehrt hatte. Sie wollte, dass Benni ihr erster war. Obwohl er manchmal ein Kotzbrocken sein konnte, wenn er es heraushängen ließ, dass seine Eltern mehr Geld hatten als ein durchschnittlicher Pubertierender Pickel.
»Nö, wieso?« Frank ließ sich nicht bremsen. »Wenns ihn stört, kann er es ja sagen! Gell, Jo? Und jetzt tu nicht so geheimnisvoll. Was …«
»Es stört«, unterbrach ihn der Kapuzenmann. »Ich sage, es stört, okay?! Nichts gegen dich und ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr mich mitnehmt, aber ich habe keine Lust zu reden, okay?« Er drehte sich kurz um und sah Nathalie mit seinem bedröppelten Hundeblick flehend an. Das Mädchen schenkte ihm ein verständnisvolles Lächeln. Der Blick des Trampers wurde hart und kalt, er verzog den Mund zu einem kurzen fiesen Grinsen. So kurz, dass Nathalie sich nicht wirklich sicher war, ob sie es gesehen oder sich nur eingebildet hatte. Ihr fröstelte, nicht nur, weil die Klimaanlage des Wagens auf Hochtouren lief.
»Toll, bist ja eine richtige Stimmungskanone«, sagte Frank schmollend und lehnte sich mit verschränkten Armen zurück. »Das nächste Mal kannste an der Tanke verrecken.«
»Hey, Frankie. Lass mal gut sein!«, rief Benni seinen Freund zur Raison.
Es folgte ein Schweigen, das vom lauten Rauschen der Klimaanlage unterstrichen wurde und beinahe körperlich fühlbar war. Sie hatten Dachau hinter sich gelassen und fuhren weiter Richtung Ampermoching. Die Bundesstraße war schwach befahren um diese Uhrzeit. Nur gelegentlich durchschnitt der Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos die Dunkelheit der Sommernacht. Bei der Abzweigung nach Biberbach sagte der Kapuzenmann plötzlich fordernd: »Hier links.«
»Links?«, fragte Benni, »Nach Biberbach? Hast du nicht was von Vierkirchen gesagt?«
»Ja. Es gibt nicht nur einen Weg dorthin. Wir fahren durch Biberbach und dann rechts.« Es dauerte wieder einen Moment, bis er ein »Bitte« hinzufügte.
Benni tat, wie ihm geheißen. Der Fremde wusste mit Sicherheit am besten, wo er hin wollte. Nachdem sie den kleinen Ort hinter sich gelassen hatten, führte die Straße durch einen Wald, der kein Ende zu nehmen schien und vor allem deshalb den Autoinsassen irgendwie gruselig vorkam, weil vereinzelt geisterhafte Nebelschwaden durch das Unterholz zogen. Doch es waren nicht die dichten Schwaden schottischer Hochmoore, die in alten Edgar-Wallace-Filmen baskervillsche Hunde ankündigten, sondern eher dampfiger Dunst wie nach einem Tropengewitter. Der Kapuzenmann fing aus heiterem Himmel zu kichern an.
»Was ist denn nun so witzig?«, fragte Frank.
»Nichts«, entgegnete Jo und kicherte weiter. »Voll gruselig hier, was? Halt da vorne mal kurz. Ich muss noch was abholen.«
»Hier?«, fragte Benni ungläubig und sah sich suchend um. »Mitten im Wald? Was willste denn hier abholen? Hier ist doch nix.«
»Da vorne«, wiederholte Jo knapp und deutete in die Dunkelheit, dabei tropfte etwas von seiner Hand auf das Armaturenbrett. Nathalie sah es genau.
Nach kurzer Fahrt tauchte im Licht der Scheinwerfer am Straßenrand inmitten einer winzigen Lichtung ein kleines Haus auf, hinter dem ein zarter Nebelschleier vorbeizog. Ein mannshoher Maschendrahtzaun umgab das Grundstück. Dunkle Kiefern drängten dicht an die Umzäunung heran.
»Dauert nur ein paar Minuten«, sagte Kapuzenjo. »Bin gleich wieder da.« Er öffnete die Beifahrertür und sprang hinaus. Er ließ die Tür offen stehen und lief leichtfüßig in die Dunkelheit. Schwül-heiße Luft strömte in den Van. Das letzte Gewitter hatte nur Feuchtigkeit, aber keine Abkühlung gebracht.
»Na, klasse!«, konstatierte Frank und verschränkte die Arme vor der Brust. »Der Typ hat wohl die Vollmeise. Und jetzt?«
»Wie und jetzt?«, fragte Benni und beugte sich über den Beifahrersitz, um die Tür zu schließen. Die Klimaanlage des Vans arbeitete nur dann gut, wenn keine Außenluft einströmte. »Nix und jetzt. Wir warten, bis der Typ wieder zurückkommt. Oh, er hat übrigens seine kostbare Reisetasche hier stehen gelassen.« Benni deutete auf das Gepäckstück, das auf dem Beifahrersitz stand.
»Da ist irgendwas auf das Armaturenbrett getropft«, sagte Nathalie leise. »Vorhin, als er auf das Haus gedeutet hat.«
Benni musterte das Armaturenbrett und fand einen dunklen Fleck. Vorsichtig stippte er mit dem Zeigefinger hinein und untersuchte den Finger im fahlen Licht der Wageninnenbeleuchtung. »Hmmm, zu dunkel für Wasser, würde ich meinen. Irgendein Saft oder Ketchup oder so.«
»Oder Blut«, entwich es Nathalie.
»Bist du schon wieder bei deinen Splatterphantasien?« Frank zog amüsiert die Augenbrauen hoch.
»Ach, vergiss es.« Nathalie winkte ab und sah in die Nacht hinaus. Ihr Magen rebellierte wie so oft, wenn sie Stress hatte oder etwas in der Luft lag, doch sie beschloss, sich keine Sorgen zu machen. Sie warteten schweigend. Die Minuten zogen langsam dahin, zäh und klebrig wie Sirup. Das Haus lag nach einer Viertelstunde immer noch im Dunkeln. Kein Licht, keine Anzeichen, dass jemand dort etwas abholte, geschweige denn eben hineingegangen war. Um sich nicht wieder in ein Axtmörderambiente hineinzusteigern, dachte Nathalie in die entgegengesetzte Richtung. Sie wies die Jungs darauf hin, dass dieser Jo das Haus offenbar gar nicht betreten hatte und fügte hinzu: »Der müsste doch längst zurück sein, oder? Da läuft irgendeine Verarsche. Dunkles Haus im Wald, gruseliger Tramper, die vergessene Tasche, das Blut oder was immer das sein soll auf dem Armaturenbrett – da verarscht uns einer. Ist hier irgendwo ’ne versteckte Kamera?« Sie sah sich suchend im Auto um.
»Wer soll uns denn verarschen?«, fragte Benni. »Quatsch. Der Typ ist vielleicht ausgerutscht auf dem feuchten Boden und liegt jetzt da draußen mit gebrochenem Genick oder so.«
»Gut, dann schauen wir nach«, sagte Nathalie und stieg aus dem Wagen. »Frankie, du kommst mit und Benni bleibt im Wagen, falls …«
»Falls was?«, fragte Frank provozierend.
»Nix.«
»Du meinst, falls es doch eine Falle sein sollte. Dann kann er wenigstens nicht alle von uns auf einen Schlag erwischen, oder?« Frank verdrehte die Augen und tippte sich an die Stirn.
»Penner! Kommst du nun mit?«
»Ich muss eh im Wagen bleiben, weil ich der einzige von uns bin, der einen Führerschein hat, logo, oder?«, sagte Benni. »Und wartet, mein Onkel hat immer Taschenlampen im Wagen. Für alle Fälle.« Er wühlte im Handschuhfach und holte zwei große Mag-Lites heraus. »Hier. Damit kann man im Zweifelsfall auch psychopathischen Mördern eins über die Birne ziehen.« Die beiden Jungs lachten. Es klang angestrengt.
Nathalie schnappte sich eine der Taschenlampen, strich sich den khakifarbenen Minirock zurecht und ging los Richtung Haus. Das Gartentor war nur angelehnt. Das Mädchen ließ den Lichtkegel ihrer Mag-Lite über die Hausfassade tanzen. Das Gebäude machte einen leicht heruntergekommenen Eindruck. Die Fassade schien schmutzig braun und von den geschlossenen Fensterläden löste sich in großen Flächen die alte grüne Farbe. Ein zweiter Lichtkegel gesellte sich zu ihrem. Frank hatte zu ihr aufgeschlossen. Gemeinsam betraten sie den Garten, den sie bei Sonnenlicht sicherlich als romantisch-verwildert bezeichnet hätten. Nun im Dunkeln schien er ihnen düster-verwahrlost.
»Hallo!«, rief Frank. »Hallo, Jo. Bist du da irgendwo?« Keine Antwort. »Falls du ausgerutscht bist und dir das Genick gebrochen hast, lass es uns wissen!«
»Sehr witzig«, meinte Nathalie. »Hier liegt jedenfalls niemand. Vielleicht sollten wir mal um das Haus herumgehen.« Sie stapften durch das nasse Gras, beleuchteten abwechselnd die Fassade des Hauses und die dunklen Kiefern hinter dem Garten mit den Taschenlampen. Keine Spur von Jo oder sonstwem. Als sie das Haus umrundet hatten, warf Nathalie einen kurzen Blick zurück zum Auto an der Straße. Benni hatte die Innenbeleuchtung angelassen und saß relaxt hinterm Steuer. Als hätte er ihren Blick bemerkt, winkte er kurz.
»Lass uns mal schauen, ob jemand zu Hause ist«, sagte Frank und schritt zur Eingangstür. Er rüttelte dramatisch am Knauf und drehte sich mit weit aufgerissenen Augen zu Nathalie um. »Hey, das gibts nicht!«
»Was?« Nathalie war sofort von seiner Erregung erfasst. »Ich wusste es doch, die Tür ist offen, oder?«
»Äh …« Frank entspannte seine Gesichtszüge und löste seine Hand von dem Knauf. »Nein, abgesperrt.«
»Depp«, rief Nathalie, wütend über sich selbst, dass sie auf Franks Spiel hereingefallen war. »Hinterm Haus war doch noch eine Tür, da können wir es ja auch noch versuchen.«
Sie gingen zur Hintertür, die offenbar von der Küche zu einer kleinen Terrasse führte. Auch hier rüttelte Frank dramatisch am Knauf, doch er konnte sein Spielchen nicht durchziehen. Denn wie erwartet und gleichzeitig befürchtet, ließ sich die Türe öffnen. Der Junge stand einige Sekunden unschlüssig vor dem Dunkel, das im Inneren des Hauses lauerte.
»Jetzt reicht es echt!« Nathalie trat neben Frank und packte seinen Oberarm. Frank lebte praktisch im Sportstudio, sofern es die Abiturvorbereitungen erlaubten. Zwar behauptete er immer, er trainiere so viel, weil die Mädels drauf stehen würden, doch in Wahrheit stand vor allem sein Ego auf einen durchtrainierten Körper. Seine harten Muskeln zu fühlen gab Nathalie zusätzliches Selbstvertrauen. »Hier läuft was ganz Schräges.«
Nathalie erinnerte sich an die zahllosen Horrorfilme, die sie gesehen hatte. Da gab es immer, selbst in den besser gemachten, eine klassische Sequenz, in der einer der jung-dynamischen, attraktiven Hauptdarsteller, meist die knackige Blondine, aus welchen Gründen auch immer ein gruseliges Gemäuer, alternativ dazu einen finsteren Keller, betreten musste. Ebenso üblicher- wie unlogischerweise stolperte die Blondine sinnlos »Hallo, hallo«-rufend in die Dunkelheit hinein, geradewegs dem Psychopathen mit der Kettensäge in die Arme, statt als allererstes einen Lichtschalter zu suchen, um die Lage besser überblicken und dem Killer vielleicht entkommen zu können. Nathalie tastete an der Wand entlang, fand schnell den Schalter und machte Licht. Die beiden Jugendlichen betraten zögernden Schrittes langsam das Haus.
»Hör zu«, sagte Nathalie bestimmt, »wir gehen schnell in jeden Raum und machen alle Lichter an, die wir finden. Alle! Erst dann schauen wir uns um.«
Frank hatte nichts dagegen. Schnell durchschritten sie die Küche, den engen Flur, das kleinen Wohnzimmer, das Schlafzimmer, ebenso Bad oder Toilette. Obwohl sie ihr Augenmerk auf Lichtschalter gerichtet hatten, war den beiden gleich aufgefallen, dass Jo oder wer immer hier wohnte, kein gutes Händchen für Inneneinrichtung hatte und vor allem öfter lüften sollte. Als sie sich genauer umsahen, entdeckten sie ein Chaos an zusammengewürfelten Sesseln mit speckigen Bezügen und Stühlen unterschiedlicher Epochen im Wohnzimmer, dem Wust aus Kissen, Kleidung, Decken und Undefinierbarem in allen Schlafzimmerecken, die fein säuberlich zusammengeschnürten Stapel von Zeitungen entlang der Badezimmerwände, die Pyramide aus milchigen Einmachgläsern, in denen Undefinierbares schwamm, in der Mitte der Küche, die grässlichen unmodernen Tapeten, die sich an zahllosen Stellen von den Wänden lösten, die Schimmelflecken in der Toilette, die von oben bis unten mit kitschigen Marienbildchen tapeziert war. Im Flur hingen an der einen Wand große Schwarzweißfotos von Unfallopfern, Großaufnahmen von entstellten, zerfleischten, malträtierten Gesichtern, die gegenüberliegende Wand war mit unzähligen Gekreuzigten übersät, Hunderte von gemarterten Christuskörpern aus Holz ohne Kruzifix. Im Schlafzimmer bemerkte Frank das Riesenposter, das genau dem Bett gegenüber an der Wand hing. Es zeigte die berühmte Szene aus dem Film Das Schweigen der Lämmer, in der die beiden Wachmänner, die den Kannibalen Hannibal Lector in seinem Hochsicherheitskäfig bewachen sollten, brutal ermordet wurden und in einer melodramatischen Inszenierung wie geschlachtete Engel an den Gitterstäben gefesselt hängen.
»Boah, wie widerlich«, rief Nathalie, die innerlich einen Kampf zwischen Schock, Ekel und Neugier ausfocht. Eben noch hatte die Neugier überwogen, nun hielten sich die Gefühle die Waage. Zum ersten Mal war Nathalie froh, dass Frank so ein Eau-de-Toilette-Junkie war, denn der Duft brachte etwas Vertrautes, Angenehmes in diese streng müffelnde Bruchbude. Franks zu riechen beruhigte sie mehr, als sie es sich selbst eingestehen konnte.
»Und guck mal hier.« Frank deutete auf den Nachttisch, dort lagen mehrere Rollen Küchenpapier. Dann zeigte er auf einen Haufen zerknüllter Küchentücher, die auf und neben dem Bett lagen. Mit spitzen Fingern hob er ein Knäuel auf. »Jede Wette, dass der sich einen auf das Bild da wichst. Muss der krank sein.«
Im Wohnzimmer fiel Nathalie ein riesiges Ölgemälde auf, das über einer verschrammten Anrichte hing. Das Bild war schlecht gemalt, doch der Dargestellte kam Nathalie bekannt vor.
»Das solltest du dir mal ansehen«, sagte Frank und lenkte Nathalie davon ab, was sie eben in der Zimmerecke erspähte: Dort lagen achtlos auf einen Haufen geworfen mehrere ramponierte Tierpräparate – Wiesel, Vögel und ein Fuchs. Nathalies Blick blieb sekundenlang an einer ausgestopften Hauskatze hängen.
Frank hielt ihr ein Album unter die Nase. »Das lag aufgeschlagen auf dem Couchtisch da.« Sie blätterte darin herum. In dem Album klebten säuberlich ausgeschnitten und chronologisch sortiert zahllose Artikel über den Kannibalen von Rotenburg, der einst monatelang die Schlagzeilen beherrscht hatte. Der unscheinbare Mann hatte per Internet einen Kandidaten gesucht, der sich von ihm schlachten und verspeisen lassen wollte – und einen Berliner Ingenieur gefunden, dessen sehnlichster Wunsch es angeblich gewesen war, so zu sterben und gegessen zu werden. Hinter der romantischen Fassade eines Fachwerkhauses in einem kleinen hessischen Dorf war es dann zu der Tat gekommen. Der Mord war erst Jahre später aufgeflogen, als eine Sonderkommission der Polizei einschlägige Chatrooms observierte und dabei auf eine neue Suchanzeige des Kannibalen stieß.
Nathalies riss den Kopf herum zu dem Bild über der Anrichte. Natürlich – deshalb war ihr das Gesicht so bekannt vorgekommen, das Gemälde war ein Portrait des Menschenfressers. Armin Meiwes – sogar der Name des Verbrechers fiel ihr plötzlich ein. Warum konnte sie sich nur an den Namen des Kannibalen erinnern? »Okay, das reicht«, sagte Nathalie laut, ihre Neugier war mehr als befriedigt. »Ich weiß nicht, was hier läuft, aber ich haue ab. Hier schaut es aus wie in einem Marilyn-Manson-Video. Und das brauche ich überhaupt nicht. Wenn das hier eine perverse Spielart von Versteckte Kamera ist, dann kommt jetzt raus, Leute.« Sie machte eine kurze Pause, wohl wissend, dass nichts passieren würde. Sie merkte, dass Frank blasser als sonst aussah und ständig schluckte. »Gut. Ich bin weg. Ich habe die Schnauze voll. Frank, wir gehen.«
Sie verließen das Haus durch die Küche. Als sie die Pyramide mit den großen Einmachgläsern passierten, blieb Frank stehen und sagte: »Schau mal. Oder besser, nein, schau lieber nicht.«
Doch Nathalie schaute bereits. In den Gläsern am Fuße der Pyramide dümpelten weißliche zoomorphe Gebilde in gelblicher Flüssigkeit, die aussahen, als hätten fette Maden beschlossen, groteske Karikaturen von Säugetieren und Vögeln zu bilden. »Tierembryonen«, entfuhr es Nathalie. In den höheren Etagen befanden sich in Alkohol eingelegte Organe. Sie erkannte ein Herz und eine Lunge. Die Präparate kamen ihr alt vor, weil sie fast völlig farblos in einer trüben Flüssigkeit schwammen – und weil auf manchen Gläsern Beschriftungen mit Datumsangaben vor 1960 zu lesen waren. Ganz oben auf dem Stapel befand sich das größte Glas. Darin steckte ein menschlicher Fötus, zumindest etwas, das entfernt an einen menschlichen Fötus erinnerte. Die schrumpelige Haut war mit großen dunklen Flecken übersät, wo die Nase hätte sein sollen, klaffte eine längliche Spalte.
»Ich kotz gleich«, sagte Frank und atmete schwer. »Ich hoffe, ich wache bald auf!«
Nathalie packte seine Hand und zog ihn mit sich fort. Nur raus hier, schoss ihr durch den Kopf, bevor er uns erwischt. Sie hatte sich tapfer dagegen gewehrt, doch nun kehrte die Axtmörderphantasie mit Vehemenz in ihr Bewusstsein zurück. So sehr sie sich auch einredete, dass das alles hier nur eine Inszenierung sein konnte, ein realer Splatterfilm, mit dem sie auf den Arm genommen werden sollte – von wem auch immer, weshalb auch immer –, sie wusste tief in ihrem Inneren, dass es real war.
»Egal was Benni sagt, ich will, dass wir sofort weiterfahren und nicht eine Sekunde länger auf diesen Typen warten, der sich auf Kannibalen einen runterholt«, sagte Nathalie, und bemühte sich ihre aufkeimende Panik niederzudrücken und nicht loszurennen. War da nicht ein Geräusch im Gebüsch? Nicht hysterisch werden, sagte sie sich und während sie sich dem Van näherten, der wie ein skurriler leuchtender Riesenkäfer an der Straße parkte, wiederholte sie laut: »Kapiert, Frank? Wir hauen ab. Egal, was Benni sagt.«
Doch Benni konnte gar nichts sagen. Er war weder im Auto noch in der Nähe.
»Benniiiii!«, rief Frank und tastete mit dem Lichtkegel seiner Mag-Lite den Wald ab. »Benjamiiiiiin!« Seine Stimme zitterte und überschlug sich.
»Das ist nun ebenfalls nicht witzig«, sagte Nathalie, öffnete die Wagentür und setzte sich schnell auf den Beifahrersitz, nachdem sie die Reisetasche des Trampers in den Fußbereich geschubst hatte.
»Da läuft echt ’ne ganz abgewixte Sache. Scheiße!« Frank stieg ein. Nathalie drückte den Türknopf auf ihrer Seite, die Zentralverriegelung ließ alle Autotüren zuschnappen. Sie fühlte sich etwas sicherer.
»Hmmm, Schlüssel steckt natürlich auch nicht. Kommt jetzt die Geschichte, in der der Mörder ums Auto schleicht und dann den abgeschlagenen Kopf des vermissten Freundes auf das Wagendach schlägt, während sich die im Auto Wartenden vor Panik in die Hose machen?« Frank versuchte zu lachen. Es blieb bei dem Versuch.
Nun erst merkte Nathalie, dass Frank noch viel näher an einer Panik war als sie. Er zitterte und schwitzte. Sein Blick huschte suchend durch die Dunkelheit draußen. Der parfümierte Muskelprotz war ein nach Angstschweiß stinkendes Häuflein Elend, das versuchte, mit coolen Witzen einen letzten Hauch von Männlichkeit aufrecht zu erhalten.
Nathalie seufzte und wühlte in ihrem kleinen schicken Ausgehrucksack nach ihrem Handy. »Okay, tief durchatmen, ich rufe Benni an. Oder wen auch immer.« Das Mobiltelefon in ihrer Hand, diese geballte Ladung Hightech im Miniformat, gab ihr schlagartig neue Zuversicht.
»Tu das. Und ich werde nun das Geheimnis der Trampertasche lüften.« Frank schnaufte schwer, beugte sich hinüber und zog die Tasche zwischen Nathalies Füßen hervor. Er stellte die Tasche auf seine Knie und zog am Reißverschluss, der sich mühelos öffnen ließ.
»Scheiße, kein Netz«, sagte Nathalie und starrte auf das Display. »Irgendwie logisch.« Aus den Augenwinkeln bemerkte sie eine Bewegung neben dem Auto, in derselben Sekunde klatschte etwas gegen das Fenster. Das Mädchen schrie panisch auf und krallte ihre linke Hand in Franks Arm. Was gegen die Scheibe der Beifahrertür geklatscht wurde, war eine Hand. Die Hand bewegte sich und zog Schlieren über das Fenster, blutige Schlieren.
»Es reicht!«, schrie Nathalie. »Es reicht! Schluss! Aufhören!«
Die Hand wurde urplötzlich zurückgezogen. Dann kamen diese Geräusche, das Kratzen und der charakteristische Ton von Blech, das eingedrückt wird. Der Van schwankte ein wenig hin und her. Jemand kletterte auf das Dach des Vans. Ein Fellbündel klatschte auf die Windschutzscheibe, wieder und wieder. Ob es eine tote Katze oder ein anderes Tier war, konnten die beiden Wageninsassen in ihrer grenzenlosen Panik nicht ausmachen. Sie starrten wie gelähmt auf den Fellklumpen, der im fahlen Licht der immer noch eingeschalteten Wageninnenbeleuchtung mit einem grässlichen »Patsch« mehrfach vor ihnen aus dem Dunkel auftauchte, aufschlug und blutige Schleier hinterließ. Das Blech knackte wieder, dann ein dumpfes Plumpsen. Der Unbekannte war offensichtlich vom Wagendach gesprungen. Plötzlich tauchte ein Gesicht aus dem Dunkel auf und quetschte sich gegen die Scheibe auf der Fahrerseite. Frank hüpfte vor Schreck auf dem Sitz und stieß sich den Kopf am Wagendach. Dass es das Gesicht von Benni war, erkannte Nathalie erst auf den zweiten Blick. Dass er mit Sicherheit tot sein musste, bemerkte sie sofort. Bennis Kopf wurde nach rechts und links geschoben und gab dabei ein ekliges Quietschen von sich. Benni verschwand. Dann tauchte ein weiterer Kopf auf und Frank schrie diesmal noch lauter auf als Nathalie. Das unrasierte Kinn von Jo rieb sich im Blut auf der Scheibe. Er grinste diabolisch und machte Fratzen, presste seine Nase und seine Lippen abwechselnd gegen das Glas. Er weidete sich an dem Entsetzen der beiden Jugendlichen, die sich aneinander klammerten. Dass Frank sich einnässte, nahm Nathalie nur ganz am Rande wahr. Jo zog sich schlagartig zurück. Wie versteinert verharrten die Autoinsassen in ihrer Position. Erst als sich minutenlang nichts tat, lösten sie sich langsam voneinander. Dabei rutschte die Reisetasche, die auf Franks Knien gelegen hatte, zur Seite. Etwas in der Tasche geriet in Bewegung und suchte seinen Weg hinaus. Ein Kopf kullerte über Nathalies Schoß, ihre Beine hinunter und kam im Fußraum zum Liegen.
Während Frank sich erneut in die Hose machte und wie Espenlaub zitterte, schrie Nathalie mit überschnappender Stimme fortwährend »Scheiße! Scheiße! Scheiße!«. Etwas anderes kam ihr nicht in den Sinn. Auch als draußen grelles Scheinwerferlicht aufflammte und mehrere Menschen schemenhaft aus der Dunkelheit des Waldes auftauchten, schrie Nathalie noch ihr Scheiße-Stakkato. Auch als die Menschen nah genug am Wagen waren, dass Nathalie erkennen konnte, dass es genau fünf waren, eine Frau und vier Männer, und alle lachten und fröhlich winkten, schrie sie weiter. Auch als sie unter den Menschen Benni wahrnahm, der ihr quicklebendig und feixend zuwinkte und dann überschwänglich Jo umarmte, schrie sie weiter. Erst als das Kamerateam die Tür auf ihrer Seite mit Bennis Wagenschlüssel öffnete und ein auf jugendlich getrimmter Mann »Herzlich willkommen auf MTV, willkommen bei Voll geschockt!, der härtesten Show, die je eine Kamera versteckt hat!« rief, hörte Nathalie auf zu schreien. Reflexartig trat sie dem Mann in der Wagentür zwischen die Beine und schlug ihm gleichzeitig ins Gesicht. Grenzenlose Wut hatte ihre Panik hinweggefegt. Der Moderator taumelte stöhnend zurück. Irgendwer gackerte lauthals los. Frank saß bleich wie ein Bettlaken neben ihr und atmete schwer.
»Ihr Arschlöcher!«, brüllte Nathalie ihren Zorn heraus. Die meisten vom Fernsehteam hörten auf zu lachen. Nur einer kicherte noch blöde.
»Mensch, Nathalie …«, sagte Benni und trat an den Wagen. »Hey, Baby, war doch nur ein Scherz! Guck, ich lebe noch und der Kopf in der Tasche ist eine Attrappe!«
»Du Arschloch«, schrie das Mädchen, bückte sich nach dem Kopf im Fußbereich, packte ihn und schleuderte ihn mit voller Wucht auf ihren Freund. »Das nennst du witzig?!«
Der Kopf prallte an seiner Brust ab. Benni rang kurz nach Luft und taumelte etwas. Dann starrte er auf den Kopf, der am Straßenrand in eine kleine Pfütze gekugelt war. »Das ist ein falscher Schädel, haben die klasse lebensecht hingekriegt …«, begann Benni, beugte sich zu dem Kopf und packte ihn am Schopf. »Das ist doch nur ein Scherz. Nur ein Scherz«, wiederholte er während er den Schädel hoch hielt. »Nur ein Scherz«, flüsterte er ein letztes Mal tonlos und starrte den Schädel an. »Onkel Herbert …« Er ließ den Kopf fallen, drehte sich weg und übergab sich.
Der Kameramann hielt gnadenlos seine Kamera auf den jungen Mann, dann schwenkte er hinunter auf den Kopf. Einige Sekunden verstrichen, bis der Kameramann mit starren Augen sein Arbeitsgerät langsam von der Schulter gleiten ließ. Plötzlich erschlaffte sein Arm völlig und die Kamera schlug zu Boden.
»Das ist kein Scherz«, sagte der Kameramann schwach. Jo, der von Nathalie malträtierte Moderator und die beiden anderen Teammitglieder kamen langsam näher. »Das ist echt Herbert, der Kopf von Herbert.«
02 Nathalie schrie noch, wenn auch tonlos, denn die Stimmbänder hatten längst den Dienst versagt, als Kriminalrat Max Pfeffer sie behutsam in seine Arme nahm.
»Schschsch«, sagte der Polizeibeamte und wiegte das Mädchen sanft hin und her. »Es ist alles gut. Es ist vorbei.« Sie legte ihren Kopf an seine Schulter. Er ließ seinen Blick schweifen. Die Feuerwehr aus Vierkirchen hatte Aggregate und Scheinwerfer aufgebaut, die das Waldstück mit dem kleinen Häuschen hell erleuchteten. Die Jungs von der Spurensicherung hatten ihre Arbeit auf der Straße schon beendet und widmeten sich längst dem Haus. Der Notarzt spritzte Frank ein kreislaufstabilisierendes Mittel. Er hatte Pfeffer schon darüber informiert, dass der Junge nicht vernehmungsfähig sei und zur Beobachtung mindestens eine Nacht mit in die Klinik müsse, weil er unter schwerem Schock stand. Die Gerichtsmedizinerin Gerda Pettenkofer wuchtete soeben ihre gewaltige Leibesfülle aus ihrem Suzuki-Jeep, den sie neben dem Streifenwagen geparkt hatte, der als erstes am Tatort eingetroffen war. Die ganze Straße war weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, der ohnehin spärliche Verkehr auf dieser Route wurde umgeleitet.
»Guten Abend, die Herrschaften. Sorry, dass ich so spät komme«, rief die Ärztin laut und zog an ihrer Zigarette. »War auf einer Grillfeier an der Isar.«
»Tu nicht so«, antwortete Kriminalkommissar Paul Freudensprung, der zu Pfeffers Team gehörte und sich um Frank kümmerte. »Du bist nur zu spät, weil du eine mickrige Friseusenschleuder fährst, die nicht auf überbreite Schwertransporte ausgelegt …«
»Noch ein Wort zu meinem Gewicht, und du bist tot!« Die Gerichtsmedizinerin ließ sich durch die Frotzeleien nicht aus der Ruhe bringen. Und weil sie wusste, wie sehr Paul Freudensprung es hasste, wenn sein Name als Gaudihupf oder Gaudi verballhornt wurde, platzierte sie nach einer Kunstpause: »Verstanden, Gaudi?« Sie grinste selbstzufrieden vor sich hin, während sie sagte: »So, wo ist der Kopf?«
»Gerda. Paul. Bitte!«, beendete Pfeffer leise aber bestimmt das Gekabbel.
»’tschuldigung.« Die Gerichtsmedizinerin kam an Pfeffer und dem Mädchen vorbei. Sie tätschelte Nathalie mitleidig den Arm. Endlich schloss das Mädchen den Mund. »Hast ihn gefunden, hmmm? Tut mir leid, ich wollte nicht … na ja. Also, wo ist nun das Corpus Delicti?« So schnell es ihr möglich war, entfernte sich Doktor Gerda Pettenkofer.
Pfeffer hielt den Teenager weiter im Arm. Nathalie schluchzte nun leise. Mit einer Hand fuhr sie sich über die Stirn und sah zu Pfeffer hoch. Seine rehbraunen Augen strahlten genau den Beruhigungseffekt aus, den sie brauchte. Pfeffer wusste das. Er kannte die Wirkung seiner Augen, den Kuscheleffekt, den sie ausstrahlten. Nathalie löste sich ein wenig von ihm.
»Sie sind der Vater von Cosmo, nicht wahr?«, sagte sie leise mit heiserer Stimme. »Cosmo, … Cosmo Pfeffer.«
»Ja. Cosmas ist mein Sohn.« Pfeffers Sohn trug eigentlich den guten alten bayerischen Namen Cosmas, doch außer dem Kriminalrat selbst nannte ihn alle Welt Cosmo.
»Cosmo hat auch so tolle Augen wie Sie«, sagte sie und starrte ins Leere. »Ich finde ihn …« Sie brach ab. »Wir sind in einer Klasse.«
Auch das wusste Pfeffer. Er hatte das Mädchen schon auf der einen oder anderen Schulveranstaltung gesehen, vor allem bei Schulmusikabenden, die Pfeffer immer gerne besuchte, weil da sein Sohn Cosmo mit seiner Hiphop-Band auftrat. Und Cosmo machte seine Sache gut, Pfeffer war wirklich stolz auf die Auftritte seines Sohns. Nathalie gehörte ebenfalls zu den festen Programmpunkten bei den Musikabenden, denn für eine Sechzehnjährige spielte sie hervorragend Klavier. Ein begabtes, hübsches Mädchen aus gutem Hause. Pfeffer strich ihr sanft über die wilde Lockenmähne. Er dachte kurz daran, dass er sich immer eine Tochter gewünscht hatte. Eine wie Nathalie. Wahrscheinlich war es besser, dass er stattdessen zwei Söhne gezeugt hatte. Er wäre womöglich einer dieser hypereifersüchtigen Väter gewesen, die ihre Töchter so lange in goldenen Käfige stecken, die sie dann auf Händen tragen, bis aus den verzogenen Prinzesschens zänkische Anspruchsterroristinnen werden.
Wie gerne würde er jetzt eine rauchen. Er wühlte in der Außentasche seines leichten Sommersakkos nach der Packung Gauloises Blondes, die er sich erst vorhin an der Tankstelle, an der der »Tramper« zu den Jugendlichen ins Auto gestiegen war, gekauft hatte. Dass er damit den fünften Versuch mit dem Rauchen aufzuhören in Folge brach, war ihm momentan egal. Lieber Raucherhusten mit Auswurf am Morgen als diese ekligen bitteren Nikotinkaugummis kauen.
»Darf ich auch eine?« Nathalie sah wieder tief in seine kuscheligen Teddybäraugen. Er gab ihr eine Zigarette und Feuer. Sie hustete bei jedem Zug. »Ich rauche eigentlich nicht.« Pfeffer schmunzelte. »Ich … ach, was. Worüber reden wir hier? Cosmo hätte wenigstens nicht so einen Scheiß …«, sie hob die Stimme und wiederholte laut, »… so einen Scheiß gemacht!« Dann sprudelte es aus ihr heraus und sie erzählte Max Pfeffer ihre Sicht der Ereignisse. Pfeffer bremste sie kurz und winkte seine junge Kollegin Annabella Scholz herbei, denn mit dem Mädchen im Arm konnte er sich keine Notizen machen, das musste nun die Kollegin übernehmen.
Als sie geendet hatte, kam Benni, der die ganze Zeit apathisch am Van seines Onkels gelehnt hatte, herüber und streichelte sanft Nathalies Rücken. »Es tut mir so leid«, flüsterte er heiser. »Ich bin …«
»Pfoten weg, du Arsch!«, schrie Nathalie und löste sich von Pfeffer gerade so weit, dass sie noch Körperkontakt hatte und gleichzeitig freie Bahn, um Benni eine herunterzuhauen. Die Ohrfeige schallte so laut, dass die Personen in der näheren Umgebung überrascht herüberschauten. »Du hast das doch alles eingefädelt! Du bist schuld an allem!«
»Ja … nein … Mann, das ist mein Onkel!« Benni hielt sich die Wange und schrie nun ebenfalls. »Mein Onkel! Kapiert! Das ist sein Kopf! Es hätte ein Plastikding in der Tasche sein sollen, kapiert?! Mein Onkel wurde geköpft. Und du regst dich über das bisschen Brimborium auf, das die von dieser Scheißshow hier veranstaltet haben!« Er machte eine fahrige Handbewegung hinüber zu der Gruppe Menschen, die bleich wie Schreckgespenster und scheu wie verlorene Schafe im Licht der Scheinwerfer standen und darauf warteten, von Pfeffers Leuten vernommen zu werden. Es handelte sich um den Kameramann, den Moderator, die Produktionsassistentin und den Redakteur von Voll geschockt!.
»Sie sind Benjamin Veicht? Der Neffe des Ermordeten?«, fragte Pfeffer sachlich, um die Emotionen etwas herunterzukochen. Der junge Mann nickte.
»Benjamin Veicht, neunzehn Jahre«, las Bella Scholz von ihrem Notizblock ab. »Geht wie alle jungen Leute hier – und übrigens wie dein Sohn, Chef –, auf das Geschwister-Scholl-Gymnasium in München, macht nächstes Jahr Abitur. Ich habe ihn schon vernommen, Chef. Der Ermordete ist sein Onkel, Herbert Veicht, Produzent von Voll geschockt! und zahlreichen anderen Reality-Formaten. Der Bruder von seinem Vater Hans-Georg Veicht. Falls dir der Name was sagen sollte – ja, das ist der Veicht von Veicht-Optik. Du weißt schon, das Billigbrillenimperium.«
Zu allem, was die Kommissarin sagte, nickte Benni bestätigend.
»Voll geschockt! finden doch alle voll cool!«, plapperte der junge Mann drauflos. »Das ist nicht so spießig wie die anderen Reinlegshows. Ich wollte schon immer mal dabei sein und habe meinen Onkel bekniet, dass ich irgendwann mal den Lockvogel spielen darf. Und heute … Mann, das ist sein Van, der für die Sendung präpariert war, versteckte Kameras in den Kopfstützen und im Armaturenbrett. Ich dachte, Nathalie und Frank finden das auch voll cool, wenn sie erfahren …«
»Frank hat sich vor Schiss in die Hose gepisst, du Arsch!«, schrie Nathalie ihren Freund an. »Wir sind beide vor Panik fast gestorben, auch ohne den echten Toten. Ist das cool? Ist das cool?«
»Kann ja keiner ahnen, dass Frank so voll rummädelt, der Schwachmat!«
»Rummädelt? Du Arschloch!«, schrie das Mädchen.
»Ganz ruhig«, sagte Pfeffer beschwichtigend. »In der Situation war es nur normal, dass jemand … rummädelt, Herr Veicht.« Der Notarzt gesellte sich mit seinem Koffer zu der kleinen Gruppe. Er löste behutsam das Mädchen aus den Armen des Kriminalrats.
»Kommen Sie mit«, sagte der Arzt. »Wir setzen uns dort drüben hin und dann werde ich Sie untersuchen.« Nathalie folgte ihm artig wie ein Kind.
»Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken«, sagte Pfeffer und tätschelte Benni Veicht den Arm. »Wirklich nicht.« Er bemühte sich nur marginal, nicht allzu zynisch zu klingen, dann ging er mit seiner Kollegin zum Haus. Paul Freudensprung gesellte sich zu ihnen.
»Wenn deine Freundin Gerda Pettenkofer mich noch einmal Gaudi nennt, ist sie tot«, grummelte er.
»Und wieso, Gaudi?«, frotzelte Annabella Scholz.
»Okay, Leute.« Pfeffer blieb kurz stehen, schnippte seine Zigarette auf den Asphalt und trat sie aus. »Alles zu seiner Zeit und jetzt ist wirklich nicht die Zeit für solche Empfindlichkeiten und Sticheleien. Paul, seit wann wirst du Gaudi genannt? Doch bestimmt schon seit der Schulzeit, oder? Jedenfalls mehr als zwanzig Jahre. Du bist alt genug, um dich nicht mehr daran zu stören, dass jeder dich Gaudi nennt – das ist ein verdammt netter Spitzname. Finde ich jedenfalls. Also bitte!«
»Du solltest auf den Chef hören, Gaudihupf«, sagte Bella.
»Bella!«, rügte Pfeffer.
»Was denn?!«
»Okay.« Freudensprung machte eine übertrieben hilflose Geste. »Dann nennt mich doch, wie ihr wollt. Wollt ihr nun mit ins Haus?«
Sie betraten das kleine Gebäude wie die Jugendlichen durch die Terrassentür. »Ich habe schon den Ausstatter der Show aus dem Bett klingeln lassen, der ist hierher unterwegs und kann mir dann sicher erklären, woher er all diese Präparate in der Küche hat. Wäre mir jedenfalls neu, dass missgebildete Menschenembryonen für jeden käuflich erwerbbar sind.« Er deutete auf die Gläserpyramide. »Außerdem wird es wirklich spannend, was er dazu zu sagen hat, dass statt dem Plastikkopf, den er angeblich präpariert hat, der abgeschnittene Schädel seines Chefs in der Reisetasche liegt. Der Typ hat mir gleich am Telefon erzählt, dass er sich bei der Innendekoration hier an den üblichen Filmklassikern orientiert hat, ein wenig Sieben hier, ein bisschen Freitag der 13. da, ein Schuss Psycho und noch eine Prise Das Schweigen der Lämmer. Die Kinder haben übrigens längst nicht alles entdeckt. Im Kühlschrank hätte es zum Beispiel noch modernde Schweinedärme gegeben und in der Wohnzimmeranrichte blutverkrustete chirurgische Instrumente. Das Haus gehört einer gewissen Martha Benzengruber. Eine alte Frau, die hier alleine lebt. Sie hat das Haus an die Produktionsfirma von Veicht vermietet und wurde für eine Woche in ein Hotel in München einquartiert, damit alles gruselig hergerichtet werden konnte. Natürlich müssen die hinterher wieder alles renovieren und in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen.«
Die Polizisten schlenderten durch die Räume und sahen sich gründlich um. »Hier sind überall versteckte Kameras angebracht. Da, in der ausgestopften Katze zum Beispiel, oder hier in der Lampe oder da.« Er deutete auf verschiedene Kameraverstecke. »Und sie haben sogar mit einem starken Störsender den Handyempfang unmöglich gemacht, damit niemand zur unpassenden Zeit telefonieren kann.«
»Irgendwie krank der ganze Aufwand, oder?« Bella Scholz sprach aus, was alle dachten. »Alles nur, um Jugendliche an den Rand eines Nervenzusammenbruchs zu bringen.«
»Nein, alles nur, um Quote zu machen«, korrigierte Freudensprung. »Schaust du manchmal abends MTV oder Viva? Da kommen lauter so debile Schock-Shows. Und den extremen Aufwand haben sie diesmal nur deshalb betrieben, weil das die Jubiläumssendung werden sollte.«
»Gut«, sagte Pfeffer. »Das hier ist ja offensichtlich nicht der Tatort. Zeig mir noch, was draußen wichtig ist.«
»Dort drüben im Unterholz hat das Filmteam gewartet, die haben im Dickicht einen getarnten Unterstand gebaut, dort konnten sie mit kleinen Monitoren alles verfolgen, was sich im Wagen oder im Haus tat. Von Anfang an.«
»Ich will alle Aufzeichnungen, von allen Kameras«, sagte Max Pfeffer. »Längst in die Wege geleitet«, entgegnete Freudensprung lässig. »Okay, der vorgebliche Axtmörder heißt Jonas Wagenbrenner, nicht Joseph, wie er die Jugendlichen hat glauben lassen. Alle nennen ihn Jo, das ist wirklich sein Spitzname. Er sprang jedenfalls aus dem Auto, lief durch den Garten um das Haus herum und hinten durch eine Lücke im Zaun hinüber zu dem Unterstand, wo er sich beim Filmteam versteckte. Während die zwei, also Nathalie Castorff und Frank Jobst, im Haus waren, ist Benjamin Veicht, der als Lockvogel in alles eingeweiht war, ebenfalls in den Unterstand und hat das Auto offen zurückgelassen, damit sein Verschwinden für zusätzlichen Schockeffekt sorgt. Von dort haben sie dann die Attacke auf das Auto gestartet und das große Finale, das die Erlösung bringen sollte.«
Das kleine Team hatte seinen Rundgang beendet. Pfeffer fiel auf, dass eine riesige Luxuslimousine der obersten Klasse im Schritttempo beinahe lautlos heranrollte und neben dem Notarztwagen zum Stehen kam. Ein Mann um die Fünfzig mit nach hinten gegelten, schulterlangen Haaren stieg langsam aus und sah sich suchend um. Er trug ein rosafarbenes Poloshirt und eine marineblaue Sommerhose mit Bügelfalte. Als er Pfeffers Blick bemerkte, straffte er seine Schultern und kam sicheren Schritts auf ihn zu.
»Sie leiten hier die Ermittlungen?« Er schüttelte keine Antwort abwartend Pfeffers Hand. Ein Alpha-Männchen hatte das andere Alpha-Männchen erkannt. »Hans-Georg Veicht, mein Name. Mein Sohn hat mich angerufen. Es ist etwas mit meinem Bruder Herbert?«
»Ja, so kann man es auch nennen. Maximilian Pfeffer übrigens mein Name, Kriminalrat. Folgen Sie mir bitte. Ihr Bruder wurde von den Jugendlichen hier ermordet aufgefunden.«
»Das hat mein Sohn mir bereits erzählt. Ich möchte ihn bitte sehen. Meinen Sohn, meine ich. Ich möchte gerne erst meinen Sohn sehen.«
»Das … ich bitte Sie, erst Ihren Bruder zu identifizieren.«
»Das haben doch schon all die anderen gemacht, oder? Mein Sohn auch.«
Pfeffer spürte die Angst des Mannes vor dem, was er sehen sollte. Er roch den Angstschweiß, der Hans-Georg Veicht den Rücken hinunter lief. Doch Pfeffer bestand darauf, denn er wollte die Reaktion sehen. Womöglich stand der Mörder hier vor ihm. Er führte Hans-Georg Veicht zu dem einzig vorhandenen Teil von Herbert Veicht, den die am Boden kniende Gerichtsmedizinerin eben in einer schwarzen Folie verpackte.
»Warte bitte eine Sekunde, Gerda«, sagte Pfeffer. »Herr Veicht möchte seinen Bruder sehen.«
»Klar, Max.« Sie öffnete die Folie und stand auf. Sie hielt eine unangezündete Zigarette im Mundwinkel. »Gib mir bitte mal Feuer, Maxl.« Der Kriminalrat erfüllte den Wunsch und rauchte solidarisch gleich eine mit.
Hans-Georg Veicht schnappte nach Luft und bemühte sich um Haltung. Er sah lange auf den abgetrennten Schädel, man konnte förmlich fühlen, dass er sich dazu zwang, den Blick nicht abzuwenden. Dann nickt er und dreht sich weg.
»Mein Bruder«, sagte er leise. »Zweifelsohne. Seit wann ist er tot?«
»Schätze mal, rund vierundzwanzig Stunden«, antwortete Gerda Pettenkofer.
»Oh, aha.« Der Mann holte aus der Brusttasche seines Polohemdes ein Lederetui, dem er eine kurze Zigarre entnahm. Er zündete sie umständlich an und inhalierte auf Lunge. Eine einzelne Träne rann seine linke Wange hinunter. »Ich habe gewusst, dass ihm seine kranken Reality-Produktionen eines Tages den Kopf kosten würden …« Er stockte. »Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint.«
Die Gerichtsmedizinerin unterdrückte ein Lachen und drehte sich kurz weg. Pfeffer fragte: »Wie haben Sie es dann gemeint? Woher konnten Sie das wissen?«
»Ich meinte wissen nicht im Sinne von hundertprozentig wissen. Ich meinte eher ahnen. Herberts Produktionsfirma ist sehr erfolgreich in diesem Reality-Segment, eine Dokusoap nach der anderen und dann noch irgendwelche halbseidenen Semipromis zum Überlebenstraining auf die Alm oder in den Dschungel schicken. Damit hat er sein Geld gemacht. Und glauben Sie mir, nicht jeder findet es gut, dass das Fernsehniveau im freien Fall nach unten ist. Da hat mein Bruder mit seinen Formaten eifrig zu beigetragen. Das bringt sicherlich Feinde ein und natürlich auch Neider, kann ich mir denken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich vermute nur. Wir haben nicht so viel Kontakt miteinander. Ich habe mit seiner Branche nichts zu tun. Wissen Sie, ich mache in Brillen.« Er saugte an seiner Zigarre. »Mein Bruder war immer ein schwieriger Charakter. Es tut mir leid, das zu diesem Anlass sagen zu müssen. Schon als Kind. Er eckte überall an, provozierte um der Provokation willen. Meine armen Eltern …«
»Hat ihr Bruder sonst noch Familie?«
»Familie?« Veicht grunzte. »Meinen Sie seine drei Exfrauen, oder das Flittchen, mit der er momentan verheiratet ist? Entschuldigen Sie, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Mein Bruder hatte immer einen seltsamen Geschmack, was seine Frauen anging. Gott sei dank hat er mit keiner Kinder in die Welt gesetzt. Mein Sohn … er mochte ihn sehr, er hat ihn wie sein eigenes Kind behandelt und total verwöhnt.« Der Brillenproduzent deutete in Richtung Kopf seines Bruders ohne hinzusehen und fragte: »Und der Rest? Ich meine, wo ist sein Körper?«
»Das wissen wir leider noch nicht. Ich bin mir aber sicher, dass wir ihn bald finden werden«, sagte Pfeffer wider besseres Wissen, denn er hatte das dumpfe Gefühl, dass sie den Körper nie finden würden.
»Schön, schön.« Man konnte merken, dass das Maximum an Beherrschung bei Hans-Georg Veicht nun erreicht war. Er wollte so weit als möglich weg von dem Schädel seines Bruders. »Ich bin sicher, Sie machen das richtig. Ist das dort der Mörder?« Er deutete hinüber zu dem jungen Mann, der bei der Scharade die Rolle des Trampers gespielt hatte. Jo Wagenbrenner lehnte blass an einem Baum und unterhielt sich mit einem der beiden Uniformierten, die abgestellt waren, ihn zu bewachen. Dabei schüttelte er ununterbrochen seinen Kopf.
»Wir wissen noch nicht, ob er der Mörder ist. Fest steht nur, dass er den Kopf Ihres Bruders in einer Reisetasche mit sich trug. Wir gehen momentan noch davon aus, dass er wie alle anderen dachte, es sei ein künstlicher Schädel.«
»Natürlich. Sie wissen am besten, was zu tun ist.« Veicht floskelte vor sich hin. »Ich möchte nun zu meinem Sohn.« Er drehte sich abrupt von Gerda Pettenkofer und Max Pfeffer weg und prallte beinahe mit Freudensprung zusammen, der leise an die Gruppe herangetreten war.
»Ist das ein Maybach?«, fragte Freudensprung ehrfürchtig und deutete auf Veichts Luxuslimousine.
»Äh, ja«, antwortete der Brillenfilialist irritiert. »Ja, ein Maybach.« Er ging mit staksigen Schritten zu seinem Sohn Benni.
»Wow, ein Maybach!« Paul Freudensprung lief davon, um den Wagen aus der Nähe zu inspizieren.
»Meine Lesebrille ist von Veicht-Optik«, sagte die Gerichtsmedizinerin.
»Spannend«, antwortete Pfeffer trocken.
»Nicht wahr? Nun weiß ich wenigstens, wo mein Geld geblieben ist. Der Kopf wurde übrigens mit absoluter Sicherheit mit einer Säge abgetrennt. Und das nicht so wahnsinnig professionell. Das sieht man schon an der leicht zerfetzten Haut und den Halsmuskelpartien. Es gibt keine geraden Schnittkanten. Da braucht man nicht erst die Knochen zu checken. Da musst du gar nicht irgendwelche Metzger oder Schlachter oder Mediziner in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen. Die könnten das besser. Und außerdem war er schon vorher tot. Das Enthaupten ist also nicht die Todesursache. Alles Weitere kriegst du demnächst schriftlich. In ein paar Tagen, nächste Woche, irgendwann halt.«
»Ich liebe deine exakten Prognosen. Apropos, meinst du, wir haben eine Chance den Körper zu finden?«
»Sonst noch Fragen, Maxl? Ich bin keine Profilerin. Ich beschäftige mich nur mit Toten. Aber wenn du mich schon so fragst – nein, ich denke nicht.«
Pfeffer nickte zustimmend.
03 »Wo warst du?! Wo warst du?!«
»Warum schreist du so? Du weißt, dass ich dich höre.«
»Wo warst du?! Ich habe dich so gebraucht und du warst nicht da!«
»Bist du sicher, dass ich nicht da war?«
»Was? Nein, ich …«
»Höre ich da Verzweiflung? Warum? Und um deine Frage zu beantworten: Ich war da.«
»Wirklich? Natürlich, wenn du es sagst. Ich war mir nicht sicher. Ich hatte Angst.«
»Ich weiß. Wir haben noch viel Arbeit vor uns.«
»Dann hast du alles gesehen?«
»Deine Fragen langweilen mich wirklich.«
»Entschuldige. Oh, ich sollte mich ja nicht ständig entschuldigen. Ich fühle mich jetzt jedenfalls so unglaublich lebendig!«
»Weil du es getan hast?«
»Nein, ja, auch, aber hauptsächlich, weil du da bist.«
»Das ist eine Selbstverständlichkeit! Komm mir nicht mit solchen Schmeicheleien. Denkst du, ich lege Wert auf so etwas? Ich bitte dich. Dazu solltest du mich besser kennen.«
»Kenne ich dich wirklich? Manchmal denke ich, ich kenne dich in- und auswendig, dann habe ich Angst, ich kenne dich gar nicht. Dann bist du so weit weg.«
»Gut, wir kommen der Sache schon näher. Du lernst dazu, denn du kennst mich wirklich nicht.«
»Bist du nun böse auf mich?«
»Böse? Ich? Das ist gut, das muss ich mir merken. Du denkst immer noch zu sehr in deinen Kategorien. Wieso sollte ichDIRböse sein?«
»Ich weiß nicht. Ich habe alles getan, was du mir gesagt hast.«
»Was ich dir gesagt habe? Habe ich dir gesagt, gehe hin und hacke ihm den Kopf ab? Das sollen meine Worte gewesen sein?«
»Nein, natürlich nicht. So hast du es nicht gesagt.«
»Gut, darauf lege ich doch einigen Wert.«
»Doch für mich waren deine Worte unmissverständlich. Also habe ich es getan. Es war grauenhaft, aber ich habe es getan. Für dich.«
»Meine Worte sind für gewöhnlich immer unmissverständlich. Und bettle nicht so sehr um Lob. Das stößt mich ab. Sieh her, schau mich an. Keine Angst. Sieh her. Es wird dir nichts passieren. Nicht jetzt und nicht später. Du bist sicher. Ich werde dich nun mit dir alleine lassen, aber du weißt, dass ich trotzdem immer bei dir bin.«
»Nein, geht nicht. Lass mich jetzt nicht alleine! Ich brauche dich doch.«
»Ich bin immer da. Doch du musst aufpassen. Konzentriere dich. Du muss ganz bei dir sein, damit sie nichts merken.«
04 »Die Ereignisse von gestern Abend scheinen Sie am wenigsten mitgenommen zu haben.«
»Finden Sie?« Jonas Wagenbrenner lehnte sich auf dem unbequemen Stuhl zurück und pustete vorsichtig in den Becher mit heißem Kaffee, den ihm Annabella Scholz gegeben hatte. Seine blasse Haut glänzte talgig im Sonnenlicht, das durch die Jalousien hereinfiel. »Das täuscht. Ich habe die ganze Nacht keine Auge zu getan. Vielleicht wirke ich nur so ruhig, weil ich so ziemlich als einziger nicht persönlich involviert war.«
»Nicht persönlich involviert? Sie sind gut, Herr Wagenbrenner.« Max Pfeffer zog sich sein Jackett aus und hängte es sorgfältig über den Schreibtischstuhl, damit es keine Knitterfalten bekam. Als er heute früh das Büro betreten hatte, hatte Annabella Scholz laut gepfiffen und Pfeffer von oben bis unten gemustert. Pfeffer war bekannt dafür, dass er sich immer stilsicher kleidete, sommers wie winters, ohne overdressed zu sein. Neider im Büro hielten ihn deshalb für einen eitlen Fatzke und selbstverliebten Gecken. Es juckte Pfeffer herzlich wenig.
Er strengte sich nicht einmal sonderlich an. Er überlegte nie groß, was er anziehen wollte, sondern entschied innerhalb von Sekunden. Er las selten Modemagazine und war kein Shoppingfreak, er hatte es einfach im Gespür und verfügte über einen kleinen Schrank voller klassischer Basics. Einmal im Halbjahr mistete er die Klamotten aus, die gewissen Trends unterworfen waren und durchforstete seine Lieblingsläden nach Aktuellem, Tragbarem. Gute Kleidung war eine seiner zwei Marotten, die er kultivierte – die andere Marotte war Jazz.
Pfeffer hatte in der vergangenen Nacht nur zweieinhalb Stunden geschlafen, denn nachdem sie den Fundort der Kopfes verlassen hatten, waren er und Annabella Scholz schnurstracks mit einem Spurensicherungsteam zur Wohnung des Toten gefahren. Dass hier ebenfalls nicht der Tatort war, hatten sie schnell festgestellt. Die große Penthousewohnung im vornehmen Stadtteil Nymphenburg war erlesen möbliert und wirkte auf die Beamten irgendwie aseptisch. Zwei Ikonen, die einzigen Bilder im Wohnzimmer, waren Pfeffer aufgefallen. Und außer ein paar Unterlagen, Notizbüchern, Kalendern und dem Laptop schien ihnen wenig sicherstellenswert, denn sie wussten noch nicht, worauf sie ihr Augenmerk richten sollten. Als Pfeffer schließlich todmüde ins Bett gefallen war, wusste er, dass sich Annabella Scholz in den nächsten Tagen akribisch mit allem beschäftigen würde, was aus der Wohnung transportiert worden war.