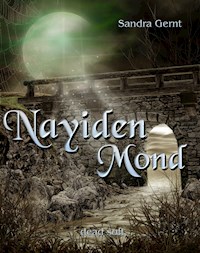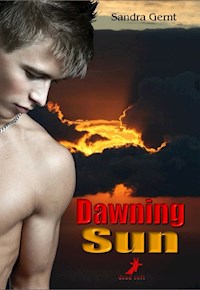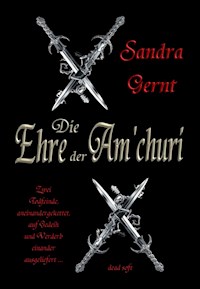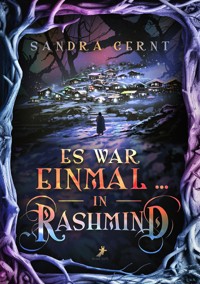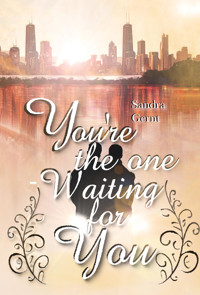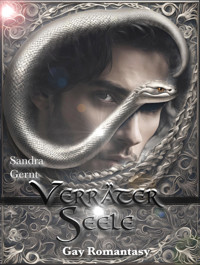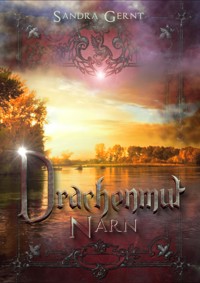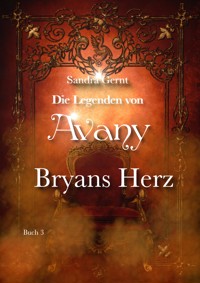4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein gay-romantisches Märchen, geeignet ab sechzehn Jahren Beinahe wäre Tary am Tag seiner Geburt zusammen mit seiner Mutter gestorben, die Hilfe bei einer fremden Ynwora-Sippe suchte. Er wird gerettet und die Schattenmächte enthüllen früh, dass ihm Großes bestimmt ist. Doni hingegen ist so bedeutungslos, dass die Mächte ihn vollständig ignorieren. Er hat keine Lebensaufgabe, kein prophezeites Schicksal, keine Daseinsberechtigung. Nichts davon braucht er, um zu kämpfen, wenn es richtig ist – und zu lieben … Ca. 60.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ca. 300 Seiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Beinahe wäre Tary am Tag seiner Geburt zusammen mit seiner Mutter gestorben, die Hilfe bei einer fremden Ynwora-Sippe suchte. Er wird gerettet und die Schattenmächte enthüllen früh, dass ihm Großes bestimmt ist.
Doni hingegen ist so bedeutungslos, dass die Mächte ihn vollständig ignorieren. Er hat keine Lebensaufgabe, kein prophezeites Schicksal, keine Daseinsberechtigung.
Nichts davon braucht er, um zu kämpfen, wenn es richtig ist – und zu lieben …
Ca. 60.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ca. 300 Seiten.
Für Manni
Möge er nicht zu lang sein, der harte Weg …
Das Gesetz
der
von
Sandra Gernt
1
s ist soweit“, verkündete Oria feierlich, die Königin der hiesigen Ynwora-Sippe. Fünf starken Söhnen hatte sie das Leben geschenkt. Diesmal würde es die lang ersehnte Tochter werden, die dereinst den Fortbestand der Herrschaftslinie sichern sollte.
„Ich habe ihren Namen heute Nacht im Traum gesehen.“ Oria nickte ihrer Mutter zu, die ihr während der Geburt beistehen würde, wie bereits bei den vorangegangenen. „Silladoni soll sie heißen. Sie wird mutig und tapfer, ungewöhnlich willensstark und klug sein. Eine würdige Königin.“ Ihre Tochter würde jedes bisschen Kraft bitter benötigen, das war Oria schmerzlich bewusst. Vor vier Tagen war ihr Gefährte gestorben. Karym. Wie üblich hatte ihre Verbindung mit Gewalt und Zwang begonnen, doch Karym hatte gelernt, dass Oria nicht seine Feindin war. Daraus war Respekt, Freundschaft und zuletzt echte Liebe erwachsen. An ihrer Seite hatte er ein freier Mann sein dürfen, der die Krieger und Wächter der Sippe angeführt hatte. Er war als Held gefallen, im Kampf gegen eines der Rattenrudel, das es auf ihre Vorräte abgesehen hatte. Silladoni würde ohne Vater aufwachsen … Und auch ihre Mutter würde sie nicht bis ins Erwachsenenalter begleiten und sie lehren, ihr Schicksal zu tragen. Oria trug das Amulett der Sicht, das ihr prophetische Gaben schenkte. Das Privileg und der Fluch einer Königin. Sie wusste genau, wann und wie sie selbst sterben würde und es gab nichts, was sie dagegen unternehmen könnte.
Doch noch war es nicht soweit. Die Schattenmächte hatten Oria verraten, dass sie im Morgengrauen ihre Tochter in den Armen halten würde. „Baro, sag deinen Brüdern Bescheid, dass die Wehen eingesetzt haben“, befahl sie ihrem ältesten Sohn. Er gehörte seit dem letzten Winter zum innersten Kreis der Wächter und durch Karyms Tod würde er demnächst zu deren Anführer aufsteigen. Dabei war er erst einundzwanzig … und nicht mehr ihr kleiner Junge. Und auch sie war keine junge Frau mehr.
„Sei unbesorgt, Mutter. Ich werde diese Geburt schadlos überstehen“, sagte sie und lächelte, trotz der Wehe, die sie heftig packte und zum völligen Stillstand zwang.
„Du vergisst, dass ich ebenfalls Trägerin des Amuletts war, Kind.“ Esra, ihre Mutter, berührte den goldenen Anhänger, der offen auf Orias Brust lag. Der dreifach verschlungene Knoten symbolisierte Leben, Schicksal und Tod. Nur die Königin durfte entscheiden, wer es benutzte; die Schattenmächte enthüllten ihr, was sie wissen musste, um die Sippe zu beschützen.
„Die letzte Prophezeiung, die es mir geschenkt hat, bevor die Bürde des Wissens und der Verantwortung auf dich überging … Heute Nacht wird sie sich endlich erfüllen.“
Oria kam nicht dazu nachzufragen, was mit diesen kryptischen Worten gemeint war. Die nächste Wehe überrollte sie mit solcher Macht, dass sie leise stöhnend in die Knie ging und sich konzentriert zum Atmen zwingen musste.
„Komm, mein Liebling. Die Geburtsliege steht bereit. Ich will nicht, dass du stürzt und dich oder deine Tochter verletzt.“
Stunden vergingen, bis Oria endlich mit einem triumphierenden Schrei das Kind aus ihrem Leib gepresst hatte. Erwartungsvoll richtete sie sich auf, um es anzusehen – und erstarrte schockiert. Das kleine Bündel neuen Lebens, das in blutgetränkten Tüchern lag und mit zittriger Stimme seinen ersten Atemzug verkündete, das war kein Mädchen!
„Wie ist das möglich?“, brachte sie halb erstickt hervor. Das Amulett, ihre Träume, alles war eindeutig gewesen!
Ihre Mutter hob den kleinen Jungen auf, hüllte ihn in ein sauberes Tuch und legte ihn in Orias Arme.
„Die Prophezeiungen lügen niemals, das weißt du“, sagte sie und küsste ihr sanft die Stirn. „Die Schatten enthüllen stets nur einen kleinen Teil der Wahrheit und es ist an uns, sie zu verstehen.“
Verwirrt und zu erschöpft, um diese Worte zu hinterfragen, drückte Oria ihren Sohn an sich. Es war ihr nicht möglich, die gewaltige Enttäuschung zu verbergen. Das Kind war gesund und kräftig, obwohl es ziemlich klein geraten war. Nun, die Wehen hatten einige Wochen zu früh eingesetzt, der Junge würde schon noch zu einem stolzen Ynwora heranwachsen, genau wie seine Brüder vor ihm. Aber ihr Volk brauchte eine neue Königin! Es war ihre dringendste und heiligste Pflicht, der Sippe eine Tochter zu schenken und seit fast zweiundzwanzig Jahren versagte sie darin, genau das zu tun. Was hatten die Schattenmächte ihr mit den Träumen zeigen wollen, was hatte sie übersehen?
In diesem Moment wurde sie von einer neuen Wehe überrascht.
„Es geht weiter, mein Liebling. Keine Angst, bald ist es geschafft.“ Esra nahm ihr das Kind ab – und Oria verstand. Zwei! Sie hatte zwei Babys in sich getragen. Warum hatte das Amulett dieses Wissen vor ihr verborgen gehalten? Sie hätte sich auf die Zwillinge vorbereiten können, es war unnötig, ihr ausschließlich Visionen von ihrer Tochter zu zeigen …
Eine knappe Stunde später hielt sie völlig erschöpft zwei gestillte und gewickelte Kinder in den Armen, während Inma, eine ihrer jüngeren Nichten es übernahm, Oria zu waschen und das Schlaflager frisch zu beziehen.
„Welchen Namen soll dein Sohn tragen?“, fragte ihre Mutter und strich sanft über das Köpfchen des schlafenden Jungen.
„Den Namen, den die Schatten mir offenbart haben“, erwiderte Oria. „Silla ist der Name meiner Tochter, der zukünftigen Königin. Ihr Bruder soll Doni genannt werden.“ Sie ließ zu, dass ihr die Kinder fortgenommen und in die bereitstehende Wiege gelegt wurden. Aus einer Walnussschale gefertigt bot diese genug Platz für die Zwillinge, sodass sie nicht getrennt werden mussten. In einigen Wochen würde es für die beiden zu eng werden, doch bis dahin konnte das Problem eines unvermuteten Zweitkindes in Ruhe gelöst werden. Oria betrachtete die wunderschönen kleinen Gesichter und fühlte sie endlich, die Mutterliebe. Der Schock über Doni hatte bislang verhindert, dass sie ihren Sohn anerkennen und in ihr Herz aufnehmen konnte. Nun spürte sie auch das Band, das ihn und seine Schwester verband.
„Sie sind vollkommen, alle beide.“ Parvu, ihr Lieblingsbruder, war leise hereingekommen. Er beugte sich über die Wiege und bewunderte die Kinder, bevor er zu ihr kam. Seit jeher war es sein Vorrecht gewesen, sie von der Geburtsliege zu heben und zu ihrem Schlaflager zu tragen. Nicht einmal Karym hatte ihm dieses Recht streitig machen wollen oder können.
Kein anderer Ynwora besaß ein solch luxuriöses Bett wie sie. Die meisten schliefen in ehemaligen Fischkonserven und gleichgültig, wie gründlich und fleißig man sie schrubbte, man träumte fast immer von Fischen. Orias Bett hingegen hatte einst in einem Puppenhaus gestanden. Es besaß weiße Seidenvorhänge, eine passende Matratze und eine verschwenderische Fülle an Kissen und Decken. Drei Ynwora hätten darin Platz, ohne sich in die Quere zu kommen. Oria war dankbar, als Parvu sie sanft ablegte. Er war ihr jüngster Bruder, es gab niemandem, der ihr näherstand. Nicht einmal ihre Söhne oder ihre Mutter. Nun, Karym war ihr vielleicht gleichwertig nah gewesen, doch er war tot …
„Ruh dich aus. In wenigen Stunden wird die Sippe nicht mehr aufzuhalten sein, jeder will die zukünftige Königin bestaunen.“
Bevor Oria etwas erwidern konnte, wurde es vor der Tür zu ihrem Schlafgemach plötzlich laut. Geschrei, erregte Stimmen, gefolgt von erschütternder Stille. Dann klopfte es kurz, und Baro trat ein.
„Verzeih, Mutter, aber wir haben einen Eindringling“, sagte er. Sein flackernder Blick und die tanzenden Finger sprachen überdeutlich, wie unsicher er noch war, wenn unkontrollierbare Dinge geschahen.
„Wir machen keine Gefangenen, das weißt du, mein Schatz“, erwiderte sie sanft. „Bringt ihn zu den Rohren und lasst ihn laufen. Seine Sippe wartet bestimmt schon auf ihn.“
„Es ist … kompliziert, Mutter“, stammelte er. Mit einem stummen Wink bat Oria ihren Bruder, dem Jungen zu helfen. Sie spürte die Anwesenheit der halben Sippe vor der Tür und wünschte, sie könnte das Amulett tragen. Die vertrauten Visionen würden ihr sagen, was sie jetzt am besten tun sollte. Doch kurz vor und nach einer Geburt war es unklug, es anzulegen. Es würde sie sonst von ihrem Körper und den Kindern ablenken und stören.
Draußen wurde es erneut unruhig. Was war da bloß los, beim ewigen Schatten? Keine Minute später kehrte Parvu zurück. Er trug eine kleine, schmale Frau, die halb bewusstlos ein Bündel umklammerte. Silberblondes Haar klebte ihr in Strähnen am Kopf. Ihre Leibesmitte war blutgetränkt. Erschrocken fuhr Oria hoch. Diese Fremde hatte gerade ein Kind geboren, genau wie sie selbst. Aber sie besaß auch schlecht verheilende ältere Stichwunden an den Armen, die ihr vermutlich von Speeren zugefügt worden waren, und ihr bleiches, ausgemergeltes Gesicht bezeugte, dass sie seit Wochen nicht genug Nahrung erhalten hatte.
Parvu bettete sie behutsam auf der Geburtsliege nieder und schob das Möbelstück herum, bis Oria sich über die Fremde beugen konnte, ohne aufstehen zu müssen.
„Wie ist dein Name?“, fragte sie und kämpfte die mitleidigen, sinnlosen Tränen zurück. Das dort war selbst noch ein Kind, ein Mädchen von höchstens fünfzehn Jahren. Viele Sippen hielten bis heute an dem barbarischen Gesetz fest, dass Frauen, die ohne einen Gefährten vor ihrem einundzwanzigsten Lebensjahr schwanger wurden, mit Gewalt fortgejagt werden mussten. Ein Brauch, der niemandem diente. Zweifellos hatte diese Kleine ihren Zustand geheim gehalten, bis es nicht mehr möglich war und ohne Hilfe ihr Baby zur Welt gebracht. Welche Ängste und Schmerzen musste sie durchlitten haben! Allein dort draußen in den endlosen Röhren und Kanälen, die die Häuser der Menschen miteinander verbanden. Niemandsland, in dem Ratten die unangefochtenen Herrscher waren.
Oria strich über die Stirn des Mädchens. Wie erwartet verglühte sie in unheilbarem Fieber. Ihre Wunden waren entzündet, ihr Körper zu stark geschwächt, der Blutverlust zu hoch. Ihr Leben konnte niemand mehr retten, sie war zu spät hergekommen. Was blieb war, ihr Wärme, Zuneigung und die Gewissheit zu schenken, dass sie in Sicherheit war. Niemand sollte allein sterben müssen.
„Dein Name?“, wiederholte sie leise.
„Alva“, wisperte es von spröden, zerrissenen Lippen.
„Alva, wie schön! Was ist mit deinem Kind? Lebt es?“ Das Mädchen nickte und lockerte den stählernen Klammergriff um das Bündel. Oria gab Parvu einen Wink, der das Kleine aus den dünnen Händen seiner Mutter entwand und an sie weiterreichte. In schmutzige, stinkende Wolltücher eingehüllt kam ein kleiner Junge zum Vorschein. Gesund und stark, was beim Zustand seiner Mutter wie ein Wunder erschien.
„Du hast einen bildschönen Sohn, Alva. Wie soll er heißen?“, fragte Oria ergriffen.
„Tary“, hauchte Alva und verlor das Bewusstsein.
„Gib mir das Amulett“, bat Oria. Es erwärmte sich, kaum dass es ihre Brust berührte. Eine Vision nahte, sie würde gewaltig werden.
Bilderfetzen, Lichtblitze, einzelne Worte. Eine ferne Zukunft, die sie selbst nicht mehr erleben würde. Das Schicksal ihrer Kinder, an dem sie keinen Anteil mehr haben durfte, wenn es sich erfüllte … Oria drückte das fremde Kind an ihr Herz und ergriff die schlaffe Hand seiner sterbenden Mutter. Ihre größte Hoffnung, dass die Schatten erlauben würden, Alva magisch zu heilen, war zerschlagen; darum tat sie, was ihr als letzte Möglichkeit blieb.
„Tary, ich begrüße dich als Sohn meiner Sippe. Sei willkommen, Ziehbruder von Silla und Doni. Ich nehme dich zu mir als mein Eigen und werde deine wahre Mutter bestatten wie eine Schwester meines Blutes.“
Ihre Worte waren laut genug, um durch das dünne Holz der Zimmertür getragen zu werden. Oria wusste, dass inzwischen die gesamte Sippe dort versammelt war und Zeuge dieser Adoption wurde. Alvas Finger krampften sich um ihre – litt sie Schmerzen? Oder hatte sie ebenfalls gehört und verstanden, was ihr versprochen wurde? Was auch immer es war, Alva erwachte nicht wieder. Einige Minuten später hatte sie es geschafft, sie hatte ihren Frieden gefunden. Oria hingegen musste sich der Frage stellen, wie sie drei hungrige Kinder zugleich stillen sollte. Nun, sie würde es herausfinden …
2
oni duckte sich in den Schatten der großen Obstschale. Er hatte Angst. Große Angst. Nicht vor den Menschen – die konnten ihn nicht sehen. Ynwora waren unsichtbar für ihre Augen, sofern sie älter als ungefähr drei Jahre waren. Die Kleinsten von ihnen sahen sie ganz normal und sprachen zu ihnen, sodass die Erwachsenen glaubten, ihre Kinder hätten eingebildete Freunde. Gefährlich wurde es, wenn ein Ynwora irgendwo eingesperrt oder festgeklemmt wurde. In einer Kiste etwa, oder unter einem Glas. Dann bemerkten sie auch die Großen und das endete in der Regel tödlich. Obwohl ein Ynwora wie ein Mensch geformt war, lediglich sehr, sehr viel kleiner, erblickten Erwachsene in ihnen widerwärtige Insekten. Ob diese nun mit dem Schuh auf sie einschlugen oder sie in hohem Bogen fortschleuderten, beides bedeutete den sicheren Tod.
Dennoch fürchtete Doni sich nicht vor der Menschenfamilie, in deren Haus er und seine Sippe lebten. Auch der Hund erschreckte ihn nicht. Castor war ein Mischling mit Schwerpunkt auf Bulldogge. Er kümmerte sich nicht um Ynwora, sofern sie ihre Hundepfeife zur Hand hatten. Nichts quälte ihn mehr als die Laute, die man diesem kostbaren, handgeschnitzten Kleinod entlocken konnte. Anyu trug es auf seinem Rücken. Zu mehr war er leider nicht zu gebrauchen. Als Jugendlicher war er unter die Füße von Marc geraten, dem Sohn der Menschenfamilie. Keiner hatte an das Wunder glauben wollen, doch Anyu hatte sich irgendwie von seinen zahllosen Brüchen und inneren Verletzungen erholt. Leider war er seitdem zum einen beim Laufen stark eingeschränkt und zum anderen ziemlich langsam beim Denken und Verstehen. Da er nicht zum Wächter taugte, begleitete er nun trotz seines Alters von fast sechsundzwanzig Jahren die jungen Leute bei den Sammeltouren. Heute waren Socken dran. Doni hasste es, Socken zu stehlen. Die Dinger waren schwer und unhandlich. Leider waren sie auch beinahe die einzigen Gegenstände, die ein Ynwora nahezu unbegrenzt mitnehmen durfte, obwohl deren Besitzer sie anschließend vermisste. Die Gesetze des Großclans der Ynwora waren in dieser Hinsicht strikt, komplex und unbeugsam.
Noch einige Monate musste Doni als Sammler überstehen. Zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag würde sich alles zum Guten wenden, wie er hoffte. Silla, seine verrückte, quirlige Zwillingsschwester mit ihrem unmäßigen Temperament würde endlich Königin und er ein Wächter des inneren Kreises werden, dazu ausersehen, die Sippe zu beschützen. Großmutter Esra gab als Königin ihr Bestes, seit Donis Mutter vor fünfzehn Jahren nach einem schwerem Unfall gestorben war; doch sie war sehr, sehr alt und krank. Seit langer Zeit schon zu schwach, um die Sippe zu führen und die Macht der Schatten genügte nicht, das zu verbergen. Sie versuchte es mit unerbittlicher Strenge und Unnahbarkeit auszugleichen und ja, bis jetzt waren sie durchgekommen. Keine der anderen Sippen hatte sie herausgefordert und die Ratten hielten sich ebenfalls zurück. Das lag aber eher an der Kampfkraft der Wächter als an der Macht der Königin. Donis ältere Brüder und seine Onkel, Cousins und Großcousins beschützten sie vor Feinden, Ratten, Kakerlaken und sonstigen Eindringlingen. Sobald Silla erst einmal Königin war, würde er zu ihnen gehören und nicht wie die übrigen jungen Männer der Sippe zum Handwerker ausgebildet werden. Er würde ein Mann sein, anerkannt, ein vollwertiger Krieger. Kein Krümelsammler und Sockendieb mehr, den jeder verachtete und auslachte! Nun gut, dass hatte erst einmal nichts mit seiner Tätigkeit zu tun. Trotzdem, mit einem Speer in der Hand würde er …
Egal.
Bis es soweit war, musste er seine Pflicht ernst nehmen und jede ihm zugewiesene Aufgabe erfüllen, gleichgültig, wie zuwider sie ihm sein mochte. Gestohlene Socken dienten der Sippe als Kleidung. Für die Menschen war es bloß ein kleines, seit Generationen akzeptiertes Ärgernis, dass in unregelmäßigen Abständen einzelne Socken spurlos verschwanden. Die Großen suchten Erklärungen in den Waschmaschinen, sprachen von sockenfressenden Monstern, glaubten, dass der Stoff sich auflöste und in den Abfluss gespült wurde. Manchmal kamen sie sogar der Wahrheit nah, indem sie sagten: „Wir haben einen Kobold im Haus.“
Kobold. Ein hässliches Schimpfwort, das kein stolzer Ynwora leichtmütig auf sich sitzen ließ. Es waren angeblich schon blutige Fehden geschlagen worden, weil ein Sippenfremder diese Bezeichnung über die Lippen gebracht hatte.
Doni linste ungeduldig über den Rand der Obstschale. Christine, die Mutter der Menschenfamilie, werkelte noch immer an der Küchenspüle herum. Dabei war es längst Schlafenszeit für anständige Langbeine. Ihr Gefährte Thomas schnarchte bereits seit geraumer Zeit im oberen Stockwerk. Dort schliefen auch Marc, der vierzehnjährige Sohn, und Tina, die fünfjährige Tochter.
„Anscheinend hat einer von denen bald Geburtstag“, raunte es an Donis Ohr. Er erschauderte leicht. Tary war der dritte in der heutigen Sammlerrunde und der Grund, warum Doni sich fürchtete. Der Kerl machte ihn ernstlich nervös. Sie waren Milchbrüder und die ersten Lebensjahre war er wie sein dritter Zwilling gewesen. Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter verkündete, Tary sei ausersehen, Sillas Gefährte zu werden. Von da an hatte Tary in einer anderen Kammer schlafen und sich von ihnen fernhalten müssen. Silla durfte ihn nicht länger als Bruder wahrnehmen, denn wer wollte schon mit seinen Geschwistern eigene Kinder zeugen? Anfangs hatte Doni geweint, weil er nicht von Tary getrennt werden wollte. Heute würde er seine Tagesration an Apfelstücken und Brotkrumen dafür hergeben, wenn er ihm niemals mehr zu begegnen bräuchte. Sie kamen seit Jahren nicht mehr gut miteinander aus, Tary ließ kaum eine Gelegenheit verstreichen, seine Geringschätzigkeit ihm gegenüber laut herauszulassen. Jeder wusste das und man hatte dafür gesorgt, dass sie nicht unnötig aufeinandertreffen mussten. Aus irgendeinem Grund allerdings war Onkel Baro, der Führer der Krieger und Sammler, heute Abend plötzlich auf neue Ideen gekommen. Er hatte sie gemeinsam für diese Sammeltour eingeteilt und weder Donis schüchternen noch Tarys empörten Protest gelten lassen. Wenn diese Nacht doch bereits vorüber wäre! Tary und er hatten schlichtweg nichts gemeinsam. Er war groß, breitschultrig, muskulös, hatte silberblondes Haar, das ihm in sanften Wellen bis auf die Schultern fiel, blaue Augen, die je nach Licht mal grünlich, mal dunkelblau schimmerten. Rasieren musste er sich wie ein ausgewachsener Krieger. Da er es nicht jeden Abend tat, wirkte er recht verwegen. Dazu trug auch der spöttische Zug bei, der sich oft in seinen Mundwinkeln zeigte. Der hatte sich entwickelt, weil die gesamte Sippe ihn Zeit seines Lebens nicht vollständig als einen der ihren anerkennen wollte. Obwohl er sich vom Tag seiner Geburt an in ihrer Mitte befand, war er nie dort angekommen. Immer blieb er der Sippenfremde. Der Sohn einer Frau, die niemand gekannt hatte. Die von ihren eigenen Leuten verstoßen worden war. Einerseits war es wichtig, dass er abseits stand, denn das Gesetz der Ynwora verlangte ausdrücklich, dass die jeweilige Königin einen Sippenfremden zum Gefährten zu nehmen hatte. Doch für Tary war es hart gewesen und es hatte aus ihm einen verschlossenen, abweisenden Mann geformt. Ja, er war bereits ein Mann, auch wenn er keinen Tag älter als Doni war. Ihn selbst würde niemand auch nur aus Versehen als Mann bezeichnen. Dafür war er nach wie vor zu schmächtig, zu weich, sämtlicher Muskeln zum Trotz, die er sich beim täglichen Laufen, Klettern und Kampftraining aneignete. Gerade einmal acht Zentimeter war er groß und wurde damit von jedem Jungen über vierzehn und nahezu allen Mädchen überragt. Tary hingegen kratzte knapp an den zehn Zentimetern. Sein kastanienbraunes Haar stand grundsätzlich wirr von seinem Kopf ab, gleichgültig, ob Großmutter Esra sie mit Kamm und Schere attackierte oder nicht. Auch seine Augen waren braun und besaßen laut Silla einen beständig verwirrten Ausdruck. Sie bezeichnete es zwar freundlich als Verträumtheit, doch sie war schließlich auch seine Zwillingsschwester und liebte ihn. Womit sie in der Sippe allein dastand. Man rückte nicht von ihm ab, wie es bei Tary der Fall war, der trotzdem Anerkennung und Respekt erfuhr. Nein, ihn beachtete man einfach nicht. Er war eben der überzählige Sohn, den niemand haben wollte, nicht einmal die Schattenmächte. Das Kind, das die Königin nicht gespürt hatte, als sie ihn unter dem Herzen trug. Der wertlose Wicht, dem das Amulett der Sicht nicht die kleinste Prophezeiung mit auf den Weg gegeben hatte. Der Junge, der die Hälfte des Namens seiner Schwester stehlen musste, damit er überhaupt einen bekam. Während Tary also zumindest eine wichtige Lebensaufgabe besaß, war er bloß ein Maul, das gestopft werden musste. Wie oft war er bei der Essensausgabe übergangen worden …
Doni riss sich zusammen und besann sich auf das, was Tary eben gesagt hatte. Eine Geburtstagsfeier wäre ein nachvollziehbarer Grund, warum Christine noch immer auf den Beinen war und in der Küche hantierte, statt ins Bett zu gehen. Oder wenigstens ins Wohnzimmer, um auf den Fernseher zu starren.
„Die Kinder haben beide im Sommer Geburtstag“, sagte er langsam. Der Frühling hatte gerade erst begonnen, die beiden konnten es also nicht sein. „Christine feiert, wenn die Kirschen grün am Baum hängen und Thomas, wenn die Blätter zu fallen beginnen. Ich sehe auch keine Sahneschüssel oder ähnliches herumstehen. Sie hat keinen Kuchen gebacken, du musst dich irren.“
Augenblicklich bereute er seine unbedachten Worte. Tary hasste es, wenn ihm jemand widersprach. Er sah, wie sich Tarys Muskeln anspannten. Da es jetzt sowieso egal war, setzte er noch eins drauf und fuhr mit zunehmend erstickter Stimme fort: „Sie singt nicht, wie sonst, wenn sie gekocht und gebacken hat und anschließend sauber macht. Ich denke, sie hat sich mit Thomas gestritten. Danach putzt sie häufig stundenlang.“ Er schloss die Augen, als er wie erwartet gepackt und gegen die Obstschale geschleudert wurde.
„Wenn ich deine Meinung hören will, du Wicht, lasse ich es dich wissen. Klar?“ Tary ließ ihn los. Er war kein Schläger und schubste andere auch nicht unbeherrscht herum. Das hier war eine Machtdemonstration, sonst nichts.
„Klar“, murmelte Doni, um seinen Frieden zu bekommen. Ein eisiger Blick streifte ihn, der tiefe Verachtung ausdrückte. Er fürchtete den Tag, an dem seine Schwester diesen Mann zum Gefährten nahm und ihn damit automatisch zum Führer der Krieger erhob. Baro ignorierte ihn wenigstens bloß, ohne seine Verachtung offen zu zeigen.
„Ihr-solltet-euch-nicht-prügeln.“ Anyu tauchte neben ihnen auf und stieß die Worte langsam und seltsam betont hervor. Tary wich einen weiteren Schritt von Doni zurück und schenkte Anyu ein halbes Lächeln. Zu Kindern und diesem armen Schwachkopf war er stets liebenswürdig.
„Keine Sorge, mit dem prügle ich mich nicht. Ich bevorzuge Gegner, die sich wehren können.“
Der Spott schmerzte schlimmer als jede Ohrfeige.
In diesem Moment warf Christine den Spüllappen ins Becken, trocknete sich die Hände ab und rief: „Komm, Castor, Feierabend für heute!“ Der Hund, der ihr zu Füßen gelegen und geschlafen hatte, sprang auf und folgte ihr trottend, als sie die Küche verließ. Seine Pfoten tappsten laut über die cremefarbenen Fliesen, während sie in ihren Filzpantoffeln kaum zu hören war. Das Licht wurde gelöscht. Endlich! Der Weg zu den Socken war frei.
Ynwora konnten im Dunkeln perfekt sehen. In Windeseile seilten sie sich vom Küchentisch ab. Diese Übung war eine Kleinigkeit für sie, das lernten bereits die Jüngsten. Auf Sammeltouren trug jeder eine Rolle Spinnengarn mit sich. Es war gewaschen, damit es nicht mehr klebte, und mit einem Dutzend Fäden zu einem starken Seil verflochten. Spinnen gehörten zu ihren Freunden und Verbündeten. Sie tauschten häufig gefangene Insekten gegen das begehrte Garn. Die Vielbeiner kannten außerdem die besten Geschichten und Witze – immerhin saßen sie tagein, tagaus still in ihren Netzen und hatten genügend Zeit, sich lustige Dinge auszudenken.
Unten am Boden angekommen mussten sie ihre Seile in einer komplizierten Bewegung schleudern, um den Spezialknoten zu lösen und es herabfallen zu lassen. Tary und Anyu schafften es wie üblich beim ersten Versuch, Doni brauchte seine drei Anläufe, wie sonst auch. Er war nicht zu ungeschickt und auch nicht zu schwach für diese Übung. Wenn er allein war, gelang es ihm immer sofort. Es machte ihn einfach nervös, sobald andere zusahen … Tary war der schlimmste Sammlergefährte, der ihm jemals zugeteilt worden war, so viel stand fest.
„Kommst du endlich?“, zischte er ungeduldig.
Doni sparte sich die Antwort und folgte den beiden anderen zum Wäschekorb, der neben der Waschmaschine auf dem Boden stand. Er war prall gefüllt mit frisch gewaschener Unterwäsche und Socken der gesamten Familie, die darauf warteten, sortiert und gefaltet zu werden. Unterwäsche war zu groß und zu schwer für sie, Socken hingegen ließen sich davonschleppen. Zwei Einzelstücke durften sie mitnehmen. Vorzugsweise die dunklen Exemplare von Thomas. Die waren lang genug, um drei bis vier Sippenmitgliedern Kleidung zu liefern, dazu war der Stoff glatt und von angenehmer Dicke und Beschaffenheit. Er ribbelte in der Regel auch nicht beim Zerschneiden auf. Christine trug zu häufig Wollstrümpfe, die sich beim Auseinandernehmen auflösten, während Marc weiße Sportsocken bevorzugte, die kratzig und schwer waren. Tinas Söckchen hingegen waren so kurz, dass sie bloß für einen von ihnen Kleidung lieferte, aber bereits zu lang, um als Schlafsack für die Kleinen zu dienen.
Stolz strich Doni über seine Hose. Die war nicht aus einer Socke geschneidert worden, sondern etwas ganz Besonderes. Ein Geschenk, das Silla ihm zu seinem neunzehnten Geburtstag überreicht hatte. Marc hatte früher gerne mit merkwürdigen Figuren gespielt – Puppen in Ynworagröße, die auf Dinosauriern, Drachen und ähnlichem Plastikgetier ritten. Inzwischen hatte der Junge das Interesse an ihnen verloren und die Puppen waren in einer großen Kiste im Keller gelandet. Eine davon hatte einen feinen Anzug getragen. Den hatte Marc der Puppe ausgezogen, aus welchen Gründen auch immer, und die Hose mitsamt der Weste achtlos unter einem Stapel Comichefte verschwinden lassen.
Das Gesetz der Ynwora verlangte, dass außer in absoluten Notfällen selbst wirklich nützliche Gegenstände, die von Menschen achtlos verworfen wurden, liegen gelassen werden mussten. Erst wenn ein voller Monat vergangen war und niemand diesen Gegenstand benutzt hatte, durfte er genommen werden. Danach stand die Sippe in der Pflicht, drei mal drei Tage zu lauschen und zu beobachten, ob der Gegenstand vielleicht doch vermisst wurde. In diesem Fall musste man ihn zurücklegen, und zwar genau an die Stelle, von wo man ihn fortgenommen hatte – sollte dies möglich sein, ohne das eigene Leben zu gefährden. Erst nach Ablauf der Frist durfte der Gegenstand frei benutzt werden. Auf diese Weise hatte auch Silla es gehandhabt und Doni mit einer Ausstattung bedacht, die praktischer nicht sein könnte. Hose und Weste waren aus dicken, dunkelbraunen, reißfesten Kunststofffasern gefertigt, die weich genug waren, um seine Bewegungen nicht zu behindern. Sie raschelten auch nicht oder rochen unangenehm, wie es bei Plastik der Fall wäre.
Jeden Abend, wenn er aufstand, stieg Doni mitsamt seinen Sachen in die Badetasse – ein ausrangierter Trinkbecher, der unter einem der Wasserrohre stand und die Tropfen auffing, die dort beständig herabfielen. Ein kurzes Bad und schon war er sauber. Seine Kleidung trocknete innerhalb von wenigen Minuten, während alle anderen Stunden vor dem Heizungsrohr verbringen mussten. Viele beneideten ihn um diese Sachen, aber da es ein Geschenk von Silla gewesen war, wagte niemand etwas zu sagen.
Anyu hatte mittlerweile seinen Posten bezogen. Er hielt die Tür im Auge, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Castor hereinkommen würde. Sollte der Hund dennoch heranrücken, musste Anyu ihn mit der Pfeife quälen, bis Tary und Doni sich in Sicherheit gebracht hatten. Eine gefährliche Aufgabe. Zum Glück war Castor zu alt, um Spaß an der Jagd auf Ynwora zu haben, und hatte zu häufig unter den hohen Tönen der Hundepfeife leiden müssen. Er wusste, dass die untere Etage nachts von ihnen heimgesucht wurde, darum hielt er sich oben bei der Familie auf und stellte sich blind und taub für jedes Geräusch, das sie versehentlich verursachten.
Tary war inzwischen den Korb hinaufgeklettert und hockte mitten im Sockenparadies. Er winkte ungeduldig, Doni sollte sich zu ihm gesellen.
„Die hier ist ideal, meinst du nicht?“ Doni bekam ein riesiges schwarzes Stoffungetüm an den Kopf geworfen, als er sich gerade über den Rand des Korbes ziehen wollte.
„AAAH!“ Mit einem Aufschrei stürzte er rücklings ab, prallte zuerst unsanft auf die kalten Steinfliesen und verhedderte sich anschließend in der Socke. Kochend vor Wut kämpfte er sich frei.
„Was soll das?“, brüllte er. Tary stand über ihm und zog eine halb geringschätzige, halb amüsierte Grimasse.
„Du bist viel zu langsam, du Baby. Ich habe bereits zwei geeignete Beutestücke ausgesucht.“ Er wies auf einen dunkelblauen Strumpf, den er sich auf den Rücken geschnallt hatte.
„So läuft das nicht! Wir ziehen nicht als Team aus, damit du deinen Spaß hast, Tary.“
Weiter kam Doni nicht. Plötzlich lag er wieder auf dem Boden. Mit einem Fuß auf seiner Brust hielt sein Gegner ihn lässig nieder. Doni könnte sein Messer zücken und es diesem grässlichen Angeber in die Wade rammen. Doch dann würde er hart bestraft werden, möglicherweise sogar mit Verbannung. Tary war zu wichtig für die Sippe. Außerdem verletzte man niemanden mit Absicht.
„Du bist ein nutzloses Nichts“, knurrte Tary verächtlich. „Zu langsam, zu schwach, zu unkonzentriert. Meinst du, ich merke nicht, dass deine Gedanken ständig abschweifen? Auch wenn du großjährig wirst, werde ich dich nicht zu den Kriegern holen. Du versagst ja bereits beim einfachen Sockensammeln!“
Mit einem letzten fiesen Druck auf Donis Kehle gab der Widerling ihn endlich frei. Hustend und würgend setzte sich Doni auf und kämpfte die Zornestränen nieder, die ihm die Sicht verschleierten.
„Vielleicht bin ich nutzlos, aber mich hasst wenigstens niemand. Du hingegen bist nur noch bei der Sippe, weil du als Zuchtbock gebraucht wirst. Keiner kann dich ausstehen!“
Schlichte Wahrheiten, die jedem klar waren und niemals nimmer nicht und unter keinen Umständen laut ausgesprochen werden durften. Doni sah, wie Tary erbleichte. Für einen kurzen Moment fiel die Maske stets beherrschter, kalter Arroganz. Ein zutiefst verletzter Junge stand dort, mit hängenden Schultern und brennendem Schmerz im Blick. Dann gewann der vertraute Spott wieder die Oberhand und der Moment verging.
„Ganz recht“, erwiderte Tary. „Ich werde Babys zeugen und die Sippe beschützen. Mit meinem Leben, wenn es sein muss. Jeder Krieger wird meinem Befehl gehorchen und die Königin ist die Einzige, vor der ich mich verantworten muss. Du hingegen wirst gar nichts tun und nichts im Leben erreichen und absolut jeder wird mehr zu sagen haben als du. Selbst Anyu hat eine wichtige Aufgabe. Dir kann man nichts anvertrauen, du verträumter Spinner. Wenn dich heute Nacht die Ratten fressen würden, würde außer Silla niemand um dich weinen.“
Weitere schlichte Wahrheiten, die leider beständig und von jedem laut ausgesprochen wurden, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Seine Schwester war die Einzige, die dagegen Einspruch erhob. Sie liebte ihn eben, weil sie zufällig zur gleichen Zeit im Bauch ihrer Mutter gewachsen waren.
Doni schluckte die Bitternis ohne Mühe, stand auf und raffte die schwarze Socke an sich. Sein Rücken schmerzte entsetzlich, selbst das Atmen fiel ihm schwer. Er hätte sich bei diesem Sturz leicht das Genick brechen können. Das schien Tary ebenfalls aufzugehen, denn er fragte mit deutlich weniger Arroganz: „Hast du dir was angeschlagen, Baby?“
„Nein!“, zischte Doni trotzig und kämpfte weiter mit dem Stoffballen, der knapp drei Mal so lang wie er selbst war und mindestens genauso schwer. Ein gut trainierter Ynwora konnte das Doppelte seines Körpergewichts tragen, bevor ihm die Puste ausging.
Doni stürzte erneut, diesmal auf die Knie, als Tary ihm die Socke mit einem Ruck entriss.
„Lass mich das machen, Kleiner, sonst stehen wir noch bei Sonnenaufgang hier herum.“
Mit geballten Fäusten stand Doni da und schaute mit hilfloser Wut zu, wie geschickt und schnell Tary den Stoff eng zusammenfaltete und zu einem Bündel verschnürte.
„Warum kletterst du nicht noch einmal in den Korb rein? Ich hab ganz oben etwas gesehen, das deine Schwester in absolute Entzückung versetzen dürfte.“
„Wir haben bereits zwei Socken erbeutet. Mehr sollten wir in einer Nacht nicht stehlen, das ist gegen die Regeln. Wegen der Auffälligkeit. Das weißt du selbst“, widersprach Doni.
„In Notzeiten haben wir auch schon fünf auf einmal genommen, erinnerst du dich nicht?“ Tary lächelte und wies nach oben. „Entscheide dich zügig. Ein nettes Geschenk für deine zukünftige Königin. Es sieht aus, als wäre es genau für sie maßgeschneidert worden … ganz in pink.“
Doni zuckte zusammen. Silla liebte diese Farbe über alles und schwebte in Glückseligkeit, seit Tina geboren wurde. Ihr Vater Thomas wurde es nicht müde, für seine Mini-Prinzessin pinkfarbene Kleidung und Spielzeug heranzuschaffen. Sogar die Wände des Kinderzimmers leuchteten in dieser Farbe.
Bevor Doni darüber nachdenken konnte, ob das wirklich eine gute Idee war, kletterte er bereits den Wäschekorb hinauf. Dank der vielen Löcher im Plastik war das selbst mit geprelltem Rücken einfach genug zu bewerkstelligen. Oben angelangt entdeckte er sofort, was Tary gemeint hatte: Eine pinkfarbene Mädchensocke, auf die das Bild einer Prinzessin gedruckt war. Eine Prinzessin mit langen blonden Haaren und hellblauen Augen. Bei allen Schatten! Das war Silla! Deren Gesicht war nicht so rundlich und derart lieblich lächelte sie auch eher selten, aber sonst … Bedächtig strich Doni über den weichen Frotteestoff. Tary hatte Recht, seine Schwester würde von einem Geschenk wie diesem absolut begeistert sein. Und nicht nur sie: Jeder, der sie anschließend in einem solchen Kleid erblickte, würde sich freuen.
Bevor er es sich anders überlegen konnte, raffte er die Socke an sich, verschnürte sie mit einem Stück Nähgarn zu einem stabilen Päckchen und kletterte rasch zurück zu seinen Gefährten. Anyu trug inzwischen das schwarze Bündel auf dem Rücken, während Tary neben der blauen Socke die Pfeife übernommen hatte. Ihm machte das zusätzliche Gewicht weniger aus.
„Bereit?“, fragte Tary knapp. Doni nickte. Wenn er bloß wüsste, warum dieser Kerl ihm den Tipp überhaupt gegeben hatte … Wollte er, dass Doni Ärger mit Großmutter Esra bekam? Der war ihm gewiss, gleichgültig, wie schön die Beute aussehen mochte. Oder war es als Wiedergutmachung gedacht, eine Art Friedensangebot?
Nein, das war nicht Tarys Stil. Er entschuldigte sich, wenn er einsah, einen Fehler gemacht zu haben. Geradeheraus und offen. Wahrscheinlich hatte ihm die Socke selbst gefallen und er wollte, dass Silla sie als Geschenk erhielt. Er durfte ihr nichts ohne echten Anlass schenken, die komplizierten Anstandsregeln der Sippe verhinderten es.
„Anyu, das ist der falsche Weg“, rief Tary, als dieser plötzlich in Richtung Hundenapf abdrehte. Das Trockenfutter, mit dem Castor täglich bedacht wurde, roch seltsam, schmeckte allerdings nicht schlecht und konnte problemlos in kleinen Mengen entwendet werden. Anyu konnte dieser Versuchung kaum je widerstehen.
„Nur-ein-Häppchen“, nuschelte er.
„Nichts da!“ Tary packte ihn am Arm und zog ihn energisch mit sich. Wenn man auf den armen Kerl nicht beständig aufpasste, fraß er sich kugelrund und schlief anschließend in einer Ecke ein, wo er Castor hilflos ausgeliefert wäre. Es geschah oft, dass die Rückwege einer erfolgreichen Mission mit Anyu im Schlepptau extrem anstrengend verliefen. Auf dem Hinweg war er stets konzentriert und eifrig darauf bedacht, seine Aufgabe mit peinlichster Disziplin zu erfüllen. Sobald das Kommando zum Rückmarsch gegeben wurde, setzte häufig etwas in seinem Kopf aus und man musste ihn mit Gewalt nach Hause zerren. Doni achtete darauf, dass Anyu zwischen ihm und Tary blieb, damit er nicht noch einmal unbemerkt abdrehen konnte. Rund zwanzig Minuten dauerte es, bis sie den Haupteingang ins Schattenreich der Ynwora erreicht hatten: Ein unauffälliges Loch in der Wand hinter dem Wohnzimmerschrank. Perfekt getarnt vor den Menschen und unerreichbar für Castor. Es gab noch zahlreiche weitere Zugänge, dieses Haus wurde seit etlichen Generationen von ihrer Sippe bewohnt.
Während sie die Wächter passierten und durch die vertrauten Tunnel schritten, konnte Doni nur an eines denken: Die Freude in Sillas Gesicht, sobald er ihr das Geschenk überreichte.
3
ary? Die Königinmutter ruft nach dir. Dringend. Der da soll auch mit.“ Woreg, einer von Donis Brüdern, wies mit dem Daumen auf ebendiesen, der gerade seinen Sammelkorb absetzte und sich den Schweiß von der Stirn wischte. Sie waren auch heute Nacht auf Sammeltour geschickt worden, obwohl man normalerweise mindestens eine Woche Pause dazwischen hatte – mit Anyu als Ausnahme, der immer ran musste. Diesmal waren sie zu viert losgezogen, weil sie einen Apfel aus der Obstschale in der Küche entwenden sollten. Äpfel wogen im Schnitt das Fünffache einer einzelnen Socke. Zudem mussten sie ein Küchenmesser benutzen, um den Apfel zu zerteilen, und dafür brauchte es mindestens drei Männer, während Anyu brav Ausschau nach Castor gehalten hatte. Natürlich wäre die Mission beinahe fehlgeschlagen, weil Doni so viel kleiner und schlapper als die anderen war und er von seiner Rückenprellung eingeschränkt wurde. Nach der geglückten Zerlegung des Obststücks musste das Messer noch gewaschen, getrocknet und zurück in die Schublade gelegt werden, in der Christine ihr gesamtes Küchenwerkzeug aufbewahrte. Das war Schwerstarbeit gewesen und der Rückweg ein einziger Albtraum. Nicht bloß Anyu war ihnen zwischendurch abhanden gekommen, als dieser Chipskrümel unter dem Wohnzimmertisch entdeckte, sondern Doni war beinahe unter der Last seines Tragekorbs zusammengebrochen.