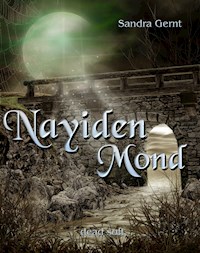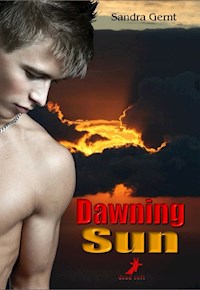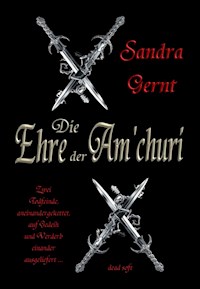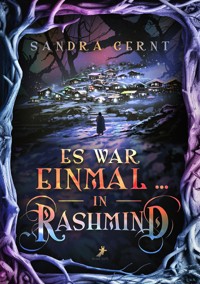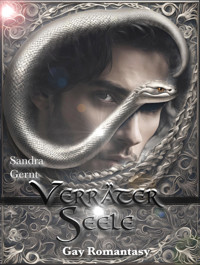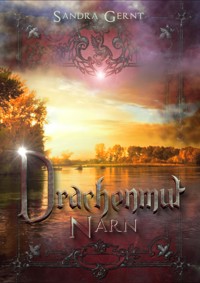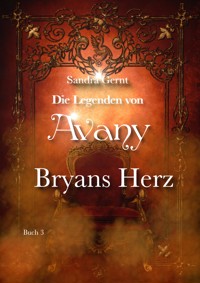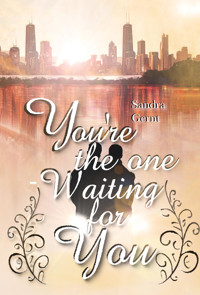
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gay Romance James Arlington, genannt Jimmy, hat alles im Leben richtig gemacht. Er ist extrem erfolgreich in seinem Job als Businesscoach, hat ein schönes Haus, ist gesund und zufrieden. Dass er keinen Partner hat, ist für ihn kein Problem. Eines Abends wird er von einem Teenager überfallen, was eine Reihe von Verwicklungen in Gang setzt, bei denen er plötzlich für eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich ist. Doch nicht nur die Kids stellen sein Leben komplett auf den Kopf, sondern auch Joey Miles. Der überaus sympathische Sozialarbeiter fordert Jimmys Überzeugung heraus, dass es für ihn einfach nicht „den einen“ geben kann. Aber kann das schon ausreichen, damit zwei einsame Herzen zueinander finden? Chad ist mit seinen drei Freunden einer Sekte entkommen. Während die Jugendlichen versuchen, Fuß in einer Gesellschaft zu fassen, die so vollkommen anders ist, werden Gedanken und Sehnsüchte immer stärker, die er zuvor nie kannte. Ist Aiden bloß ein Freund? Oder ist da etwas, für das er nicht einmal einen Namen weiß? Ca. 75.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 366 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gay Romance
James Arlington, genannt Jimmy, hat alles im Leben richtig gemacht. Er ist extrem erfolgreich in seinem Job als Businesscoach, hat ein schönes Haus, ist gesund und zufrieden. Dass er keinen Partner hat, ist für ihn kein Problem. Eines Abends wird er von einem Teenager überfallen, was eine Reihe von Verwicklungen in Gang setzt, bei denen er plötzlich für eine Gruppe Jugendlicher verantwortlich ist. Doch nicht nur die Kids stellen sein Leben komplett auf den Kopf, sondern auch Joey Miles. Der überaus sympathische Sozialarbeiter fordert Jimmys Überzeugung heraus, dass es für ihn einfach nicht „den einen“ geben kann. Aber kann das schon ausreichen, damit zwei einsame Herzen zueinander finden?
Chad ist mit seinen drei Freunden einer Sekte entkommen. Während die Jugendlichen versuchen, Fuß in einer Gesellschaft zu fassen, die so vollkommen anders ist, werden Gedanken und Sehnsüchte immer stärker, die er zuvor nie kannte. Ist Aiden bloß ein Freund? Oder ist da etwas, für das er nicht einmal einen Namen weiß?
Ca. 75.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte knapp 366 Seiten
von
Sandra Gernt
Inhalt
Kapitel 1: Überfall
Kapitel 2: Ratlosigkeit
Kapitel 3: Dummheiten
Kapitel 4: Bedürfnisse
Kapitel 5: Babyschritte
Kapitel 6: Glaubensfragen
Kapitel 7: Familienrat
Kapitel 8: Seifenblasen
Kapitel 9: Seltsame Gedanken
Kapitel 10: Weltenkollisionen
Kapitel 11: Annäherung
Kapitel 12: Ängste
Kapitel 13: Notwendige Hilfe
Epilog: Fünf Jahre später …
Nachwort
Überfall
immy fluchte leise vor sich hin. Er hatte seine verdammten Unterlagen vergessen! Das durfte einfach nicht passieren, er war sowieso schon so spät dran.
Als Coach und freiberuflicher Berater für Finanzmanagement war er manchmal zu merkwürdigen Uhrzeiten unterwegs. Seine Klienten zahlten irrsinnige Summen, damit er ihnen Ratschläge gab, die jeder Mensch mit halbwegs gesundem Verstand selbst hätte erschließen können. Dinge wie: „Zahlen Sie topqualifizierten Fachkräften ein anständiges Gehalt, damit sie in der Firma bleiben, statt ihr Glück bei der Konkurrenz zu versuchen und dabei auch noch Insiderwissen aus Ihrer Firma mitzunehmen.“ Erstaunlicherweise war gesunder Verstand keine weit verbreitete Qualität. Was für Jimmy bedeutete, dass er in absehbarer Zukunft nicht arbeitslos werden würde.
Für gewöhnlich konnte er sich seine Zeit gut einteilen. Seminare und Vorträge jeden Freitag und Samstag, Firmenbesichtigungen von montags bis mittwochs, Papierkram, Dossiers erstellen, Coachingtermine und alles weitere, wann immer es in den Kalender passte. Er nahm sich die Sonntage häufiger frei, um Sport zu treiben, Spaß zu haben, Freunde zu treffen. Durchzuatmen. Nicht ausschließlich zu arbeiten, bis er mit Anfang sechzig tot umfallen würde wie sein Vater. Der hatte auf dem Bau geschuftet, an seinen freien Tagen schwarz gearbeitet, wie ein Irrer Alkohol gesoffen, geraucht, sich praktisch ausschließlich von Fleisch ernährt. Das zusammengenommen hatte ihn in ein frühes Grab gebracht. Nein, das war definitiv nicht Jimmys Vorstellung von einem Leben.
Mit zweiundvierzig gehörte der Begriff „Work-Live-Balance“ nicht zur Grundausstattung seiner Generation. Jimmys Meinung nach hatte die Jugend da allerdings einiges richtig verstanden. Er wollte das Leben genießen. Arbeit war wichtig, keine Frage, und der Erfolg, den er in seinem Job hatte, garantierte ihm ein sorgenfreies, sehr angenehmes Leben. Sprich, er konnte seine fast siebzigjährige, verwitwete Mutter finanziell unterstützen, er konnte in einem wunderschönen alten Haus in Lincoln Park wohnen, einem pittoresken Stadtviertel in Chicago, wo er eine abwechslungsreiche Umgebung mit allem, was man zum täglichen Leben brauchte, mit erstaunlich viel Natur in unmittelbarer Nähe verbinden konnte. Er konnte sich leisten, was immer er haben wollte, sein Bankkonto war extrem gut gepolstert.
An den meisten Tagen genoss er sein Dasein als schwuler Single aus der oberen Mittelschicht. Und dann waren da Tage wie diese, wo einfach alles irgendwie schiefging. In fünf Minuten sollte er am Rednerpult stehen und einen eloquenten Vortrag darüber halten, wie mittelständige Betriebe und Firmen sich in harten Zeiten wie diesen aufstellen mussten, um national und international konkurrenzfähig zu bleiben. Untermalt mit routinierten Witzen, mit denen er sowohl graugesichtige Boomer als auch geschniegelte Jungs frisch vom College mit ihren Start-up-Unternehmen abholen konnte. Moderne, leicht verständliche Präsentationen, die Macht der Lebenserfahrung, die Jimmy mitbringen konnte – er hatte mit einundzwanzig sein erstes IT-Unternehmen gegründet, auf einen Börsenwert von über eine Millionen Dollar gebracht und für den zehnfachen Preis verkauft, noch bevor die große Weltfinanzkrise 2008 zuschlagen konnte. Jimmy war ein beliebter Redner, ein erfahrener Geschäftsmann, und man glaubte ihm, was er zu sagen hatte.
Leider brauchte er seine Unterlagen, um diese Rede führen zu können und aus irgendeinem Grund hatte er sie im Auto liegen lassen. Ärgerlich! Er würde abgehetzt vor die Zuhörer treten, statt entspannt und souverän lächelnd zu erscheinen. Das gab einen sofortigen Abzug in der Kompetenzwahrnehmung und Jimmy hasste das ganz einfach. Alternativ würde er etwas zu spät kommen. Auch das beschädigte seine Kompetenz. Ein Ärgernis!
Er lief die Treppe hinab, weil das schneller ging, als auf den Aufzug zu warten. Acht Stockwerke nach unten, bis er endlich die Tiefgarage erreichte. Mit gesenktem Kopf eilte er die Reihen von geparkten Autos entlang, ärgerte sich wie so oft über das flackernde Dämmerlicht und den Gestank nach Benzin, Diesel, Feuchtigkeit und Urin. Selbst in einem Luxushotel wie diesem war die Tiefgarage kein schöner Ort, an dem man längere Zeit verweilen wollte.
„Hey, Mister.“ Eine Stimme ließ Jimmy innehalten. Er fuhr herum – und erstarrte. Vor ihm stand ein junger Mann. Nein, ein dünner, ausgemergelter Teenager, garantiert nicht älter als fünfzehn, sechzehn Jahre. Er trug eine schmutzige schwarze Shorts, ein rotes T-Shirt, billige Turnschuhe. Er war dunkelhäutig, zitterte – sei es vor Angst, Kälte, Hunger oder Drogenentzug. Und er hielt ein Messer in der bebenden Hand. Der Blick, mit dem er Jimmy anstarrte, war von Todespanik gezeichnet. „Hey“, flüsterte er rau. „Gib mir dein Geld!“
Jimmy wich einen Schritt vor ihm zurück. Er war wachsam angespannt, doch er wusste – wusste es ganz einfach – dass dieser Junge keine Gefahr für ihn darstellte. Es war ein Kind, das offenkundig auf der Straße leben musste, wo es nicht hingehörte. Wenn er jetzt falsch reagierte, würde der Kleine unberechenbar werden und ihn angreifen, da machte er sich keine Illusionen. Der Junge war in die Enge getrieben und er rechnete vermutlich damit, eher früher als später von Cops erschossen zu werden.
„Okay, Buddy“, sagte Jimmy leise, mit erhobenen Händen. „Ganz ruhig. Ich möchte, dass du nachdenkst, okay? Ich werde dir Geld geben. Du musst einfach nur ruhig bleiben, dann gehen wir beide in einer Minute getrennte Wege. Du hast dann das Geld für deine Drogen und ich gehe heil nach Hause. Alles ist gut.“
„Ich nehme nichts!“, stieß der Junge mit weit aufgerissenen Augen hervor. „Ich nehme keine Drogen!“
„Das ist gut“, erwiderte Jimmy überrascht. „Bleib dabei. Okay? Ich weiß nichts über dich. Ich weiß nicht, was in deinem Leben abgeht. Ich bin einfach nur irgendein Typ in einem überteuerten Anzug, der hier an diesem Ort ist, um einen Vortrag über Businessstrategien zu halten. Ich hole jetzt meine Brieftasche raus.“ Er hatte immer hundert Dollar in kleinen Scheinen dabei, obwohl er quasi alles mit der Karte bezahlte. Für Trinkgelder waren ihm die Scheine angenehmer, und manchmal gab es kleine Supermärkte, bei denen der Kartenleser nicht vernünftig funktionierte.
Blind griff er in seine Geldbörse, suchte die Scheine raus, hielt sie dem Jungen hin. Er wünschte spontan, es wäre mehr. Ihm machte das Geld nichts aus. Der Kleine da hingegen, man sah ihm an, wie dringend er eine vernünftige Mahlzeit brauchte.
„Es gibt in der Nähe eine Suppenküche“, sagte er, während der Junge ihm das Geld aus den Fingern rupfte und dann ängstlich vor ihm zurückwich. „Es gibt Menschen da draußen, die dir helfen können. Du brauchst Hilfe, nicht wahr?“
Der Junge sah ihn bloß gestresst an, hektisch atmend, das Geld an die Brust gedrückt.
„Niemand hilft uns“, wisperte er. „Sie wollen uns auseinanderreißen, aber das lassen wir nicht zu! Danke, Sir. Ich …“ Er hatte Tränen in den Augen und stammelte diese Worte, die überhaupt keinen Sinn ergaben. Ohne weiterzureden warf er sich herum und rannte davon.
Jimmy starrte ihm nach, dachte über diese seltsame Begegnung nach, bis sein Handy klingelte.
„James, wo steckst du?“, erklang die Stimme seiner Assistentin. Oh. Ja, er hatte einen Job zu erledigen und nun war er definitiv zu spät.
„Haley … Ich bin in der Tiefgarage. Man hat mich gerade überfallen und ausgeraubt“, sagte er und wunderte sich, wie gepresst er dabei klang. Nun gut, die Situation war auch für ihn stressig gewesen.
„O mein Gott, bist du verletzt? Ich rufe sofort die Polizei!“
„Nein, nein, mir geht es gut.“ Jimmy dachte nach und kam zu dem Schluss, dass der Junge mehr als genug Vorsprung haben dürfte. Das war gut so. Er wollte nicht, dass dem Kleinen etwas geschah. Würde er verhaftet werden, käme er garantiert wegen bewaffnetem Überfall in ein Erwachsenengefängnis, und wenn man ihn Jahre später rausließ, wäre er endgültig zerbrochen, zerstört und für die Gesellschaft verloren.
Zwanzig Minuten später saß er in einem Nebenraum, zusammen mit zwei Cops, hatte eine Decke um die Schultern, als wäre er wer weiß wie traumatisiert, und sein Vortrag war mit dem vollen Verständnis aller geladenen Gäste vertagt worden. Gemeinsam mit Drew und Carol, den beiden uniformierten Cops, sah er sich das schlechte Überwachungsvideo an, das eine der Kameras in der Tiefgarage von dem Überfalls aufgenommen hatte.
„Sie haben sehr gut reagiert, Sir“, sagte Drew anerkennend. Er war etwa in Jimmys Alter, wirkte desillusioniert, aber freundlich. Carol, seine Partnerin hingegen, war noch blutjung und machte sich eifrig Notizen. „Deeskalierend, kooperativ. Der Junge war offenkundig high.“
Die Kamera hatte nur die Bilder aufgenommen, nicht das, was gesprochen worden war.
„Der Junge hat gesagt, er würde keine Drogen nehmen“, entgegnete Jimmy. „Er wirkte eher wie ein Ausreißer auf mich. Halb verhungert, verzweifelt und womöglich mit Geschwistern unterwegs. Er sprach davon, dass man sie auseinanderreißen wolle.“
„Das System ist bedauerlich fehlerhaft.“ Drew seufzte leise. „Geschwister werden oft getrennt, was extrem traumatisch ist. Leider verstehen die Kids nicht, dass eine Trennung besser ist, als auf offener Straße erschossen zu werden. Wenn der Junge jüngere Geschwister bei sich hat, wird er sie nicht beschützen können. Da draußen sind echte Raubtiere unterwegs, die es auf die Kleinen abgesehen haben. Insbesondere auf Mädchen.“
„Ich wünschte, ich hätte ihn besser erreichen können“, murmelte Jimmy betroffen. „Er braucht Hilfe.“
„Das ist nicht Ihre Schuld, Sir. Ein verzweifelter Teenager hätte Sie mit diesem Messer eben auch umbringen können. Sie haben alles richtig gemacht. Die Aufnahmen sind ziemlich nutzlos … Haben Sie irgendetwas an ihm bemerkt? Würden Sie ihn auf Fotos wiedererkennen?“
„Ich weiß es nicht. Ich kann gerne morgen aufs Revier kommen und mir die Vermisstenfälle anschauen, garantieren würde ich bloß für nichts.“
„So machen wir das. Diese Kids müssen runter von der Straße. Ich hab wirklich keine Lust, ein solches Baby erschießen zu müssen, bloß weil es mit dem Messer auf mich losgeht.“ Drew stellte noch einige Routinefragen, bevor er ihn gehenließ. Er würde keine Anzeige gegen unbekannt stellen. Die hundert Dollar waren ihm wirklich scheißegal. Wenn es hingegen irgendetwas gab, was er tun könnte, um den Jungen und vielleicht noch ein, zwei kleinere Geschwister von der Straße zu holen, dann wollte er sein Bestes geben.
„Die Chancen sind tatsächlich recht groß, dass es sich um Ausreißer handelt“, sagte Carol. „Hier in dieser Gegend haben wir es seltener mit Gangaktivitäten oder drogensüchtigen Obdachlosen zu tun, die in Luxushotels eindringen. Die wissen in der Regel, dass dort alles mit Kameras überwacht wird.“
„Das ändert nichts an den Fakten. Wir müssen die Kids finden und von der Straße holen, sonst haben wir hier schneller einen neuen Drogenstrich etabliert, als einer von uns piepsen kann.“ Drew verzichtete darauf, noch ausführlichere Beschreibungen zu liefern, wofür Jimmy ihm dankbar war. Er wollte gar nicht hören, dass minderjährige Teenager ihre Körper verkaufen mussten. Schlimm genug, wenn sie in solche Not gerieten, dass sie keine andere Möglichkeit sahen, als sich selbst zur Ware zu degradieren. Noch viel schlimmer hingegen, dass es Käufer gab, die an dieser Ware interessiert waren. Wie konnte irgendjemand ein solches Kind anschauen und denken, wie geil es wäre, wenn … ? Er schüttelte sich bei der bloßen Vorstellung.
„Falls Ihnen unwohl ist, Sir, gehen Sie besser ins Krankenhaus“, sagte Carol besorgt, die seine Reaktion fehlinterpretierte. „Ein solcher Schreck kann abrupte Folgen haben, das sollte man nicht unterschätzen. Auch wenn Sie ja zum Glück nicht verletzt wurden.“
Er lächelte, dankte ihr, versicherte, dass er gut auf sich aufpassen würde. Dann endlich ließen sie ihn allein.
Jimmy setzte sich wieder an den Tisch, ein wenig ratlos, was er jetzt tun sollte. Als es klopfte und Haley den Kopf reinsteckte, lächelte er sogleich wieder tapfer. Sie war Marokkanerin, knapp dreißig, Collegeabsolventin, ehrgeizig. Für sie war er bloß ein Sprungbrett. Sie studierte seine Methoden und in ungefähr einem halben Jahr würde sie garantiert weiterziehen, um Karriere zu machen. Er sah es als Ehre an, ihr auf ihrem Weg behilflich zu sein, doch er bedauerte jetzt schon den Tag, an dem sie ihn verlassen würde – nie hatte er eine fähigere Assistenz gehabt.
„Hey“, sagte sie und trat ein. Sie hielt eine Tasse Tee in der Hand, die sie ihm anreichte. „Ich dachte mir, du könntest etwas für die Nerven gebrauchen. Besser als Kaffee und viel besser als Alkohol. Du musst ja gleich noch Auto fahren.“
„Dank dir. Mit dem Alkohol sollte ich bis zu Hause warten, definitiv.“
„Soll ich deine Termine morgen absagen?“, fragte sie und zog ihr Tablet aus der praktischen schwarzen Handtasche, mit der sie jederzeit eine Mondlandung planen könnte.
„Nein, das ist nicht nötig. Ich fahre jetzt sofort, drücke mir eine Baldrian rein, geh heiß duschen und dann ab ins Bett. Mir ist nichts passiert. Das war ein halb verhungertes, völlig verängstigtes Kind. Ich war viel mehr in Sorge, dass der Junge sich selbst verletzt, als dass er mir irgendwas antun könnte.“
Sie musterte ihn skeptisch, widersprach jedoch nicht.
„Ich stelle mir den Wecker eine Viertelstunde früher als sonst“, sagte sie stattdessen. „Wenn du morgen aufwachst und merkst, dass es nicht klappt, funk mich jederzeit an, ich kläre das mit den Klienten. Jeder wird Verständnis haben, wenn du nicht arbeitest, weil du aufgrund von Schlafmangel nicht die gewohnte Topleistung bringen kannst.“
Das war ihre Art, subtile Kritik zu üben, und natürlich hatte sie vollkommen recht. Jimmy schätzte es, dass sie ihm eine Brücke baute, statt ihn einfach nach dem Verstand zu fragen.
„Ich werde sehen, wie ich morgen früh dran bin“, erwiderte er. „Danke, Haley, du bist die Beste.“
„Ich weiß, Sir, dafür werde ich bezahlt“, antwortete sie vollkommen ernst. „Ich suche einen der Bediensteten, damit er dich zum Auto begleitet. Ich weiß, es ist nicht notwendig. Besser ist es trotzdem und ich bin mir sehr sicher, dass das auch im Interesse des Hotels ist. Hier sind alle untröstlich, wie so etwas geschehen konnte. Es ist schlecht für das Geschäft, wenn die Gäste nicht sicher sind und ich gehe davon aus, dass man umgehend einen Wächter engagieren wird, der zukünftig kontrolliert, wer die Tiefgarage betritt.“
Davon ging Jimmy ebenfalls aus. Er trank seinen Tee und wartete brav, bis Haley mit einem Mann wiederkehrte. Der Anzugträger gehörte zur Führungsriege des Hotels, und er entschuldigte sich wortreich bei Jimmy für dieses schreckliche Ereignis, als hätte er selbst versehentlich den jugendlichen Dieb engagiert, um den Überfall zu veranlassen. Er begleitete Jimmy persönlich zu dessen Auto und versprach ihm das Blaue vom Himmel herab, um für jeden Schaden aufzukommen, der aus dieser Sache entstehen mochte. Jimmy wiederum versprach ihm, dass er dieses Angebot nicht ausnutzen würde, obwohl er ohne Schwierigkeiten das Hotel wegen mangelnder Sicherheitsmaßnahmen verklagen könnte.
„Sie bekommen lebenslanges Nutzungsrecht in unserem Penthouse, Sir, wenn Sie von dieser Klage absehen wollen“, stammelte der arme Kerl. Was de facto bedeutete, dass Jimmy sein Haus vermieten und in die Luxussuite einziehen könnte, mit Vollversorgung und Spa-Nutzung. Selbst das würde für das Hotel billiger kommen als ein Rechtsstreit, den sie definitiv verlieren würden.
Er lächelte mysteriös, verabschiedete sich von dem aufgelösten Mann, nahm sich vor, demnächst mit seiner Familie hier frühstücken zu gehen und dabei anzutesten, ob man ihn tatsächlich als VIP-Gast behandeln würde, und fuhr dann nach Hause. War es nicht einfach nur lächerlich? Es gab kein Privileg, das er nicht in Anspruch nehmen konnte, weil er ein alter weißer männlicher Sack mit Bildung, teurem Anzug und gutem Job war. Der Junge von vorhin hingegen, er hatte schlichtweg keine Chance. Weil er beim Geburtslotto verloren hatte.
Jimmy wusste es. Er kannte das System und nutzte es bereits sein gesamtes Leben lang aus. So sehr wie heute hatte es ihn schlichtweg noch nie gestört …
Chad sah sich dreimal gründlich um. Erst als er sicher war, dass ihn niemand beobachtete – in erster Linie, weil es stockdunkel war und man Katzenaugen bräuchte, um ihn zu sehen –, betrat er den Raum. Sie befanden sich im Abwassersystem. Durch puren Zufall hatten sie diesen ehemaligen Wartungsraum im Tunnel entdeckt und was waren sie glücklich, dass niemand sonst ihn für sich beanspruchte!
„Ich bin’s“, sagte er sofort, damit seine Freunde sich nicht ängstigen mussten. Aiden, Liam und Mason. Sie steckten alle gemeinsam in diesem Desaster, in diesem Albtraum. Wie sie jemals wieder daraus erwachen sollten, wusste keiner von ihnen. Sie bemühten sich, nicht zu viel darüber nachzudenken.
„Hattest du Erfolg?“, fragte Aiden. Er war der Älteste von ihnen, schon fast siebzehn. Da er sich auf der Flucht verletzt hatte, konnte er im Moment die Führungsrolle nicht übernehmen. Ein Hund hatte ihn gebissen, und die Wunde sah echt schrecklich aus. In diesem kalten, stinkenden Raum wurde das auch nicht unbedingt besser.
„Ich hab einen Geschäftstyp beraubt“, erwiderte Chad leise und versuchte so zu klingen, als wäre das leicht gewesen. Als wäre es etwas, worauf er stolz sein konnte. Als würde er nicht für den Rest seines Lebens Albträume haben, weil er einen Mann mit einem Messer in der Hand ausgeraubt hatte. „Immerhin hundert Dollar. Ich hab Essen gekauft, und diese Antibiotikasalbe konnte ich klauen.“ Außerdem hatte er mehrere Flaschen Wasser dabei. Eine schüttete er zur Hälfte über Aidens eitrige Bisswunde in der Wade. Sein Freund zischte und winselte unterdrückt vor Schmerz, doch er beklagte sich nicht. Er war Schlimmeres gewohnt. Sie alle waren Schlimmeres gewohnt. Danach verteilte Chad die Salbe sparsam auf der großflächigen Verletzung und wickelte einen Stoffstreifen eines T-Shirts darum, das er ebenfalls geklaut hatte. Die hundert Dollar würden nicht lange reichen, sie mussten vorsichtig damit umgehen.
Er hatte Dosen mit Linsen- und Bohneneintopf gekauft. Es war billig, das Zeug machte lange satt und man konnte es geschmacklich ertragen, auch wenn es kalt war. Niemand beschwerte sich. Sie aßen schweigend, wechselten sich dabei mit dem einzigen Löffel ab, den sie besaßen. Auch den hatten sie gestohlen.
Aiden schaffte kaum ein paar Happen. Er fieberte, ihm ging es wirklich schlecht. Chad betete, dass die Salbe jetzt ihr Wunder vollbringen und seinen Freund vor einer Blutvergiftung retten würde. Er half ihm danach, in den Tunnel hinauszuhumpeln und die Blase zu erleichtern, bevor es zurück in ihren Schutzraum ging und die Tür diesmal mit einer abgebrochenen Metallstange von innen verrammelte. Wieder an seinem Platz angekommen sackte Aiden wimmernd und nach Luft japsend zurück zu Boden, rollte sich zusammen und schlief fast sofort ein.
„Die Salbe wird helfen, oder?“, fragte Liam. Er war vierzehn, genau wie Mason. Im Flackerlicht der Kunststoffröhre, die wundersamerweise noch funktionierte, wirkte er wie ein Wickelkind. Ein Baby, das voller Hoffnung zu Chad hochblickte. Der nickte eifrig, zauberte von irgendwoher eine Art Lächeln.
„Es wird alles gut werden“, sagte er voller Überzeugung, die er nicht spürte. Liam glaubte ihm. Er wollte es glauben. Wie verwaiste Hundewelpen schmiegten er und Mason sich aneinander, während Chad sich zu Aiden setzte. Als die anderen schliefen, zog er die Karte hervor.
Der Mann vorhin, dieser Geschäftsmann, hatte blind in seine Brieftasche gegriffen und ihm zusammen mit den Geldscheinen auch eine Visitenkarte angereicht.
James Arlington. Businesscoach, Gutachter, Berater. Ein Mann, der sich mit Finanzen auskannte. Normalerweise hätte Chad die Karte längst fortgeschmissen. Er brauchte definitiv keinen Businesscoach! Was das eigentlich sein sollte, war ihm sowieso nicht klar. Aber da war etwas im Blick und Tonfall des Mannes gewesen. Echte Sorge. Eine Art von … Väterlichkeit? Chad hatte mit einem Messer herumgefuchtelt und diesem Mann Geld gestohlen, und dennoch hatte der von Suppenküchen und Hilfsangeboten gesprochen.
Irgendetwas an dieser Begegnung hatte Chad berührt. Stark genug, dass er die Karte, die auf dickem Karton bedruckt edel in Schwarz und Gold prangte, fast eine Stunde lang anstarrte und zwischen den Fingern umherdrehte. Schließlich steckte er sie zurück in die Hosentasche. Er musste schlafen. Morgen früh erwartete sie ein neuer Tag voller Ängste, Sorgen und Hoffnungslosigkeit.
Ratlosigkeit
en Morgen hatte Jimmy ganz normal mit Arbeit verbracht, nachdem er erstaunlich gut in der Nacht geschlafen hatte. Erst gegen Mittag fühlte er sich extrem ausgelaugt und müde, die Kopfschmerzen wurden allmählich so stark, dass er die restlichen Termine für den Tag absagt und zum Polizeirevier fuhr, nachdem er sich dort vorher angekündigt hatte. Er wurde freundlich empfangen, ein weiblicher Detective setzte ihn vor einen Bildschirm und ließ ihn Fotos von vermissten Kindern ansehen.
Man musste keine Spezialausbildung haben, um sehr schnell zu erkennen, welche Muster es hier gab. Von der erschreckend hohen Anzahl an vermissten Kindern allgemein war ein unglaublich hoher Prozentsatz weiblich und schwarz. Auch viele schwarze Jungen waren darunter, aber die Anzahl von schwarzen Mädchen, die verloren gingen, stand in keinerlei Relationen zu dem, was sie statistisch an der Anzahl der Bevölkerung ausmachten. Sehr viel weniger weiße Kinder wurden vermisst, und es schienen quasi gar keine spanischen Kinder dabei zu sein. Als er die Ermittlerin danach fragte, zuckte sie bloß mit den Schultern.
„Wir vermuten, dass insbesondere mexikanische und puerto ricanische Familien eher davon absehen, ihre Verwandten vermisst zu melden“, sagte sie. „Sei es, dass sie illegal hier sind, sei es, dass sie einfach Angst vor der Polizei haben. Es ist auf jeden Fall auffallend, dem stimme ich zu.“ Es war vor allen herzzerreißend. Jedes dieser jungen Gesichter war ein Schicksal. Eine Geschichte. Man konnte sich ausmalen, dass insbesondere die dunkelhäutigen Mädchen Opfer von Verbrechen geworden sein dürften.
Unter den dunkelhäutigen Jungen konnte Jimmy keinen wiederfinden, der mit seiner Erinnerung an den jugendlichen Räuber von gestern Nacht übereinstimmte. Das musste nichts zu sagen haben, er war gestresst gewesen, das Licht extrem schlecht, und die ausgemergelte, bleiche, unterernährte Gestalt musste nichts mit einem dieser Fotos zu tun haben. Dort sahen die Kinder größtenteils glücklich und gut genährt aus. Nach weit über einer Stunde gab er auf. „Das ist in Ordnung“, sagte die Ermittlerin. „Manchmal kommt die Erinnerung auch erst später zurück. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, ein besonders auffälliges Merkmal, zögern Sie nicht, und rufen Sie uns an. Wir freuen uns über jeden Fall, den wir abschließen können.“
Jimmy blickte sich in diesem Großraumbüro um. Viele Schreibtische waren schlicht und ergreifend leer. Man sah ihnen an, dass sie nicht benutzt wurden. Die Abteilung war offenkundig unterbesetzt, diejenigen, die hier arbeiteten, waren allesamt schon jenseits der fünfzig und sie hatten diese stille Resignation an sich, von Menschen, die keine Kraft mehr hatten, sich gegen die Bösartigkeit der Welt aufzulehnen. Es war einfach nicht möglich, diesen zahllosen Einzelfällen gerecht zu werden.
Sicherlich hat jeder Einzelne hier mit hohen Idealen angefangen, mit dem Ehrgeiz, etwas zu verändern, etwas Gutes zu tun. Die Realität der beständigen Misserfolge zerstörte diesen Idealismus, diese Energie, und es gab nichts, um das aufzuhalten.
„Sind hier nur die offenen Fälle drin?“, fragte Jimmy.
„Ja“, entgegnete die Ermittlerin. „Wir müssen jeden Fall individuell betrachten. Häufig genug wollen die so genannten Ausreißer nicht gefunden werden. Das sind Kinder aus schlechten Familien, die Elend und der Gewalt entkommen wollen, um irgendwie zu überleben. Diejenigen, die wir eben nicht als drogensüchtige Obdachlose aus den Parks und vom Kinderstrich wegholen, befinden sich größtenteils gar nicht mehr in der Stadt. Sie schmuggeln sich in Züge hinein, kaufen sich Bustickets und versuchen ihr Glück irgendwo anders. In Florida, in Kalifornien, oder auch direkt in Mexiko. Anders sieht es mit Kindern aus guten Familien aus, die nach einem Streit weglaufen. Die finden wir meistens in weniger als zwölf Stunden und können sie nach Hause bringen. Es liegt insgesamt selten ein direktes Verbrechen vor, wenn Kinder vermisst werden.“
Etwas von dieser Aussage störte Jimmy. Er hatte natürlich keine Ahnung, er hatte sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt. Aber nach seinem Verständnis dürfte mit hoher Sicherheit ein Verbrechen vorliegen, wenn dunkelhäutige Mädchen unter zehn Jahren auf dem Weg zur Schule verschwanden. Sie waren zu jung, um allesamt Ausreißerinnen zu sein. Das war vielleicht nur seine laienhafte Meinung. Es konnte durchaus sein, dass sie sich schon lange nicht mehr in der Stadt aufhielten, aber das lag wohl eher daran, dass man sie entführt und in die Sexindustrie reingepresst hatte, oder? Nun, vielleicht hatte die Ermittlerin sich auch etwas ungünstig ausgedrückt und wie gesagt, er hatte nicht die geringste Ahnung von dem Thema. Er versprach, noch einmal gründlich nachzudenken, ob ihm irgendetwas zu dem jungen Mann von letzter Nacht einfallen würde, dann kehrte er nach Hause zurück.
Jimmy war seltsam frustriert, unruhig und er wusste beim besten Willen nicht, was er mit sich anfangen sollte. Er versuchte es mit Sport, was ihn nicht wirklich auf andere Gedanken brachte. Also duschte er sich, zog sich um und verabredete sich schließlich spontan mit seinen Geschwistern, um endgültig auf andere Gedanken zu kommen. Erstaunlicherweise sagten alle zu, was selten geschah, gerade dann, wenn es spontan angefragt wurde.
Sie trafen sich im Haus seiner Schwester Cathy, die sich spontan bereit erklärt hatte, für Essen und Getränke zu sorgen. Sie war seit einigen Jahren geschieden, ihre beiden Kinder gingen aufs College. Die Scheidung war hässlich gewesen, sie hatte Zeit gebraucht, um danach wieder auf die Füße zu kommen. Inzwischen hatte sie sich erholt und sie führte ein erfolgreiches Unternehmen für Partnervermittlung, bei dem sie bei der Programmierung der Handyapps voll involviert gewesen war, mit ihren Fähigkeiten als Informatikerin und Software-Entwicklerin. Jimmy und Cathy waren diejenigen, die die mathematischen Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt hatten, die für eine große Bank gearbeitet hatte. Cathy war die Älteste, Jimmy war ihr nachgefolgt. Und dann waren da noch ihre beiden jüngeren Geschwister, Michael und Diana. Michael arbeitete als Biologe im Botanischen Garten, er war ein verschrobener, stiller kleiner Mann. Er hatte nie geheiratet, und ob er überhaupt jemals eine längere Beziehung geführt hatte, das wusste Jimmy nicht. Diana wiederum arbeitete in der pharmazeutischen Industrie, und sie war die Einzige unter ihnen, die tatsächlich eine glückliche Ehe führte.
Sie hatten nicht unbedingt einen fantastischen Zusammenhalt unter Geschwistern. Die Altersabstände waren groß unter ihnen, als Michael und Diana geboren wurden, die Zwillinge waren, war Jimmy schon vierzehn gewesen und hatte sich mehr als Ersatzvater denn als großer Bruder gefühlt. Doch sie mochten sich und wenn einer von ihnen um Hilfe bat, dann waren alle anderen durchaus bereit, sich Mühe zu geben. Hilfe wollte er heute gar nicht, lediglich ein wenig Ablenkung und einen gemeinsamen Abend. Sie hörten ihm zu, als er erzählte, was geschehen war.
„Gehst du nicht zu gutherzig an diese Sache ran?“, fragte Cathy. „Der Junge hat dich ausgeraubt, das ist Fakt. Er hatte ein Messer in der Hand, und er wollte keine Hilfe von dir, er wollte dein Geld. Interpretierst du da nicht zu viel rein? Du weißt doch gar nicht, ob er nicht doch high war, ob er nicht einer Gang angehört und das eine Mutprobe für ihn war, du weißt gar nichts über ihn.“
„Ich werde ihn sehr sicher niemals wiedersehen“, entgegnete Jimmy. „Ich kann deshalb so viel in ihn hinein interpretieren, wie ich nur möchte. Es geht mir besser, wenn ich mir vorstelle, dass er ein hilfloses Kind ist. Es geht mir besser, wenn ich mir wünsche, dass irgendjemand ihm hilft. Ich will nicht, dass dieses Kind, das ich in ihm sehe, eine von Drogen zerstörte Bestie ist, die ohne Mitleid tötet. Und sollte ich nicht halluziniert haben, dann ist es auch nicht das, was ich gesehen habe. Er hatte panische Angst vor mir. Er wollte das nicht tun, was er da gerade getan hat. Er sah nicht aus, als wäre er auf Drogen gewesen.“
„Dann stellen wir uns doch mal vor, dass du nachher nach Hause kommst, und er sitzt vor deiner Tür und fleht dich um Hilfe an“, sagte Michael. „Was würdest du tun?“
„Ihn fragen, was er möchte, was sonst? Wenn er mehr Geld will, dann gebe ich ihm Geld. Ich hab genug davon, es würde mir nichts ausmachen. Ich würde mich nicht für den Rest meines Lebens aussaugen lassen, das jetzt nicht. Ich würde versuchen, herauszufinden, was er wirklich braucht. Ob er von seinem Zuhause fort ist, ob er bedroht wird, ob er Geschwister hat, die er beschützen muss. Ich würde ihm Essen geben, und mit ihm zusammen versuchen herauszufinden, wie er aus dieser Misere herauskommen kann. Vielleicht hat er gewalttätige Eltern, dann müssen die verhaftet werden. Niemand will ins System, das ist mal klar. Von einer Pflegefamilie zur nächsten geschickt zu werden, oder in irgendeinem Waisenhaus zu landen, das ist furchtbar. Keine Frage. Aber immer noch besser, als das Glück auf der Straße zu suchen. Da gibt es kein Glück.“
„Du bist für dein Alter viel zu idealistisch, das ist dir schon klar, hm?“ Cathy schüttelte den Kopf. „Zum Glück müssen wir uns keine Sorgen machen, weil du den kleinen Scheißer wohl tatsächlich niemals wiedertreffen wirst. Und das ist auch verdammt noch mal gut so!“
„Ach kommt, Leute!“, sagte Diana. „Ich glaube, du brauchst einfach Ablenkung, Bruder. Sollen wir eine Baseballübertragung anmachen? Oder wir spielen eine Runde Billard.“ Cathy hatte im Partykeller einen Billardtisch, den sie gerne nutzten, wenn sie zu viert zusammen waren. Sie sahen sich an, standen wortlos auf, schnappten sich ihre Getränke und die Teller mit den Häppchen und gingen die Treppe hinab, in den Keller. Cathy machte flotte Partymusik an, ein wenig später spielten sie Billard, sangen Songs aus ihrer Jugend, oder zumindest Cathys und Jimmys, lachten, hatten Spaß. Selbst Michael konnte mehr als einmal ein Lächeln entlockt werden.
Es fühlte sich gut an, es war genau das, wofür er hergekommen war. Verständnis, Ablenkung, gute Gesellschaft. Das hatte er gebraucht, um den Kopf wieder frei zu bekommen. So würde er die Sache überwinden können. Er wollte mit seinem Leben weitermachen. Morgen wieder normal arbeiten gehen, den Vortrag bald nachholen, der aufgeschoben worden war, Gutachten schreiben, Businessanalysen vornehmen, den ganzen Kram, der ihm gutes Geld einbrachte. Irgendwann einmal ein Buch über sein Fachgebiet schreiben. Nicht mehr und nicht weniger wünschte er sich.
Er konnte nicht den heiligen Samariter spielen, wenn es kein hilfebedürftiges Opfer auf seinem Weg gab. Er fühlte sich trotzdem, als hätte er es sich leicht gemacht. Als hätte er dieses Kind im Stich gelassen, während er die Möglichkeit hatte, mehr zu tun. Er wusste nicht, was dieses Mehr hätte sein können – denn ja, der Kleine hatte mit einem Messer herumgefuchtelt. Nun ja, Gefühle waren nicht immer logisch. Er würde darüber hinwegkommen.
„Hilf mir“, wisperte Aiden. Er klang jünger als er war und schwach noch dazu. Er sah schrecklich aus. Das Fieber war gestiegen, seine Augen glänzten, seine Gesichtsfarbe war ungesund rotweiß gefleckt. Man sah ihm an, wie stark er fror. „Die Schmerzen sind nicht auszuhalten“, stieß er hervor und winselte bei jedem Atemzug.
Es trieb Chad die Tränen in die Augen. Was zur Hölle sollten sie denn jetzt machen? Er zog den Stoffverband beiseite, so gut es ging, denn er hatte sich mit der Wunde verklebt. Aiden zuckte heftig und jammerte. Er hatte allen Grund zum Jammern.
„Himmel hilf“, sagte Chad, denn selbst in dem schlechten Flackerlicht konnte man erkennen, wie angeschwollen die Wunde war, sie eiterte, alles war rot, heiß, entzündet.
„Aiden, es geht nicht anders, du musst zu einem Arzt. Das bringt dich um!“
„Wir können nicht zu einem Arzt“, sagte Liam sofort. „Die packen uns, die schicken uns zurück!
„Leute, auf keinen Fall will ich zurück“, rief Mason.
„Ich würde lieber sterben! Hörst du? Lass mich eher hier unten verrecken, als irgendetwas zu tun, was uns zurückbringt. Versprich du mir das.“ Aiden packte Chad am Handgelenk und drückte zu. Unkontrolliert, viel zu schwach. Er konnte nicht einmal mehr die Augen offenhalten, der Kopf sackte ihm weg.
Aiden lag im Sterben. Das wurde Chad in diesem Moment klar. Er hatte keine Ahnung von Medizin, von Wunden, von irgendwas. Er hatte verdammt noch mal keine Ahnung! Doch wenn man so aussah wie Aiden, dann konnte man das nicht überleben. Nicht hier unten, in einem finsteren, stinkenden Loch. Es war viel zu kalt hier unten, viel zu dreckig. Sie alle würden hier unten verrecken, wenn sie dauerhaft blieben.
„Ich gehe noch mal raus“, sagte er. „Ich such mir irgendeine Drogerie und klaue Medikamente. Was gegen die Schmerzen, gegen das Fieber. Es gibt Mittel gegen Fieber. Und eine bessere Salbe, die da tut’s ja nicht richtig. Irgendwas, was dir wirklich hilft. Aiden? Du hältst durch, bis ich wieder da bin. Du versprich mir das, ja, du haust nicht einfach ab.“
„Wo soll ich denn hin?“ Aiden schnaubte. Vielleicht sollte es ein Lachen werden, doch dafür fehlte ihm die Kraft, er öffnete nicht einmal mehr die Augen. Chad ignorierte ihn. Aiden hatte ihn ganz bestimmt verstanden. Der Scheißkerl sollte es nicht wagen, einfach zu sterben! Zu sterben und sie allein zurückzulassen. Chad erlaubte das nicht!
„Mason, Liam: Ihr passt auf ihn auf. Gebt ihm Wasser zu trinken. Verstanden? Ich bin zurück, so schnell wie ich kann.“ Mason und Liam nickten, die Augen aufgerissen, ihre Gesichter bleich. Sie hatten Angst. Sie hatten unsagbare Angst, dass er nicht zurückkommen würde. Oder dass er zu spät kam und sie allein mit einer Leiche hier sitzen lassen würde. Verdammt, sie waren doch nur Babys!
Sie waren alle noch Babys. Ja, normalerweise fühlte Chad sich schon ziemlich erwachsen. Im Augenblick wusste er genau, dass er noch ein Baby war. Er brauchte seine Mom. Seinen Dad. Er brauchte jemanden, der ihn in die Arme nahm und ihm sagte, dass alles wieder gut werden würde. Das hatte er nicht. Seine Mom und sein Dad, sie hatten ihn fortgeschickt. Die ganze Gemeinschaft hatte ihn fortgejagt. Sie hassten ihn, sie hassten, wer er war. Was er war. Genau wie die Eltern der anderen es auch getan hatten.
„Ich beeile mich!“ Chad verließ den Raum mit dem schrecklichen Gefühl, dass es schon längst zu spät war, um noch irgendetwas tun zu können. Um Aiden zu retten.
Es war zwei Tage her, seit er diesen Mann im Hotel überfallen hatte. Erst hatte es so ausgesehen, als würde es Aiden bessergehen. Das Essen, das Wasser, die Salbe, alles das hatte ihm gut getan. Er schien sich zu erholen. Doch in den letzten Stunden hatte er wie irre abgebaut. Er war vor ihren Augen verfallen, und er brauchte jetzt wirklich einen Arzt, sonst würde es einfach enden. Und das wäre nicht fair. Leider war das Leben nicht fair, dass wusste er ja.
Mit Tränen in den Augen verließ Chad den Tunnel. Wie üblich sah er sich überall um, aus Angst, dass jemand ihn beobachtete, wie er dort herauskam. Doch es regnete leicht, er war allein. Es war kalt, und es war schon wieder dunkel geworden.
Wo sollte er hin? Er wollte kein Geschäft überfallen. Die hatten Kameras. Selbst kleine Läden hatten Kameras und Schutzvorrichtungen und manche von den Kassierern hatten Schrotflinten im Kassenbereich. Die wollten sich gegen Diebe wehren, gegen Leute wie ihn. Chad wollte garantiert keine Schrotladung ins Gesicht bekommen. Also würde er das Geld nutzen. Er hatte ja noch etwas. Vielleicht würde es reichen, vielleicht könnte er damit Medikamente kaufen, die Aiden wirklich helfen würden. Er musste es versuchen!
Er musste sich eine richtig gute Geschichte überlegen, die er in der Drogerie erzählen konnte. Vielleicht etwas über ein krankes Haustier? Damit es nicht so verdächtig klang. Wenn er erzählte, dass er nicht genug Geld für den Tierarzt hatte, aber Mittel für eine eitrige Wunde haben wollte, ob man ihm noch was empfehlen konnte, vielleicht würde das helfen?
Aber dann würde man ihm sicherlich Mittel geben, die für Tiere richtig waren, hingegen nicht das Richtige für einen Menschen, oder? Er hatte doch keine Ahnung von all dem Zeug. Solche Dinge hatte er nie selbst entscheiden müssen. Bislang hatte die Gemeinschaft sich um alles gekümmert. Seine Mom war für die Gesundheitsfragen zuständig gewesen. Das war Frauensache. Jetzt war er allerdings allein. Keine Frau in der Nähe. Kein Priester, der die Antworten auf sämtliche Fragen kannte.
Chad griff in die Tasche, wühlte nach den Geldscheinen. Reichte das aus? Medikamente waren teuer! Er stieß auf die Visitenkarte. Zog sie hervor, betrachtete sie. James Arlington. Das klang freundlich. Es war ein freundlicher Mann gewesen, jemand, der sich um ihn gesorgt hatte. Der ihn angesehen hatte, genau wie sein Dad es früher getan hatte. Früher, als noch alles gut gewesen war. Zu Hilfe, er hielt das hier nicht aus!
Im Licht der Straßenlaterne studierte er die Karte, als würde sie ihm irgendeine Antwort geben können. Er betrachtete die Adresse. Das war noch nicht einmal weit von hier, stellte er verwirrt fest. Er kannte die Straße, er war sie in den vergangenen Tagen einige Male entlanggelaufen, als sie noch auf der Suche nach einem geeigneten Unterschlupf gewesen waren. Es war vielleicht zehn Minuten von hier.
Na ja, aber es war doch vollkommen egal, wo dieser Mann wohnte! Oder arbeitete, es musste ja nicht seine Hausadresse sein. Viel wichtiger war, wo sich die nächste Drogerie befand, in der er rezeptfreie Medikamente kaufen konnte. Musste herausfinden, welche Medikamente gut waren. Den Fiebersaft, den seine Mom ihm früher gegeben hatte, wenn er krank war, den würde er erkennen. Aber ob das reichte? Der Fiebersaft war für kleine Kinder, oder? Aiden war ja kein Kind mehr. Sicherlich braucht er etwas Stärkeres. Mit seiner grässlich entzündeten Wunde, das war schon etwas anderes als eine Erkältung. Chad brauchte jemanden, den er fragen konnte. Er brauchte Hilfe.
Seine Gedanken schleuderten im Kreis umher, wie ein Kinderkarussell, nur viel schneller. Rund und rund im Kreis herum. Vollkommen sinnlos. So kam man nicht vorwärts.
Während Chad noch darüber nachdachte, hatten seine Füße sich entschieden, vorwärts zu laufen. Ohne sein Zutun stellte er fest, dass er schon die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hatte. Die Hälfte des Weges zu dem Haus, wo dieser Mann wohnte, den er mit einem Messer bedroht hatte. Brillanter Plan. Garantiert würde der sich freuen, ihn wiederzusehen. Wahrscheinlich hatte der eine Waffe in irgendeiner Schublade. Die würde er herausziehen, Chad die gesamte Ladung in den Körper ballern und dann die Cops anrufen, um ihnen zu sagen, dass es Notwehr gewesen war. Alles sprach dagegen, zu diesem Haus zu gehen. Zu diesem Mann, bei dem er nichts gewinnen konnte. Er brauchte die Hilfe für Aiden, er brauchte Medikamente, was machte er denn hier?
Tränenblind begann er zu rennen, das Gefühl, zu spät zu kommen trieb ihn vorwärts. Er wusste, er hatte nicht mehr viel Zeit. Er musste jetzt das Richtige tun. Bloß was das Richtige war, das wusste er nicht. Und das war es, worum es ging. Er konnte die Verantwortung nicht länger tragen. Er konnte nicht länger so tun, als wäre er ein Ersatz-Daddy für Liam und Mason. Als wäre er in der Lage, sich um Aiden zu kümmern. Er hatte getan, was er konnte, aber jetzt wusste er nicht mehr weiter.
Da vorne, da war es. Ein altes Haus, hübsch, gepflegt. Es sah genauso aus wie alle anderen Häuser hier in der Straße. Alles gleich. Gleich groß, gleich geformt. Wie aus einem Guss. Und trotzdem, es war ein hübsches Eigenheim. Ein Schild informierte darüber, dass hier ein Business Coach wohnte. Genau das, was auf der Karte stand.
Der Typ kannte sich mit Geld aus.
Bist du wahnsinnig?, brüllte seine innere Stimme. Du brauchst einen Arzt! Du brauchst jemanden, der sich mit Wunden auskennt, und mit viel zu hohem Fieber, und starken Schmerzen. Sowas brauchst du! Du brauchst niemanden, der dir was über Business und Geld erzählen kann.
James Arlington war ein erwachsener Mann. Dreißig, vierzig Jahre alt vielleicht. Alt genug, um erwachsen und verantwortungsvoll zu sein. Alt genug, um zu wissen, was verdammt noch mal zu tun war. Er hatte ihn angesehen. Besorgt, freundlich. Hatte gesagt, dass Chad sich Hilfe suchen sollte. Hatte von Suppenküchen gesprochen. Hatte ihm ohne weiteres sein Geld gegeben. Und diese Karte.
Chad kannte keinen anderen Menschen, der in letzter Zeit freundlich zu ihm gewesen wäre. Den er um Hilfe bitten könnte. Es gab einfach niemanden! All jene, denen er bislang vertraut hatte, hatten ihn fortgestoßen, ihn weggejagt, sie wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Damit musste er klarkommen. Es gab niemanden. Er war in einer solch elenden Lage, dass er tatsächlich bereit war, irgendeinen wildfremden Mann um Hilfe zu bitten, einzig und allein, weil er freundlich ausgesehen hatte. Das war Irrsinn, oder?
Er zitterte schon wieder, es rächte sich, dass er die letzten zwei Tage und Nächte kaum hatte schlafen können. Die Angst, dass etwas Schreckliches geschehen würde, wenn er die Augen zu lange zumachen würde, sie hatte ihn wach gehalten. Die Angst um Aiden, dem es immer schlechter ging. Die Angst, dass er versagen würde, Liam und Mason zu beschützen. Aber er konnte doch jetzt nicht genau den Mann um Hilfe anflehen, den er ausgeraubt hatte! Er konnte das nicht tun, denn was würde es bringen? Der Mann würde die Cops rufen, denn das war doch die einzige Möglichkeit, die es in dieser Situation gab. Der Kerl würde die Cops rufen, so sicher wie das Amen in der Kirche.
Also doch weglaufen? Eine Drogerie suchen? Es war noch nicht zu spät. Noch war nichts geschehen. Chad musste nur ruhig werden, nachdenken. Irgendwo hier gab es den Laden, den er brauchte. Wo er Medikamente kaufen konnte. Was machte er denn hier? Er hatte doch einfach nur Zeit verschwendet. Zeit, die Aiden nicht hatte. Er war solch ein Versager, solch eine Niete! Er musste … Himmel, er wusste nicht, wohin er sollte. Klingeln? Klopfen? Um Hilfe schreien? Oder wegrennen, laufen, bis er das richtige Geschäft gefunden hatte? Was sollte er tun?
Weinend ging er in die Knie. Die völlige Ratlosigkeit, sie krachte wie ein zusammenstürzender Wolkenkratzer auf ihn nieder. Die Verantwortung, die er trug, sie war viel zu viel. Er konnte nicht mehr! Er kauerte sich auf den Stufen vor dem Hauseingang zusammen und weinte, weinte vor Angst, schluchzte seine Panik heraus, und hasste sich selbst dafür. Er war solch ein Versager! Er durfte hier nicht herumsitzen, er musste doch Hilfe holen, Medikamente kaufen, er musste … Was musste er denn jetzt tun?
Dummheiten
immy hörte merkwürdige Laute von draußen. Er befand sich im Bad; nachdem er einen langen Arbeitstag hinter sich gebracht hatte, wollte er eigentlich nur rasch duschen und sich dann in Ruhe überlegen, was er zu essen haben wollte. Danach noch ein paar Unterlagen durchgehen, Musik auflegen, eine halbe Stunde lesen. Das gehörte zu seinem festen Abendritual. Er wollte beständig lernen, jeden Tag etwas Neues erfahren. Darum besaß er eine ganze Regalwand voll mit Sachbüchern, über diverse Themen. Geschichte, Archäologie, Paläontologie, Sprachforschung, verschiedene Fremdsprachkurse, Mathematik, Physik, Biologie, Politik, Geographie. Er hatte auch Bildbände, Reiseberichte von Menschen, die Asien, Europa, Australien und Neuseeland durchwandert hatten.
Er wollte über Kulturen, Sprachen, Menschen allgemein so viel wie möglich erfahren. Es war ihm wichtig, nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Nie glauben, dass er bereits alles konnte und wusste. Als Jimmy die High School abgeschlossen hatte, da hatte er sich ein Jahr Auszeit genommen. Sein Dad war deswegen beinahe ausgerastet, hatte ihm gesagt, er würde sein Leben wegwerfen, wenn er nicht sofort aufs College gehen und seinen Abschluss machen würde. Seine Mom hingegen hatte ihn ermuntert, ihn angefeuert, etwas über das Leben zu lernen, bevor er sich brav einem konservativen Karriereweg unterwarf. Er war ins Flugzeug gestiegen, was fast sein gesamtes Geld aufgebraucht hatte, was er für diesen Trip sparen konnte. In seinem jugendlichen Leichtsinn hatte er kein Problem darin gefunden, nicht genau zu wissen, wie er seinen Rückweg finanzieren sollte – einer der Gründe, warum er diese Erfahrung auf keinen Fall hätte aufschieben dürfen, denn dann wäre er niemals aus den Staaten rausgekommen.