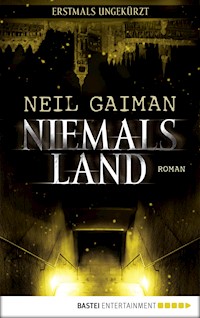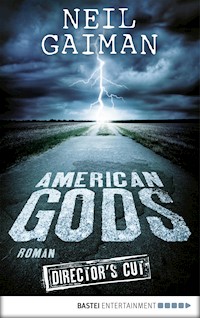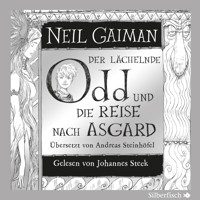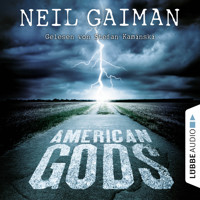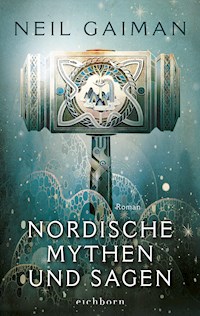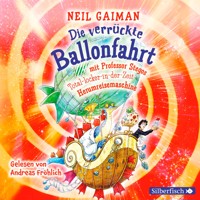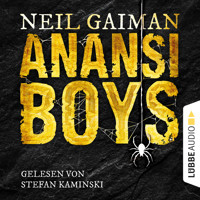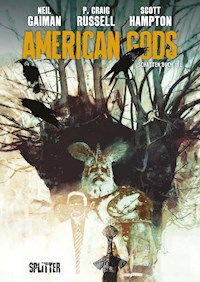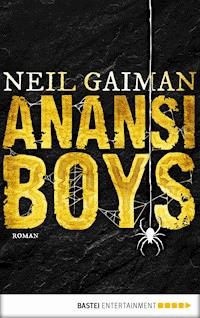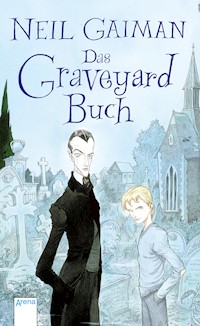
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nobody Owens ist ein eher unauffälliger Junge. Nobody lebt auf dem Friedhof, liebevoll erzogen und behütet von den Geistern und Untoten, die dort zu Hause sind. Doch der tödliche Feind, vor dem der kleine Bod einst auf den Friedhof floh, ruht nicht. Er wartet auf den Tag, an dem Bod sein Zuhause verlassen wird, um zurückzukehren in die Welt der Lebenden. Wer wird Nobody dann noch beschützen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Neil Gaiman
Das Graveyard-Buch
Aus dem Englischen von Reinhard Tiffert
Veröffentlicht als E-Book 2010 Text © Neil Gaiman Published by Arrangement with Neil Gaiman © für die deutsche Ausgabe: Arena Verlag GmbH, Würzburg 2009 Aus dem Englischen übersetzt von Reinhard Tiffert Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Umschlagillustration: Chris Riddell © Chris Riddell Gestaltung der Blechbox: Frauke Schneider Zuerst erschienen unter dem Titel »The Graveyard Book« bei Harper Collins Publishers, New York 2008 Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-401-80051-6
www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Rattle his bones Over the stones It’s only a pauper Who nobody owns
Schlag sein Gebein über dem Stein es ist nur ein Niemand ganz für sich allein.
Alter Kinderreim
Kapitel eins
Wie Nobody auf den Friedhof kam
Eine Hand in der Dunkelheit, darin ein Messer. Das Messer hatte einen Griff aus poliertem schwarzem Knochen und eine Klinge, feiner und schärfer als jede Rasierklinge. Das Opfer, in das sie eindrang, spürte den Schnitt gar nicht, jedenfalls nicht sofort. Das Messer hatte schon fast alles erledigt, weswegen es in dieses Haus gekommen war. Klinge und Griff waren feucht davon. Die Haustür, durch die das Messer und der Mann, der es in der Hand hielt, eingedrungen waren, stand noch einen Spaltbreit offen. Nächtliche Nebelschwaden wanden sich ins Innere des Hauses. Der Mann namens Jack blieb einen Augenblick auf dem Treppenabsatz stehen. Mit der linken Hand zog er ein weißes Taschentuch aus seinem schwarzen Mantel und wischte damit das Messer und die behandschuhte Rechte, die das Messer hielt, säuberlich ab. Dann steckte er das Taschentuch wieder ein. Die Jagd war fast vorbei. Die Frau hatte er im Bett liegen lassen, den Mann auf dem Schlafzimmerboden, das ältere Kind in seinem hellen, farbenfrohen Zimmer zwischen Spielzeug und halb fertigen Basteleien. Nun stand noch dasJüngste auf der Liste, fast noch ein Baby, das gerade laufen lernte. Danach wäre die Arbeit getan. Er streckte die Finger. Der Mann namens Jack war schließlich ein Profi, zumindest behauptete er das von sich, und ein Lächeln würde er sich erst gönnen, wenn sein Werk getan war. Seine Haare waren dunkel und seine Augen waren dunkel und er trug schwarze Handschuhe aus feinstem Schafsleder. Das Zimmer des Kleinen befand sich oben unter dem Dach. Jack stieg die Treppe hinauf, seine Schritte geräuschlos auf dem Teppichboden. Oben öffnete er die Tür zur Mansarde und ging hinein. Seine schwarzen Lederschuhe glänzten wie schwarze Spiegel; der Schein des Halbmondes glitzerte darin, so blank geputzt waren sie. Der wirkliche Mond schien durch das Flügelfenster. Nebel dämpfte den Schein, doch der Mann namens Jack brauchte nicht viel Licht. Für ihn reichte es. Er konnte die Silhouette des Kindes im Bettchen ausmachen, Kopf, Rumpf und Gliedmaßen. Das Bettchen hatte hohe Seitengitter, damit das Kind nicht herausklettern konnte. Der Mann namens Jack beugte sich über das Bett, hob die rechte Hand – die mit dem Messer – und er richtete es auf die Brust... und ließ sie wieder sinken. Die Gestalt im Bettchen war ein Plüschbär. Es war kein Kind da. Jacks Augen hatten sich an das fahle Mondlicht gewöhnt, daher hatte er nicht das Bedürfnis, das elektrische Licht einzuschalten. Licht war nicht so wichtig, er hatte andere Fähigkeiten.
Jack hob witternd die Nase. Er achtete nicht auf die Gerüche, die er mit ins Zimmer gebracht hatte, er hielt sich nicht auf mit denen, die hier ohne Bedeutung waren, er konzentrierte sich auf den Geruch, der ihn hierhergeführt hatte. Er roch das Kind, einen milchigen Duft wie Schokoladenkekse, und er roch den stechenden Geruch einer nassen Wegwerfwindel. Er roch auch das Babyshampoo im Haar des Kindes und noch etwas aus Gummi, das es bei sich hatte,ein Spielzeug,dachte er und dannnein, etwas zum Nuckeln. Das Kind war bis vor Kurzem noch hier gewesen, doch jetzt war es nicht mehr hier. Jack folgte seiner Nase, ging die Treppe hinunter durch das hohe, schmale Haus. Er schaute ins Bad, in die Küche, in den Wäschetrockenschrank und gelangte schließlich in die Diele, wo außer den Fahrrädern der Familie, ein paar leeren Einkaufstaschen und einer herumliegenden Windel nur Nebelschwaden zu sehen waren, die sich durch die offene Haustür hereingestohlen hatten. Der Mann namens Jack gab einen Laut von sich, ein Grunzen, das Enttäuschung ausdrückte und auch Befriedigung. Er steckte das Messer wieder in die Scheide in der Innentasche seines Mantels und trat hinaus auf die Straße. Draußen verband sich das Mondlicht mit dem Schein der Straßenlaternen, doch der Nebel hüllte alles ein, dämpfte die Geräusche und machte die Nacht unheimlich. Er schaute hinunter auf die Lichter der geschlossenen Läden, dann die Straße hinauf, wo die letzten Häuser standen, ehe das Dunkel des alten Friedhofs begann.
Der Mann namens Jack sog schnüffelnd die Luft ein. Dann lenkte er seine Schritte ohne Hast den Hügel hinauf.
Seit das Kind laufen konnte, machte es seinen Eltern ebenso viel Freude wie Kummer, denn dieser Junge konnte klettern wie kein zweiter, sich an unmöglichen Orten verstecken und plötzlich wieder auftauchen. In dieser Nacht hatte ihn ein Geräusch aus dem Zimmer unter ihm geweckt, etwas war krachend zu Boden gefallen. Einmal wach, langweilte er sich schon bald und überlegte, wie er aus seinem Bettchen hinauskommen könnte. Es war vergittert so wie der Laufstall unten in der Wohnung, aber er war sicher, dass er trotzdem hinausklettern konnte. Er brauchte nur eine Stufe... Er setzte seinen großen honigfarbenen Plüschbären in eine Ecke des Bettchens, umklammerte die Gitterstäbe mit seinen kleinen Händen, setzte einen Fuß auf den Bauch des Bären, den anderen auf den Kopf, zog sich hoch, bis er stand, und kugelte mehr, als er kletterte, über das Seitengitter aus dem Bettchen. Mit einem dumpfen Laut landete er in dem Haufen aus Spielzeug und Plüschtieren: Ein paar hatte er zu seinem ersten Geburtstag (vor noch nicht einmal einem halben Jahr) bekommen, ein paar hatte er von seiner älteren Schwester geerbt. Er war überrascht, als er auf dem Boden aufschlug, aber er weinte nicht. Wenn man weinte, kamen die Erwachsenen und steckten einen wieder ins Bett. Er krabbelte aus dem Zimmer.
Der Weg die Treppe hinauf war schwierig und gefährlich, das beherrschte er noch nicht so gut. Aber hinunter ging es ziemlich leicht, wie er herausgefunden hatte. Er rutschte auf seinem gut gepolsterten Hosenboden von Stufe zu Stufe hinunter. Er nuckelte an seinemLulli,sein Schnuller, von dem seine Mutter seit Neuestem behauptete, dass er eigentlich zu groß sei dafür. Bei seiner Reise treppab auf dem Popo hatte sich die Windel gelöst, und als er auf der letzten Stufe angekommen war und sich in der kleinen Diele aufrichtete, fiel sie herunter. Er trat aus der Windel heraus. Er hatte nichts als sein Nachthemdchen an. Die Treppe hinauf zu seinem Zimmer und zu seiner Familie war steil und abschreckend, aber die Tür hinaus auf die Straße stand einladend offen. Zögernd setzte der kleine Junge den Fuß nach draußen. Der Nebel hüllte ihn ein wie ein lang vermisster Freund. Anfangs noch unsicher, dann immer schneller und zuversichtlicher stapfte er den Hügel hinauf.
Weiter oben lichtete sich der Nebel. Das Licht des Halbmonds war nicht so hell wie das Tageslicht, beileibe nicht, aber man konnte den Friedhof doch gut erkennen. Da. Da stand die verlassene Friedhofskapelle mit den verriegelten Türen und dem mit Efeu bewachsenen Turm. Aus der Dachrinne, auf Höhe des Daches, wuchs ein kleiner Baum.
Ringsum Grabsteine, Grüfte und Gedenktafeln. Und hin und wieder lugte ein Kaninchen, eine Wühlmaus oder ein Wiesel aus dem Gebüsch und huschte über den Weg. All das hätte ein nächtlicher Beobachter im Mondlicht erkennen können. Freilich hätte er nicht die blasse, rundliche Frau gesehen, die unweit der Eingangspforte vorbeiging, und wenn er doch genauer hingeschaut hätte, dann hätte er erkannt, dass sie nur aus Mondschein, Nebel und Schatten bestand. Und doch gab es diese blasse rundliche Frau und sie war auf dem Weg zu einer Ansammlung halb zerfallener Grabsteine nahe der Eingangspforte. Die Pforte war verschlossen, im Winter ab vier Uhr nachmittags, im Sommer ab acht Uhr abends. Der Friedhof war auf einer Seite durch ein mit Spitzen bewehrtes Eisengitter geschützt und an den anderen Seiten von einer hohen Ziegelmauer umschlossen. Die Stäbe des Eisengitters waren so eng, dass kein Erwachsener, ja nicht einmal ein zehnjähriges Kind sich hätte durchzwängen können. »Owens!«, rief die blasse Frau mit einer Stimme wie das Säuseln des Windes im hohen Gras. »Owens! Schau doch mal!« Sie bückte sich und betrachtete etwas auf dem Boden. Kurz darauf tauchte eine schattenhafte Gestalt im Mondschein auf, die sich als ein grauhaariger Mann in den Vierzigern herausstellte. Er schaute in dieselbe Richtung wie seine Frau, und als er sah, was sie gerade betrachtete, kratzte er sich am Kopf.
»Gnädige Frau«, begann er, denn er stammte aus einer Zeit, als Höflichkeit noch etwas galt, »ist das wirklich das, wofür ich es halte?« Im selben Augenblick musste das Wesen, das er gerade kritisch beäugte, wohl Mrs Owens erblickt haben, denn es öffnete den Mund, ließ den Schnuller herausfallen und streckte ein kleines Patschhändchen aus, als wollte es unbedingt Mrs Owens blassen Finger packen. »Ich fress einen Besen, wenn das kein Baby ist«, entfuhr es Mr Owens. »Natürlich ist das ein Baby«, sagte seine Frau. »Aber die Frage ist doch, was machen wir mit ihm?« »Das ist in der Tat die Frage, gnädige Frau«, sagte ihr Gatte. »Aber es ist nichtunsereFrage, denn dieses Baby leibt und lebt und hat folglich nichts mit uns und unserer Welt zu tun.« »Schau doch nur, wie es lächelt!«, sagte Mrs Owens. »So ein süßes Lächeln.« Und mit Geisterhand strich sie ihm über das spärliche blonde Haar. Der kleine Junge kicherte vor Freude. Eine kühle Brise ging durch den Friedhof und zerteilte den Nebel hügelab (denn der Friedhof dehnte sich über die ganze Anhöhe und seine schmalen Wege zogen sich den ganzen Hang hinauf und wieder hinunter). Plötzlich rasselte es. Jemand musste am Gitter der Eingangspforte mit dem Vorhängeschloss und der Kette rütteln. »Das ist bestimmt jemand von der Familie des Babys«, sagte Owens. »Man holt es in den Schoß der Familiezurück. Lass den Kleinen jetzt«, ermahnte er seine Frau, die ihre Geisterarme um den kleinen Jungen geschmiegt hatte. »Der Kleine sieht aber nicht so aus, als hätte er eine Familie«, entgegnete Mrs Owens. Unterdessen hatte der Mann im dunklen Mantel aufgehört, an der Hauptpforte zu rütteln, und sah sich nun die schmale Seitenpforte an. Aber auch die war mit einem Schloss versehen. Im vorangegangenen Jahr waren Gräber mutwillig geschändet worden, worauf die Stadtverwaltung Sicherheitsmaßnahmen verfügt hatte. »Bitte, gnädige Frau, lass ihn nun, sei so gut«, drängte Mr Owens, als er plötzlich eine Erscheinung sah. Der Mund ging ihm auf, aber ihm fehlten die Worte. Man könnte meinen, Mr Owens hätte nicht so viel Aufhebens um eine Erscheinung zu machen brauchen, da er und seine Frau doch ebenfalls seit mehreren Hundert Jahren tot waren und ihr gesellschaftlicher Umgang fast ausschließlich aus Toten bestand. Doch gab es einen Unterschied zwischen dem Friedhofsvolk und dieser Erscheinung hier: eine schemenhafte Gestalt, grau wie Bildschirmgeflimmer, voll panischer Angst, die sich sogleich auch auf die Owens übertrug. Eigentlich waren es drei Gestalten, zwei größere und eine kleinere, aber nur eine von ihnen war mehr als ein fahler Schatten, und diese Gestalt sagte:Mein Junge! Er will meinem Jungen etwas zuleide tun!
Ein Scheppern. Der Mann draußen vor der Pforte schleppte einen schweren Abfalleimer von der Straßeherüber zu der hohen Ziegelmauer, die diese Seite des Friedhofs umschloss. »Beschützt meinen Sohn!«, sagte der Geist und Mrs Owens glaubte, dass es eine Frau war. Sicherlich die Mutter des kleinen Jungen. »Was hat er Ihnen getan?«, fragte Mrs Owens, aber sie war sich nicht sicher, ob die Erscheinung sie verstand.Die Arme ist erst vor Kurzem gestorben,dachte sie. Um wie viel besser war doch ein sanfter Tod, eine Zeit des Übergangs an der Stätte des Begräbnisses, damit man sich in den eigenen Tod finden und mit den anderen Bewohnern Bekanntschaft schließen konnte. Aus dieser geisterhaften Gestalt dagegen sprach nur Entsetzen und Angst um ihr Kind. Ihr leiser Schrei, den das Ehepaar Owens vernahm, erregte allgemeine Aufmerksamkeit, denn nun kamen von überall her andere Friedhofsbewohner herbei. »Wer sind Sie«, fragte Caius Pompeius die Erscheinung. Sein Grabstein war nur noch ein verwitterter Felsbrocken. Vor zweitausend Jahren hatte er sich gewünscht, dass seine sterblichen Überreste nicht ins ferne Rom überführt, sondern hier auf der Anhöhe neben dem Marmorheiligtum zur letzten Ruhe gebettet wurden. Er war somit der älteste Friedhofsinsasse und diese Verantwortung nahm er sehr ernst. »Sind Sie hier bestattet?« »Selbstverständlich nicht! Ganz offensichtlich ist sie erst seit Kurzem tot.« Mrs Owens legte den Arm um die weibliche Erscheinung und sprach in sanftem, begütigendem Ton auf sie ein.
Von der hohen Mauer an der Straßenseite war ein dumpfes Krachen zu hören. Die Mülltonne war umgefallen. Im milchigen Licht der Laterne kletterte ein Mann auf die Mauer. Er hielt einen Augenblick inne, dann glitt er, sich an der Mauerkrone festhaltend, mit baumelnden Beinen auf der anderen Seite hinab und ließ sich schließlich auf den Friedhofsboden fallen. »Aber machen Sie sich das klar«, sagte Mrs Owens zu der Erscheinung. »Er lebt, wir nicht. Kannst du dir vorstellen...?« Das Kind blickte verwirrt zu ihnen hinauf. Es streckte die Hand erst nach der einen, dann nach der anderen Gestalt aus, doch er griff ins Leere. Die Erscheinung, die einmal seine Mutter war, schwand rasch dahin. »Ja«, sagte Mrs Owens als Antwort auf etwas, was sonst niemand gehört hatte. »Wenn wir das können, dann tun wir das auch.« Und zu ihrem Mann gewandt: »Und du, mein lieber Mann, willst du diesem Würmchen ein Vater sein?« »Ob ichwaswill?«, fragte Owens mit hochgezogener Braue. »Wir hatten keine Kinder«, sagte seine Frau. »Seine Mutter will, dass wir es beschützen. Also sagst du Ja?« Der Mann im schwarzen Mantel war zwischen Efeuranken und verwitterten Grabsteinen gestolpert. Jetzt stand er wieder auf den Beinen und ging vorsichtig weiter. Dabei scheuchte er eine Eule auf, die mit lautlosen Flügelschlägen davonflog. Den kleinen Jungen hatte er schon entdeckt, Triumph blitzte in seinen Augen.
Owens wusste, was seine Frau dachte, wenn sie in diesem Ton mit ihm redete. Nicht umsonst waren sie, im Leben wie im Tode, seit über zweihundertfünfzig Jahren verheiratet. »Bist du dir auch ganz sicher?«, fragte er. »So sicher wie noch nie«, lautete ihre Antwort. »Also gut. Wenn du ihm eine Mutter sein willst, dann will ich ihm ein Vater sein.« »Haben Sie das gehört?«, fragte Mrs Owens die verblassende Gestalt auf dem Friedhof, von der nur noch der vage Umriss einer Frau zu erkennen war wie ein fernes Wetterleuchten. Sie erwiderte etwas, was außer Mrs Owens niemand hören konnte. Dann verschwand sie gänzlich. »Sie kehrt nie mehr hierher zurück«, sagte Mr Owens. »Wenn sie wieder erscheint, dann auf ihrem Friedhof oder wo man sie sonst bestattet.« Mrs Owens beugte sich mit ausgestreckten Armen zu dem kleinen Jungen hinunter. »Na komm, mein Kleiner, komm zu Mama.« Als der Mann namens Jack, das Messer schon in der Hand, über den Friedhof auf sie zuging, kam es ihm vor, als umhüllten Nebelschwaden das kleine Kind und entzogen es seinem Blick. Da war nichts mehr außer Nebel und zitterndem Gras im Mondschein. Er kniff die Augen zusammen und sog die Luft ein. Irgendetwas war geschehen, wenn er auch nicht wusste, was. Er knurrte wie ein wütendes, um seine Beute betrogenes Raubtier. »Hallo?«, rief der Mann namens Jack. Vielleicht hattesich das Kind ja irgendwo versteckt. Seine Stimme war dunkel und rau und hatte einen seltsamen Unterton, als sei der Mann überrascht, sich selbst sprechen zu hören. Doch der Friedhof hütete sein Geheimnis. »Hallo?«, rief er noch einmal. Er hoffte, irgendetwas von dem Kind zu hören, dass es weinte, dass es etwas stammelte oder sich bewegte. Was er stattdessen hörte, hatte er nicht erwartet, eine samtene Männerstimme, die sagte: »Kann ich Ihnen helfen?« Der Mann namens Jack war groß, doch dieser Mann war noch größer. Jack trug dunkle Kleidung. Doch die Kleidung dieses Mannes war noch dunkler. Wenn Menschen den Mann namens Jack bemerkten – was er durchaus nicht mochte –, dann fühlten sie sich unsicher, unwohl oder aus unerklärlichen Gründen verängstigt. Der Mann namens Jack blickte zu dem Fremden auf und es war der Mann namens Jack, der sich unsicher fühlte. »Ich habe jemanden gesucht«, gab er zur Antwort und steckte die rechte Hand in die Manteltasche, um das Messer zu verstecken und doch griffbereit zu haben. »Nachts in einem abgesperrten Friedhof?«, sagte der Mann trocken. »Es geht um ein kleines Kind«, erklärte Jack. »Ich habe ein Kind weinen hören, als ich vorbeiging. Ich habe durch das Gitter geschaut und das Kind gesehen. Was tut man in so einem Fall?« »Ich muss Ihren Gemeinsinn loben«, sagte der Fremde. »Aber einmal angenommen, Sie finden das Kind. Wiewollten Sie dann mit ihm hier herauskommen? Mit einem Kind auf dem Arm können Sie schwerlich über die Mauer klettern.« »Dann hätte ich gerufen, bis mir jemand nach draußen geholfen hätte«, antwortete Jack. Schwere Schlüssel klirrten. »Ja, und das wäre dann ich gewesen«, sagte der Fremde. »Ich hätte Ihnen aufgeschlossen.« Er suchte einen großen Schlüssel aus dem Bund heraus. »Kommen Sie mit.« Der Mann namens Jack ging hinter dem Fremden her. Das Messer nahm er wieder aus der Manteltasche. »Sind Sie der Friedhofswärter?« »Ja, gewissermaßen«, sagte der Fremde. Sie gingen auf die Eingangspforte zu und – da war sich Jack sicher – entfernten sich von dem Kind. Aber der Friedhofswärter hatte nun einmal die Schlüssel. Ein Messerstich im Dunkeln und dann würde er in aller Ruhe nach dem Kind suchen, wenn nötig die ganze Nacht. Er hob schon den Arm. »Wenn es wirklich ein weinendes Kind war«, sagte der Friedhofswärter, ohne sich umzudrehen, »dann bestimmt nicht hier auf dem Friedhof. Bestimmt haben Sie sich getäuscht. Es ist doch sehr unwahrscheinlich, dass ein Kind hier hereingekommen sein soll. Bestimmt haben sie einen Nachtvogel schreien hören und eine Katze oder einen Fuchs vorbeihuschen sehen. Vor dreißig Jahren, als hier die letzte Beerdigung stattfand, hat man den Friedhof zum Naturschutzgebiet erklärt. Denken Sie noch einmal genau nach, ob Sie sicher sind, dass Sie ein Kind gesehen haben.«
Der Mann namens Jack dachte nach. Der Fremde schloss die Seitenpforte auf. »Ein Fuchs«, sagte er. »Füchse geben ganz merkwürdige Laute von sich, fast so, als ob ein Mensch weint. Nein, Ihr Besuch auf diesem Friedhof war ein Irrweg. Das Kind, das Sie suchen, wartet irgendwo auf Sie, aber es ist nicht hier.« Er wartete einen Augenblick, damit sich dieser Gedanke tief in Jacks Gemüt festsetzte, dann stieß er mit einem Schwung die Pforte auf. »Es hat mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sicher werden Sie da draußen alles finden, was Sie brauchen.« Der Mann namens Jack stand wieder draußen vor der Pforte. Der Fremde schloss von innen ab und steckte den Schlüssel wieder ein. »Wo gehen Sie jetzt hin?«, fragte Jack. »Es gibt noch mehr Tore«, erläuterte der Fremde. »Mein Auto steht auf der anderen Seite. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Sie brauchen sich auch nicht an dieses Gespräch zu erinnern.« »Nein«, sagte Jack zustimmend, »das tue ich nicht.« Er erinnerte sich, wie er den Hügel heraufgekommen war. Dann hatte sich das, was er für ein Kind gehalten hatte, als ein Fuchs herausgestellt. Ein freundlicher Friedhofswärter hatte ihn wieder auf die Straße hinausgelassen. Er steckte das Messer wieder in die Scheide. »Also dann Gute Nacht.« »Gute Nacht«, verabschiedete sich der Fremde, den Jack für den Friedhofswärter gehalten hatte. Der Mann namens Jack lenkte seine Schritte hügelabwärts auf der Suche nach dem Kind.
Aus dem Schatten beobachtete der Fremde den Mann namens Jack, bis dieser verschwunden war. Dann begab er sich im Dunkeln zu dem ebenen Platz unterhalb der Hauptanhöhe, wo ein Obelisk und eine Grabplatte an einen gewissen Josiah Worthington erinnerten. Mr Worthington war ein erfolgreicher Bierbrauer und Politiker, der später zum Freiherrn geadelt wurde. Vor über dreihundert Jahren hatte er den alten Friedhof samt dem angrenzenden Land gekauft und alles der Stadt auf Dauer überschrieben. Für sich selbst hatte er den besten Platz auf dem Hügel als Ruhestätte ausgesucht – ein natürliches Amphitheater mit Blick auf die ganze Stadt und noch weiter – und dafür gesorgt, dass der Friedhof als solcher erhalten blieb. Die Friedhofsbewohner waren ihm dankbar dafür, wenngleich nicht so, wie sich Sir Josiah Worthington das vorgestellt hatte. Alles in allem mochten zehntausend Seelen den Friedhof bevölkern, doch die meisten lagen im Tiefschlaf oder zeigten kein Interesse an den allnächtlichen Umtrieben. So waren nicht mehr als dreihundert von ihnen im Amphitheater versammelt. Auf leisen Sohlen wie der Nebel kam der Fremde zu dem mondbeschienenen Platz, hielt sich aber im Schatten und beobachtete von dort aus schweigend die Versammlung. Josiah Worthington sprach gerade. »Meine liebe gnädige Frau«, sagte er, »Ihre Hartnäckigkeit ist schon... nun ja, ist Ihnen denn nicht klar, wie lächerlich das ist?«
»Nein«, erwiderte Mrs Owens, »das ist mir nicht klar.« Sie saß im Schneidersitz auf dem Boden, mit dem lebenden Kind im Schoß, und stützte dessen Kopf mit ihren blassen Händen. »Mit Verlaub, Euer Ehren«, schaltete sich Mr Owens ein, der neben ihr stand, »Mrs Owens möchte Ihnen nur begreiflich machen, dass sie es nicht so sieht, im Gegenteil, sie betrachtet es als ihre Pflicht.« Mr Owens hatte Josiah Worthington noch als leibhaftigen Menschen in Erinnerung, als beide noch am Leben waren. Ja, er hatte mehrere teure Möbelstücke für Worthingtons Herrenhaus draußen in Inglesham angefertigt und hatte immer noch großen Respekt vor ihm. »IhrePflicht?«Sir Josiah schüttelte den Kopf, als wolle er ein paar Spinnfäden loswerden. »Eine Pflicht haben Sie nur gegenüber der Bürgerschaft des Friedhofs, Wesen ohne Fleisch und Blut, Geister, Wiedergänger und Erscheinungen. Dieses Wesen hier sollten Sie so schnell wie möglich dorthin zurückbringen, wo es zu Hause ist, und das ist nicht hier.« »Seine Mutter hat mir den Jungen anvertraut«, sagte Mrs Owens, als ob das alles wäre, was es dazu zu sagen gab. »Meine liebe gnädige Frau...« »Ich bin nicht Ihre liebe gnädige Frau«, sagte Mrs Owens und erhob sich. »Und offen gesagt weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt mit euch gepuderten Dummköpfen rede, wo dieses kleine Wurm jeden Augenblick aufwachen wird und Hunger hat. Und wo bekomme ich auf dem Friedhof etwas zu essen für ihn, das möchte ich gern wissen.« »Das ist genau der Punkt«, bemerkte Caius Pompeius trocken. »Was wollen Sie ihm zu essen geben? Wie können Sie überhaupt für ihn sorgen?« Mrs Owens Augen brannten. »Ich kann mich um ihn kümmern«, sagte sie, »so gut wie seine richtige Mutter. Sie hat ihn mir gegeben. Sehen Sie doch selbst: Ich halte ihn, oder nicht? Ich streichle ihn.« »Jetzt nimm doch Vernunft an, Betsy«, sagte Mutter Slaughter, eine kleine schrumpelige alte Frau mit Haube und Umhang, die sie zu Lebzeiten getragen hatte und mit denen sie auch begraben worden war. »Wo soll er denn wohnen?« »Na, hier«, sagte Mrs Owens. »Wir ernennen ihn zum Ehrenbürger des Friedhofs.« Mutter Slaughters Mund bildete ein kleines rundes O. »Aber«, sagte sie. Dann sagte sie: »Aber ohne mich.« »Warum denn? Es wäre nicht das erste Mal, dass wir einen Außenstehenden zum Ehrenbürger ernennen.« »Richtig«, sagte Caius Pompeius. »Aberderlebte nicht mehr.« An dieser Stelle merkte der Fremde, dass er, ob er wollte oder nicht, in den Streit hineingezogen wurde, und trat widerstrebend aus dem Schatten, aus dessen Dunkel er sich löste wie ein Stück Finsternis. »Nein«, pflichtete er bei, »in der Tat lebe ich nicht mehr. Aber ich teile Mrs Owens’ Standpunkt.« »Tatsächlich, Silas?«, sagte Josiah Worthington.
»Ja. Zu seinem Wohl – ich glaube fest, dass es zu seinem Wohl ist – haben Mrs Owens und ihr Gatte dieses Kind in ihre Obhut genommen. Doch braucht es mehr als ein rechtschaffenes Ehepaar, um ein Kind aufzuziehen«, sagte Silas. »Dazu braucht es einen ganzen Friedhof.« »Und was ist mit essen und so weiter?« »Ich kann auf dem Friedhof ein und aus gehen. Ich kann ihm etwas zu essen bringen«, sagte Silas. »Alles schön und gut, was Sie da sagen«, sagte Mutter Slaugther. »Aber Sie gehen hier ein und aus und keiner weiß, wo Sie stecken. Wenn Sie eine Woche lang fortbleiben, könnte der Junge sterben.« »Sie sind eine kluge Frau«, sagte Silas, »nicht umsonst hält man so große Stücke auf Sie.« Er konnte die Gedanken der Toten nicht so lenken wie die der Lebenden, doch konnte er es mit Schmeichelei und Überredung versuchen, denn dagegen waren auch die Toten nicht gefeit. Dann verkündete er: »Wenn Mr und Mrs Owens seine Eltern sein wollen, dann will ich sein Vormund sein. Ich bleibe hier auf dem Friedhof, und wenn ich wirklich einmal nach draußen muss, dann sorge ich dafür, dass sich jemand an meiner Stelle um ihn kümmert. Wir können die Krypta der Kapelle benutzen.« »Aber«, protestierte Josiah Worthington. »Dies ist ein Menschenkind, ein lebendes Kind. Ich muss schon sehr bitten. Das hier ist ein Friedhof, keine Kinderkrippe, verdammt noch mal« »Ganz genau«, sagte Silas und nickte. »Eine sehr richtige Bemerkung, Sir Josiah. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Und aus genau diesem Grund ist es auch so wichtig, dass das Kind hier aufwächst, ohne das, wenn Sie mir den Ausdruck verzeihen wollen,Lebenauf dem Friedhof zu stören.« Dann ging er zu Mrs Owens hinüber und schaute auf das Kind, das in ihrem Arm schlief. Er hob eine Augenbraue. »Hat es denn einen Namen, Mrs Owens?« »Seine Mutter hat mir keinen genannt«, sagte sie. »Nun«, entschied Silas, »sein alter Name nützt ihm jetzt sowieso nichts mehr. Da draußen gibt es Leute, die ihm übelwollen. Also geben wir ihm doch einen neuen Namen, wie?« Auch Caius Pompeius trat heran und warf einen Blick auf das Kind. »Es sieht ein bisschen aus wie mein Prokonsul Marcus. Wir könnten ihn Marcus nennen.« Josiah Worthington widersprach. »Er sieht eher aus wie mein Chefgärtner Stebbins. Aber das soll kein Vorschlag für einen Namen sein. Der Mann hat gesoffen wie ein Loch.« »Er sieht aus wie mein Neffe Harry«, meinte Mutter Slaughter. Fast schien es so, als wollte der ganze Friedhof sich einschalten und Ähnlichkeiten zwischen dem Kind und irgendwelchen lang vergessenen Personen anbieten. Schließlich wurde es Mrs Owens zu viel. »Er sieht aus wie niemand anderes als er selbst«, sagte sie entschieden. »Er sieht aus wie niemand, nobody.« »Dann also Nobody«, sagte Silas. »Nobody Owens.« Und in diesem Augenblick, als wollte es auf seinenNamen antworten, schlug das Kind hellwach die Augen auf. Es schaute sich um und ließ den Blick über die Gesichter der Toten wandern. Dann sah es Silas fest in die Augen. Sein Blick war ernst. »Was soll das für ein Name sein – Nobody«, empörte sich Mutter Slaughter.»SeinName, und ein guter obendrein«, entgegnete Si-las. »Er wird dabei helfen, ihn zu beschützen.« »Ich will keinen Streit«, sagte Josiah Worthington. Das Kind schaute zu ihm auf und plötzlich, ob vor Hunger oder vor Müdigkeit oder vor Heimweh, verzog es sein kleines Gesicht und fing an zu weinen. »Lassen Sie uns allein«, sagte Caius Pompeius zu Mrs Owens. »Wir werden die Angelegenheit ohne Sie weiterbesprechen.«
Mrs Owens wartete draußen vor der Friedhofskapelle. Vor über vierzig Jahren war die Kapelle, ein kleiner Kirchenbau mit einem Turm, unter Denkmalschutz gestellt worden. Der Stadtrat hatte aber beschlossen, dass die Kosten für die Renovierung der kleinen alten Kapelle in dem aufgelassenen Friedhof zu hoch seien. So hatte man sich damit begnügt, den Eingang mit einem Vorhängeschloss zu sichern und zu warten, bis der Bau einstürzte. Doch die efeubewachsene Kapelle war solide gebaut und würde auch in diesem Jahrhundert nicht einstürzen. Das Kind in Mrs Owens’ Arm war wieder eingeschlafen. Sie wiegte es sanft und sang ihm ein altes Lied vor, das ihr schon ihre Mutter gesungen hatte, vor langer Zeit, als bei den Männern gepuderte Perücken in Mode kamen. Das Lied ging so:
Schlaf, Kindchen, schlaf, Sei doch lieb und brav. Bist du einmal aufgewacht, Siehst du die Welt in ihrer Pracht, Küss der Liebsten Wangen, Reich die Hand zum Tanz, Finde deinen Namen Und verborgner Schätze Glanz...
Mrs Owens sang bis hierher, als sie bemerkte, dass sie das Ende des Liedes vergessen hatte. Sie meinte, der Schlussvers hätte etwas zu tun mit »fettem Speck«, aber das konnte auch ein anderes Lied sein, deshalb brach sie ab und sang stattdessen über den Mann im Mond, für den es sich nicht lohnt, und danach sang sie mit ihrer schönen Altstimme ein neueres Lied über den »Daumen, der schüttelt die Pflaumen«. Sie sang gerade eine lange Ballade über einen jungen Landadligen, den seine Liebste ohne besonderen Grund mit einem Aalgericht vergiftet hatte, als Silas mit einem Pappkarton zur Friedhofskapelle kam. »Bitte schön, gnädige Frau«, sagte er. »Viele schöne Sachen für einen kleinen Prachtkerl. Wir können das gut in der Krypta unterbringen.« Er öffnete das Vorhängeschloss und machte die schwere Eisentür auf. Mrs Owens trat ein und betrachtete misstrauisch die Bretter und die alten Kirchenbänke, die an der Wand lehnten. In einer Ecke standen stockfleckige Kisten voller Kirchenbücher. Eine offene Tür führte zu einem viktorianischen Wasserklosett und einem Waschbecken mit einem Kaltwasserhahn. Das Kind schlug die Augen auf und schaute. »Am besten lassen wir die Vorräte hier«, schlug Silas vor. »Hier ist es kühl, da hält sich das Essen länger.« Er griff in den Karton und holte eine Banane heraus. »Und wo wächst so was?«, fragte Mrs Owens mit einem argwöhnischen Blick auf das gelbe Ding in Silas’ Hand. »Das ist eine Banane, eine Frucht aus den Tropen. Ich glaube, man muss die Schale abmachen«, sagte Silas. »So.« Das Kind – Nobody – wand sich in Mrs Owens Arm. Sie ließ es herunter und sogleich wackelte es zu Silas hinüber, packte ihn am Hosenbein und hielt sich fest. Silas gab ihm die Banane. Mrs Owens sah zu, wie der kleine Junge aß. »Ba-nane«, wiederholte sie ungläubig. »Noch nie gehört. Nie. Wie schmeckt das denn?« »Ich habe keine Ahnung«, sagte Silas, der nur eine Art Nahrung zu sich nahm, und das waren nicht Bananen. »Sie könnten dem Jungen hier ein Bett für die Nacht herrichten.« »Das tue ich ganz bestimmt nicht, wo doch Owens und ich so eine reizende Gruft gleich neben dem Narzissenbeet haben. Jede Menge Platz für den Kleinen. Außerdem«, fügte sie hinzu, damit Silas nicht glaubte, sie wolle seine Gastfreundschaft zurückweisen, »will ich nicht, dass der Kleine Sie stört.«
»Er stört mich nicht.« Der Junge hatte die Banane gegessen. Was er nicht vertilgt hatte, befand sich auf seinem Gesicht und auf seinem Schlafanzug. Er strahlte, verschmiert und apfelbackig. »Nane«, sagte er freudig. »Was für ein schlaues Kerlchen«, sagte Mrs Owens. »Und was für eine Sauerei er gemacht hat! Warte, du kleiner Schmierfink...«Und sie wischte ihm die Bananenreste aus dem Gesicht und aus den Haaren. »Was meinen Sie, wie sich die Versammlung entscheiden wird?« »Ich weiß es nicht.« »Ich kann ihn nicht mehr hergeben. Schon gar nicht nach all dem, was ich seiner Mutter versprochen habe.« »Obwohl ich zu meinen Lebzeiten alles Mögliche gewesen bin«, sagte Silas, »bin ich doch nie Mutter gewesen. Und ich habe nicht vor, jetzt damit anzufangen. Aberichkann diesen Ort verlassen...« Mrs Owens sagte nur: »Ich nicht. Meine Knochen liegen hier. Und auch die meines Mannes. Ich werde für immer hierbleiben.« »Es muss gut sein«, sagte Silas, »einen Platz zu haben, wo man hingehört. Ein Zuhause.« Er sagte das ohne jede Sehnsucht, mit einer Stimme, so trocken wie der Wüstenwind, als stelle er lediglich etwas völlig Unbestreitbares fest. Mrs Owens bestritt es nicht. »Glauben Sie, dass wir lange warten müssen?« »Nicht lange«, antwortete Silas, doch da irrte er sich.
Oben auf dem Platz neben dem Obelisken hatte jeder Friedhofsbewohner seine eigene Meinung und jeder wollte sich Gehör verschaffen. Dass ausgerechnet das Ehepaar Owens und nicht irgendein dahergelaufener Hallodri in diese Sache geraten war, bedeutete eine ganze Menge, denn die Owens galten als rechtschaffen und waren angesehen. Dass Silas angeboten hatte, den Jungen zu beschützen, hatte ebenfalls Gewicht. Die Friedhofsleute betrachteten ihn mit einer gewissen ehrfürchtigen Scheu, denn Silas war Grenzgänger zwischen ihrer Totenwelt und der Welt, die sie verlassen hatten. Und doch, und doch... Ein Friedhof ist normalerweise kein demokratisches Gemeinwesen, aber der Tod ist seinem Wesen nach sehr demokratisch, und jeder Tote hatte eine Stimme und auch eine Meinung dazu, ob das lebende Kind bei ihnen bleiben durfte oder nicht, und jeder wollte sich Gehör verschaffen heute Nacht. Es war Spätherbst und der Tag brach nur zögernd an. Obwohl der Himmel noch dunkel war, drangen die Geräusche der ersten Autos den Hügel herauf, und während die Lebenden im nebligen Morgendunkel zur Arbeit fuhren, redeten die Friedhofsbewohner immer noch über das Kind, das zu ihnen gekommen war, und darüber, was sie tun sollten. Dreihundert Stimmen, dreihundert Meinungen. Nehemiah Trot, der Dichter von der verfallenen nordwestlichen Seite des Friedhofs, hatte gerade in wohlgesetzten Worten seine Ausführungen begonnen, obwohl niemand hätte sagen können, was er eigentlich meinte, da geschah etwas,das alle Anwesenden verstummen ließ, etwas, das in der Geschichte des Friedhofs noch nie vorgekommen war. Ein riesiges weißes Pferd, das Pferdekenner als Grauschimmel bezeichnen würden, kam den Hügel herauf. Noch bevor man es sehen konnte, hörte man das Getrappel der Hufe und das Knacken und Rascheln, als es sich den Weg durch Gebüsch und Gestrüpp bahnte, durch den Efeu und den Stechginster, die am Hügel entlangwuchsen. Groß wie ein Zugpferd war es, mindestens neunzehn Hand hoch. Es hätte einen Ritter in voller Rüstung in die Schlacht tragen können, doch auf seinem bloßen Rücken saß eine ganz in Grau gewandete Frau. Ihr Kleid und ihr Schal schienen aus Spinnweben gemacht zu sein. Ihr Gesicht war sanft und friedvoll. Die Friedhofsbewohner kannten sie alle, denn jeder von uns begegnet der Dame auf dem Grauschimmel am Ende seiner Erdentage und sie ist unvergesslich. Das Pferd blieb neben dem Obelisken stehen. Im Osten dämmerte es schon und das erste schwache Morgenlicht gab den Friedhofsbewohnern ein unbehagliches Gefühl. Am liebsten wären sie in ihre heimischen Grüfte zurückgekehrt. Dennoch rührte sich keiner von der Stelle. Alle schauten, aufgeregt und furchtsam zugleich, auf die Dame auf dem Grauschimmel. Die Toten sind normalerweise nicht abergläubisch, aber sie beobachteten sie, wie die römischen Auguren den Flug der heiligen Raben beobachteten, auf der Suche nach geheimen Zeichen, auf der Suche nach Weisheit.
Und dann sprach sie zu ihnen. Mit einer Stimme wie einhundert helle Silberglöckchen sagte sie nur: »Die Toten sollten sich barmherzig zeigen.« Und dazu lächelte sie. Das Pferd, das ein Büschel Gras abgerupft hatte und zufrieden kaute, hielt inne. Die Dame tätschelte den Hals des Pferdes und sogleich wendete es. Es machte ein paar große klappernde Schritte, dann löste es sich vom Boden und galoppierte in den Himmel. Sein Hufschlag hallte wie ferner Donner und wenig später war es den Blicken entschwunden. Das jedenfalls behaupteten die Friedhofsbewohner, die in jener Nacht auf der Anhöhe dabei gewesen waren. Die Debatte war aus und vorbei und im Handumdrehen ein Beschluss gefasst. Das Kind namens Nobody Owens wurde zum Ehrenbürger des Friedhofes ernannt. Mutter Slaughter und Sir Josiah begleiteten Mr Owens zur Krypta der alten Kapelle, wo sie Mrs Owens die Neuigkeit überbrachten. Das Wunder schien sie nicht zu überraschen. »Recht so«, sagte sie. »Manche von den Honoratioren haben keinen Funken Verstand.Sieschon. Natürlich.«
Noch ehe die Sonne an einem donnergrollenden Morgenhimmel aufging, war das Kind in der behaglich eingerichteten Gruft des Ehepaares Owens eingeschlafen (Meister Owens war vor seinem Ableben das Oberhaupt der hiesigen Tischlerinnung gewesen und seine Zunftgenossen hatten alles getan, damit er ehrenvoll zu Grabe getragen wurde).
Silas machte einen letzten Gang nach draußen, ehe die Sonne aufging. Er fand das hohe schmale Haus am Hügel, untersuchte die drei Leichen, die er dort fand, und er studierte das Muster der Stichwunden. Als er genug gesehen hatte, trat er hinaus in den dunklen Morgen, den Kopf voller Gedanken an die unerfreulichen Möglichkeiten, die sich ergeben konnten. Dann kehrte er zum Friedhof zurück, wo er in der Kapelle schlief und die Tage mit Warten verbrachte. In der kleinen Stadt am Fuß des Hügels wurde der Mann namens Jack immer wütender. Auf diese Nacht hatte er sich schon so lange gefreut; monatelang, jahrelang hatte er darauf hingearbeitet. Und am Anfang hatte ja auch alles geklappt wie am Schnürchen – drei Leben ausgelöscht, bevor einer auch nur einen Schrei ausstoßen konnte. Und dann... Dann war plötzlich alles auf unerträgliche Weise schiefgegangen. Warum um alles in der Welt war er den Hügel hinaufgegangen, wo das Kind doch ganz offensichtlichhinuntergegangen war? Und als er unten angekommen war, war die Spur kalt geworden. Jemand musste das Kind gefunden haben, mitgenommen und versteckt haben. Eine andere Erklärung gab es nicht. Draußen krachte der Donner, laut und unvermittelt wie ein Gewehrschuss, und dann setzte heftiger Regen ein. Der Mann namens Jack war ein methodischer Kopf, er plante schon den nächsten Schritt. Er gedachte einige Leute in der Stadt zu besuchen, die für ihn Augen und Ohren offen halten sollten.
Er brauchte der Versammlung nicht zu sagen, dass er gescheitert war. Und außerdem, sagte er sich, als er vor dem morgendlichen Regenschauer unter einer Ladenfront Zuflucht suchte, war er nicht gescheitert. Noch nicht. Er hatte noch viel Zeit, um den letzten Teil des Geschäfts abzuschließen. Um den letzten Faden abzuschneiden. Erst als die Sirenen heulten und das erste Polizeiauto, dann ein Krankenwagen und dann ein Zivilfahrzeug mit Blaulicht an ihm vorbeirasten, schlug der Mann namens Jack den Mantelkragen hoch, zog den Kopf ein und ging langsam davon. Das Messer war in seiner Manteltasche, sicher in der Scheide und geschützt vor den Unbilden der Elemente.
Kapitel zwei
Die neue Freundin
Bod, so wurde er nun genannt, war ein stilles Kind mit nüchternen grauen Augen und einem dichten Schopf zerzauster mausgrauer Haare. Die meiste Zeit war er folgsam. Er lernte sprechen und setzte dem Friedhofsvolk mit seinen Fragen zu. »Wieso darf ich nicht raus aus dem Friedhof?«, fragte er oder: »Wie mache ich das, was der da gerade gemacht hat?«, oder: »Wer wohnt eigentlich hier?« Die Erwachsenen gaben sich alle Mühe, seine Fragen zu beantworten, aber oft fielen ihre Antworten vage, verwirrend oder widersprüchlich aus. Dann ging Bod immer zu der alten Kapelle, um mit Silas zu reden. Er wartete dort bis Sonnenuntergang, wenn Silas gewöhnlich erwachte. Bei seinem Vormund konnte er sicher sein, dass er eine Erklärung bekam, die so klar und so einfach war, dass Bod sie auch verstehen konnte. »Du darfst den Friedhof nicht verlassen, weil wir dich nur auf dem Friedhof beschützen können. Hier lebst du im Kreis derjenigen, die dich lieben. Draußen wärst du nicht sicher. Noch nicht.« »Aber du gehst doch auch nach draußen. Du gehst jede Nacht nach draußen.«
»Ich bin unendlich viel älter als du, mein Junge. Und ich bin überall sicher, ganz gleich, wo ich bin.« »Das bin ich auch.« »Ich wünschte, es wäre so. Aber nur, solange du hierbleibst, bist du wirklich sicher.« Oder: »Wie man das macht? – Manches lernt man durch Erziehung, manches durch Übung, manches kommt einfach mit der Zeit. Diese Fertigkeiten erwirbst du, indem du dich damit beschäftigst. Schon bald wirst du lernen, dich unsichtbar zu machen, durch Wände zu gehen und traumzuwandeln. Manches können die Lebenden nicht lernen, da wirst du noch ein bisschen warten müssen. Aber ich bin sicher, dass du selbst diese Dinge am Ende lernen wirst.«
»Schließlich bist du Ehrenbürger des Friedhofs«, sagte Silas. »Also sorgt der Friedhof für dich. Da du hier lebst, kannst du in der Dunkelheit sehen. Du kannst dich auf eine Weise fortbewegen, die den übrigen Lebenden nicht gegeben ist. Sie übersehen dich, ihre Augen gleiten von dir ab. Auch ich bin Ehrenbürger des Friedhofs, obwohl das in meinem Fall nicht mehr als ein Aufenthaltsrecht bedeutet.« »Ich will so sein wie du«, sagte Bod und schob die Unterlippe vor. »Nein«, widersprach Silas, »das willst du nicht.« Oder: »Wer da liegt? – Meistens steht es auf dem Grabstein geschrieben. Kannst du schon lesen? Kennst du das ABC?«
»Das was?« Silas wiegte den Kopf, sagte aber nichts. Mr und Mrs Owens waren zu ihren Lebzeiten keine großen Leser gewesen und Fibeln gab es keine auf dem Friedhof. In der folgenden Nacht erschien Silas vor der Familiengruft der Owens. Unter dem Arm hatte er drei große Bücher, zwei bunte Lesefibeln (A wie Apfel und B wie Ball) und eine Ausgabe vonABC – die Katze lief im Schnee