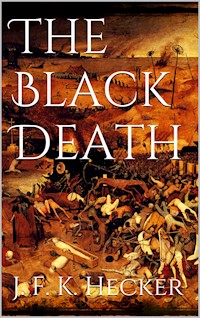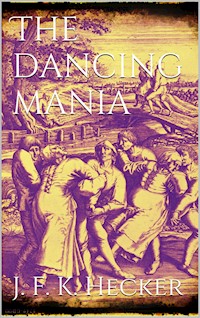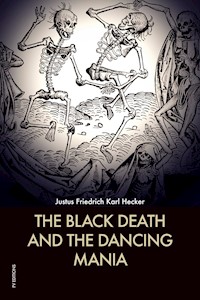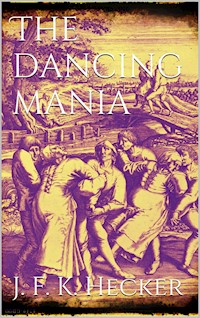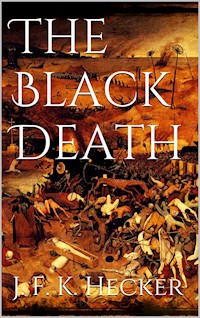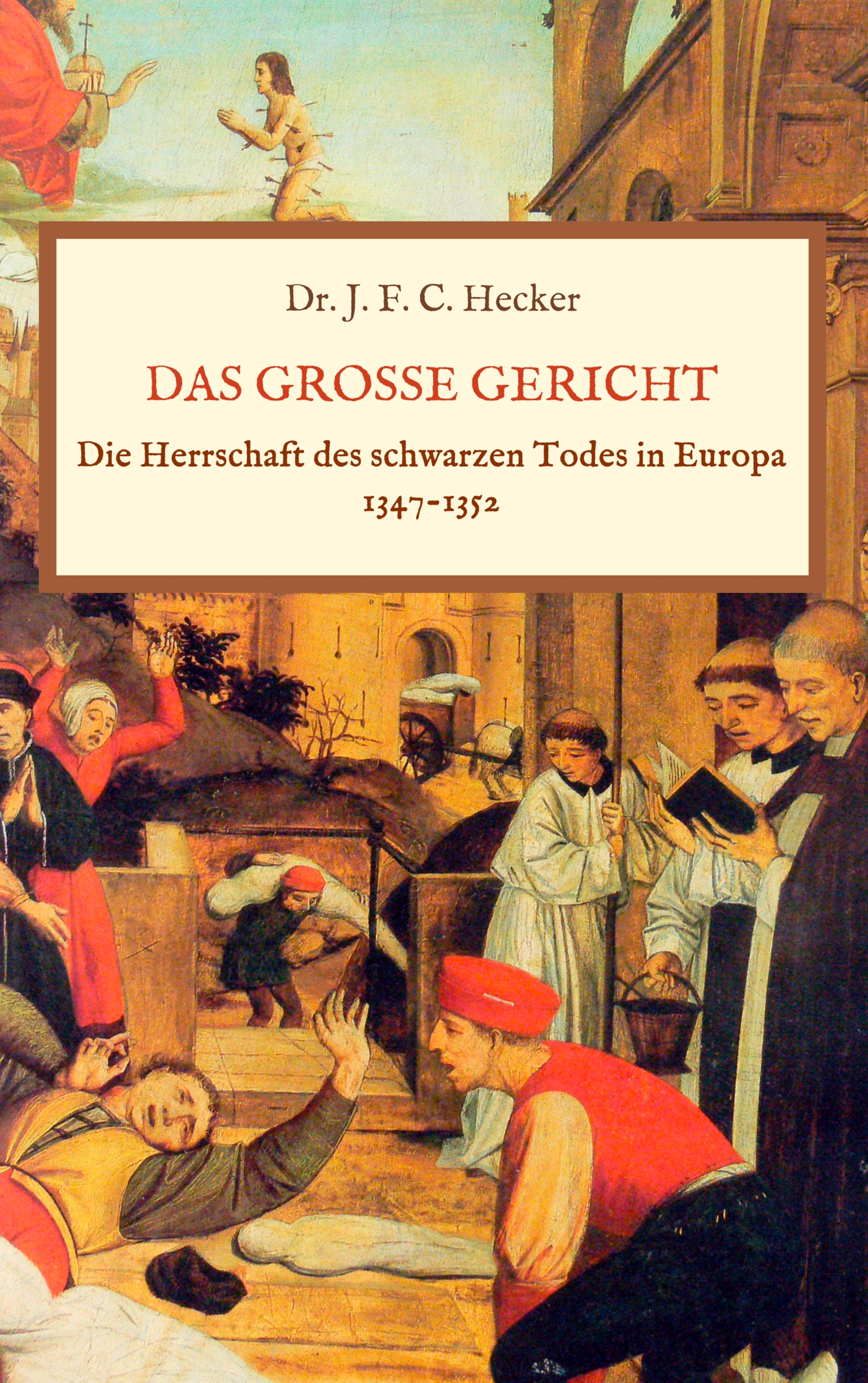
Das große Gericht: Die Herrschaft des schwarzen Todes in Europa 1347-1352 E-Book
Justus Friedrich Karl Hecker
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Schwarzer Tod wird eine der verheerendsten Pandemien der Weltgeschichte bezeichnet, die im 14. Jahrhundert in Europa geschätzte 25 Millionen Todesopfer - ein Drittel der damaligen Bevölkerung - forderte. Man schätzt, dass im Gebiet des heutigen Deutschlands jeder zehnte Einwohner infolge des Schwarzen Todes sein Leben verlor. Hamburg, Köln und Bremen zählten dabei zu den Städten, in denen ein sehr hoher Bevölkerungsanteil starb. Die sozialen Auswirkungen des Schwarzen Todes reichten sehr weit: Juden gerieten in den Verdacht, die Seuche durch Giftmischerei und Brunnenvergiftung ausgelöst zu haben. Dies führte in vielen Teilen Europas zu Judenpogromen und einer Auslöschung jüdischer Gemeinden. Indessen zogen Geißler durch die Straßen und fügten sich öffentlich Schmerzen zu, um ihre Sünden zu büßen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort.
Allgemeines.
Die Krankheit.
Ursachen. Verbreitung.
Menschenverlust.
Moralische Folgen.
Die Ärzte.
Anhang.
II. Verhöre der Brunnenvergiftung beschuldigter Juden
Zu dieser Ausgabe.
Impressum
Vorwort.
MAN findet hier eine inhaltreiche Seite der Weltgeschichte aufgeschlagen. Sie handelt von einer Erschütterung des Menschengeschlechts, der an Umfang und Gewalt keine andere gleichgekommen ist, sie spricht von unglaublichen Niederlagen, von Verzweiflung und entfesselten dämonischen Leidenschaften, sie zeigt den Abgrund allgemeiner Gesetzlosigkeit in Folge einer Weltseuche, die sich von China bis nach Island und Grönland verbreitete.
Die Veranlassung, dieses Bild einer längst entschwundenen Zeit zu enthüllen, liegt am Tage. Eine neue Weltseuche hat fast dieselbe Ausdehnung erreicht, und wenn auch weniger furchtbar, doch ähnliche Erscheinungen zum Teil hervorgerufen, zum Teil angedeutet. In ihren Ursachen ihrer Verbreitung über Asien und Europa liegt die Aufforderung, sie von einem großartigen Gesichtspunkte aufzufassen, denn sie führt zur Ahnung des Weltorganismus, in welchem das organische Gesamtleben den großen Naturkräften untertan ist. Nun ist menschliches Wissen noch nicht so weit gediehen, in die Vorgänge über und unter der Erde Zusammenhang zu bringen, oder auch nur die Naturgesetze vollständig zu ermitteln, deren Kenntnis man bedürfte, viel weniger sie auf große Erscheinungen anzuwenden, in denen eine Triebfeder tausend andere in Bewegung setzt. Von dieser Seite ist also jener Gesichtspunkt nicht aufzufinden, wollen wir nicht in das unfruchtbare Gebiet der Vermutungen geraten, deren die Welt schon zu viele hat. Wohl aber zeigt er sich auf dem weiten und gedeihlichen Felde der historischen Forschung. Die Geschichte, dieser Spiegel des Menschenlebens in allen seinen Richtungen, bietet auch für die Weltseuchen eine unerschöpfliche, wenn auch wenig gekannte Fundgrube von Tatsachen dar, sie macht auch hier ihre Würde als wahrheitsliebende Philosophie der Wirklichkeit geltend. Ihrem Geiste entspricht die Auffassung der Weltseuchen als Weltbegebenheiten, die Deutung ihrer Erscheinungen aus der Zusammenstellung des Gleichartigen, in der die Tatsachen durch sich selbst reden, indem sie aus höheren Gesetzen des fortschreitenden Menschenlebens hervorgegangen erscheinen. Kosmischer Ursprung und folgenreiche krampfhafte Regung der unterliegenden Völker sind die hervortretenden Seiten, auf welche sie bei allen Weltseuchen hinweist. Diese selbst aber gestalten sich in ihren Eingriffen auf den Organismus wie in ihrer Verbreitung sehr verschieden, und es ist hier eine Entwickelung von Form zu Form in Jahrtausenden unverkennbar, so daß die Weltgeschichte in große Zeiträume zerfällt, in denen bestimmt ausgeprägte Seuchen vorherrschten. So weit unsere Zeitbücher reichen, kann hierüber noch mehr oder minder sichere Auskunft gegeben werden. Doch ist dieser Teil der medizinischen Geschichtschreibung, der in die Weltgeschichte so vielseitig und mächtig eingreift, kaum erst in der Anlage begriffen. Die Ehre der Wissenschaft, die menschlichem Tun und Treiben überall vorleuchten soll, läßt uns den Wunsch aussprechen, daß er auf dem noch nicht ganz verschütteten Boden der deutschen ärztlichen Gelehrsamkeit erfreulich gedeihen möge.
Berlin, den 2. März 1832. d. V.
1. Allgemeines.
IN großen Seuchen offenbart sich die allwaltende Macht, welche den Erdball mit all seinen Geschöpfen zu einem lebendigen Ganzen gestaltet hat. Die Kräfte der Schöpfung treten in gewaltsamen Widerstreit: die trockene Schwüle des Luftkreises, die unterirdischen Donner, die Nebel der übertretenden Wasser verkünden Zerstörung, der Natur genügt nicht der gewöhnliche Wechsel von Leben und Tod, und über Menschen und Tiere schwingt der Würgengel sein flammendes Schwert.
Diese Umwälzungen geschehen in großen Umläufen, die dem Geiste des Menschen in seiner Beschränkung auf einen kleinen Kreis der Erkenntnis, unerforschlich bleiben. Aber sie sind größere Weltbegebenheiten, als irgend andere, die nur aus der Zwietracht, oder der Not, oder den Leidenschaften der Völker hervorgehen. Sie erwecken durch die Vernichtung neues Leben, und wenn der Aufruhr über und unter der Erde vorüber ist, verjüngt sich die Natur, und der Geist erwacht aus Erstarrung und Versunkenheit zum Bewußtsein höherer Bestimmung.
Wäre es menschlicher Forschung noch irgend erreichbar, ein historisches Bild so mächtiger Ereignisse in lebendigem Zusammenhange zu entwerfen, wie die Geschichtschreiber von Kriegen und Schlachten und Völkerwanderungen entworfen haben, so würde die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts auf klare Anschauungen zurückzuführen sein, und die Wege der Vorsehung würden deutlicher erkannt werden. Es würde nachzuweisen sein, daß der Geist der Völker durch das zerstörende Widerspiel der Naturkräfte tiefe Eindrücke erleidet, und daß in der allgemeinen Gesittung durch Niederlagen hervortretende Wendepunkte herbeigeführt werden. Denn alles was in dem Menschen liegt, Gutes und Böses, wird durch die Gegenwart großer Gefahr gesteigert, sein Inneres gerät in Aufruhr, wie bei dem Anblick eines jähen Abgrundes, – der Gedanke der Selbsterhaltung beherrscht die Gemüter, die Selbstverleugnung wird auf härtere Proben gestellt, und wo irgend Finsternis und Rohheit walten, da fliehen die geängsteten Sterblichen zu den Götzen ihres Aberglaubens, und göttliche wie menschliche Gesetze werden frevelhaft übertreten.
Ein so gewaltsamer Zustand bringt nach einem allgemeinen Naturgesetz Veränderung hervor, eine heilsame oder nachteilige, wie die Umstände sich gestalten, so daß die Völker entweder höheren sittlichen Wert erringen, oder tiefer versinken. Dies alles aber geschieht nach einem viel größeren Maßstabe, als durch den gewöhnlichen Wechsel von Krieg und Frieden, durch das Emporkommen oder den Fall der Reiche, weil die Naturkräfte selbst die Seuchen hervorbringen, und den menschlichen Willen unterjochen, der in den Kämpfen der Völker gewöhnlich allein hervortritt.
2. Die Krankheit.
DAS denkwürdigste Beispiel hiervon gibt eine große Seuche des vierzehnten Jahrhunderts, welche Asien, Europa und Afrika verheerte, und deren sich noch jetzt die Völker in düsteren Überlieferungen erinnern. Es war eine morgenländische Pest, kenntlich am Brandbeulen und Drüsengeschwülsten, die in keiner andern Fieberkrankheit vorkommen. Wegen dieser Brandbeulen und schwarzen Flecken auf der Haut, den Verkündern fauliger Entmischung, nannte man sie in Deutschland wie in den nordischen Reichen den schwarzen Tod, in Italien hieß sie das große Sterben.1 Nur wenige Zeugnisse über ihre Zufälle und ihren Verlauf sind uns erhalten, aber sie reichen hin, um das Bild der Krankheit zu erhellen, und sie werden durch Übereinstimmung mit den Merkmalen desselben Übels in neuerer Zeit glaubwürdig.
Der kaiserliche Schriftsteller Kantakuzenos,2 dessen eigener Sohn Andronikus dieser Pest in Konstantinopel erlag, berichtet von großen Eiterbeulen an den Oberschenkeln und Armen der Kranken, die durch Erguß von übelriechender Jauche, wenn man sie öffnete, Erleichterung brachten. Damit sind offenbar die Bubonen, die untrüglichen Kennzeichen der morgenländischen Pest bezeichnet, denn er spricht außerdem noch von kleineren Beulen an den Armen und im Gesicht, wie an anderen Teilen des Körpers, und unterscheidet diese ganz deutlich von den Brandblattern, die nicht weniger von der Pest in allen ihren Formen hervorgebracht werden. Bei manchen brachen schwarze Stippchen3 über den ganzen Körper hervor, entweder einzeln, oder zusammenhängend und verfließend. Diese Zufälle fanden sich nicht bei allen vereint, bei manchen reichte ein einziger hin, ihnen den Tod zu bringen, einige aber genasen mit allen behaftet wider Erwarten. Kopfzufälle waren häufig; viele Kranke wurden stumpfsinnig und verfielen in betäubenden Schlaf, auch verloren sie die Sprache durch Zungenlähmung, andere waren schlaflos und angstvoll. Schlund und Zunge wurden schwarz und wie von Blut unterlaufen, kein Getränk löschte den brennenden Durst, und so währte die Qual ohne Linderung bis zum Tode, den viele durch Verzweiflung beschleunigten. Die Ansteckung war augenscheinlich, denn die Pfleger ihrer Verwandten und Freunde erkrankten, und viele Häuser in der Hauptstadt starben bis auf den letzten Bewohner aus.
Bis hierher zeigte sich nur die gewöhnliche Beschaffenheit der morgenländischen Pest, es gesellten sich aber noch tiefere Leiden zu dieser Seuche, die zu anderer Zeit nicht vorgekommen sind. Die Werkzeuge des Atmens wurden von fauliger Entzündung ergriffen, ein heftiger Brustschmerz befiel die Kranken, Blut wurde ausgehustet, und der Atem verbreitete einen verpestenden Geruch.
Im Abendlande wurde diese Erscheinung beim Ausbruch der Seuche vorherrschend.4 Ein hitziges Fieber, von Blutauswurf begleitet, tötete in den ersten drei Tagen. Es scheint, daß Bubonen und Brandbeulen zuerst gar nicht vorkamen, sondern daß die Krankheit in der Gestalt des anthraxartigen Lungenübels die Zerstörung des Körpers vollendete, bevor noch die übrigen Zufälle sich entwickelten. So wütete die Seuche in Avignon volle sechs oder acht Wochen lang, und verursachte durch den verpesteten Atem der blutspeienden Kranken nah und fern eine so entsetzliche Ansteckung, daß selbst Eltern ihre erkrankten Kinder flohen und alle Bande des Blutes sich lösten. Denn die Nähe eines der Pest Verfallenen war sicherer Tod.5 Nach dieser Zeit sah man Bubonen in den Achseln wie in den Weichen, und Brandbeulen über den ganzen Körper, aber nur erst gegen den siebenten Monat genasen einige Kranke mit gereiften Bubonen, wie in der gewöhnlichen, milderen Pest. So berichtet der mutvolle Guy von Chauliac, der die Ehre des Arztes darin suchte, der Gefahr Trotz zu bieten, der den Pestkranken wacker und rastlos beistand, und die Entschuldigung seiner arabistischen Genossen verschmähte, daß ärztliche Hilfe vergebens sei, und daß die Ansteckung zur Flucht berechtige. Zweimal sah er die Pest in Avignon, zuerst i. J. 1348 vom Januar bis zum August, dann zwölf Jahre später, im Herbst, wo sie von Deutschland zurückkehrte, und neun Monate lang Angst und Schrecken verbreitete. Das erste Mal wütete sie mehr unter den Armen, i. J. 1360 aber mehr unter den Reichen und Vornehmen, auch tötete sie jetzt eine Überzahl von Kindern, die sie früher verschont hatte, und nur wenige Weiber.
Ähnliches sah man in Ägypten6; auch hier war der Lungenbrand vorherrschend, und tötete mit brennender Hitze und Blutspeien rasch und unfehlbar; auch hier verbreitete der Hauch der Kranken die tödliche Ansteckung, und menschliche Hilfe war so vergeblich wie für die Nahenden verderbenbringend.
Boccaccio, der in Florenz, dem Sitze der wieder erwachten Wissenschaften, Augenzeuge unglaublicher Niederlagen war, beschreibt die Zufälle der Krankheit lebendiger, als seine nichtärztlichen Zeitgenossen.7 Sie begann hier, nicht wie im Orient, mit Nasenbluten, dem sicheren Zeichen unvermeidlichen Todes, sondern es entstanden, bei Männern wie bei Frauen, zu Anfang Geschwülste in den Weichen und in den Achseln von verschiedenem Umfang, bis zur Größe eines Apfels oder eines Eies, welche das Volk Pestbeulen (Gavoccioli) nannte. Bald darauf erschienen ähnliche Geschwülste ohne Unterschied an allen Teilen des Körpers, und es zeigten sich schwarze oder blaue Flecke am Arm oder am Oberschenkel wie an allen anderen Stellen, entweder einzeln und groß, oder klein und dichtgedrängt. Und so wie die Pestbeulen zuerst als ein sicheres Todeszeichen angesehen wurden, so waren es diese Flecken für jeden, der sie bekam.8 Kein ärztlicher Rat, noch die Kraft einer Arznei brachte Hilfe, sondern es starben fast alle innerhalb der ersten drei Tage, nach dem Erscheinen jener Zeichen, einige früher, andere später, und die meisten ohne alles Fieber9 und andere Zufälle. Die Seuche aber griff um so wütender um sich, da sie sich von den Kranken den Gesunden mitteilte, wie das Feuer trockenen und fettigen Stoffen in seiner Nähe, und selbst das Berühren der Kleider und anderer Gegenstände, welche von den Verpesteten benutzt worden waren, die Krankheit zu übertragen schien. Nun wurden aber nicht nur Menschen von der Pest angesteckt, sondern auch Tiere erkrankten daran, und starben in kurzer Zeit, wenn sie Sachen von Erkrankten oder Verstorbenen berührt hatten. So sah Boccaccio mit eigenen Augen zwei Schweine auf den Lumpen eines an der Pest Verstorbenen nach kurzem Herumwerfen tot zusammenstürzen, als hätten sie Gift bekommen. An anderen Orten starben Hunde, Katzen, Hühner und andere Tiere scharenweise durch Pestansteckung,10 und es ist zu vermuten, daß auch andere Tierseuchen sich entwickelten, wenngleich die unkundigen Schriftsteller des vierzehnten Jahrhunderts hierüber schweigen.
In Deutschland wiederholten sich durchweg dieselben Erscheinungen, überall finden sich die untrüglichen Merkmale der morgenländischen Bubonenpest mit unabwendbarer Ansteckung, doch waren hier die Niederlagen bei weitem nicht so groß, wie in den übrigen Ländern Europas.11 Nicht alle Urkunden tun von dem Blutspeien Meldung, der eigentümlichen Zugabe dieser mörderischen Seuche, doch ist hieraus auf keine erhebliche Milderung oder Veränderung der Krankheit zu schließen. Denn es ist hierbei nicht nur die Unvollständigkeit der Chroniken in Anschlag zu bringen, sondern es wird auch einzelnen Angaben durch andere vielfältig widersprochen. So steht den Chroniken von Straßburg, die nur von Beulen und Drüsen in den Achseln und Weichen berichten,12 eine andere Angabe entgegen, wonach das tödliche Blutspeien in Deutschland vorgekommen ist,13 diese wird aber dadurch verdächtig, daß der Berichterstatter den Tod der davon Befallenen bis zum sechsten und achten Tage hinausschiebt, während kein anderer Schriftsteller einen so langen Verlauf des Übels bestätigt, und selbst in Straßburg, wo eine Milderung der Pest noch am leichtesten angenommen werden könnte, weil i. J. 1349 nur 16.000 Menschen weggerafft wurden, doch die meisten schon am dritten oder vierten Tage ihren Geist aufgaben.14 In Österreich, und hier besonders in Wien, war die Seuche vollkommen so bösartig, wie nur irgendwo, so daß die Kranken, die rote Flecke und schwarze Beulen hatten, wie die mit Drüsen Behafteten gegen den dritten Tag starben,15 und endlich zeigten sich an den Küsten der Nordsee wie in Westfalen plötzliche Todesfälle ohne weitere Entwicklung der Krankheit überaus häufig.16
Nach Frankreich kam die Pest südlich von Avignon her, und war hier verheerender, als in Deutschland, so daß an vielen Orten von zwanzig Einwohnern nur zwei überlebten. Viele wurden wie vom Blitz getroffen, und starben auf der Stelle, und zwar mehr Jugendkräftige, als Alte; mit Drüsen in den Achseln und Weichen brachten die Kranken kaum zwei oder drei Tage zu, und erschienen diese unheilbringenden Zeichen, so schlossen sie mit der Welt ab, und suchten nur noch Trost in dem Ablaß, den ihnen der Papst Clemens VI. in der Todesstunde verhieß.17
In England erschien das Überleben so wie in Avignon mit Blutspeien und mit derselben Tödlichkeit, so daß die Kranken, die mit diesem Zufall, oder auch mit Blutbrechen behaftet waren, entweder sogleich, oder in zwölf Stunden, oder höchstens in zwei Tagen dahinstarben.18 Die Brandbeulen und Drüsen in den Weichen und Achseln erkannte man bald als Verkündiger der tödlichen Krankheit, und ohne Hoffnung waren die verloren, denen sie in großer Zahl über den ganzen Körper entstanden. Schnitt man die harten und trockenen Beulen auf, so entquoll ihnen spärlicher Eiter, doch wagte man dies erst zu Ende der Seuche, und rettete damit noch viele Kranke, indem man die Natur zur kritischen Ausscheidung nötigte. Jeder Ort, den die Kranken berührt hatten, ihr Atem, ihre Kleider verbreiteten die Ansteckung, und wie überall wurden Angehörige und Freunde, die keine Gefahr sehen wollten, oder sie heldenmütig verachteten, Opfer ihrer Teilnahme. Selbst die Augen der Kranken hielt man für Quellen fernwirkender Verpestung19, sei es nun wegen ihres unheimlichen Glanzes oder der Entstellung, die sie in jeder Pest erleiden, oder einer uralten Vorstellung gemäß, die in dem Blick den Träger dämonischer Bezauberung erkennen wollte. Den Furchtsamen frommte nur selten die Flucht aus verpesteten Städten, denn der Keim des Übels haftete an ihnen, und sie erkrankten hilflos auf einsamen Landsitzen. So verbreitete sich die Seuche über England mit beispielloser Schnelligkeit, nachdem sie zuerst in der Grafschaft Dorset ausgebrochen war, von wo aus sie durch die Grafschaften Devon und Sommerset bis Bristol vordrang, und dann Glocester, Oxford und London erreichte. Wahrscheinlich wurden nur wenige Orte verschont, vielleicht gar keiner, denn die Jahrbücher der Zeitgenossen berichten, im ganzen Lande sei nur der zehnte Einwohner am Leben geblieben.20
Von England brachte ein Schiff die Ansteckung nach Bergen, der Hauptstadt von Norwegen, wo die Pest als dann in ihrer schrecklichsten Form mit Blutbrechen begann, und im ganzen Lande nur den dritten Teil aller Einwohner verschont ließ. Die Seefahrer fanden auf den Schiffen keine Freistätte, und oft sah man Fahrzeuge auf den Wellen treiben und stranden, deren Mannschaft bis auf den Letzten ausgestorben war.21
In Polen erkrankten die Verpesteten mit Blutspeien und starben innerhalb weniger Tage in so großer Anzahl, daß, wie versichert wird, kaum der vierte Teil der Einwohner übrig blieb.22
In Rußland endlich erschien die Pest erst zwei Jahre später, als im südlichen Europa, und wiederum mit denselben Zufällen, wie überall. Russische Zeitgenossen haben aufgezeichnet, sie habe mit Frost, Hitze, stechendem Schmerz in den Schultern und im Rücken begonnen, sei von Blutspeien begleitet gewesen, und in zwei, höchstens drei Tagen tödlich geworden. Erst im Jahre 1360 werden Drüsen am Halse, in den Achseln und in den Weichen erwähnt, die bei anhaltender Fortdauer des Blutspeiens erschienen wären. Nach den Erfahrungen im westlichen Europa kann aber nicht angenommen werden, daß diese Erscheinungen sich nicht schon früher gezeigt haben sollten.23
So viel nach urkundlichen Quellen über die Natur des schwarzen Todes. Die mitgeteilten Beschreibungen enthalten mit wenigen unwesentlichen Ausnahmen alle Zufälle, die in neuerer Zeit in der morgenländischen Pest beobachtet worden sind. Hierüber kann kein Zweifel obwalten, die Tatsachen liegen klar vor Augen. Man erinnere sich aber wohl, daß diese gewaltige Krankheit nicht immer in derselben Gestalt erscheint, sondern daß sie bei unverändertem Wesen des Giftes, das sie hervorbringt, und von ihr so reichlich aus dem Körper des Kranken ausgeschieden wird, proteusartig wechselt, von der unscheinbarsten fieberlosen Brandblase, die erst nach einiger Dauer ihr Gift nach dem Innern entsendet, und dann erst Fieber und Bubonen hervorruft, bis zu den mörderischen Formen, wo anthraxartige Entzündungen edle Eingeweide befallen. In einer solchen Form zeigte sich die Pest des vierzehnten Jahrhunderts, denn das sie begleitende Brustleiden, welches in allen Ländern erschien, aus denen uns Nachrichten erhalten worden sind, kann nach aller Vergleichung mit ähnlichen und bekannten Zufällen für kein anderes genommen werden, als für den Lungenbrand der neuern Heilkunde,24