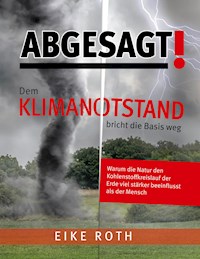Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Weltklimarat IPCC warnt: Um katastrophale Klimaentwicklungen zu vermeiden, muss der Mensch seine CO2-Freisetzungen so schnell wie möglich vollkommen einstellen. Das kann aber nur stimmen, wenn erstens CO2 der entscheidende Klimafaktor ist und wenn zweitens das viele CO2 in der Atmosphäre tatsächlich vom Menschen verursacht ist. Der erste Punkt, die hohe Klimawirksamkeit des CO2, ist wissenschaftlich massiv umstritten. Dieser Streit dürfte mittlerweile allgemein bekannt sein. Aber auch der zweite Punkt, die anthropogene Herkunft des vielen CO2, wird immer wieder angezweifelt. Das hört man viel seltener, es ist aber noch wichtiger, weil auf dieser Herkunft das gesamte Gebäude der menschengemachten Klimaänderung aufbaut. Um die Klärung dieser Frage geht es in diesem Buch. Es soll dem Leser helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Wichtige Diskussionspunkte sind insbesondere Fragen wie: Welchen Anteil des anthropogen freigesetzten CO2 entnehmen der Ozean und die Biomasse rasch wieder der Atmosphäre? Welche Freisetzungen sind notwendig, um den starken Anstieg der CO2-Konzentration und deren laufendes weiteres Wachsen erklären zu können? Welche Bedeutung haben die jahreszeitlichen Schwankungen der CO2-Konzentration? Was können wir aus dem Verlauf der 14CO2-Konzentration nach dem Atombombenteststopp lernen? Welche unterschiedlichen Wirkungen können natürlich freigesetzte und vom Menschen freigesetzte CO2-Moleküle haben? Welche Unterschiede gibt es im zeitlichen Verlauf der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre gegenüber dem radioaktiven Zerfall eines Gemisches instabiler Substanzen? Und noch einige andere mehr. In allen Punkten zeigt es sich, dass die Argumente gegen den überwiegenden Einfluss des Menschen auf die CO2-Konzentration sehr gute Chancen haben, richtig zu sein. Nach den Regeln der Physik spricht alles dafür, dass auch hier die Natur stärker ist als der Mensch. Wenn das stimmt, dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder bestimmt natürlich freigesetztes CO2 das Klima, oder es bestimmt gar nicht CO2 das Klima, sondern es wird von ganz anderen Faktoren bestimmt. Eine Reduktion der menschlichen CO2-Freisetzungen zum Schutze des Klimas macht in beiden Fällen keinen Sinn. Angesichts der gravierenden Konsequenzen müssen die Argumente sorgfältig ausdiskutiert werden. Dieses Buch möchte in gut verständlicher Form einen Beitrag dazu leisten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch
1 Einleitung
2 Sachstand, was wir einiger maßen gesichert wissen
3 Interpretation und Schlussfolgerungen durch IPCC
4 Die Missing Sink
5 Gegenargumente zu IPCC
6 Diskussion im einzelnen
6.1 Vorbemerkungen
6.2 Der Kohlenstoffkreislauf
6.3 Speicher-Grundgesetze
6.4 Grundsätzliches zum Verhalten von CO
2
in der Atmosphäre
6.5 Natürliche Umwälzung
6.5.1 Entstehung
6.5.2 Der Kreislauf zwischen Atmosphäre und Biomasse
6.5.3 Der Kreislauf zwischen Atmosphäre und Ozean
6.5.4 Der »3er-Pack« und der tiefe Ozean
6.5.5 Rückkopplungen
6.5.6 IPCC widerspricht sich
6.5.7 Fehlerbetrachtung
6.5.8 Kurzfassung
6.6 Zwischenbemerkung
6.7 Der kontinuierliche Anstieg der Konzentration
6.8 Hoch sein und schnell wachsen
6.9 Die jahreszeitlichen Zyklen
6.10 Vergleich mit IPCC
6.10.1 Modelle
6.10.2 Vergleiche
6.10.3 Gedankenexperiment 1
6.10.4 Gedankenexperiment 2
6.10.5 Gedankenexperiment 3
6.10.6 Ergebnis
6.10.7 Ein grundsätzliches Problem
6.11 Der falsche Blickwinkel
6.12 Was hat die erhöhte CO
2
-Konzentration verursacht?
6.12.1 Vorbemerkung
6.12.2 Nur die anthropogenen Freisetzungen?
6.12.3 Eine Senke ist keine Quelle
6.12.4 Einfrieren der Freisetzungen auf ihrem heutigen Niveau
6.12.5 CO
2
-Zusammensetzung proportional zu den Quellstärken
6.12.6 Sauerstoff in der Atmosphäre
6.13 Das Zeitkonstanten-Problem
6.13.1 Eingangsbemerkungen
6.13.2 Vorüberlegungen
6.13.3 Die »adjustment time« nach IPCC
6.13.4 Konzentrationsanpassung aus physikalischer Sicht
6.13.5 Die dritte Version oder die Gleichgewichtsfrage
6.13.6
14
CO
2
6.13.7 Die Bedeutung der Zeitkonstanten
6.14 50 % Verbleib?
6.14.1 Keine physikalische Grundlage?!
6.14.2 Erklärungsversuch
6.14.3 Die Bezugsgröße
6.14.4 Experimentelle Überprüfung
6.15 CO
2
als entscheidender Klimafaktor?
6.16 Das Bern Carbon Cycle Model
6.16.1 Eine Summe abfallender e-Potenzen
6.16.2 Addition von Impulsantworten
6.16.3 Ein Kreisschluss?
6.16.4 Der grundlegende Unterschied
7 Was tun?
8 Zusammenfassung
Literatur
Über den Autor
Zu diesem Buch
Seit gut vier Jahrzehnten beschäftige ich mich intensiv mit dem Einfluss des Menschen auf das Klima. Die meisten damals diskutierten Gegenargumente erwiesen sich sehr schnell als nicht haltbar. Herausgreifen möchte ich nur das angebliche Topargument: den vermeintlichen Widerspruch zum Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Vereinfacht ausgedrückt sagt der Zweite Hauptsatz aus, dass Wärme von selbst immer nur von einem wärmeren zu einem kälteren Körper übergehen kann, nie umgekehrt. Die Erde ist aber wärmer als die Atmosphäre. Es wäre daher unmöglich, dass die Atmosphäre die Erde erwärmt, infolge des Zweiten Hauptsatzes wäre der Treibhauseffekt ein physikalisches No-Go, wurde gesagt (und wird zum Teil auch heute noch gesagt). Das ist aber eindeutig ein Missverständnis: Der Zweite Hauptsatz regelt nur den Netto-Wärmeaustausch, es darf sehr wohl auch Wärme vom kälteren zum wärmeren Körper transportiert werden, solange nur gleichzeitig mehr Wärme in der umgekehrten Richtung transportiert wird. Beim Strahlungsaustausch zwischen zwei Körpern passiert das sogar immer so: Der kältere Körper strahlt aufgrund seiner Temperatur Wärme ab, in alle Richtungen, also unvermeidbar auch zum wärmeren Körper hin. Der zweite Hauptsatz regelt nur, dass der wärmere Körper immer noch mehr Wärme zum kälteren Körper hin strahlt. Und wenn der kältere Körper näher an die Temperatur des wärmeren herangeführt wird, dann strahlt er eben etwas mehr in Richtung des wärmeren Körpers, aber immer noch weniger als der wärmere Körper auf ihn strahlt. Entsprechend wird jeder (konstant) beheizte Körper wärmer, wenn seine Umgebung wärmer wird! Z. B. wird es in einem konstant beheizten Haus wärmer, wenn die Außentemperatur steigt.
Beim Haus sind das Alltagserfahrungen, aber die Erde kann sich nicht anders verhalten. Wenn die Atmosphäre mehr CO2 enthält, dann strahlt sie mehr Wärme in Richtung auf die von der Sonne konstant geheizte Erde und macht diese dadurch wärmer, auch wenn die Atmosphäre selbst kälter ist als die Erde. Es gibt also den Treibhauseffekt, daran führt kein Weg vorbei! Man kann nur darüber diskutieren, wie groß er ist.
Auch andere Gegenargumente waren nicht viel besser. Konsequenterweise habe ich die Sorge vor der menschengemachten globalen Erwärmung damals für prinzipiell berechtigt gehalten. Ich habe das auch in vielen Diskussionen, Veröffentlichungen und auch in Vorlesungen so vertreten, nicht zuletzt auch in drei populärwissenschaftlichen Büchern. Die Menschheit verhielt sich zwar nicht so, wie sie sollte, aber wie sie sich verhalten sollte, das schien klar zu sein.
Kurz nach 2000 kam dann aber die Überraschung: Die allgemeine Erwärmung verlief deutlich langsamer als von den meisten Klimamodellen vorausgesagt. Irgendetwas konnte ganz einfach nicht stimmen! Das ist in der Wissenschaft eigentlich nichts Besonderes, neue Erkenntnisse gibt es bei ihr immer wieder und fast überall. Dann muss eben nachjustiert werden. Aber die Argumente, mit denen die »alten Klima-Ansichten« verteidigt wurden (und vielfach auch heute noch verteidigt werden!), die schienen mir oft wissenschaftlich nicht haltbar zu sein. Das machte stutzig. Genügt dann ein Nachjustieren, oder sind grundlegendere Änderungen notwendig? Und wenn erst einmal das Vertrauen verloren ist, dann schaut man überall genauer hin. Mit diesem Blickwinkel zeigten sich dann in den Aussagen der »etablierten Klimawissenschaft« zahlreiche Ungereimtheiten, auch äußerst gewichtige Ungereimtheiten! Der Verdacht wurde immer stärker, dass mehr als nur einfaches Nachjustieren unumgänglich ist. Ein paar Beispiele für die Ungereimtheiten:
Die Erwärmung der letzten 150 Jahre ist beispiellos, wird gesagt: Das ist jedoch
höchstwahrscheinlich falsch!
Im Übergang von der letzten Eiszeit zur heutigen Warmzeit (der genaue Name ist übrigens »Zwischeneiszeit«, denn in einer »richtigen Warmzeit« sind beide Pole eisfrei) hat sich das Klima zweifelsfrei viel stärker (und wahrscheinlich auch viel schneller) erwärmt als es das heute tut, und zwischenzeitlich war es schon drei Mal mindestens so warm, wie es heute ist (»Neolithisches Klimaoptimum«, »Römisches Klimaoptimum«, »Mittelalterliches Klimaoptimum«). »Beim Klima nichts Neues«, könnte man zum heutigen Zustand sagen.
Die Erwärmung der letzten 150 Jahre ist schlecht, wird gesagt: Auch das ist
höchstwahrscheinlich falsch!
Wenn man den Historikern glauben darf, ging es der Menschheit insgesamt in den genannten Klimaoptima immer besser (kulturelle Blütezeiten!) als in den kälteren Zeiten dazwischen (Völkerwanderung, Verfall, Armut und Hunger!). Warum soll sich dieses Schema plötzlich geändert haben? Wo das »wahre Klimaoptimum« liegt, kann niemand verlässlich sagen, vermutlich aber bei
höherer
Temperatur als heute!
Die Erwärmung verstärkt extreme Wetterereignisse, wird gesagt: Auch das ist
höchstwahrscheinlich falsch!
Detaillierte Statistiken zeigen jedenfalls
keine Zunahme
von Wirbelstürmen und dergleichen. Durch Extremwetter verursachte Todesfälle sind in den letzten 100 Jahren sogar zweifelsfrei
stark zurückgegangen
, trotz starken Bevölkerungswachstums.
Bedrohlicher
ist das »Klima« wohl
eindeutig nicht
geworden!
CO
2
ist ein Schadstoff, wird gesagt: Das ist so
mit Sicherheit falsch!
CO
2
ist lebensnotwendig,
ohne CO
2
würde es kein Leben auf der Erde geben
, auch uns Menschen nicht! Und das CO
2
hilft uns auch gegen den immer noch weit verbreiteten Hunger, weil Nahrungsmittelpflanzen bei mehr CO
2
nachgewiesenermaßen
besser wachsen
als bei weniger CO
2
(»CO
2
-Düngeeffekt«). Warum wird dieser gesicherte(!) Effekt nicht dem umstrittenen(!) Klimaeinfluss
gegengerechnet?
Die Klimawirksamkeit von CO
2
ist hoch, wird gesagt: Das ist zumindest
massiv umstritten!
Eine hohe Klimawirksamkeit wird nur in umstrittenen Klimamodellen errechnet, deren Ergebnisse mit den Beobachtungen nur schlecht übereinstimmen. Bei einem Widerspruch zwischen Modell und Beobachtung sollte grundsätzlich primär
das Modell
in Frage gestellt werden. Beim Klima ist aber auch das anders. Warum?
Die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Ich gewann immer mehr den Eindruck, dass ich mich gravierend getäuscht hatte. Das Klimaproblem ist in wichtigen Teilen anders, wohl ganz anders, als ich es zunächst eingeschätzt hatte. Ich musste meine früheren Aussagen widerrufen. Die Erkenntnis war vielfach schmerzhaft und hat mir im Kollegenkreis verständlicherweise nicht nur Zustimmung eingebracht. Aber das Umdenken war meines Erachtens unumgänglich.
Vor einigen Jahren habe ich dann nach vielen Einzel-Wortmeldungen versucht, die vielen Problempunkte rund um das Klimaproblem zusammenzuschreiben. Herausgekommen ist das Buch »Probleme beim Klimaproblem – Ein Mythos zerbricht« (Roth, 2019). Das Buch zeigt, dass sehr vieles in der vorherrschenden Darstellung zum »Klima« nicht stimmen kann oder zumindest äußerst fragwürdig ist, siehe auch die oben aufgezählten Beispiele. Aufgenommen worden ist das Buch größtenteils sehr positiv, nur haben die meisten »etablierten Klimawissenschaftler« es leider konsequent ignoriert und sich Diskussionen über seine Aussagen entzogen. Das finde ich sehr schade, denn »Wahrheit« kann man m. E. nur durch offene Diskussionen herausfinden.
Beim Schreiben des »Probleme«-Buches bin ich auch erneut auf einen alten Diskussionspunkt gestoßen: Woher kommt das viele CO2 in der Atmosphäre? Die Ansicht »nicht vom Menschen«, gab es auch schon zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem Klimaproblem. Aber damals schienen alle Argumente gegen den Treibhauseffekt und den menschengemachten Klimawandel nicht haltbar zu sein, warum sollte gerade dieses eine Ausnahme bilden? Wenn der Mensch sogar doppelt so viel CO2 in die Atmosphäre pustet, wie sich in dieser ansammelt, woher sonst soll denn dann das viele CO2 kommen? Außerdem hat die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre genau in dem Maße abgenommen, wie es zur Verbrennung der fossilen Energieträger passt. Das bestätigt, wurde gesagt, diese Verbrennung als Ursache des CO2-Anstieges und das klang plausibel. Also hatte ich mich damit zufriedengegeben, dass das mit dem anthropogenen Ursprung des vielen CO2 schon seine Richtigkeit haben würde und ich hatte nicht weiter nachgedacht. Bei den Recherchen zu dem Buch sind dann aber auch da Zweifel aufgetaucht. Aber das Buch sollte fertig werden. Herausgekommen ist dann ein Anhang, in dem erhebliche Zweifel am anthropogenen Ursprung des vielen CO2 in der Atmosphäre angemeldet wurden.
Aber beschäftigt hat mich das Thema natürlich weiter. Das CO2 in der Atmosphäre ist Teil des Kohlenstoffkreislaufes der Erde und der ist zumindest in Teilbereichen kompliziert. Und viele Begriffe und Aussagen sind unpräzise und daher die Ursache von Missverständnissen. Je tiefer ich eingestiegen bin, desto mehr haben sich die Zweifel am anthropogenen Ursprung verfestigt. Daraus ist dann ein zweites, klimakritisches Buch geworden: »Abgesagt! – Dem Klimanotstand bricht die Basis weg« (Roth, 2020). Darin werden die Zweifel an der anthropogenen Herkunft untermauert.
Auch dieses Buch hat ein zweigeteiltes Schicksal erlitten: weitgehende Zustimmung von Menschen, die die These vom katastrophalen menschengemachten Klimawandel eher skeptisch sehen, und praktisch vollständiges Ignorieren von Seiten der »etablierten Klimawissenschaft«. Die Zustimmung hat mich natürlich wieder gefreut, aber sie war diesmal nicht mehr so einheitlich wie beim Probleme-Buch. Ich habe gelernt, dass gar nicht so wenige »Klimaskeptiker« im Laufe der Zeit ihre je eigene Meinung zum Kohlenstoffkreislauf entwickelt haben. Das kann als Zeichen einer »nicht gesättigten Wissenschaft« aufgefasst werden, also als eine Art Warnzeichen. Das finde ich prinzipiell gut, so funktioniert in meinen Augen Wissenschaft. Dass diese »Klimaskeptiker« dann aber zu einer offenen Diskussion über die tatsächlich »richtige« Lösung vielfach genauso wenig bereit waren (und oft leider auch noch sind) wie viele »etablierte Klimawissenschaftler«, das bedauere ich sehr. »Wissenschaft« wird nur weiterentwickelt, indem man kontroverse Meinungen zulässt und sie dann offen ausdiskutiert. Das scheint in der heutigen Zeit schwierig zu sein.
Aber wenn man sie sucht, dann findet man auch Diskussionen. Damit erhält man auch Ansatzpunkte, wo man nochmals vertieft nachdenken muss. Und daraus resultierten dann z. T. auch neue Erkenntnisse. Dabei sind die prinzipiellen Aussagen aus dem Buch »Abgesagt!« voll bestätigt worden, aber es hat sich gezeigt, dass einige Zusammenhänge detaillierter beschrieben werden müssen und dass sich dann manche Zahlen doch auch merklich ändern. Auf der anderen Seite scheint mir die Beweisführung jetzt noch zwingender zu sein. Die Regeln der Physik und der Logik lassen eigentlich gar keine andere Schlussfolgerung zu: Bei der »etablierten Klimalehre« stimmt der Ansatz nicht! Daher jetzt der nochmalige Versuch einer geschlossenen Darstellung der Problematik. Hierzu dieses Buch »Das große Klima-Rätsel: Woher kommt das viele CO2?«.
Das Buch konzentriert sich streng auf den Kern des ganzen Klimaproblems: Woher kommt das viele CO2 in der Atmosphäre? Es wird gezeigt, dass die Argumente für eine natürliche Herkunft gar nicht so schlecht sind. Offensichtlich ist auch hier die Natur stärker als der Mensch. Wenn sich das bewahrheitet, dann fällt mit einem Schlag gleich die ganze Basis für den menschengemachten Klimawandel weg! Denn dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder wird das Klima von natürlich freigesetztem CO2 bestimmt, oder es wird gar nicht von CO2 bestimmt, sondern von ganz anderen Einflussfaktoren!
In beiden Fällen ist eine Reduzierung unserer CO2-Freisetzungen nicht erforderlich (jedenfalls nicht zum Schutz vor Erwärmung) und wir können weiterhin kostengünstige fossile Energie zum Bekämpfen von Hunger und Elend in der Welt und zum Anheben des Lebensstandards der Armen einsetzen. Das »Klimaproblem« sieht dann völlig anders aus: An die Stelle des Versuches, Klimaänderungen zu vermeiden, muss das Bemühen treten, Klimafolgen möglichst gut abzufedern.
Das Buch möchte mit verbesserten Argumenten den Anstoß geben, die tatsächliche Herkunft des vielen CO2 in der Atmosphäre in offener und detaillierter Diskussion zu klären. Weil die »etablierte Klimawissenschaft« die Diskussion ohnehin weitgehend verweigert, habe ich mir die größte Mühe gegeben, es auch für Nicht-Fachleute so verständlich wie möglich zu schreiben. Und ich möchte alle einladen, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen. »Wage es, zu wissen« war das Motto der Aufklärung. Ich möchte das ein klein wenig an die heutige Zeit anpassen: »Wage es, dir deine eigene Meinung zu bilden«. Ich hoffe, dass das mit diesem Buch etwas leichter fällt.
1 Einleitung
»Klima« ist der langjährige Durchschnitt von Wetter. Das Klima auf der Erde hat sich immer schon geändert, es hat sich in den letzten 150 Jahren geändert (es ist wärmer geworden) und es wird sich auch zukünftig ändern (wir wissen nur nicht, wohin!). Als Ausgangspunkt für Diskussionen des derzeitigen Klimas wird meist das Jahr 1850 genommen (der Weltklimarat IPCC nimmt sogar das Jahr 1750, aber der Unterschied ist nicht groß). Dabei ergeben sich jedoch drei Probleme: Erstens ist es nicht gesichert, dass 1850 Gleichgewicht geherrscht hat (was IPCC aber annimmt), zweitens ist 1850 auch das Ende der Kleinen Eiszeit (die ihren Höhepunkt ca. 1650 hatte) und drittens markiert 1850 auch den Anfang der Industriellen Revolution (die den Menschen erst in die Lage versetzt hat, zumindest theoretisch die CO2-Konzentration nennenswert zu beeinflussen; ob er das auch tatsächlich getan hat, ist Gegenstand des Buches). Wir haben also eine unsichere Ausgangslage, wir wissen nicht, wie sich das Klima nach dem Ende der Kleinen Eiszeit »von selbst« entwickelt hätte und wir wissen nicht, wie stark der Mensch zur CO2-Konzentrationserhöhung beigetragen hat.
In diesem Buch wird gezielt der letzte Punkt untersucht. Auf den kommt es auch an: Wenn die anthropogenen Freisetzungen tatsächlich untergeordnet sind, wenn also die Natur auch hier stärker ist als der Mensch, dann kann die Klimawirksamkeit des CO2 so hoch sein wie sie will, die anthropogenen Freisetzungen können trotzdem keinen nennenswerten Einfluss auf das Klima haben! Der Forderung, die anthropogenen CO2-Freisetzungen zu reduzieren, bricht dann schlichtweg die Grundlage weg. Es wird gezeigt, dass das höchstwahrscheinlich genauso ist.
2 Sachstand, was wir einigermaßen gesichert wissen
Wirklich messen können wir nur die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Seit 1958 geschieht das kontinuierlich und sorgfältig, siehe Abb. 1. Der Anstieg verlief einigermaßen gleichmäßig entlang einer Exponentialkurve, überlagert durch jahreszeitliche Zyklen in der Höhe von ca. 6 ppm, die durch Fotosynthese der Pflanzen im Frühjahr und Sommer und Verrottung von Blättern und dergleichen im Herbst und Winter erklärt werden, mit Schwerpunkt auf der Nordhalbkugel. Einigermaßen genau bekannt sind auch noch die anthropogenen Freisetzungen, die hauptsächlich infolge der Verbrennung fossiler Energieträger erfolgen. Andere CO2-Flüsse können nur grob abgeschätzt werden.
Für die nachfolgenden Überlegungen sind insbesondere die folgenden fünf Aussagen wichtig:
2.1 Vor Beginn der Industriellen Revolution etwa Mitte des 19. Jahrhunderts waren in der Atmosphäre ca. 280 ppm CO2 enthalten (0,028 %).
2.2 Jährlich wurde etwa ein Viertel des CO2-Inventars der Atmosphäre zwischen dieser und dem Ozean und der Biomasse ausgetauscht (»natürliche Umwälzung«). Dieser Wert ist nur grob bekannt: (IPCC, 2013) gibt ca. 80 ppm / a an, mit einer Unsicherheit von »mehr als ± 20 %«. Entnahme und Rückgabe müssen aber gleich groß gewesen sein, wenn Gleichgewicht geherrscht haben soll.
2.3 Zu diesen natürlichen Freisetzungen von ca. 80 ppm / a sind als Folge der Industrialisierung noch die anthropogenen CO2-Freisetzungen hinzugekommen. Heute betragen diese etwas mehr als 4 ppm / a. Außerdem haben sich auch noch andere Parameter geändert, z. B. ist es wärmer geworden.
2.4 Heute sind ca. 410 ppm CO2 in der Atmosphäre vorhanden und die Konzentration wächst jährlich um ca. 2 ppm weiter.
2.5 Der allmähliche Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre wird durch jahreszeitliche Zyklen in der Höhe von ca. 6 ppm überlagert (Abb. 1).
Abb. 1: Entwicklung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre 1958–2021: Kontinuierlicher Anstieg, Überlagerung durch jahreszeitliche Zyklen; gemessen auf dem Mauna Loa, Hawaii. Quelle: Wikipedia (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).
Anmerkung: CO2-Mengen können entweder als Zahl der Moleküle oder als Masse in kg oder t angeben werden, wobei oft auch nur die Masse des im CO2 enthalten C angegeben wird (Umrechnungsfaktor 3,66). Man kann CO2-Mengen aber auch aus der Relation von Inventar und Konzentration in der Atmosphäre angeben: 1 ppm Konzentration (in der Atmosphäre) entspricht 2,13 Gt C bzw. 7,8 Gt CO2. Wendet man diese Einheit »ppm« auf CO2-Flüsse oder auf CO2-Inventare in anderen Reservoiren an, muss man berücksichtigen, dass sie die Menge angibt, die in der Atmosphäre diese Konzentration ergibt.
3 Interpretation und Schlussfolgerungen durch IPCC
Die grundlegende Annahme von IPCC wird in Ziff. 3.1 wiedergegeben und die wichtigsten daraus gezogenen Schlussfolgerungen werden in den Ziff. 3.2 bis 3.4 genannt (IPCC, 2007, 2013, 2018, 2021):
3.1 Feste »airborne fraction«: Den Anstieg der CO2-Konzentration um ca. 2 ppm / a bei anthropogenen Freisetzungen von ca. 4 ppm / a interpretiert IPCC als Verbleib von etwa der Hälfte der anthropogenen Freisetzungen in der Atmosphäre. Und das ist, wieder nach IPCC, nicht zufällig so, sondern es gilt immer, sodass sich eine feste »airborne fraction« von ca. 50 % ergibt, unabhängig von der Höhe der anthropogenen Freisetzungen und unabhängig von der erreichten Konzentration.
Solche Aussagen macht IPCC oft, als Beispiel sei eine Formulierung aus (IPCC, 2021) zitiert: »Over the past six decades, the average fraction of anthropogenic CO2 emissions that has accumulated in the atmosphere (referred to as the airborne fraction) has remained nearly constant at approximately 44 %« (übersetzt: »Über die letzten sechs Jahrzehnte ist der mittlere Anteil der anthropogenen CO2-Emissionen, der sich in der Atmosphäre angesammelt hat (als »airborne fraction« bezeichnet) angenähert gleich bei ca. 44 % geblieben«). Als Folge der festen airborne fraction ist der Anstieg der Konzentration von 280 auf 410 ppm ausschließlich auf die anthropogenen Freisetzungen zurückzuführen. So sieht das jedenfalls IPCC. Hierzu wieder beispielhaft eine Formulierung aus (IPCC, 2021): »It is unequivocal that the increase of CO2 … in the atmosphere over the industrial era is the result of human activities« (übersetzt: »Es ist unwidersprochen, dass die Zunahme von CO2 … in der Atmosphäre im Industriezeitalter das Resultat menschlicher Aktivitäten ist«).
Ergänzung: Dieses »50 %-Modell« geht, wie der Name sagt, vom Zuwachs der Konzentration um die Hälfte der anthropogenen Freisetzungen aus. IPCC und auch viele andere Wissenschaftler verwenden es sehr häufig. Der genaue Wert schwankt zwar in den einzelnen Arbeiten ein klein wenig (oben habe ich 44 % zitiert), doch sind die Abweichungen zu 50 % immer nur klein. Davon zu unterscheiden ist ein anderes Modell, das von IPCC vor allem für verfeinerte Rechnungen eingesetzt wird und nach einer Forschergruppe aus Bern »Bern Carbon Cycle Model« genannt wird. Auf Besonderheiten dieses Modells wird in Ziff. 6.16 näher eingegangen. Hier sie nur vorweg gesagt, dass bei diesem Modell nicht ca. 50 % der anthropogenen Freisetzungen langfristig in der Atmosphäre verbleiben, sondern nur ca. 20 % (IPCC, 2007).
3.2 Steigende Konzentration: Weil immer ca. 50 % verbleiben, steigt die CO2-Konzentration immer weiter, solange die anthropogenen Freisetzungen nicht vollständig eingestellt werden.
3.3 Steigende Erwärmung: Weil CO2 der entscheidende Klimafaktor ist, steigt mit der Konzentration auch die Klimaerwärmung immer weiter an. Die anthropogenen Freisetzungen müssen daher unbedingt auf null reduziert werden (»zero carbon«).
3.4 Festes CO2-Budget: Als Folge des obigen entspricht einer jeden vorgegebenen Klimagrenze, z. B. Erwärmung um maximal 2° C, eine bestimmte CO2-Konzentration in der Atmosphäre und dieser Konzentration entspricht eine bestimmte Gesamtmenge an anthropogen freigesetztem CO2 (»festes CO2-Budget«). Dieses »feste CO2-Budget« darf, unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Freisetzungen, nicht überschritten werden, wenn die Grenze eingehalten werden soll.
Zur Klarstellung: Das »feste CO2-Budget« ist beim Bern Carbon Cycle Model infolge des geringeren Verbleibs natürlich deutlich größer als beim »50 %-Modell«, aber die Problematik ist grundsätzlich die gleiche.
4 Die Missing Sink
Die grundlegende Annahme von IPCC ist Ziff. 3.1: Die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre ist abhängig von der Freisetzung in die Atmosphäre!