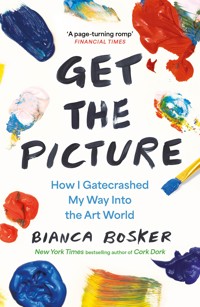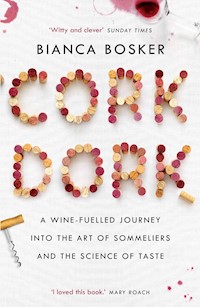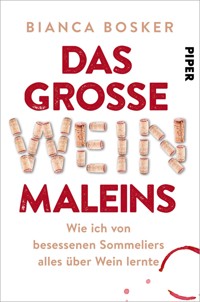
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Weintrinken will gelernt sein Es gibt Menschen, die innerhalb von Sekunden aus einem Schluck Wein die Rebsorte, die Anbauregion, das Weingut und den exakten Jahrgang herausschmecken. Als Bianca Bosker eher zufällig von der Olympiade für Sommeliers hört, ist sie sofort fasziniert von deren geschmacklichem Können. Sie kündigt ihren Job und heftet sich ein Jahr an die Fersen der renommiertesten Weinkenner, um ihre Kunst zu erlernen. Als Leser erfahren wir im Zuge ihres Abenteuers, wie wir unseren Geschmackssinn mit Weinverkostung schulen können, was Orangensorten damit zu tun haben, wann Wein nach Sattelleder schmeckt und dass Flaschenpreise von über 50 Euro kein Indikator für Qualität sind. Ein großes Lesevergnügen für alle Weinkenner und solche, die es werden wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.deFür Matt
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Viola Krauß© Bianca Bosker, 2017Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Cork Dork« bei Penguin Books, New York 2017Deutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotive: iStock/VasjaKomanIllustrationen: Designed by macrovector/FreepikSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Einleitung
Die Blindverkostung
1 Die Ratte
2 Der Geheimbund
3 Der Showdown
4 Der Grips
5 Das Zauberreich
6 Die Orgie
7 Die Qualitätskontrolle
8 Die zehn Gebote
9 Der Auftritt
10 Die Prüfung
11 Das Kellnern
Epilog
Die blindeste Verkostung von allen
Danksagung
Bibliografie (Auswahl)
Einleitung
Die Blindverkostung
Von Parfüm musste ich mich als Erstes verabschieden, aber das hatte ich nicht anders erwartet. Dann folgten parfümierte Waschmittel und schließlich Trocknertücher. Die Finger von rohen Zwiebeln oder scharfen Soßen zu lassen machte mir nichts aus. Kein Salz ins Essen zu tun war zunächst hart, dann eine Zeit lang erträglich und danach zum Heulen. Wenn ich auswärts aß, schmeckte alles so, als ob es in Salzlauge getaucht worden war. Den Mund nicht mehr mit Listerine zu spülen war nicht so tragisch; stattdessen Zitronensäurelösung und mit Wasser verdünnten Whiskey zu verwenden hingegen schon. Schlimm wurde es, als ich Kaffee verbannte. Doch zu diesem Zeitpunkt war ich es bereits gewohnt, morgens etwas schwerer in die Gänge zu kommen. Nüchternheit am helllichten Tag gehörte der grauen Vorzeit an, genau wie sämtliche Heißgetränke, Zahnschmelz auf meinen Zähnen und ein Vorrat an Kopfschmerztabletten.
Das alles war Teil meines Entzugsprogramms, das ich mir auf Anraten von über zwei Dutzend Sommeliers zusammengeschustert hatte, die im Verlauf von anderthalb Jahren zu meinen Mentoren, Peinigern, Ausbildungsoffizieren, Chefs und Freundinnen und Freunden wurden.
Sie fragen sich vielleicht, wieso ich mich achtzehn Monate lang von einem Haufen Flaschenschubsern in feinem Zwirn habe coachen lassen. Sommeliers sind schließlich nichts anderes als bessere Kellner mit schickem Namen (somm-el-jee), die speisende Gäste unter Druck setzen, ihr Geld für Wein zu verprassen, oder etwa nicht?
So ungefähr stellte ich mir das jedenfalls vor, bis ich mich in die Hände eines elitären Sommelier-Klans begab, für den das Servieren von Wein nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensart darstellte, ein Leben für den Geschmack vor allen Dingen. Sie nehmen an hochkarätigen Wettbewerben und Meisterschaften teil (teilweise während sie im neunten Monat schwanger sind), hantieren mit millionenschwerem flüssigem Gold und möchten gerne die Welt davon überzeugen, dass die Schönheit des Geschmacks auf die gleiche Ebene wie die Schönheit der Kunst und der Musik gehört. Sie beobachten den Wetterbericht, um zu wissen, ob es nasebetäubenden Regen geben wird, und sie lecken an Steinen, um ihre Geschmacksknospen zu trainieren. Zahnpasta ist eine Bürde. Sie beschweren sich über diesen elenden Geschmack nach »neuem Glas« und opfern für den Zungenzirkus sogar ihre Ehe. Mir sagte einmal ein Sommelier, dessen Frau sich wegen seines obsessiven Lernverhaltens von ihm scheiden ließ: »Wenn ich mich zwischen der bestandenen Prüfung und meiner letzten Beziehung entscheiden müsste, würde ich mich für die bestandene Prüfung entscheiden, ganz klar.« Ihre Aufgabe besteht im Wahrnehmen, Analysieren, Beschreiben und Erklären der Geschmacksvariationen einer Flüssigkeit, die von Bestandteil zu Bestandteil das komplizierteste Getränk der Erde ist. »Aberhunderte flüchtige Stoffe gibt es darin. Polysaccharide. Proteine. Aminosäuren. Biogene Amine. Organische Säuren. Vitamine. Carotinoide«, erklärte mir ein Önologie-Professor. »Beim Wein handelt es sich um die komplexeste Matrix, die es gibt. Komplexer ist nur das Blut.«
Was bedeutet dieser Fokus auf solch minutiöse Geschmacksunterschiede? Das war mir selbst nicht wirklich klar. Zumindest nicht, als ich mit der ganzen Sache anfing. Ich bin zu diesen Sommeliers gestoßen, weil ich wissen wollte, was das für ein Leben in der Extremzone des Geschmacks war und wie sie dorthin gelangt waren. Das Ganze wandelte sich irgendwann zur Frage, ob ich selbst wohl auch dorthin gelangen könnte – ob jede x-beliebige Person das könnte – und was sich beim Erreichen meines Ziels wohl ändern würde.
Doch seien Sie gewarnt:
Ein Glas Wein mag für Sie einen Wohlfühlmoment darstellen. Den Moment, in dem Sie es sich nach einem langen Tag gut gehen lassen, in dem Sie einen Teil Ihres Gehirns abschalten. Wenn das so bleiben soll, dann machen Sie einen großen, großen Bogen um die Personen in diesem Buch.
Wenn Sie sich jedoch irgendwann einmal gefragt haben, was dieses ganze Brimborium beim Thema Wein eigentlich soll, ob es wirklich einen erkennbaren Unterschied zwischen einer 20-Euro- und einer 200-Euro-Flasche gibt, oder was wohl passieren würde, wenn Sie selbst es wären, die Ihren Sinnen alles abverlangten – nun, in diesem Fall würde ich Sie gerne mit ein paar Leuten bekannt machen.
Mit meiner persönlichen Wein-Offenbarung verhielt es sich ein wenig anders: Sie passierte am Computerbildschirm. Und ich war nicht einmal am Trinken – ich sah lediglich anderen dabei zu.
Damals arbeitete ich als IT-Journalistin und schrieb für eine netzbasierte Nachrichtenseite über die Googles und Snapchats dieser Welt, und das allermeiste verrichtete ich am Bildschirm. Ein halbes Jahrzehnt war ich auf IT-Streife gewesen, hatte virtuelle Artikel über virtuelle Dinge in virtuellen Universen geschrieben, die man nicht schmecken, fühlen, anfassen oder riechen konnte. »Eindringlich« waren für mich nur Webseiten mit richtig großen digitalen Fotos, und »riechen« konnte ich lediglich Ärger – Körpergeruch, Mittagessen mit einer Kollegin, ausgelaufene Milch im Bürokühlschrank. Einmal ließ ich jemanden einen Artikel schreiben mit dem Titel: »Wie man auf Google Street View Urlaub machen kann«, als ob das Scrollen durch unscharfe Fotos vom Waikoloa-Strand auf Hawaii ein ernst zu nehmender Ersatz für das Herumlümmeln in der späten Nachmittagssonne mit Mai Tai in der Hand wäre.
Eines Sonntagabends schleppte mich mein damaliger Freund und heutiger Ehemann in ein Restaurant am südlichen Rand des Central Park. Es war die Art Restaurant, die sich damit rühmte, mit Essen so zu verfahren, wie es J. P. Morgan angeblich mit Jachten tat: Wer nach dem Preis fragt, kann es sich nicht leisten. Normalerweise würde ich mich aus Angst vor dem – finanziellen und vielleicht auch seelischen – Bankrott von solch einem Ort fernhalten, aber wir sollten seinen Kunden Dave treffen. Und Dave war Weinliebhaber.
Ich persönlich mochte Wein ungefähr so, wie ich tibetische Puppenspiele oder die Theorie der Teilchenphysik mochte, was so viel heißen soll wie: Ich hatte keine Ahnung, was da eigentlich passierte, war aber bereit zu lächeln und zu nicken. Die Ergründung dieser Fachgebiete schien mir die Anstrengung kaum Wert zu sein. Dave sammelte Weine aus dem Bordelais. Meine Einschätzung ging damals so weit, dass ich Weine im Allgemeinen aus der Flasche bevorzugte, aber bei Wein im Karton hätte ich sicherlich auch nicht die Nase gerümpft.
Kaum hatten wir uns gesetzt, erschien auch schon der Sommelier. Ein alter Bekannter von Dave natürlich. Nachdem er ein paar Plattitüden von wegen »guter Jahrgang« und »elegante Nase« von sich gegeben hatte, verschwand er, um uns eine Flasche zu holen, und goss Dave bei seiner Rückkehr einen Schluck zum Probieren ein. »Absolut trinkig«, murmelte der Sommelier. Was für ein Unsinnswort. Soviel ich weiß, ist der Wein einfach nur »süffig«.
Während die beiden mit großem Ohhh und Ahhh die vortrefflichen Grafit- und Teeraromen bewunderten, schaltete ich innerlich ab. Doch dann erwähnte der Sommelier, dass er sich gerade auf den Wettbewerb zum World’s Best Sommelier vorbereitete.
Wie bitte?
Der Gedanke erschien mir zunächst komplett lächerlich. Das Servieren von Wein, ein Wettkampfsport? Öffnen, einschenken, fertig. Oder?
Der Sommelier ging kurz die wichtigsten Bestandteile des Wettbewerbs durch. Am schwierigsten und nervenaufreibendsten war wohl die Blindverkostung, wo es die vollständige Herkunft von zwei Dutzend Weinen zu erkennen galt: in welchem Jahr der jeweilige Wein gemacht wurde, mit welcher Rebsorte, in welchem Fleckchen dieser Erde (Anbaugebiet wohlgemerkt, nicht Land) und wie lange man ihn lagern kann, was man am besten dazu isst und warum.
Ehrlich gesagt, klang das alles nach dem geringstmöglichen Spaß, den man mit Alkohol nur haben kann. Wobei ich für Wettbewerbe ja ziemlich ich viel übrighabe, je weniger sportlich und je schlemmerhafter, desto besser. Als ich nach jenem Abend also nach Hause kam, schaute ich mich im Netz ein wenig um, was es mit diesem Sommelier-Gefecht wohl auf sich haben mochte.
Es entwickelte sich zu einer Obsession. Ganze Nachmittage vergeudete ich an den Laptop gefesselt mit Videos darüber, wie die Rivalen entkorken, dekantieren, schnüffeln und spucken bei ihrer Jagd nach dem Titel des World’s Best Sommelier. Es war wie bei der Hundeausstellung Westminster Dog Show in New York, nur eben mit Alk: Von einer Disziplin zur nächsten fochten wohlgepflegte Typen mit zurückgegeltem Haar und polierten Fingernägeln untereinander einen Wettstreit aus, bei dem es auf rätselhafte Details, eine finster dreinblickende Jury sowie die Grazie, mit der die Kandidaten im Kreis herumliefen, ankam. (Die Sommeliers haben im Uhrzeigersinn um einen Tisch herumzugehen.) Die Anwärter wählten ihre Worte so, als ob jede Silbe auf die Goldwaage gelegt würde, und versuchten, bei ihren Gästen (nicht Kunden – Gäste) wertvolle Hinweise auf Laune, Budget und Geschmack zu erkennen. Wie ich in dem schwachen Zittern einer seltsam schräg einschenkenden Hand das verzweifelte Bemühen nach Beherrschung so sah, spürte ich: Ihr Handwerk war strengen Regeln unterworfen, die ich kaum erahnen, geschweige denn honorieren konnte. Klar war nur, dass sie auf keinen Fall gebrochen werden durften: Véronique Rivest, die erste Frau, die es jemals in die letzte Wettbewerbsrunde geschafft hat, war außer sich, als sie vergaß, ihren Gästen Kaffee oder Zigarren anzubieten. »Merde, merde, MERDE!«, klagte sie lauthals. Nicht die geringste Spur von Ironie war dabei erkennbar. Absolut faszinierend.
Später fand ich heraus, dass einer der Anwärter Tanzunterricht genommen hatte, um seinen eleganten Gang auf dem Parkett zu perfektionieren. Ein anderer engagierte einen Stimmcoach, um seine Stimme in einen samtigen Bariton zu verwandeln, sowie einen Gedächtnistrainer, damit er sich die Namen der Weingüter besser merken konnte. Wieder andere zogen Sportpsychologen zurate, um unter dem Druck die Nerven zu bewahren.
Wenn das Bedienen schon eine Kunst sein soll, so handelt es sich bei der Blindverkostung augenscheinlich um pure Magie. In einem der Videos glitt Véronique ins Rampenlicht, während im Hintergrund die Kameras klickten, und näherte sich einem von vier Gläsern gesäumten Tisch, von dem jedes um die hundert Milliliter Wein enthielt. Sie griff nach einem weißen und steckte ihre Nase tief ins Glas. Ich hielt den Atem an und lehnte mich Richtung Bildschirm. Sie hatte gerade mal 180 Sekunden Zeit, um sich auf die korrekten Aromen und Bukette einzuschießen und daraus korrekt abzuleiten, was sie gerade trank. Es gibt über fünfzig Weinanbauländer; nahezu zweihundert trinkbare Jahrgänge; mehr als 340 unterschiedliche Appellationen allein in Frankreich sowie mehr als fünftausend Rebsorten, die in beinahe endloser Zahl verschnitten werden können. Wenn wir nachrechnen – die drei also multiplizieren, subtrahieren, übertragen –, erhalten wir zig verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Unerschrocken leierte sie das Aromaprofil eines Chenin Blanc aus dem indischen Maharashtra von 2011 mit einer Leichtigkeit herunter, als würde sie jemandem den Weg zu ihrer Wohnung erklären.
Ich war völlig gefesselt von diesen Leuten, die hier eine Art von Sinnesschärfe entwickelt hatten, wie ich sie bislang nur bei Bombenspürhunden vermutet hatte. Diese Sommeliers und ich, wir führten meiner Meinung nach diametral entgegengesetzte Leben: eines der sensorischen Kultiviertheit und eines der sensorischen Deprivation. Ich fragte mich, was ich wohl versäumte. Und während ich so vor meinem Computer saß und mir im Wiederholungsmodus Videos von weinschnüffelnden Menschen ansah, beschloss ich, genau das herauszufinden.
Ich bin gelernte Journalistin und von Haus aus Persönlichkeitstyp-A-Neurotikerin, also begann ich meine Recherchen auf die einzig für mich vorstellbare Weise: Ich las alles, was ich in die Finger bekam, bombardierte die Sommeliers mit E-Mails und tauchte an den unterschiedlichsten Orten uneingeladen auf, nur um zu sehen, ob ich wohl jemanden kennenlernen würde.
Mein erster Abend mit einer Horde Sommeliers aus New York City nahm kein gutes Ende. Den Anfang machte ich mit dem ungebetenen Erscheinen bei dem Blindverkostungs-Wettbewerb eines Weinhändlers, wo ich gemeinsam mit der Jury ein paar Gläser süffelte, etwa ein Dutzend Weine zu Ehren des Gewinners probierte, dann allen in eine Hotelbar für die nächste Runde folgte und das Abendessen gegen eine Flasche Champagner tauschte, die ein durstiger Sommelier unbedingt mit mir teilen wollte. Anschließend stolperte ich nach Hause, wo ich mich augenblicklich übergab.
Früh am nächsten Morgen, als ich gerade mit einem Auge »Kater Heilmittel« googelte, bekam ich eine SMS von dem Typen, der vergangene Nacht den Schampus geordert hatte. Er schickte mir ein Foto von sechs vor ihm aufgereihten Weinen. Er war am Verkosten. Schon wieder.
Lektion Nummer eins: Diese Leute sind unerbittlich.
Ihr Vierundzwanzig-Stunden-Eifer war weit entfernt von dem, was ich in Büchern und Zeitschriften ausgegraben hatte, um in die Fußstapfen von jemandem wie Véronique treten zu können. Ein Leben im Dienste des Weins wird in der Literatur als etwas zutiefst Genusssüchtiges dargestellt: eine Menge schicker Männer (traditionell sind es die Männer gewesen), die schicke Flaschen an schicken Orten trinken. Ein harter Arbeitstag bedeutete in diesem Fall das Hinunterwürgen einer Flasche Bordeaux, die weniger als ein Jahrzehnt alt war. »Wenn ich zurückblicke auf meine erste Reise an die Loire, so sehe ich einen jüngeren Mann, der Unannehmlichkeiten aushielt, die einem heutzutage qualvoll erscheinen«, schreibt der Weinimporteur Kermit Lynch in seinen Erinnerungen Adventures on the Wine Route. Um was genau handelte es ich bei diesen qualvollen Unannehmlichkeiten, die er erdulden musste? Er »flog von San Francisco nach New York, stieg um, landete in Paris, mietete einen Wagen und fuhr an die Loire«. Quelle horreur!
Als ich mehr und mehr Zeit mit Sommeliers verbrachte – endlich, inklusive spätabendlichen Trinkens bei ihnen daheim und Unterweisungen in der Kunst des Spuckens –, zog mich diese Subkultur, die ich nirgends widergespiegelt fand, zunehmend in ihren Bann. Für ein Fachgebiet, in dem sich scheinbar alles ums Vergnügen dreht, nimmt die heutige Generation Sommeliers – oder »Somms«, wie sie sich im Englischen gerne nennen – beachtliche Mühen auf sich. Sie sind bis tief in die Nacht hinein auf den Beinen, stehen früh auf, um Wissen aus Weinenzyklopädien zu büffeln, üben am Nachmittag das Dekantieren, verbringen ihre freien Tage mit Wettkämpfen und widmen die paar übrig gebliebenen Minuten dem Schlaf oder, was wahrscheinlicher ist, träumen von einer Flasche seltenen Rieslings. Ein Sommelier umschrieb das Ganze einmal als »eine Art Blutsport mit Korkenzieher«. Ein anderer nannte das, was Sommeliers für Wein empfinden, eine »Krankheit«. Das waren die hedonistischsten Masochisten, die ich jemals kennengelernt hatte.
Nichts von dem, was ich sah oder las, fing die gesamten Eigenarten diesen Berufs ein. Viele Jahrzehnte zuvor handelte es sich bei Sommeliers oftmals um gescheiterte Köche. Sie waren aus den Küchen geworfen worden und hatten sich dann für einen Job verpflichtet, den sie mit dem ganzen Charme des Lasttiers, nach dem sie benannt sind, ausübten. (Das Wort »Sommelier« kommt vom mittelfranzösischen »somme«, was »Packesel« bedeutet.) Sie waren dafür bekannt, in spießigen französischen Restaurants mit steifer Miene und im dunklen Anzug herumzustolzieren und wie finstere Bestatter auszusehen. Die aufstrebenden Sommeliers von heute sind von noblen Hochschulen abgegangen, um dem nachzugehen, was sie für ihre Berufung halten. Genau wie ich befinden sie sich in ihren späten Zwanzigern, sind kinderlos, besorgt ums Geld und trotz allem darum bemüht, ihre Eltern davon zu überzeugen, dass sie ihr Leben nicht ruiniert haben, nur weil sie nicht Jurist geworden sind.
Mit Masterabschlüssen in Philosophie und Ingenieurdiplomen von Stanford verfechten diese selbst ernannten »Büroflüchtlinge« hochtrabende Theorien über den Service und ehrgeizige Vorstellungen vom Potenzial des Weins, die Herzen der Menschen zu berühren. Und einer Branche, die lange einer althergebrachten Burschenschaft geähnelt hat, haben sie sowohl Jugend als auch XX-Chromosomen beschert.
Anfangs war mein Interesse hauptsächlich journalistischer Natur gewesen. Mein ganzes Leben war ich besessen von der Besessenheit anderer Leute gewesen. Nie hatte ich stundenlang Schlange gestanden, um mir für einen Teenieschwarm die Seele aus dem Leib zu schreien, nie hatte ich eine Figur in einem Videospiel »daten« wollen, allerdings hatte ich jahrelang über die Leute geschrieben und sinniert, die genau das tun. Die Leidenschaft der Somms hatte mich daher selbstverständlich sofort infiziert. Ich wollte unbedingt herausfinden, was sie antrieb. Wieso brannten sie so für den Wein? Und inwiefern hat diese »Krankheit« ihr Leben auf den Kopf gestellt?
Doch als ich tiefer in ihre Welt vordrang, passierte etwas Unerwartetes: Ich begann, ein gewisses Unbehagen zu verspüren. Nicht wegen der Sommeliers – die abgesehen von der Neigung, mir zu viel einzuschenken, wunderbar charmant waren –, sondern wegen meiner eigenen Einstellung und Voreingenommenheit. Um ehrlich zu sein, war meine stärkste Emotion in puncto Wein so etwas wie schambehaftetes Schuldgefühl gewesen. Wein wird als integraler Bestandteil eines kultivierten Lebens angesehen, mehr als jedes andere Nahrungsmittel auf dieser Welt. Robert Louis Stevenson nannte Wein »Poesie in Flaschen«, und Benjamin Franklin bezeichnete ihn als den »Beweis, dass Gott uns liebt« – nie hat irgendjemand derart über, sagen wir, Lammkotelett oder Lasagne gesprochen, so köstlich sie auch sein mögen. Die Somms redeten von Wein, der ihren Geist in luftige Höhen hob wie eine Symphonie von Rachmaninow. »Dagegen fühlt man sich klein und unbedeutend«, ergoss sich einer von ihnen. Ich hatte keine Ahnung, was sie da redeten, und offen gesagt klang das alles ziemlich weit hergeholt. Laberten die einfach nur Müll, oder mangelte es mir an der Fähigkeit, eine der ultimativen Freuden des Lebens anständig würdigen zu können? Ich wollte wissen, was diese Weinliebhaber meinten und wieso grundsätzlich vernünftige Menschen schwindelerregend viel Zeit und Geld für ein paar flüchtige Sekunden Wohlgeschmack aufbringen. Ganz direkt ausgedrückt, wollte ich wissen: Was war so besonders am Wein?
Wenn ich ein Glas Wein trank, war das so, als ob meine Geschmacksknospen verschlüsselte Nachrichten abfeuerten. Mein Hirn konnte lediglich ein paar wenige Worte entziffern: »Blablabla Wein! Du trinkst Wein!«
Für den Weinkenner jedoch kann diese verstümmelte Nachricht eine Geschichte vom Rebellen in der Toskana erzählen, der »Vaffanculo!« zu Italiens Weinreglements sagte und einfach französische Cabernet-Sauvignon-Reben pflanzte, oder vom irren Winzer, der Granatfeuer und Panzern auswich und Weinlese um Weinlese machte, den ganzen fünfzehnjährigen Bürgerkrieg im Libanon hindurch. Derselbe Schluck kann von den wandelnden Gesetzen eines Landes erzählen oder vom faulen Kellergesellen, der seine Aufgabe, die Weinfässer zu reinigen, vermasselt hat. Mittels ihrer Sinne haben diese Trinker Zugang zu einer reichhaltigeren Welt, in der Geschmäcker und Gerüche Geschichten, Sehnsüchte und Ökosysteme entstehen lassen.
Meine Unwissenheit in Anbetracht solcher Nuancen trieb mich langsam in den Wahnsinn. Während ich nun meinen Freunden zuhörte, wie sie Starbucks zugunsten von vier Euro teurem Cold Brew Coffee abschworen oder von sortenreiner Schokolade schwärmten, fiel mir ein Paradox in unserer Feinschmeckerkultur auf: Wir sind ständig auf der Suche nach noch besser schmeckendem Essen und Trinken – planen die Reiseroute dementsprechend, verprassen unser Geld für Degustationsmenüs, kaufen exotische Zutaten, sind scharf auf die frischestmögliche Ware. Und doch tun wir nichts, um unseren eigenen Geschmackssinn zu verbessern. »Unsere Nation ist geschmacksblind«, schrieb M. F. K. Fisher einst, und diese Kritik gilt – soweit ich das beurteilen kann – heute noch genauso wie 1937.
Meine journalistische Neugier wurde schnell von einem persönlichen und tiefer gehenden Anliegen überschattet. Neuerdings befiel mich der Frust wegen meiner IT-zentrierten Existenz, in der die glatte Eintönigkeit des Bildschirms sämtliche Geschichten und das Leben selbst abflacht. Je mehr ich erfuhr, desto eingeschränkter und unvollständiger erschien mir meine eigene kleine Erfahrungswelt. Auf einmal kam es mir völlig unzureichend vor, über die Sommeliers lediglich zu schreiben. Was ich stattdessen wollte: so sein wie sie.
Ich begann mich zu fragen, was ich wohl tun müsste, um im Wein das erkennen zu können, was sie darin erkannten. Haben diese Profis das allein durch Üben hingekriegt? Oder waren das genetisch gesegnete Mutanten mit ultrascharfem Geruchssinn?
Ich bin stets davon ausgegangen, dass man als Supersensoriker geboren, so wie Novak Djokovic genetisch mit der nötigen Spannweite ausgestattet wurde, um alle Gegner zu zermalmen. Wie sich herausstellen sollte, war das keine Entschuldigung. Als ich begann, meine YouTube-Exzesse mit einer gesunden Kost aus wissenschaftlichen Studien zu ergänzen, wurde mir klar, dass die Schulung von Nase und Zunge in erster Linie eine Schulung des Gehirns darstellen muss.
Nur, dass die meisten von uns sich wenig darum scheren. Von Denkern wie Platon beeinflusst, die Schmecken und Riechen als »niedrige Sinne« abgetan haben, kennen die meisten von uns nicht einmal die einfachsten Wahrheiten über diese beiden Sinne (und verwechseln sie noch dazu gerne mal). Wenn wir verschiedene Geschmäcker wahrnehmen (kleiner Tipp: nicht nur mit dem Mund), bringen wir sie durcheinander. Wir wissen nicht einmal, wie viele Geschmacksrichtungen es überhaupt gibt (mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als die fünf, von denen Sie bislang gehört haben). Und wir sind davon überzeugt, dass der Mensch sich zum schlechtesten Riecher des Tierreichs entwickelt hat (wohingegen die neuesten Forschungsergebnisse zeigen, dass dies ein Mythos ist). Im Wesentlichen ignorieren wir praktisch zwei der fünf Sinne, die uns gegeben sind, um die Welt zu erfassen und zu interpretieren.
Ich konnte es kaum erwarten, das zu ändern und herauszufinden, was ich die ganze Zeit vernachlässigt hatte, beim Thema Wein wie im Leben allgemein. Die Somms, die ich kennenlernte, erzählten, wie ihnen ihre Ausbildung bei allem Möglichen geholfen hat: Sie entdeckten neue Alltagsfreuden, vertrauten auf die eigenen Sinneswahrnehmungen und ließen sich nicht mehr von Etikett und Preis berauschen. Ein umfangreicheres Erleben genießen zu können schien für jeden von uns möglich, wenn wir uns auf die sensorische Information einstellten, die wir normalerweise übergehen. Und es dürstete mir danach, es auszuprobieren.
Dieses Buch handelt von dem Jahr, das ich unter Aromaanbetern, Sinnesforschern, Jägern DEREINEN Flasche, Geruchsgenies, beschwipsten Hedonisten, rebellischen Winzern und den ehrgeizigsten Sommeliers der Welt verbrachte. Dieses Buch ist kein Weinführer oder ein gutgläubiges Hochhalten sämtlicher Traditionen des Weintrinkens. Genau genommen, geht es dem Phänomen auf den Grund, dass die Weinindustrie – wie ein Weinökonom es beschrieben hat – »an sich anfällig für dummes Gelaber ist«. Wenn wir dieses Gelaber jedoch aus dem Weg räumen, bleiben Erkenntnisse übrig, die fernab von Speis und Trank noch Relevanz besitzen.
Dieses Buch ist weniger der Weg von Weintraube zu Weinglas (auch wenn es kurze Einblicke in die Weinherstellung geben wird), sondern ein Abenteuer von Weinglas zu Gurgel – in die wilde Welt der Weinbesessenheit und Weinwertschätzung in all ihren Farben und Fehlern. Es erforscht unsere Beziehung zu einem siebentausend Jahre alten Saft, der ägyptische Herrscher, mittellose Bauern, russische Zaren, Börsenmogule, Vorstadteltern und chinesische Studenten bezaubert hat. Stellen Sie sich ein auf einen Blick hinter die Kulissen von Sternerestaurants, auf orgienhafte Zechgelage für die oberen Zehntausend, auf eine Reise in die Vergangenheit zu den allerersten Restaurants, auf fMRT-Geräte und Forschungslabore. Nebenbei werden Sie den Irren, der mich schikanierte, kennenlernen, den Korkenknallkopf, der mich coachte, den Burgundersammler, der mich verführen wollte, und den Wissenschaftler, dessen Forschungsobjekt ich war.
Der Zusammenhang zwischen dem Geschmack und dem Genießen des Lebens findet sich in unserer Sprache wieder. Unserem Leben verleihen wir gern »Würze«. Das spanische Verb »gustar« – etwas gern mögen, jemandem gefallen – stammt vom lateinischen »gustare« ab, nämlich »schmecken«. So, wie wir im Deutschen im negativen Sinne sagen, dass uns ein bestimmter Umstand »nicht schmeckt«, verwendet man im Spanischen das »Schmecken« auch im positiven Sinne in Bezug auf Kleidung, Demokratie, Kunst, Dosenöffner. Einer Person, der die richtigen Dinge gefallen, wird nachgesagt, sie habe »Geschmack« – auch wenn diese Dinge, wie beispielsweise Musik, überhaupt nicht essbar sind.
»Geschmack« und »schmecken« sind nicht nur unsere Standardmetaphern, wenn es um das Auskosten des Lebens geht. Sie sind derart feste Bestandteile unseres Denkens, dass sie gar keine Metaphern mehr sind. Nach Meinung der Sommeliers, Sinnesgelehrten, Winzer, Weinexperten und -sammler, die ich kennengelernt habe, folgt aus dem besseren Geschmackssinn ein besseres Leben sowie ein tieferes Verständnis von uns selbst. Und ich habe erkannt, dass man für eine Verfeinerung des Geschmackssinns beim komplexesten Nahrungsmittel der Welt anfangen muss: dem Wein.
1 Die Ratte
Wenn Sie Freunde und Familie davon in Kenntnis setzen, dass Sie einen festen Journalistenjob an den Nagel gehängt haben, um daheimzubleiben und Weine zu probieren, werden sich besorgte Menschen bei Ihnen melden. Sie sagen: Ich werde meine Sinne verfeinern und herausfinden, was den Wein zu etwas so Besonderem macht. Die Leute hören: Ich habe meinen Job gekündigt, um den ganzen Tag zu saufen und meine Chancen auf Obdachlosigkeit signifikant zu erhöhen.
Ich versicherte den Leuten, sie müssten sich keine Sorgen machen. Es handele sich um einen ordentlichen Beruf. Ich würde später einen Job in der Weinindustrie ergattern können. Ich würde weiter meine Miete zahlen können. Das Problem war nur, dass mittlerweile zwei Monate ins Land gezogen waren und es nicht einmal die Aussicht auf eine Lohnarbeit gab. Und ich trank tatsächlich mehr. Ich ging auf Weinveranstaltungen, traf mich mit jedem, der mir etwas erzählen konnte und wollte, und ich entkorkte auf einen Schlag zwei oder drei Flaschen Pinot Noir. Die Handtücher in meinem Badezimmer hatten violette Flecken vom Rotwein, der stets an meinen Lippen hing. Wenn mein Mann ohne mich ausging, fragten unsere Freunde: »Wo ist Bianca?«, gefolgt von einem gedämpften: »Ist sie wieder am Trinken?«
Weinleute lieben es, über Wein zu reden, versicherte ich mir. Zeig dich, zeig dein großes Interesse, und ab geht die Grand-Cru-Post. Nicht, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, als ich meinen Job verließ. Mit all dem hochnotpeinlichen Selbstbewusstsein einer penetranten Reporterin hatte ich ein vorläufiges Dreistufenprogramm entworfen: Zuallererst brauchte ich einen neuen Job. Das Dasein eines Sommeliers würde ich nur verstehen, wenn ich mich ihnen anschlösse, räsonierte ich. Ganz bescheiden nahm ich mir eine Anstellung als Sommelierassistentin in einem Zweisternerestaurant vor (zu den drei Sternen würde ich mich später hocharbeiten können). Als Zweites würde ich mir einen Mentor suchen, einen weisen Obi-Wan Kenobi, der erkennt, dass die Macht in mir stark ist, und mich in die Geheimnisse von Gaumen und Nase einweiht. Als Drittes würde ich die Prüfung zum Certified Sommelier des Court of Master Sommeliers ablegen und damit in die höheren Ränge der Branche aufsteigen.
Das war, bevor ich wusste, dass es einen Namen für Leute wie mich gab: Ich war eine »Zivilistin« – eine Außenseiterin, eine Kundin und Amateurin, die keine Ahnung hatte, wie es sich anfühlt, in einem kalten Keller den Großteil des Tages Tausende Weinflaschen zu zählen oder den pingeligen Freund des Restaurantbesitzers zu beschwichtigen, der einen 1700 Euro teuren Guigal »La Landonne« von 1988 hat zurückgehen lassen, weil er »zu schwach« sei (was in etwa der Behauptung gleichkommt, ein Raketenwerfer hätte »nicht genügend Explosionskraft«). Zivilisten, oder sogar Weinsammler und -kenner, wissen nicht wirklich, was es bedeutet, sein ganzes Leben nach ein paar flüchtigen chemischen Reaktionen auf der Zunge und im Nasengang auszurichten. Zivilisten genießen den Wein; Sommeliers liefern sich ihm bedingungslos aus, geblendet von der Art brennender Leidenschaft, die irrationale und sogar selbstzerstörerische Entscheidungen fürs Leben nach sich zieht. Den Zivilisten wird nach dem Mund geredet, weil die Sommeliers sie rein theoretisch ja bedienen und weil am Ende der Mahlzeit jemand die Rechnung bezahlen muss. Doch man wahrt eine deutliche Distanz zu ihnen, und es gibt eine Grenze, die sie niemals überschreiten dürfen. Diese fachfremden Amateure, zu denen ich unbestreitbar gehörte, sind nicht würdig, in die allerheiligsten Keller, Verkostungsgruppen und Servicebereiche der Sommeliers vordringen zu dürfen.
Kurz, meine anfängliche Zuversicht war komplett unangebracht. Auch wenn ich in diesen ersten Monaten tatsächlich mit vielen Leuten aus der Weinwelt sprach, so wusste ich in Wahrheit nur eines: welcher Wein am besten zu einer großen Portion kleiner Brötchen passt (Antwort: jeder Wein).
So ungefähr standen die Dinge, als ich Joe Campanale kennenlernte.
Die Restaurantszene ist berüchtigt für ihren Geiz mit Komplimenten, aber von Joe sprachen alle so, als ob er ein Superstar wäre. Kaum dreißig Jahre alt, hatte er schon vier erfolgreiche Restaurants in Downtown Manhattan als Teilhaber und Getränkemanager eröffnet. Seine Erfolgsgeschichte war umso bemerkenswerter, als es sich mit New York und dem Scheitern von Restaurants in etwa so verhält wie mit Saudi-Arabien und der Ölproduktion. Wieder und wieder bekam ich von Gastronomen den gleichen Witz erzählt: Wie kann man im Restaurantbetrieb ein kleines Vermögen machen? Indem man mit einem großen Vermögen beginnt.
Für jeden Job, in den ich mich hineinschummeln wollte, brauchte es genau das, was ich nicht hatte: Erfahrung. Und die wiederum bekam ich nur durch einen Job. Um mir ein Treffen zu verschaffen, das mich in die Nähe einer Anstellung würde bringen können, tat ich etwas, das ich gerade noch so mit meiner journalistischen Integrität in Einklang bringen konnte: Ich deutete an, ich würde gerne einen begeisterten Bericht über die Geschehnisse im (Name des Restaurants) schreiben. Ganz beiläufig würde ich dann meine Absicht, Sommelière zu werden, erwähnen. Das ist nicht besonders gut gelaufen.
Ich kam mir vor wie eine glücklose Fischerin, die ein letztes Mal müde ihre Schnur auswarf, bevor sie wieder einmal mit leeren Händen an Land ging. Doch mit Joe geschah etwas Lustiges.
Ein Biss.
»Unsere Kellergehilfin – die hat sich tatsächlich gerade verletzt und kann nicht …« Joes Blick wanderte zu meinem Bizeps. »Na ja, das ist ziemlich körperliche Arbeit«, erklärte er. »Kannst du Kisten heben?«
Nein, nicht wirklich, aber das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich wollte mehr über diese Arbeit im Weinkeller erfahren. Sie klang irgendwie unzeitgemäß, wie Schornsteinfeger oder Stadtschreier. Ich habe schnell gelernt, dass Kellergehilfin die höfliche Bezeichnung war. Die Leute im Restaurant sagten Kellerratte. Das klang zwar ein klein wenig anders als meine vorherige Jobbezeichnung, »IT-Chefredakteurin«, aber was soll’s. Ich war verzweifelt. Verzweifelt versuchte ich, in der Branche Fuß zu fassen, verzweifelt versuchte ich, meinen Lieben zu beweisen, dass ich nicht auf dem besten Weg in die Entzugsklinik war, und verzweifelt versuchte ich definitiv auch, sämtliche Warnzeichen zu ignorieren.
Ich sagte auf der Stelle zu. Ich sollte im L’Apicio arbeiten, dem neuesten und größten Restaurant in Joes wachsendem Imperium. Das Vorstellungsgespräch war verdächtig schnell über die Bühne gegangen, und ich hatte kaum eine Ahnung davon, was der Job beinhaltete. Ich verdiente zehn Dollar die Stunde, doch der wahre Wert lag im Zugang zu Joes Expertise und seinen Weinen.
In den vorangegangenen Monaten der Arbeitslosigkeit hatte ich mir Karrieretipps von Sommeliers und Veteranen der Weinbranche geholt. Ihr Bild eines traditionellen Systems von Lehrjahren und Gönnerschaft schien eher dem Florenz der Renaissance als dem New York des 21. Jahrhunderts entstiegen. Eine Sommelière ist keine Rechtsanwältin. Es gibt keinen offiziellen Studiengang dafür, und staatliche Prüfungen muss sie ebenso wenig bestehen (auch wenn es mittlerweile durchaus einige zertifizierte Ausbildungen gibt). Rein theoretisch kann jede in ein Restaurant spazieren und sich Sommelière nennen. Rein praktisch aber bringt das gar nichts. Das wäre ungefähr so, als ob ich in Baggy Pants und Streifenshirt schlüpfen und ins Trainingslager der Yankees reinzukommen versuchen würde – insbesondere in einer Stadt mit Weltklasserestaurants wie New York. Der Werdegang eines Anwalts ist ein vergleichsweise kurzer, läppischer Spaziergang gegen den Werdegang einer Sommelière in einem der Toprestaurants dieser Erde.
Im inoffiziellen Ausbildungssystem fängt eine Einsteigerin beispielsweise mit dem Einlagern von Weinflaschen als Kellerratte an, steigt zur Servicehilfskraft oder Weinladenverkäuferin auf, rückt irgendwann zur Kellnerin auf, dann zur Sommelière und schließlich eines Tages zur leitenden Sommelière oder Getränkemanagerin, also derjenigen, die für sämtliche Flüssigkeiten eines Restaurants zuständig ist, von Espresso bis Zinfandel. Diese Position wiederum könnte zum Chef de Vin oder zur Weindirektorin einer Restaurantkette führen. Eine frühere Generation Sommeliers konnte sich durch Mundpropaganda einen Ruf erarbeiten und aus dem guten Namen ihres Mentors Kapital schlagen bzw. einen Bombenjob an Land ziehen. Doch die Konkurrenz hat zugenommen, und mittlerweile kombinieren die angehenden Weinprofis diese altmodische Vorgehensweise mit der Autorität von Auszeichnungen, Anstecknadeln und Diplomen von so illuster klingenden Verbänden wie dem Wine & Spirit Education Trust, dem Court of Master Sommeliers oder der Deutschen Weinschule. Es kann Jahre dauern, bis man eine Stelle in einem der Toprestaurants ergattert, und selbst dann braucht es die perfekte Mischung aus fachlichen Fähigkeiten, Charisma und dem gewissen Etwas, das sich nicht erlernen lässt.
Sexy war der Job als Kellerratte nicht, aber er passte wunderbar in meinen (leicht überarbeiteten) Plan. Joe versprach mir, dass ich mir dadurch einen ausgezeichneten Einblick ins Weinprogramm verschaffen würde – was verkauft sich, wann, an wen, wie, für wie viel Geld – und dass ich mich allein durchs Hantieren mit seinen Weinflaschen mit den Weinregionen vertraut machen würde. Außerdem sah die Weinbranche als Gegenleistung für meine Arbeit reichlich Gelegenheit zum Verkosten vor. Jeden Donnerstag würde ich nach Belieben Wein mit Joe probieren dürfen, der reihum eine Anzahl Weinhändler empfing, die alle darauf brannten, ihm Wein für sein Sortiment vorzustellen. Zusätzlich würde ich einen Freibrief für die beinahe täglich stattfindenden Verkostungen der lokalen Händler erhalten, All-you-can-drink-Weinbüfetts, bei denen die Sommeliers der Stadt die neuesten Bestände präsentiert bekamen.
In gewisser Weise wurde man bei den Einstiegsjobs der Weinwelt nicht mit Geld, sondern mit Geschmäckern bezahlt. Speziell bei den jungen Sommeliers waren die begehrtesten Stellen diejenigen, bei denen man Gelegenheit zur Verkostung einer großen Auswahl an Weinen bekam. Ich habe einen Sommelier kennengelernt, der seine Spitzenstelle als Chef de Vin in einem hippen Restaurant im Napa Valley – nebst Freundin, Haus, Auto und Hund – für einen weit weniger repräsentativen Job an den Nagel gehängt hat, nur um seinen Gaumen zu verfeinern. »An einem Abend in New York kann ich mehr Weine verkosten als in einem ganzen Jahr in Kalifornien«, erklärte er.
Mit dem Kellerrattendasein würde ich mich von der Verkostung von drei bis vier (billigen) Weinen die Woche zur Verkostung von Dutzenden, wenn nicht gar Hunderten Weinen die Woche aus jeder nur vorstellbaren Region und jeder erdenklichen Preisklasse steigern. Es ist nämlich quasi unmöglich, Meisterverkosterin zu werden, ohne entweder in der Weinbranche zu arbeiten oder sehr, sehr reich zu sein. In manchen Wochen würde ich Wein im Wert von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden Dollar trinken, ohne einen einzigen Cent dafür zu zahlen. Für eine Anfängerin wie mich, die ihre mentale Geschmacksbibliothek aus dem Nichts aufbauen wollte, war das ein wahr gewordener Traum.
Was Joe der Einfachheit halber verschwieg, war die Tatsache, dass mein Traumjob für gewöhnlich im Desaster endete.
An einem Mittwoch um dreizehn Uhr stellte ich mich im L’Apicio der Assistentin des Getränkemanagers, Lara Lowenhar, vor. Sie war Mitte dreißig, hatte hauchdünne Augenbrauen, runde Wangen und perfekte Nägel, die in einem dunklen Bordeauxrot erstrahlten. Schritt für Schritt ging sie mit mir die wechselvolle Geschichte der bisherigen Kellerratten durch.
Die erste war unvergessen, weil sie so schnaufte und keuchte, während sie die Weinkisten die Treppe hinaufhievte, und weil ihr Gesicht dabei so »krass rot« werden konnte. Sie hielt sich nicht besonders lang. Ihre Nachfolgerin verbrachte ihre Zeit im Keller gerne mit Weinen. »Es war zu viel für sie«, sagte Lara mit heiserer Stimme, die schätzungsweise vom jahrzehntelangen Schreien in überfüllten Restaurants herrührte. »Wenn ich körperliche Arbeit sage, dann meine ich körperliche Arbeit. Das war einfach zu viel für sie.« Ihr Ersatz wurde letzten Endes während der Arbeit krank – irgendetwas mit niedrigem Blutdruck –, und der Ersatz für den Ersatz, diejenige, die sich verletzt hatte, war quasi von Anfang an ein Problem gewesen. »Sie war derart unscheinbar, dass ich sogar ihren Namen vergessen habe«, sagte Lara mit einem Seufzer. »Sie war im Grunde diejenige, die meine Geduld am meisten auf die Probe gestellt hat, weil ich einfach nicht verstand, was los war. Sie hat mir beigebracht, wie es ohne Schreien geht … Es war einfach nur frustrierend mit ihr.« Jetzt hatte sie mich.
»Ich bin äußerst geduldig«, teilte sie mir mit. Das klang eher wie eine Warnung, wie eine von diesen leeren Beteuerungen à la »delfinsicher«, deren pure Erwähnung Zweifel in einem hervorrufen.
Ihre Führung durch das L’Apicio begann Lara durch den Diensteingang, den ich von nun an ausschließlich benutzen sollte. Das Restaurant befand sich auf der Lower East Side, neben einem Reparaturservice für Heizkessel und zwei Shakes-&-Smoothies-Läden, und die Doppeltüren auf der East First Street führten direkt in den Bienenstock der Küche. Dort war es lebhaft und laut, und ich stand augenblicklich jemandem im Weg. Ich machte einen spastischen Hüpfer, um zwei Pfannen mit gegrilltem Gemüse auszuweichen, und stieß gegen eine Ablage mit Kerzenständern. Lara ließ daraufhin einen Vortrag über die Gastroetikette vom Stapel, da sie in mir völlig zu Recht eine Gefahr für mich selbst und andere sah. »Wenn du in eine Restaurantküche hineinspazierst und dich dabei hinter einer Person befindest, legst du dieser Person entweder im Vorbeigehen eine Hand auf den Rücken, oder du sagst ›hinten‹, damit sie sich nicht umdreht«, wies sie mich geduldig an. Wir wichen einem Mann in Crocs aus, der zusammengefaltete Kartons auf einen Müllcontainer schleuderte, und gingen dann an jemandem vorbei – HINTEEEEEEN! –, der Suppentöpfe zu einem Spülbecken trug. Es wurden Gläser auf Hochglanz poliert und akribisch Champignons geschnippelt, es wurde geriebener Parmesan abgewogen und zu Shakira gesummt. Die wahre Action fand direkt dahinter, auf einem weißen Gewirr aus Vorbereitungstischen, statt. Ein Schleier aus Körpern hantierte mit Kupfertöpfen und ließ Messer über bündelweise Grünzeug hüpfen. Lara unternahm nicht einmal den Versuch, mich dort hindurchzubugsieren.
Ich würde mit all dem nichts zu tun haben. Meine Aufgabe war es, mich ganz alleine in eine kleine, dunkle, eiskalte Kammer einzuschließen, die von Lara großzügig Weinkeller genannt wurde. Sie war so eng, dass wir beide nicht einmal Schulter an Schulter stehen konnten; so lang, dass vierzig Weinflaschen Hals an Hals nebeneinander gelagert werden konnten; und so hoch, dass ich nicht auf die oberen Regale schauen konnte, ohne eine Metallleiter hinaufzukraxeln, die dünn wie ein Stöckelschuh war.
»Das hier ist die Bibel«, sagte sie, während sie mir ein Klemmbrett mit zerknitterten Seiten in die Hände schob. »Das hier ist von nun an das Allerwichtigste in deinem Leben.«
Das Allerwichtigste in meinem Leben schien irgendwie verschlüsselt. Verständnislos glotzte ich auf eine der Zeilen: »DETTORIMOSCADEDDU 2010 L12 DE«.
»Das ist unser Kellerbuch. Es ist alphabetisch nach Erzeugern geordnet. Deren Name steht zuerst, dann der Fantasiename, Jahrgang, Lage«, sagte Lara.
»L12 DE« bezog sich auf die Flaschen im linken Regal, in Reihe 12, Spalten D bis E. »Dettori« war die Abkürzung für den Erzeuger Tenute Dettori. »Moscadeddu« der nome di fantasia, der Fantasiename, ein beliebiger Spitzname der Winzer für eine ihrer Weinlinien, um sie voneinander zu unterscheiden und, so kam es mir persönlich vor, um Kellerratten wie mich zu quälen. Lara wollte mir beim Zurechtfinden helfen. Im Allgemeinen, erklärte sie, befindet sich auf dem Flaschenetikett eine Kombination aus Erzeugernamen, Fantasienamen und Jahrgang (das Jahr der Weinlese). Auch die Rebsorte könnte dort aufgeführt sein (»Pinot Gris«, »Fiano«, »Aglianico«) oder das Anbaugebiet (»Sonoma Valley«, »Soave«, »Chianti«) – beides zusammen allerdings selten. Insbesondere bei den Weinen aus der Alten Welt gingen die Erzeuger davon aus, dass der Name des Anbaugebiets völlig ausreiche, um zu wissen, welche Traube für den Wein verwendet wurde. Nur ein schwachsinniger Banause hat keine Ahnung, dass ein Chianti per Gesetz aus mindestens siebzig Prozent Sangiovese-Trauben bestehen muss, wenn er das Gütesiegel DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) tragen möchte. Gleiches gilt, sagen wir, für einen DOCG Barolo, der zu hundert Prozent aus Nebbiolo-Trauben gemacht sein muss.
Ich hob eine Flasche von L15 J auf und suchte auf dem Etikett nach dem Erzeuger, nur um zu sehen, ob ich den Code auch alleine knacken konnte. Ganz oben stand in großen Lettern »Coenobium«. Das musste der Erzeuger sein.
»Äh, koh-no-bi-jum?«, riet ich.
Es war der Fantasiename, und er wurde »Sen-no-bi-jum« ausgesprochen. Ich versuchte es noch mal. »Lazio?« Das war der Name der Stadt. Lara ließ ihren Finger einen langen Absatz in Italienisch entlangwandern, vorbei am Kleingedruckten mit Alkoholgehalt, Flaschennummer, Schwefelgehalt und irgendeiner amtlichen Prüfungsnummer. Neben einer mikroskopisch kleinen Textzeile am unteren Rand des Etiketts machte sie halt. »Monastero Suore Cistercensi« stand dort. Natürlich.
Ich war verantwortlich für das Einlagern sämtlicher neuer Weinkisten, sobald sie eintrafen. Wenn kein Platz war im Keller, sollte ich Platz schaffen. Ich musste die Flaschen auspacken, jede in einen Einschub stecken und diesen Einschub in der Bibel markieren.
»Mir ist egal, wo was liegt«, sagte Lara. Nach einer kleinen Pause korrigierte sie sich. »Aber, ja, die gefragteren Posten, wie die hier, sollten besser dort liegen.« Sie dachte über diese Aussage nach. »Und die hier« – sie zeigte auf eine Flasche Rotwein, die sich in keiner Weise von den anderen unterschied – »sollte nicht ganz da unten liegen.« Auch wie ich den Wein ins Regal stellte, war ihr nicht egal, da man den Keller vom Speisesaal aus sehen konnte. »Wenn du die vordere Flasche rausziehst, holst du die hintere nach vorn« – jeder Einschub war zweireihig – »weil der Keller dann voller aussieht.« Oh, und bring nichts durcheinander, sonst kann keiner die Flasche finden, die der Gast bestellt hat. »Und das ist der absolute Horror für uns.«
Ich versuchte, mir Notizen zu machen, während Lara in einer scheinbar fremden Sprache weiter voranpreschte. »Wenn irgendwo ›offen‹ steht, dann heißt es ›offen‹, es sei denn, wir haben sechsundachtzig. Dein P-Mix ist nun auf der Lagerplatztafel beheimatet.« Das sei extrem wichtig, da ich den P-Mix (den was, bitte?) auf der Lagerplatztafel (wo?) gewissenhaft überprüfen müsste, um etwas zu tun, das ich nicht kapierte. Auch die ARs (wie bitte?) würde ich brauchen, die Lara mir vor jeder Lieferung zu mailen versprach. Neue Weiße gehörten in den niedrigen Weinkühlschrank, und Lara brauchte davon jeweils … wie viele noch mal? Zwei? Shit. Sie führte mich aus dem Keller hinaus, in dem ich eine vampirsichere Dunkelheit bewahren musste, damit sich die schlafenden Flaschen nicht erwärmten, und dann hielten wir vor den Weinkühlschränken an – hüfthohe Dinger hinter der Bar. Ich nutzte eine kleine Pause zwischen den maschinengewehrartigen Befehlssalven, um das Wichtigste klarzustellen: Mit »offen« waren die offenen Weine gemeint, die per Glas ausgeschenkt werden. P-Mix bedeutete Produkt-Mix, und bei den großen Metallschüsseln mit Huhn, Chilisauce und Reis, die dort in der Ecke standen, handelte sich um das »Familienessen« für die Mitarbeiter.
»Wir nennen uns Familie«, sagte Lara, »weil wir einander öfter sehen als unsere eigentliche Familie.«
Sie führte mich zum Garderobenschrank, dann hob sie den Arm und zog eine Leiter herunter, die sich von einer Falltür in der Decke entfalten ließ. Das klapprige Gestell ähnelte den hohen Dingern, die Maler benutzen, nur war es steiler, frei schwebend und hatte seine besten Jahre bereits hinter sich. Es führte in den Dachboden hinauf, einem, wie es aussah, sehr dunklen, sehr beengten, sehr wenig einladenden Ort voller Kartons und Wäschehaufen – Arbeitskleidung, Servietten, Lappen. Das war das Lager für den überschüssigen Wein. In Anbetracht der New Yorker Mietpreise musste Lara suboptimale Lagerungsbedingungen riskieren und die überzähligen Flaschen ins Dach bugsieren.
Lara stupste mich an, damit ich die – in ihren Worten – »furchtbare Leiter« bis zu einem sogenannten Podest hinaufkraxelte, das aus einem fußbreiten Rahmen um die Falltür herum bestand. Dort sollten ich und eine Kiste Wein hinpassen. Und es sah viel zu klein für nur eins von beiden aus. Es wurde von mir erwartet, dass ich Kisten mit je zwölf Flaschen Wein – also um die achtzehn Kilo oder beinahe ein Drittel meines Körpergewichts – in den Speicher hinein- und von da hinaustrug, und zwar auf der »furchtbaren Leiter«.
»Ich hab Angst, und ich bin zwei Jahre lang dort hoch- und runtergeklettert«, meinte Lara. Ich wackelte zum Kriechboden hinauf und sah anschließend Lara dabei zu, wie sie die am wenigsten riskante Abstiegsmethode vorführte. Anscheinend war es das Beste, sich auf den Hintern zu setzen, sich selbst und die Weinkiste Zentimeter für Zentimeter näher an die Stufen zu schieben, sich auf die obersten Sprossen zu stellen und sich dann alle zwölf Flaschen an die Brust zu hieven, ohne vornüber auf den Betonboden zu stürzen. »Ich habe schon ein paar Leute runterfallen sehen, und es sah nicht lustig aus«, verriet Lara.
Ich bin niemand, der seinen eigenen Tod herbeifantasiert. Doch ich wusste, dass der Tod beim Befördern von Pinot Grigio im Auftrag dünkelhafter Yuppies a) nicht die Art und Weise war, wie ich dahinscheiden wollte, und b) nun ganz klar im Bereich des Möglichen lag.
Die Köche waren zu beneiden. Sie hatten Essen – buntes, eindeutiges, geläufiges, erkennbares Essen. Ich hingegen hatte 1800 kalte Flaschen, deren Namen ich nicht aussprechen konnte und die an Orten und mit Trauben hergestellt wurden, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Die Köche tanzten als Team zusammen in der Küche herum. Ich war auf mich selbst gestellt. Sie standen außerdem auf festem Boden. Und mir war alles viel zu hoch.
In meinem vorherigen Job als Journalistin hatte ich fünf Jahre lang mehr oder weniger das gleiche Programm: aufwachen, die U-Bahn zur Eighth Street nehmen und um neun Uhr dreißig pünktlich zur Redaktionssitzung im Büro ankommen. Als Joes Kellerratte begann ich, an Gratisverkostungen der Weinhändler teilzunehmen – das sind die Zwischenhändler, die Läden und Restaurants eine Auswahl an Weinen verkaufen, die sie entweder selbst importiert oder von Importhändlern gekauft haben. Nun war ich offizielles Mitglieder des New Yorker Weinheeres, und im Rahmen meiner neuen Lebensweise pflegte ich mein erstes Glas Wein etwa zur selben Stunde zu mir zu nehmen, wie ich früher die Morgenschlagzeilen überflog. An den meisten Tagen war ich zur Mittagszeit betrunken, um zwei Uhr verkatert und gegen vier Uhr nachmittags am Bedauern, dass ich zum Mittagessen diesen Riesenburger verschlungen hatte.
New York war eine viel, viel trunkenere Stadt, als ich jemals geglaubt hätte. Zu jeder Stunde an jedem Tag der Woche konnte ich mich herumtorkelnden Männern in Anzügen anschließen, die mit bordeauxroten Zähnen die neuesten Weine der City probierten. Ich nahm mir den Ratschlag eines jungen Sommeliers zu Herzen, der mit ebenso wenig Geld wie ich das Schmecken erlernen wollte, und nutzte die Verkostungen, um die Vielfalt der »noblen Rebsorten« zu ergründen, also einige der weltweit am meisten angebauten Rebsorten. In der einen Woche trank ich also nichts als Sauvignon Blanc – aus dem französischen Sancerre, dem neuseeländischen Marlborough, dem US-amerikanischen Santa Ynez Valley und dem australischen Margaret River –, bis meine Nase und mein Mund all seine grasigen, limonenwassrigen Permutationen im Griff hatten. In der nächsten Woche waren es ausschließlich Gewürztraminer, dann Tempranillo und so weiter und so fort, durch sämtliche Rebsortenberühmtheiten hindurch. Indem ich die Rebsorte stets beibehielt, versuchte ich, den Charakter eines jeden Weins – das Pflaumenartige am Merlot zum Beispiel – zu erschmecken und wie sich die Rebsorte beim Queren von Ländern und Klimazonen verändert.
Jeden Donnerstag stolperte ich von den Alles-für-umme-Veranstaltungen der Weinhändler rüber zum L’Apicio für eine weitere Verkostungsrunde mit Joe. Drei Stunden am Stück kamen Vertriebler mit Flaschen vorbei. Und ich probierte sie alle. Da sie um Joes Vorliebe für Weine mit Geschichte wussten, bauschten die Händler den exzentrischen Ursprung ihrer Joker-Weingüter, die sie in ihren Bestand aufgenommen hatten, hübsch auf. »Es wurde vor fünf Generationen gegründet und nun von der Großenkelin wiederbelebt … Auf diesen Weinbergen findet man überall Ruinen aus der Römerzeit, und es gibt einen großen Hügel, der Julius Cäsars Feriendomizil war … Dieses Weingut hat einen Therapieesel … Dieser Erzeuger hat einige Zeit in einem Arbeitslager verbracht, darüber wurde sogar ein Fernsehfilm gedreht …«
Doch auch hier fand das Trinken noch kein Ende. Um eine bessere Weinverkosterin zu werden, waren Blindverkostungen von großer Wichtigkeit, bei denen Somms sich gegenseitig eine bessere Aromaerkennung einbläuten. Von Leuten, die die Kunst des »Blendens« beherrschten, konnte ich mir Feedback zu meiner Verkostungstechnik geben lassen und mir das Basiswissen aneignen und außerdem die Kosten für acht bis zwölf Probeweine mit ihnen teilen. Bislang hatte ich mich in zwei Gruppen einschleichen können. Freitags traf ich mich mit anderen Anfängern. Mittwochs kam ich mit fortgeschrittenen Sommeliers zusammen. Sie bevorzugten das Verkosten am Morgen, da sie davon ausgingen, dass ihre Sinne in diesen Stunden wacher waren als nach einem Tag voller Reize, zudem arbeiteten die meisten aus der Gruppe abends. Also fanden wir uns jeden Mittwoch um zehn Uhr morgens in der Wohnung von einer von uns in Queens ein und brachten in knittriger Alufolie oder in Kniestrümpfen versteckte Flaschen mit. Unsere Gastgeberin wohnte in einem Einzimmerapartment, das sie in einem Stil, der sich wohl am besten mit »Weinchic« beschreiben lässt, eingerichtet hatte. Eine hüfthohe, mit Korken gefüllte Flasche stand da in der Ecke, es gab einen Weinkühlschrank, der bis zur Decke reichte, statt Coffeetablebüchern lagen Weinenzyklopädien herum, und die syrahfarbenen Wände zierten gerahmte Weinetiketten. Unsere Sitzungen fingen für gewöhnlich damit an, dass irgendjemand darüber tratschte, mit welch mangelhaftem Stil der Typ vorigen Abend den Wein dekantierte. Sie endeten mit einer Debatte darüber, welche Weine am besten zu schalen Tortillachips passten, da keine von uns gefrühstückt hatte.
Nach meiner ersten Blindverkostung mit den Profis wurden mir Hausaufgaben aufgegeben. Ich war zu ihnen gekommen, um das Verkosten zu erlernen. Offensichtlich überstieg dies mein Können bei Weitem. »Erst mal musst du das Spucken lernen«, wurde ich von einer hartgesottenen Sommelière namens Meghan in Kenntnis gesetzt, nachdem sie gesehen hatte, wie ich mich durch ein ganzes Glas kämpfte. Das Ausspucken ist eine Kunst für sich, und mit meiner Taktik hatte sie definitiv nichts gemeinsam – ich positionierte meinen Mund direkt über den schaumigen Inhalt des Spuckeimers und schleuderte den Wein mit hängendem Kinn und einem »Blaa« hinaus. Sie führten mich an das »selbstbewusste Ausspucken« heran – mit geschürzten Lippen einen kräftigen, gleichbleibenden Strahl herausschießen – sowie an das »doppelte Spucken« – zweimal pro Schluck ausspucken, um wirklich sicherzugehen, dass ich keinen Alkohol herunterschluckte und lediglich eine minimale Menge über meine Schleimhaut aufnahm. Als ich diese raffinierte Art des Spuckens zum ersten Mal probierte, spritzten mir Tröpfchen aus dem Gemeinschaftseimer auf Wangen und Stirn. »Mir fiel das selbstbewusste Spucken am Anfang auch ganz schwer«, beruhigte mich Meghan. »Es braucht einfach nur Übung.«
Zwischen meinen Rebsaft-Trainingseinheiten schnüffelte ich an Quitten, mampfte verschiedene Apfelsorten und schaute, wie lange ich an den Kräutern in meinem Supermarkt riechen konnte, bis ich die Aufmerksamkeit des Sicherheitsbeamten erregte. Ich bemühte mich, die mir erteilten Ratschläge bezüglich meines sensorischen Gedächtnisses zu befolgen, und prägte mir die Eindrücke von Tieren, Gemüse und Mineralien ein, damit ich diese Düfte auch in einem Wein ausmachen konnte. Jahrelang hatte ich mich an die Vorstellung geklammert, dass mich Gefräßigkeit zu einem besseren Menschen macht, also war ich absolut begeistert, dass Essen und Trinken in rauen Mengen an oberster Stelle stand. »Eins nach dem anderen. Erst muss dein Gehirn mit jeder Menge Informationen gefüttert werden«, riet Ian Cauble, ein Meistersommelier aus Kalifornien. »Iss viel, probiere viel Obst. Du musst jede Sorte Zitrusfrüchte probieren. Du musst die Schale probieren, den Kern, den Saft von reifen Orangen, unreifen Orangen, überreifen Orangen, Navelorangen, Meyers Zitronen, unreifen grünen Zitronen, Limetten …« Austern und Kaviar also nicht. Aber wenn das Kauen einer Grapefruitschale mich zu einer besseren Verkosterin machen würde, war ich bereit.
Ein anderer Profi überredete mich dazu, ein bisschen Dreck in meinen Ernährungsplan aufzunehmen.
»Schlecke an Felsbrocken, wenn du draußen unterwegs bist«, legte dieser Sommelier mir nahe, der offensichtlich nicht in Manhattan lebte, wo einen ein derartiges Vergnügen entweder vergiftet oder in die Klapse bringt. »Ich schlecke andauernd an Felsbrocken.«
»Welche Art Felsbrocken?«, fragte ich, eher aus Neugier denn aus dem Wunsch, es ihm gleichzutun.
»Jede Art Felsbrocken, an dem ich vorher noch nicht geschleckt habe«, verriet er mir. »Es macht Spaß, den Unterschied zwischen rotem Schiefer und blauem Schiefer zu schmecken. Roter Schiefer enthält mehr Eisen – schmeckt also ein bisschen wie blutiges Fleisch. Blauer Schiefer hat etwas Nasses, Teichkiesiges.«
Im Laufe dieser Besprechungen brachten mich meine inoffiziellen Weinberater zu der Einsicht, dass wenigstens ein Teil meines dreistufigen Plans goldrichtig war: die Prüfung zum Certified Sommelier des Court of Master Sommeliers zu machen.
Seit 1977 ist der adlig klingende »Court« (dt. Hof) mit der ehrwürdigen Aufgabe betraut, dass sich keiner umsonst den Namen »Sommelier« ans Revers heftet. Als bedeutendster Prüfungsausschuss für professionelle Sommeliers legt der Court die Maßstäbe für jeden einzelnen Aspekt im Verhalten eines Sommeliers fest. (Siehe beispielsweise die Richtlinien bezüglich der Entgegennahme eines Kompliments vonseiten des Gastes.) Eine Qualifikation des Courts ist nicht obligatorisch. Doch genau wie ein Magister oder ein Grand-Cru-Etikett für Menschen dient ein Diplom des Courts als Gütesiegel, mit dem ein Sommelier meist mehr Geld verdienen, schneller aufsteigen und einen handfesten Beweis der eigenen Kompetenz vorlegen kann. (Es gibt vier Prüfungsstufen, vom »Introductory Sommelier« zum »Master Sommelier«.) Eine steigende Zahl Restaurants erwartet von ihren Sommeliers ein Abschlusszertifikat des Courts, und jedes Jahr sitzen Tausende von ihnen in den Prüfungen, obwohl es bei manchen Abschlüssen eine zwölfmonatige Warteliste gibt. Diejenigen, die durchhalten – und die Prüfung schaffen –, werden in eine Familie einflussreicher Weinprofis aufgenommen, die aufeinander aufpassen. Ein aufstrebender Master Sommelier verglich sein Bestehen der Prüfung sogar mit der Aufnahmezeremonie bei der Mafia. Ich jedenfalls war bereit, mir in den Finger zu stechen und den erforderlichen Schwur zu leisten. Seit ich mich auf diesen Weg begeben hatte, ahnte ich, dass ich das sensorische Dasein und den Weinfanatismus der Sommeliers nie ganz begreifen würde, wenn ich ihre Lebensweise nicht vollkommen adaptieren und so wie sie sein würde. Da ich nicht jahrelang Zeit hatte, um mich auf dem üblichen Weg hochzuarbeiten, war die Certified-Prüfung des Court of Sommeliers der realistischste Versuch, von der Kellerratte hoch ins Restaurant befördert zu werden.
Um sich des Certified-Titels würdig zu erweisen, müssen angehende Somms ihre Kompetenz auf dem Gebiet der Weintheorie unter Beweis stellen (Welche Rebe ist auf Madeira am weitesten verbreitet?), ihre Fähigkeiten beim Servieren des Weins (Haben Sie alle siebzehn Schritte ausgeführt, die beim richtigen Einschenken eines Roten erforderlich sind?) sowie ihr Können bei der Blindverkostung (Sind Sie in der Lage, Aromen, Säure, Alkoholgehalt, Gerbstoffe, Süße, Anbauregion, Rebsorte und Jahrgang herzuleiten?). Diese drei Bereiche spiegeln das benötigte Basiswissen eines Sommeliers wider, doch damit nicht genug. Die Kandidaten müssen auch unter Beweis stellen, dass sie sogar im Angesicht von Albtraumgästen und Restaurantkatastrophen stets Haltung und Eleganz bewahren. Die Prüfung stellt mentale Stärke, Selbstvertrauen und Grazie unter Druck auf die Probe. Und jeder, mit dem ich darüber sprach, hatte eine Horrorgeschichte auf Lager. »Zeig das kleinste bisschen Schwäche, und sie wird brutal vorgeführt werden«, verriet mir Meistersommelier Steven Poe, als ich ihn um Rat fragte. »Bevor ich meine Prüfung im Bereich Service antrat, blickte ich in den Rückspiegel meines Autos und sagte: ›DIESEMOTHERFUCKER! DIEWERDENVERSUCHEN, DICHAUSEINANDERZUNEHMEN! DENTEUFELWERDENSIETUN! DUWIRSTGEWINNEN!DUGEHSTDAJETZTREINUNDMACHSTSIESOWASVONFERTIG! FIXUNDALLEMACHSTDUDIE!‹ Dann hab ich so viel Scotch getrunken« – er hielt ein unsichtbares Schnapsglas mit zwei Fingern hoch und kippte es runter – »und sie anschließend niedergewalzt.«
Kurse kann man keine nehmen, um die Prüfung zu bestehen. Der Court händigt einem stattdessen eine zweiseitige Literaturliste mit elf Büchern und drei Weinenzyklopädien aus. Alles, was ich wissen musste, würde ich mir also selbst beibringen müssen. Um überhaupt einen Versuch starten zu dürfen, musste ich erst einen Eignungstest bestehen, der mit dem Warnhinweis versehen war, dass eine dreijährige Erfahrung im Wein- und Dienstleistungsgewerbe »dringend empfohlen« werde. Und ich gab mir gerade mal ein Jahr. Für alles.
Wie Sie sich vorstellen können, waren die Reaktionen auf mein Vorhaben, es in dieser Zeitspanne von Kellerratte zu Certified zu Sommelière zu schaffen, wenig ermutigend.
»Die greifen gerade hart durch. Und bei dir werden sie besonders hart sein, weil du Journalistin bist«, warnte mich eine Sommelière meiner Mittwochsrunde. Die Doku Somm, die vor Kurzem gezeigt worden war, sowie die Fernsehserie Uncorked (dt. Entkorkt) hatten das Interesse an den Diplomen des Courts angekurbelt, und so kursierte das Gerücht, dass die Prüfung schwieriger geworden war, um die Schwachen auszusieben. Schwache Zivilisten vor allen Dingen.
Ein Meistersommelier, der selbst schon jede Menge Prüfungen beaufsichtigt hat, wollte mich ermutigen und erreichte genau das Gegenteil damit.
»Die wollen einfach nur sichergehen, dass du beim Bedienen klarkommst und nicht durchdrehst und anfängst zu weinen und abhaust«, meinte er.
Es bereitete mir einigermaßen Sorge, dass so etwas überhaupt im Bereich des Möglichen lag.
»Passiert das denn oft?«, fragte ich.
»Stäääändig.« Es könnte aber noch viel, viel schlimmer kommen, fügte er hinzu. Beim Versuch, über einer offenen Flamme zu dekantieren, hatte sich manch einer schon selbst angezündet.
Als ich das alles meinem Mann Matt erzählte, brachte er die beste Ansage von allen.
»Versuch doch lieber, deinen alten Job zurückzukriegen!«
Nicht ganz unverständlich, dass er so pessimistisch war.
Meine Leistung als Kellerratte hatte ein neues Tief erreicht, als ich mich auf ein Weindinner vorbereitete, das Joe für eine kleine Gruppe Kenner veranstaltete.
Ich wollte gerade meinen Arbeitstag beenden, da bat mich Joe, die »Siebenhundertfünfziger« runterzubringen, die er und Lara auf einem der oberen Kellerregale beiseitegelegt hatten (der Inhalt einer Standardflasche beträgt 750 Milliliter). Lara hatte mir versichert, ich müsse den Wein nicht mit Samthandschuhen anfassen, wenn ich meiner Arbeit nachging, und weil ich Joe gerne zeigen wollte, was für eine erfahrene alte Ratte ich war, mutete ich dem Wein einiges zu. Die Flaschen lugten aus meiner Ellbogenbeuge hervor, kopfüber, sie ragten kreuz und quer vor meiner Brust hervor, als ich die Leiter hinabstieg.
Erst als ich sie auf einem Tisch aufprallen ließ, wurde mir klar, welch kostbare Fracht ich da getragen hatte. Das waren Juwelen von legendären italienischen Erzeugern, darunter ein »Tignanello« des Weinhauses Antinori, der erste des Siegeszuges der sogenannten Supertoskaner, für die Sangiovese mit französischen Rebsorten verschnitten wurde.
Ich würde etwa einen Monat lang im Keller schuften müssen, um mir die Teilnahme an solch einem Dinner leisten zu können. Joe kam vorbei und warf einen Blick auf das Raubgut.
»Die stehen seit gestern aufrecht im Regal, damit sich das Depot absetzen kann«, sagte er. »Es ist unglaublich wichtig, dass diese Weine nicht herumgeschubst werden.«
Darauf erwiderte ich nichts.
Joe nahm einen Korkenzieher aus seiner Tasche und begann, die Metallfolie um den Korken herum abzunehmen. Dazu setzte er die zweieinhalb Zentimeter lange Klinge am Korkenzieher unter der Kante an und umkreiste damit den Hals, wobei er zwei saubere Schnitte machte – den einen im Uhrzeigersinn, den anderen entgegen dem Uhrzeigersinn. Während er sich mit dem Daumen am Rand des Flaschenmundes abstützte, schnippte er mit dem Messer am Korkenzieher die metallene Kapsel von der Flasche weg. Sie löste sich so selbstverständlich ab, dass es aussah, als ob der Wein seinen Hut lüpfen würde. Die Korkenzieherspirale drehte Joe, ohne die Flasche auch nur im Geringsten zu bewegen. Eine schnelle Bewegung aus dem Handgelenk, und schon hatte der Tignanello scheinbar freiwillig seinen Korken abgegeben.
Ich schaute zu, wie er das ganze Prozedere wiederholte, und fragte dann, ob ich es auch mal versuchen dürfte. Ich begann, am Flaschenhals herumzusägen. Das bereitete Joe sichtlich Schmerzen.
»So viel Kraft ist gar nicht nötig«, sagte er.
Ich sägte sanfter.
Er machte ein zerknautschtes Gesicht, so, als hätte er gerade einen Chianti mit Korkschmecker getrunken. »Ehrlich, probiere bitte, die Flasche ruhig zu halten.«
Ich hörte auf zu sägen, setzte das Messer am unteren Rand der Kapsel an, so, wie er es getan hatte, streifte es nach oben und hieb mir dabei tief in den Daumen. Kleine Nadelstiche Blut tauchten dort auf.
Joe machte sich mehr Sorgen um den Wein. »Du darfst die Flasche nicht bewegen«, versuchte er es noch einmal, als ob ich das die ersten Male überhört und Schütteln für die passende Maßnahme gehalten hätte. Er nahm mir das Kellnermesser aus der geschundenen Hand. Ich wollte nicht einmal versuchen, den Korkenzieher hineinzudrehen, und er bot es mir auch nicht an.
Nun sollte ich die Weine dekantieren, was ich noch nie in meinem Leben getan hatte.
»Weißt du, wie man Weine dekantiert?«, fragte mich Joe.
»Ja, klar«, log ich.