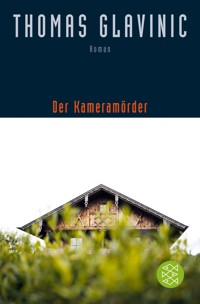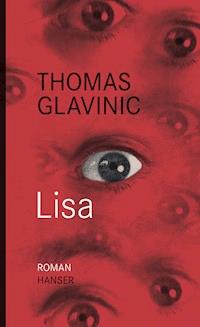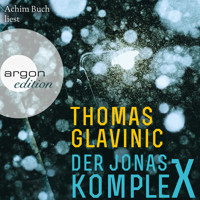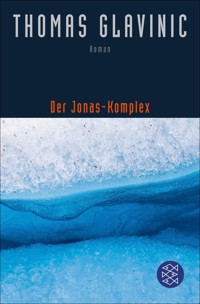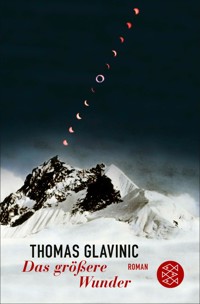
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas Glavinics großer Roman über die Liebe Während einer Expedition zum Gipfel des Mount Everest erinnert sich Jonas zurück an sein Leben – an seine außergewöhnliche Kindheit mit seinem Zwillingsbruder Mike und seinem Freund Werner, an seine Reisen durch die ganze Welt und an die Momente mit seiner großen Liebe Marie, die sein Leben verändert hat. In »Das größere Wunder« erzählt Thomas Glavinic von magischen Begegnungen, großen Freundschaften und tragischen Schicksalsschlägen, von einem Baumhaus in Norwegen, einer einsamen Insel und dem Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Thomas Glavinic
Das größere Wunder
Roman
Über dieses Buch
Während einer Expedition zum Gipfel des Mount Everest erinnert sich Jonas zurück an sein Leben– an seine außergewöhnliche Kindheit mit seinem Zwillingsbruder Mike und seinem Freund Werner, an seine Reisen durch die ganze Welt und an die Momente mit seiner großen Liebe Marie, die sein Leben verändert hat. In »Das größere Wunder« erzählt Thomas Glavinic von magischen Begegnungen, großen Freundschaften und tragischen Schicksalsschlägen, von einem Baumhaus in Norwegen, einer einsamen Insel und dem Aufstieg auf den höchsten Berg der Welt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thomas Glavinic wurde 1972 in Graz geboren. Sein erster Roman »Carl Haffners Liebe zum Unentschieden« erschien 1998. Danach folgten u. a. die Romane »Der Kameramörder«, der mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet wurde, »Wie man leben soll« und »Die Arbeit der Nacht«. »Das bin doch ich« stand 2007 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen die Romane »Das größere Wunder« und »Der Jonas-Komplex«. Zahlreiche seiner Romane wurden für die Bühne adaptiert und verfilmt. Seine Werke sind in 20 Sprachen übersetzt. Thomas Glavinic lebt in Wien.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2013 Thomas Glavinic
Für diese Ausgabe:
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de nach einer Idee vom Peter-Andreas Hassiepen
Coverabbildung: Getty images und akg-images
ISBN 978-3-10-492109-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
Ich war hierher gekommen, an diesen Ort, und war nicht intakt genug oder hatte nicht genug reale Substanz, um seine Bedingungen zu akzeptieren.
Denis Johnson
Ich bin die Milliarden.
Fitzcarraldo
1
Das Gestern stand klar vor ihm, das Soeben schwand, zerfloss, ungreifbar und verbraucht.
An seinem Zelt wurde der erste Leichnam vorbeigetragen, notdürftig bedeckt mit einer im Wind flatternden Plane. Nach den Überresten der zwei anderen Sherpas, die ein tonnenschwerer Sérac im Eisbruch erschlagen hatte, wurde noch gesucht. Weiter oben am Berg, zwischen Lager 3 und Lager 4, waren mehrere Franzosen in einem Schneesturm verschwunden, ohne Funkkontakt und ohne Vorräte an künstlichem Sauerstoff für einen ihrer Kameraden, der angeblich schon das Bewusstsein verloren hatte. Vor kurzem war zudem die Nachricht gekommen, dass in Lukhla ein Flugzeug mit vier Teilnehmern der Green-Future-Expedition vermisst wurde, darunter ein Rabbi und ein amerikanischer Schauspieler.
Unter den Hunderten und Aberhunderten Menschen, die das Basislager mit ihren Zelten, ihren brummenden Generatoren, ihren vielfältigen Sitten und Gewohnheiten bevölkerten, herrschte gedrückte Stimmung. Viele waren einfach verstummt, andere schrien, einige weinten, manche lieferten sich Wortgefechte. Mittendrin rief eine Frau unablässig nach Batterien für ihr Funkgerät, wobei sie ein Megafon benutzte, das ihr schließlich weggenommen wurde.
Nachdem sich Jonas davon überzeugt hatte, nirgends gebraucht zu werden, war er wieder auf einem Klappstuhl vor seinem Zelt zusammengesunken. Er betrachtete alles Geschehen wie durch einen Schleier, bemühte sich, Anteil zu nehmen, doch er begriff kaum, was vor sich ging.
Sein Zustand lag nicht allein an den bohrenden Kopfschmerzen, die die Höhe nach dem zügigen Aufstieg bei ihm hervorgerufen hatte und gegen die auch die roten Pillen aus Helens Apotheke nichts ausrichteten, obwohl sie sonst bei jedem wirkten. Weder lag es an der Mattigkeit, die ihn schon erfasst hatte, ehe er gestern ins Lager gekommen war, noch hatte es etwas mit der Übelkeit zu tun, die ihm die Hygienemängel in den Kloaken auf dem Weg eingetragen hatten und die ihn in unregelmäßigen Abständen hinter ein paar Felsen trieb, wo die Sherpas eine Toilette mit Steinwänden errichtet hatten. Er hatte zwar schlechte Laune, weil er fand, dass manche Sherpas die Yaks, diese wunderbaren zotteligen Märchentiere, die Lasten transportierten, nicht gerade rücksichtsvoll behandelten, aber das war es auch nicht. Vielmehr war die Erinnerung mit Gewalt über ihn hereingebrochen, und er befand sich nicht wirklich hier, vor seinem Zelt im Basislager jenes Berggiganten, der ihn schon als Kind auf geradezu unheimliche Art fasziniert hatte, sondern hatte sich ganz in sich zurückgezogen. Er dachte an den Weg, der ihn hierher geführt, der ihn um die Welt getrieben hatte, der ihn einst in Südamerika auf Marie hatte stoßen lassen, jene Marie, mit der er urplötzlich das Gefühl gehabt hatte, sich im Zentrum eines Jahrhundertsturms wiederzufinden, in ständiger Erwartung von Abenteuer und Chaos, kopflos und ohne Maßstab für das, was in sein Herz drang.
Jonas steckte fest in Gedanken an den Weg, der kurz nach seinem 18. Geburtstag begonnen hatte, als Picco ihm in einem denkwürdigen Gespräch eröffnete, dass er, Jonas, von nun an über so viel Geld verfügte, wie er niemals würde ausgeben können. Eine Stunde später hatte sich der Mann, dem Jonas alles verdankte, jedenfalls das, was er seine Freiheit nannte, in seinem Landhaus das Leben genommen, zerfressen von seiner elenden Krankheit, und Hohenwarter, Piccos Freund und Berater, hatte die vielfältigen Transaktionen seines Vermögens vollendet. Das war der Tag, an dem es begonnen hatte. Alles.
Ein rauschebärtiger Riese mit einem Funkgerät sah auf Jonas herunter, er schien schon eine Weile auf ihn einzureden. Jonas zuckte die Schultern. Der Miene des Mannes konnte er ablesen, dass es die falsche Reaktion gewesen war. Nach einer Weile dämmerte ihm, dass es sich um Sven gehandelt hatte, einen der Bergführer des Teams.
Padang brachte heißen Tee. Jonas nickte ihm zu. Er wollte etwas über die Toten sagen, den schmächtigen Koch fragen, ob er Freunde verloren hatte, aber die Wirklichkeit entglitt ihm wieder, machte Platz für Szenen aus seinem Leben, in denen er feierte, in denen er Angst hatte, in denen er lachte, in denen er Schlimmes tat, in denen er allein war und wanderte und reiste, im Auto, im Bus, in Hunderten Zügen, in Tausenden Flugzeugen, auf der Suche nach dem einzigen, für das es wert war zu leben: der Liebe.
»Ob es dir gut geht! Hörst du mich überhaupt?«
»Ja, ich höre dich«, sagte Jonas.
»Alles in Ordnung mit dir?«
»Danke, muss nur erst mal verschnaufen.«
»Viel trinken, das ist jetzt das Wichtigste. Aber das weißt du selbst, ist ja nicht dein erster Berg.«
»Nein, ist es nicht.«
»Was war eigentlich dein höchster Gipfel?«
»Helen, ich bin jetzt nicht …«
»Das ist für mich nicht uninteressant, die Erfahrung spielt eine große Rolle für die Akklimatisation. Wie hoch warst du schon?«
Jonas rieb sich das Gesicht und schwieg.
»Jonas, ich unterhalte mich nicht aus reinem Vergnügen mit dir oder weil es keine Kranken und Jammernden ringsum gäbe und mir langweilig wäre. Ich will einschätzen, wie klar du denken kannst. Das ist der Everest.«
»Das ist mir schon aufgefallen.«
»Hier gehen ganz üble Dinge vor sich. Bei den Rumänen hat es auch einen erwischt, die Lunge von dem musst du dir mal anhören. Solange da noch was zu hören ist. Aber die Gruppe kenne ich, es war nur eine Frage der Zeit, bis bei denen etwas passiert. In Kathmandu hat …«
»Helen, mir geht es gut«, sagte Jonas, stand auf, ein wenig wackelig, und sah ihr direkt in die Augen.
»Ich will dich nicht auch noch im Gamow von ein paar Sherpas runtertragen lassen müssen.«
»Das wird ganz bestimmt nicht nötig sein, versprochen.«
»Um dich wäre es schade«, sagte sie. »Verstehst du?«
»Ich verstehe«, sagte er.
»Das verstehst du also.«
»Ja, Helen. Das verstehe ich.«
»Gut, Jonas, dann sag mir, was dein höchster Berg war.«
»Das Matterhorn.«
»Das ist doch hoffentlich ein Witz!« rief sie aus.
»Ist es«, sagte er. »Ein Witz.«
»Weißt du eigentlich, dass ich das Recht habe, dich hier im Basislager festzuhalten oder nach Lukhla zurückzuschicken, ganz egal, was Hadan meint? Wenn ich dich nicht für körperlich und geistig imstande halte, diesen Berg zu besteigen, bleibst du da.«
»Aconcagua«, sagte Jonas. »6900 Meter. Können wir dieses Theater jetzt lassen?«
»Na schön. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir das schon gesagt habe: Sprich vor anderen Teams bitte nicht davon, dass ich als Ärztin dabei bin.«
»In Ordnung, aber wieso denn nicht?«
»Weil die meisten keine haben. Viele Teams verfügen nicht einmal über das Nötigste an Ausrüstung, die glauben, sie klettern hier einfach mal so hoch. Schlimmstenfalls tauchen bei mir jeden Tag Dutzende von Leuten auf, und ich kann nicht alle behandeln. Speziell unseren Gamow-Sack muss ich dann herborgen, und ich wette, genau dann, wenn der mit irgendeinem saudischen Prinzen unterwegs nach unten ist, kriegst du deine Probleme. Na egal. Noch Tee? Was zu essen?«
»Irgendwas gegen Übelkeit …«
Er stieß sie zur Seite. Noch vor der Toilette hörte er ihr Lachen. Er musste selbst lachen. Aber nur kurz.
2
Für Jonas hatte jede Zeit ihren eigenen Geruch, so wie sie auch eine eigene Stimmung und einige charakteristische Bilder hatte. Die Zeit, als er sieben oder acht war und lernte, dass das Leben nicht einfach sein würde, roch nach dem starken Filterkaffee seiner Mutter.
Es war jene Zeit, in der er unglücklich war, wenn er in der Schule sitzen musste, weil er dann nicht auf seinen Bruder aufpassen konnte. Mike besuchte den Kindergarten, obwohl er gleich alt war wie Jonas, auf den Tag genau. Bei seiner Geburt war etwas schiefgegangen, die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gewickelt und ihm zu lange die Luft abgesperrt, und nun konnte er weder bis drei zählen noch einen Hund von einer Katze unterscheiden.
Es gab niemanden auf der Welt, den Jonas so sehr liebte, nicht einmal Werner. Er dachte Tag und Nacht daran, wie er Mike beistehen konnte, wie er ihn vor den Hänseleien anderer Kinder und vor der Wut seiner Mutter schützen konnte, der Wut seiner Mutter und der ihrer Freunde, die nichts übrighatten für ein Kind, das dauernd in die Hose machte, mit dem Essen herumwarf und Haushaltsgeräte kaputtschlug. Und so kam Jonas jeden Morgen zu seiner Mutter in die Küche, wo es nach Kaffee roch, im Radio Volksmusik gespielt wurde und überall leere und halbleere Rotweinflaschen herumstanden.
»Mutti, ich habe gestern ein Glas aus dem Schrank genommen.«
»Na und? Stell’s wieder zurück.«
»Das kann ich nicht.«
»Wieso nicht? Hast du es zerbrochen?«
»Es ist mir runtergefallen. Tut mir leid.«
»Du bist ein Idiot, weißt du das? Das wirst du von deinem Taschengeld bezahlen.«
»Entschuldige bitte.«
»Ach, verzieh dich.«
Jonas war jede Form von Beschimpfung oder Strafe lieber, als mit anzusehen, wie Mike gedemütigt wurde, wie er den Mund verzog und zu weinen begann. Jeder musste bemerken, dass Mike nicht verstand, was man von ihm wollte, aber seine Mutter bemerkte es nicht, sie nicht und ihre Freunde nicht, sie schimpften, sie schlugen zu, und Mike wehrte sich niemals.
Jonas, Mike und Werner waren am selben Tag zur Welt gekommen, ihre Mütter lernten sich im gemeinsamen Krankenzimmer kennen.
Jonas und Werner besuchten denselben Kindergarten, saßen in der Grundschule nebeneinander, lernten auf demselben Fahrrad fahren und im selben Fluss schwimmen, verteidigten sich gegenseitig bei Prügeleien, passten gemeinsam auf Mike auf und entwickelten ähnliche Vorlieben und Abneigungen. Gemeinsam blockierten sie Garagen, probierten Apfelmost, fälschten Unterschriften für ihre Mitschüler, terrorisierten den Postboten, ruinierten Schlösser, warfen unangenehmen Zeitgenossen Flaschen durchs Fenster, in denen sie tausende Fliegen gezüchtet hatten, unterbrachen versehentlich die Stromversorgung des ganzen Ortes, retteten eine Hasenfamilie aus einer Tierheimhölle, und all das noch vor ihrem zehnten Lebensjahr.
Jonas wunderte sich oft, warum es nie Prügel für ihre Streiche setzte, egal, wie schlimm sie waren.
Werners Großvater hieß eigentlich Leopold Brunner, doch Verwandte und enge Freunde nannten ihn Picco, und Werner nannte ihn den Boss, wie er es in einem Film über einen Mann gehört hatte, der Picco angeblich ähnlich sah.
Jonas kam das erste Mal mit dem Boss in Berührung, als Werner in den Karateverein wollte, wo eine resolute Bäckermeisterin Kampfsport lehrte. Jonas hatte kein Geld dafür, weil sich seine Mutter in den wenigen wachen Stunden zwischen zwei Fuselräuschen weigerte, die Kursgebühren zu übernehmen. Werner redete mit Picco, und der bezahlte den Jahresbeitrag für beide. Da waren sie neun.
Diese Zeit – es war eine Zeit, die nach Plastik roch und seltsam rund war – verbrachten Jonas und Mike bereits öfter bei Werner als zu Hause, denn in der schäbigen, niemals aufgeräumten Wohnung ihrer Mutter war es unerträglich. Die Mutter kam, wann sie wollte, und wenn sie kam, war sie betrunken und nicht allein. Bisweilen schlug sie die beiden, doch mehr als die Ohrfeigen schmerzten Jonas die Schwäche und die leere Trauer, mit der sie diese verabreichte.
Zu essen gab es unregelmäßig, und wenn er saubere Wäsche wollte, musste Jonas seine und Mikes Sachen im Waschbecken mit Seife bearbeiten. Nachts lag er wach und hoffte, dass sein Schluchzen von den Stöhngeräuschen aus dem Nebenzimmer übertönt wurde. Schlief er doch ein, wurde er zum Schlafwandler, landete in Schränken, in der Besenkammer, in der Badewanne oder unter dem Tisch. Er hatte so grauenvolle Albträume, dass seine Schreie sogar die lallenden Bettgenossen seiner Mutter alarmierten.
Jonas empfand wenig religiöse Gefühle im herkömmlichen Sinn, doch oft starrte er mit verweinten Augen in die Dunkelheit und betete zu Gott, flehte ihn an, ihm einen Engel zu schicken, eine Form von Erlösung, irgendetwas, das sein Leben erträglich machte. Er konnte sich nicht vorstellen, dass es jemals einen einsameren Menschen gegeben hatte als ihn. In der Wohnung seiner Mutter baute er um sich eine Mauer aus Büchern und Musik, die er mit seinem Kassettenrecorder abspielte, dem letzten Geschenk, das er von seinem Vater bekommen hatte.
Die Jungen sahen Picco selten, er hielt sich im Hintergrund, und weil Werners Eltern ständig geschäftlich verreist waren, wurden Werner, Jonas und Mike hauptsächlich von Hausangestellten aufgezogen, sofern man das, was sich innerhalb dieses Hauses ereignete, als Erziehung bezeichnen konnte. Jonas war das recht, weil er schon damals der Ansicht war, dass es niemanden auf der Welt gab, der ihn erziehen konnte.
»Ich will der werden, der ich bin«, hatte er einmal auf die entsprechende Frage eines Freundes seiner Mutter geantwortet. Das hatte ihm eine Kopfnuss seiner Mutter eingebracht. Trotzdem antwortete er das gleiche, als ihn Picco ein paar Monate darauf fragte, und der gab ihm keine Kopfnuss, sondern wollte wissen, wie genau das gemeint war.
»Ich glaube, man ist schon jemand«, sagte Jonas. »Jeder ist jemand, und besser als das kann er nicht werden. Er kann nichts anderes werden, und wenn er es doch wird, ist er nicht glücklich.«
»Willst du glücklich sein?« fragte Picco.
»Dumme Frage«, antwortete Jonas.
Die Leute ringsum zuckten zusammen, doch Picco lachte. »Du hast recht. Ich habe sie falsch gestellt. Glaubst du, man ist glücklich, wenn man geworden ist, was man ist?«
»Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann nur so.«
»Und du meinst, das Leben ist uns vorbestimmt?«
»Wann habe ich denn das wieder gesagt? Ich habe gesagt, man muss der werden, der man ist, man muss herausfinden, wer man ist, und der muss man dann werden, auch wenn einem das nicht gefällt.«
»Ist das nicht Vorbestimmung?«
»Nicht wirklich. Vielleicht bin ich ein Gewaltverbrecher oder ein Clown, vielleicht ein Automechaniker oder ein Koch, vielleicht bin ich nur das, was ich sein soll, wenn ich in einem Supermarkt arbeite oder wenn ich den ganzen Tag schlafe oder wenn ich Banken ausraube, aber das ist nicht Vorherbestimmung. Vorherbestimmung ist, wenn vorherbestimmt ist, dass mir an einem bestimmten Tag ein Dachziegel auf den Kopf fällt, aber ich glaube nicht, dass ich wichtig genug bin, dass jemand vorherbestimmt, wann mir ein Dachziegel auf den Kopf fallen wird. Ich glaube, ich bin ich, und das muss ich erst werden, weil ich noch ein Kind bin.«
Picco sah ihn lange an, ohne ein Wort zu sagen. Schließlich landete ein Gummigeschoss in Jonas’ Gesicht, er drehte sich um und sah gerade noch, wie Werner um die Ecke flitzte. Damit war das Gespräch beendet.
Picco hatte blaue, jungenhaft strahlende Augen und eine herrlich sanfte Stimme, die sanfteste Stimme, die Jonas je gehört hatte, eine Stimme, von der man sich umschmeichelt und getragen fühlte. Er war anders gekleidet als die meisten Männer seines Alters, trug oft Turnschuhe zum Sakko, seine Bewegungen waren ungezwungen und federnd. Wenn er daheim war, bemerkte man das sofort an der Musik von Johnny Cash, die weite Teile des Hauses ausfüllte. Die Hausangestellten – zu Anfang fiel es Jonas schwer, die Übersicht zu behalten, er schätzte ihre Zahl auf sieben oder acht – behandelte Picco mehr als Freunde denn als Untergebene.
Von denen hatten die Jungen Regina am liebsten. Die Köchin verarztete Wunden, nahm Weinende in den Arm, verteilte Süßigkeiten, erzählte Geschichten und hatte keine Ahnung von dem, was sie am Herd tat.
»Was kochst du heute?« fragte Jonas.
»Das weiß ich nicht.«
»Du meinst, du hast dich noch nicht entschieden?«
»O doch, aber woher soll ich denn wissen, was dabei rauskommt?«
Jonas sah ihr zu, und sogar ihm war klar, dass sie ohne große Sachkenntnis ans Werk ging. Planlos vermischte sie Gewürze, Kräuter, Fleisch und Nudeln, und ihrer Miene beim Abschmecken konnte er ablesen, wie neugierig sie selbst auf das Ergebnis ihres Experiments war.
Zur Leibesfülle neigte hier niemand, auch nicht Gruber, der Gärtner, der in einer Hütte neben dem Haupthaus lebte und sich um alle Reparaturen kümmerte, die auf dem weitläufigen Anwesen anfielen. Seit er sich einmal mit einem Wagenheber ungeschickt angestellt hatte, hinkte er auf dem rechten Bein. Er ging niemals aus, bekam nie Besuch und lachte nie.
Hohenwarter, der eine Art Beraterstelle für Picco einzunehmen schien, sahen sie unregelmäßig, zu selten, um aus ihm schlau zu werden, jedenfalls nicht in diesen ersten Jahren. Er hatte etwas Verschmitztes und strahlte zugleich eine nachlässige Brutalität aus. Ab und an steckte er den Jungen Geld zu und erzählte ihnen vom alten Rom. Mit seinem kahlen glänzenden Kopf und seinen Maßanzügen, die in heftigem Kontrast zu den Filzpantoffeln standen, in denen er durchs Haus schlich, war er eine ziemlich ungewöhnliche Erscheinung. Erst Jahre später begann Jonas zu verstehen, wie viele Geheimnisse es in diesem Haus gab, deren Mittelpunkt Hohenwarter war, und dass es hier um Geschäfte ging, für deren Dimension ihm auch später noch jeder Begriff fehlte.
Mit zehn kam Jonas ins Krankenhaus, weil ihn ein neuer Freund seiner Mutter verprügelt hatte, genau jener, den Jonas insgeheim »das Affe« nannte, weil so ein Mensch seiner Ansicht nach keinen korrekten Artikel verdiente.
Anlass für den Vorfall war Mike gewesen. Beim Versuch, eine Bierflasche als Mikrofon zu benützen und einen Sportreporter zu mimen, hatte Mike die Flasche zerschlagen. Das Affe stürzte sich sofort auf ihn und schlug ihm hart ins Gesicht. Ohne nachzudenken, sprang Jonas dazwischen.
»Hör auf! Lass ihn in Ruhe! Er hat es nicht absichtlich gemacht!«
Im nächsten Moment lag er auf dem Boden, ohne zu wissen, was ihm geschah. Er verstand nicht, wieso er neben leeren Flaschen und Spuren von Katzenpisse auf diesem schmutzigen alten Spannteppich lag und ein riesiger, nach Alkohol dünstender Mann über ihm stand und mit den Fäusten auf ihn einschlug, er verstand es damals nicht und Jahrzehnte später nicht. Er wusste nur, dass ihn nicht der physische Schmerz am tiefsten verletzte, sondern die betretene Untätigkeit seiner Mutter, die mit gesenktem Kopf und einem Glas in der Hand daneben stand und so tat, als sei sie nicht da.
Das war das Bild, das Jonas nie vergessen sollte. Er dachte an seinen Vater, der ein paar Jahre zuvor gestorben war und ihn sicher beschützt hätte, er dachte an den Mount Everest, auf den die mutigsten Menschen der Welt kletterten, er dachte an den Grand Canyon, den er besuchen wollte, seit er im Kindergarten Bilder davon in einem Buch gesehen hatte, und den er sich als eine Heimstatt zauberhafter Urwesen ausmalte, die ihn vor allen Gefahren beschützen würden.
Bald darauf dachte er gar nichts mehr, und alles versank in Dunkelheit.
Mike, Werner und Picco besuchten ihn jeden Tag im Krankenhaus. Selbst Hohenwarter und Regina erschienen, gefolgt von einem riesigen Mann, den Jonas nicht kannte. Beim Anblick der Hämatome an Jonas’ Körper schüttelte Picco den Kopf, strich ihm durchs Haar und murmelte etwas, während Werner stapelweise Micky-Maus-Hefte auspackte und auf den Nachttisch legte.
Mike kletterte zu Jonas ins Bett und schmiegte sich an ihn. Beim Abschied musste er jedes Mal von Jonas fortgezogen werden.
»Er wohnt derzeit bei uns«, erklärte Werner. »Picco wollte das so.«
Am zweiten Tag bekam Jonas ein Einzelzimmer. Als er am Tag darauf für eine Untersuchung nach draußen gerollt wurde, bemerkte er erstaunt, dass der unbekannte Mann aus Piccos Begleitung vor der Tür saß und in einer Zeitschrift las.
»Na, Junge?« sagte der Riese. »Üble Sache, aber es gibt immer noch Schlimmeres.«
»Stimmt wohl.«
»Kennst du die Geschichte von dem Vortragsreisenden in Bangkok?«
»Ich glaube nicht.«
»Nun, das war schon ein älterer Herr, und Bangkok ist heiß und feucht. Nach einem Vortrag ging er auf sein Zimmer und nahm erst mal eine kalte Dusche.«
»Klingt vernünftig.«
»Danach legte er sich aufs Bett, und um sich weiter zu erfrischen, schaltete er einen Ventilator ein. Leider hatte er noch nasse Hände. Errätst du, wie die Geschichte weitergeht?«
»Ich fürchte ja«, sagte Jonas.
»Eine halbe Stunde später kam ein Zimmermädchen rein, und selbst da roch es noch verbrannt.«
»Er war tot?«
»Mausetot.«
»Das ist wirklich schlimmer als das, was mir passiert ist.«
»Siehst du«, sagte der Mann und nahm seine Zeitschrift wieder auf. »Man muss die Dinge immer von der positiven Seite betrachten.«
Nach einer Woche, in der ihn seine Mutter kein einziges Mal besucht hatte, wurde Jonas entlassen, und von da an änderte sich einiges.
Mike und Jonas wohnten von nun an bei Picco. Jonas bekam das Zimmer neben Werner, das dreimal so groß war wie sein altes, es war sauber, er hatte immer frische Wäsche und sogar neue Hosen, die ihm nicht zu kurz waren, er musste sich nicht allein um sich kümmern, sondern wurde geweckt und bekam Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
»Merkt dein Großvater eigentlich, dass Mike nicht so ist wie wir?« fragte Jonas. »Weiß er, dass es anstrengend werden kann mit ihm?«
»Der findet den normaler als uns, glaube ich«, sagte Werner.
»Und wie lange sollen wir bleiben?«
»Warten wir mal ab. Mir wäre es am liebsten, ihr bleibt für immer.«
»Aber das geht doch nicht.«
»Hier geht alles.«
Die Mutter sahen Jonas und Mike zunächst einmal die Woche. Immer im Beisein des Riesen aus dem Krankenhaus, der Zach hieß und jedes Ziel in einer Entfernung von bis zu dreißig Metern mit einem Stein treffen konnte.
Die Gespräche mit ihr verliefen einsilbig, sie war so gut wie nie nüchtern. Auf Jonas wirkte sie wie jemand, der von einer bösen Hexe verzaubert und in einen Dämmerschlaf versetzt worden war. Sie schälte Erdnüsse, indem sie mit dem Aschenbecher darauf schlug, bohrte verloren in Mottenlöchern an ihrer Jacke und kratzte sich fluchend mit einer Stricknadel in ihrem Gipsarm, weil sich eine Fliege hinein verkrochen hatte. Den Gips trug sie, weil sie in einer Kneipe die Treppe hinuntergefallen war. Jonas hielt ihren Anblick kaum aus und atmete jedes Mal auf, wenn sie wieder zur Tür hinaus war.
Nach und nach besuchten Jonas und Mike ihre Mutter seltener.
Das Affe sah niemand wieder.
Seit Jonas zu Werner gezogen war, verloren für ihn die hohen kirchlichen Feste ihre Bedeutung. Es wurde nichts außer den Geburtstagen gefeiert.
»Gibt es bei euch kein Weihnachten?« fragte Jonas.
»Nein, wieso?« antwortete Werner.
»Weil man das eben feiert.«
»Wieso?«
»Na ganz einfach … weil man Geschenke kriegt und so.«
»Die kriegen wir ja sowieso.«
»Ja gut … aber wegen dem Baum … und wegen Gott.«
»Lass das mal nicht den Boss hören. Der will von Gott nichts wissen. Er sagt, Gott ist ein Nazi.«
Kleidung kauften die Jungen immer gemeinsam mit Zach. Was ihm gefiel, durfte Jonas für Mike ein zweites Mal einpacken, der immer das Gleiche anhaben wollte wie er. Um sich von Mike zu unterscheiden, trug Jonas stets noch einen Gürtel oder ein Armband, was jedoch nur Werner auffiel. Weil Mike oft stumm dasaß und man nicht auf den ersten Blick merkte, dass er die Welt mit anderen Augen sah, kam es mitunter zu Verwechslungen. Jonas und Werner gefiel die Verwirrung, die die Zwillinge bei manchen Hausbewohnern anrichteten, und Jonas trieb sie gern auf die Spitze, indem er sich zuweilen als Mike ausgab, um auf diese Weise herauszufinden, wie sich die Menschen seinem Bruder gegenüber benahmen. Wer nett zu Mike war, den mochte er. Wer böse zu ihm war, fand am nächsten Tag Hundekot in seinen Schuhen oder halbtote Mäuse im Bett.
Die Volksschule hatten Jonas und Werner dank einer nachsichtigen Lehrerin hinter sich gebracht, und nun stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Zwei Abgesandte einer Hochbegabtenschule kamen ins Haus und prüften sie. Der IQ beider Jungen lag im Spitzenbereich, dennoch weigerte sich die Schule mit Hinweis auf ihre disziplinären Defizite, sie aufzunehmen.
Von da an ließ Picco die beiden im Haus unterrichten.
Es gab vier festangestellte Lehrer für Mathematik, Deutsch, Englisch und Latein, außerdem noch einen Russen und einen Italiener, weil Jonas so gern Sprachen lernte, dazu kamen wechselnde Vortragende für die Fächer Geschichte, Geografie, Chemie, Physik, Biologie und Philosophie, die meisten waren ausgewiesene Spezialisten.
Es kamen Nobelpreisträger ins Haus, Olympiasieger, Fernsehstars, Schachgenies, Künstler, Politiker und Zauberer. Manche blieben länger, andere kürzer, viele nur einen Tag. Jonas und Werner schafften es, einen missliebigen Lehrer nach dem anderen in die Flucht zu schlagen, bis das Personal ihren Wünschen entsprach. Egal, wie schlimm sie es trieben, ob sie den Lehrern ein Feuerzeug in den Auspufftopf ihres Autos schoben, sie mit Bienenstöcken traktierten oder das Essen mit Abführmittel versetzten, von Picco bekamen sie niemals Vorwürfe zu hören. Und auch sonst von niemandem.
Mit dem Sportlehrer hätten sie sich indes niemals angelegt, denn zum einen mochten sie ihn sehr, zum anderen hätte der sich zu helfen gewusst. Es war Zach, der sie in einer Kampfkunst unterrichtete, die er Wing Chun nannte und von der sie nie zuvor gehört hatten. Er behauptete, sie von einem Meister in Hongkong gelernt zu haben, einem gewissen Wong Shun Leung.
Gleich zu Anfang des Unterrichts machte er die Jungen mit den vier Kampfprinzipien dieser Kunst vertraut: 1. Ist der Weg frei, stoße vor. 2. Ist der Weg versperrt, bleibe stehen. 3. Ist der Gegner stärker, gib nach. 4. Zieht sich der Gegner zurück, folge ihm. Das war praktisch und einfach zu merken. Es gab auch vier Kraftprinzipien, und Zach sagte, diese seien der Schlüssel zu allem, was er über das Leben und das Kämpfen wusste: Mach dich frei von deiner eigenen Kraft. Mach dich frei von der Kraft deines Gegners. Nutze die Kraft des Gegners. Füge deine eigene Kraft hinzu.
Sie übten oft stundenlang. Jeder Tag begann mit der »Kleinen Idee«, bei der Jonas vor einem Spiegel stand und jene Bewegungsabfolgen übte, die sich »sein Rückgrat merken sollte«, wie es Zach ausdrückte. Danach versank er im Chi Sao, der klebenden Hand, einer Übung, bei der die Trainingspartner einander gegenüberstanden und in einer unaufhörlichen Bewegungsschleife sich an den Armen drückten, ohne je den Kontakt zu verlieren. Drückte man zu fest, verschwendete man Kraft und konnte vom anderen aus dem Gleichgewicht gebracht werden, drückte man zu sanft, konnte man selbst weggedrückt werden. Es war eine Übung, bei der Jonas in seinen und den Körper des anderen hineinlauschte, und er fand sich oft in einer Art Trance wieder, nach der er sich an keinerlei Einzelheiten mehr erinnern konnte.
3
Jonas war so zerschlagen, dass er für die dreißig Meter zum Essenszelt zehn Minuten benötigte. Dort ließ er sich neben Sam auf eine Bank fallen, einem der Bergsteiger aus seinem Team, den er bereits in Kathmandu kennengelernt hatte. Der saß mit hängenden Schultern da und konnte nur noch flüstern.
»Stimme total weg«, krächzte er. »So was wie das hier habe ich selten erlebt. Ich bin kein Jammerer, ich habe Möbel in achtstöckigen Häusern ohne Lift hochgeschleppt, aber so was wie das hier habe ich noch nicht erlebt.«
»Du hörst dich an wie einer, der nachts fremde Frauen am Telefon belästigt«, sagte Jonas und nahm den Tee entgegen, den ihm Padangs Bruder Pemba reichte.
»Diese Kälte! Diese Kopfschmerzen! Diese Übelkeit! Die verdammte Verdauung, man weiß gar nicht, wieso man vom Scheißhaus überhaupt noch runter soll!«
Er sprach in so aufgesetzt gequältem Ton, dass Pemba laut lachte und die anderen Sherpas ringsum ansteckte, die, mit verschiedenen Verrichtungen beschäftigt, auf Hadans Erscheinen warteten.
Jonas trank den Tee in kleinen Schlucken und bemühte sich, ihn nicht gleich wieder von sich zu geben. Als der Expeditionsleiter, ein vollbärtiger Kerl von stattlicher Körpergröße und mit einer riesenhaften Nase, nach einigen Minuten das Zelt betrat, war seiner Miene abzulesen, dass Ärger in der Luft lag.
»Leute, seid mal einen Moment still! Ja, auch du da hinten, Hank! Ennio und Carla schweigen ebenfalls, sonst mache ich Ernst und sie dürfen dieses Jahr ihre Sauerstoffflaschen tatsächlich selber rauftragen. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Das freut mich.
Meine Freunde, ungeachtet dessen, was sich heute im Eisbruch abgespielt hat – hier am Berg muss man an sich selbst denken, und so gesehen war das kein schlechter Tag für unser Team. Wir schauen nach vorne. Ich begrüße diejenigen von uns, die heute mit dem letzten Schwung angekommen sind, ich habe gehört, in Lobuche hat es euch nicht so gefallen? Da seid ihr aber nicht die ersten.«
Schwaches Gelächter machte die Runde, einige husteten. Hadan streckte einen Finger hoch, und es wurde wieder leise.
»Das Unglück der Sherpas im Eisbruch ist natürlich eine große Katastrophe. Wer möchte, kann nachher zur Gedenkfeier gehen, die später ein Stück weiter talwärts stattfinden wird.«
Er raschelte geräuschvoll mit den Papieren, die er in den Händen drehte, und schaute zu Boden.
»Was ist mit den Franzosen?« rief der Mann, den Hadan Hank genannt hatte.
»Die würde ich noch nicht abschreiben, ich kenne ihren Bergführer, und wo der ist, geht das Licht zuletzt aus. Ach ja, und aus Lukhla hört man, das Flugzeug sei vielleicht gar nicht in Kathmandu gestartet. Warten wir also mal ab.«
Im Zelt hob Gemurmel an. Jemand unternahm den vergeblichen Versuch, allgemeinen Applaus zu entfachen.
»Probleme haben wir, wie ihr wisst, mit den Sherpas. Nicht mit unseren Jungs hier, ihr seid wundervoll, und an dieser Stelle möchte ich euch einmal gesonderten Dank aussprechen dafür, dass ihr mit uns klettert. Ohne euch würde keiner von uns den Gipfel, ja nicht einmal eines der Hochlager zu Gesicht bekommen. Liebe Leute, seid euch dessen bewusst, dass diese kleinen zähen Burschen die Höhe von Geburt an hundertmal besser vertragen als ihr, und begegnet ihnen mit dem Respekt, den sie verdienen.«
Nun applaudierte das ganze Zelt, ein schriller Pfiff ertönte, da und dort wurden die Namen einzelner Sherpas gerufen, die verlegen lachten.
»Das Problem liegt woanders«, setzte Hadan fort. »Wegen der Sonnenfinsternis ist es schwierig, in diesem Jahr die besten Hochträger an den Berg zu bekommen. Einige von ihnen halten sie für ein böses Omen und lassen diese Saison lieber aus, obwohl sie das Geld dringend nötig hätten. Unfälle wie der heute im Eisbruch sind deshalb doppelt schlimm.«
»Wann findet diese Sonnenfinsternis eigentlich statt?« rief eine Frau mit langen blonden Locken.
»Ziemlich genau in sechs Wochen«, beschied ihr jemand von hinten.
»Und was genau mögen die Sherpas daran nicht?«
»Es ist ihnen zu dunkel«, sagte der Mann neben ihr.
»Und was ist nach dieser Sonnenfinsternis«, rief die Frau, »können sie nicht wenigstens dann an den Berg kommen?«
»Das ist Anne«, flüsterte Sam Jonas zu, »Tierpflegerin aus irgendeinem Kaff in Texas. Habe sie und ihren Verlobten, den schleimigen Kerl neben ihr, vor ein paar Jahren an der Ama Dablam kennengelernt. Er kommt aus Portugal, einem Land mit großer alpinistischer Tradition. Mit denen werden wir noch unseren Spaß haben, meine Fresse.«
»Und wer ist dieser Hank?« fragte Jonas leise.
»Hank Williams, Universitätsdozent aus Kalifornien. In Wahrheit heißt er anders, sie nennen ihn nur so wegen seiner musikalischen Vorlieben. Ich mag ihn.«
»Wir wollen das nicht hier und jetzt diskutieren«, rief Hadan gegen den anschwellenden Chor erregter Stimmen, »maßgeblich für uns ist einzig, dass es am Berg nicht genug erfahrene Sherpas gibt. Natürlich hat das die Preise hochgetrieben, aber da ich diesen Mehraufwand einzig aus Edelmut und keineswegs wegen meiner totalen juristischen Ohnmacht nicht an meine Kunden weitergebe, betrifft euch das nicht. Uns sollte neben der Tatsache, dass wir nicht genug Träger haben, eher Sorgen machen, was es bedeutet, wenn ein paar hundert Amateure ohne ausreichende Sherpaunterstützung auf diesem Monster von einem Berg herumspazieren. Das wird uns in hohem Maß betreffen, denn so groß und mächtig dieser Berg auch ist, so wenig Platz gibt es darauf. Damit hier niemand stirbt, ist neben dem Können der Bergsteiger und viel Glück auch eine Menge Koordination und Disziplin notwendig, und ich kann die Rolle der einheimischen Helfer gar nicht genug herausstreichen.«
»Hadan hört sich gern reden«, flüsterte Sam.
»Ich fasse es nicht«, rief Annes Verlobter, »die trauen sich nicht auf ihren Berg, weil in einem Monat fünf Minuten lang die Sonne verschwindet, und deswegen bricht hier das Chaos aus?«
Sam stieß Jonas an und lachte leise. Jonas fing den Blick einer jungen Frau auf. Sie lächelte ihm zu und verdrehte die Augen.
»Tiago, wenn du etwas auf dem Herzen hast, erzähl es mir später«, sagte Hadan scharf. »Wir sind nicht hierhergekommen, um über die Gebräuche unserer Gastgeber zu urteilen. Wir sind Gäste und benehmen uns als solche.«
Sein Blick schweifte vom einen zum Nächsten. Erst jetzt fiel Jonas auf, dass in Hadans Vollbart Eiskristalle hingen. Sein Haar war zerzaust, um den Hals trug er eine Kette mit einem Xi-Stein. Wie Jonas seinen Expeditionsleiter einschätzte, war es ein echter.
»Hört mir genau zu. Was ich nun sage, muss jedem von euch in allen Konsequenzen klar sein. Zu Hause, in der Ferne, war es Theorie. Nun ist es Realität. Ihr könnt hier sterben. Es gibt eine absolut reale Chance, von diesem Berg nicht mehr runterzukommen. Da oben, ja sogar hier im Lager, kann es sehr schnell gehen, denn die Höhe bringt euch um. Ein Lungenödem, ein Hirnödem, in weniger als einer halben Stunde seid ihr außer Gefecht. Gar nicht zu reden von der Unfallgefahr, von Schwächeattacken, wir haben hier jedes Jahr ein, zwei Herzinfarkte, und die Schlaganfälle hat noch keiner gezählt. Generell ist die Südseite des Berges die gefährlichere. Aber wir haben uns bewusst für sie entschieden und müssen mit den Risiken umgehen.«
»Hadan hört sich übrigens sehr gern reden«, flüsterte Sam.
Hadan raschelte erneut mit den Papieren in seiner Hand. Sein Blick ruhte auf Anne und Tiago.
»Ich will, dass ihr Bescheid wisst: Dies könnten die letzten Tage eures Lebens sein. Lasst das auf euch wirken. Und vergesst nicht, dass ihr niemals nur euch selbst gefährdet, wenn ihr Unsinn macht, sondern immer auch die Menschen, die euch aus dem Schlamassel wieder rauszuholen versuchen.
Und zum anderen: Gebt die Heldenphantasien auf, die ihr von zu Hause mitgebracht habt. Das ist kein heroischer Berg, so wie es keine heroische Art zu sterben ist, da oben für alle Zeit festzufrieren. Hier werden keine Heldenepen geschrieben, jedenfalls nicht von euch. Die einzigen Helden, die es hier gibt, sind die Sherpas, die eure Ausrüstung, euren Sauerstoff, eure Zelte da hochschaffen, die euch Schnee schmelzen und Tee kochen und im Extremfall eure Seelen retten, also erweist ihnen eure Dankbarkeit.«
Er räusperte sich. Es blieb still.
»Hörst du«, flüsterte Sam und stieß Jonas an, »unsere Seelen werden von ihnen gerettet, das ist doch wirklich nett von den tapferen Sherpas.«
»Bitte hör auf«, sagte Jonas, »wenn ich lache, werden die Kopfschmerzen noch schlimmer.«
»Gut, soweit alles klar?« rief Hadan. »Zwei Dinge akzeptiere ich nicht: Respektlosigkeit gegenüber unseren einheimischen Freunden und Widerstand gegen meine Entscheidungen.«
»Ho, ho!« rief Tiago.
»Ihr habt mich nicht dafür bezahlt, damit ich euch auf den Gipfel des Everest bringe. Das glaubt ihr vielleicht, aber so verhält es sich nicht. Ihr habt mich dafür bezahlt, dass ich euch lebend von hier wegkriege. Wenn der eine oder andere dabei den Gipfel schafft, umso besser. Wenn nicht, ist es keine Katastrophe. 50000 Dollar sind nicht viel Geld, zumindest für die meisten von euch. Kommt ihr eben nächstes Jahr wieder.«
Er lachte, und ehe Tiago etwas einwerfen konnte, fügte er hinzu: »Für diejenigen unter euch, die ihn nicht verstanden haben, das war ein Witz. Wobei es niemandem schaden könnte, sich zu überlegen, was das Geld, das jeder von euch in diese Expedition gesteckt hat, hier vor Ort bedeuten würde. Damit baut man hier eine ganze Schule.«
Hadan ging zu den Getränkekisten und nahm sich eine Dose Bier. Ein Flüstern ging durch das Zelt, abgelöst durch eine Kakofonie von Schnauben und Husten.
»Ein wenig dick trägt er auf, wie üblich«, raunte Sam, »doch er hat nicht unrecht. Übrigens, guck dir mal die Fingernägel der Tante da vorne an. Jeder Nagel eine andere Farbe. Investmentbankerin. Ganz nett. Hat eine Schraube locker.«
»So, Leute!« rief Hadan. »Ehe die Männer anfangen, sich sinnlos zu betrinken und den letzten Rest ihrer Würde zu verlieren, noch ein kurzer Abriss der kommenden Wochen. Wir akklimatisieren uns eine Weile im Basislager, schließlich unternehmen wir einen Tagesausflug durch den Khumbu hoch zu Lager 1. Da bleiben wir nicht, sondern marschieren wieder runter. Ein paar Tage später dasselbe noch mal, aber da übernachten wir oben. Mit dieser Taktik arbeiten wir uns allmählich von Lager zu Lager den Berg hinauf. Anders kriegen wir die Sauerstoffsättigung eures Blutes nicht dahin, wo sie sein muss. Der Rest, und das ist mein Schlusswort, hängt in hohem Maße von eurer eigenen Leidensfähigkeit ab. Prost!«
Er nahm einen Schluck Bier, dann bat er Ang Babu, der unter den Sherpas die Leitung am Berg innehatte, mit ihm zu kommen, um ein paar Dinge zu besprechen. Applaus begleitete seinen Abgang. Er schaute noch einmal ins Zelt.
»Lasst das bitte, wir sind nicht im Theater!«
»Übrigens«, sagte Sam, »die Bankerin war vor vier Jahren mit mir am Elbrus, da hieß sie noch Andrew.«
»Im Ernst?«
»Mein voller Ernst. Der Typ da drüben heißt Charlie, verkauft Autos und bohrt gern in der Nase. Die da ist Eva, sie weiß, dass sie gut aussieht und freut sich sehr darüber, in ihrem komischen Videoblog dreht sich eigentlich alles nur um sie. Der dort hat einen unaussprechlichen Namen und ist schon mit einem Hirnschaden hergekommen, wenn du mich fragst, denn sieh dir mal an, wie der zuckt! Da! Schau mal! So geht das die ganze Zeit! Und die da vorne heißt Sarah, eine deutsche Studentin, die die Expedition angeblich von ihrem Freund geschenkt bekommen hat.«
»Das muss eine tolle Beziehung sein.«
»Wahrscheinlich hat er sie gut versichert.«
Jonas saß eine Weile da und fragte sich, was im Moment überwog, der Kopfschmerz oder die Übelkeit. Gern hätte er sich unter die Teammitglieder gemischt, um zu hören, wie Hadans Auftritt angekommen war, doch er war schon kaum fähig gewesen, sich auf die Ansprache zu konzentrieren, und sein einziges Ziel war sein Zelt.
»War der wirklich schon mal selbst da oben?« hörte er beim Vorbeigehen Tiago fragen.
»Dreimal«, sagte Hank. »Der weiß, wovon er redet.«
»Er macht es sich viel zu einfach. Er ist nicht nur dafür bezahlt worden, mich heil wieder nach Hause zu bringen, sondern vor allem rauf!«
»Wie soll das funktionieren? Rauflaufen musst du schon selbst.«
»Das werde ich auch, darauf kannst du dich verlassen. Auch wenn ich jetzt kotzen gehe. Und die Schule für die armen Sherpakinder, weißt du, wohin der sich seine …«
Die Frau, mit der er zuvor Blickkontakt gehabt hatte, stellte sich Jonas in den Weg.
»Haben wir uns schon begrüßt?« Sie streckte ihm die Hand hin. »Ich bin Eva. Blick und Fänge. Der Blog. Schon gelesen? Hab mich in der Rundmail vorgestellt.«
»Tut mir leid, ich muss mich dringend hinlegen.«
»Gute Besserung, aber könnte ich vorher noch ein Interview für meinen Blog haben? Die Zeitung, die meine Reise mitfinanziert hat, will tägliche Berichte, und ich möchte Stimmen anderer Bergsteiger einfangen.«
»Jetzt ganz bestimmt nicht. Später auch nicht. Am besten nie.«
Schwer durch den offenen Mund atmend, stolperte er aus dem Zelt.
Die Kälte draußen erfrischte ihn so weit, dass er den Weg ohne Haltepausen bewältigte, doch nachdem er den Reißverschluss am Eingang hinter sich zugezogen hatte, brach er zusammen. Alles um ihn drehte sich, er fühlte sich wie auf einem Karussell. Eine neue Welle von Übelkeit überkam ihn. Mit aller Willenskraft kämpfte er sie nieder, doch der folgende Hustenanfall ließ seinen ganzen Körper erbeben.
Ehe er in die Dunkelheit abtauchte, fiel ihm Tanaka ein. Den hatte er damals, als er mit Fischvergiftung und Krämpfen in Armen und Beinen in einem Tokioter Krankenhaus gelegen war, gefragt:
»Wie elend kann man sich eigentlich fühlen?«
»Elend wird nach Richter gemessen«, lautete die Antwort.
»Wovon reden Sie da?«
»Von Erdbeben. Oder eigentlich davon, wie man Erdbeben und Elend misst. Die Mercalli-Skala endet bei 12. Richter ist prinzipiell nach oben offen. Übelkeit, Elend, Depression – alles Richter. Freude, Lust, Glück – alles Mercalli.«
4
An ihrem zwölften Geburtstag chauffierte Zach die Jungen und Picco aus der Stadt hinaus, die Hügel hinauf und durch die nebeligen Weinberge, wo die Straßen immer schmaler wurden und es im Sommer nach frisch gemähtem Gras roch, während nun im Dezember Schnee auf den Feldern lag. Picco summte zur Melodie von »Everybody Loves A Nut« aus dem Radio.
Werner schrieb etwas auf einen Zettel aus dem Notizblock, den er immer bei sich trug, und legte ihn Jonas auf den Schoß.
Siehst du deine Mutter heute noch? stand da.
Nein, schrieb Jonas zurück.
Du willst nicht oder sie will nicht?
Ich will nicht.
Aha.
Kommen deine Eltern? schrieb Jonas.
Nein.
Wieso nicht?
Ich weiß nicht.
Aha.
Nach einer halben Stunde gelangten sie zu einem schlossähnlichen Gebäude, das hinter dem Hausberg des Ortes lag und das sie noch nie gesehen hatten. Es lag halb versteckt in einem Wald, trotzdem hatte man von der Lichtung davor einen eindrucksvollen Ausblick auf das Tal unter ihnen. Werner und Mike interessierten sich nicht weiter für die Landschaft, Jonas hingegen stand da und schaute, bis Picco zu ihm trat.
»Was siehst du da?«
»So – viel. Viel.«
»Und was noch?«
»Immer mehr.«
»Und was noch?«
»Ich weiß nicht«, sagte Jonas, und im selben Moment erschauerte er, »ich weiß aber, dass noch etwas da ist.«
»Kluger Junge«, sagte Picco. »Vergiss es nie. Und jetzt komm mit.«
Der Garten des Hauses war nicht besonders ansehnlich. Tote Äste, knorrige Bäume, viel Unkraut, ein kaputter Stacheldraht.
»Ist nicht ganz fertig geworden«, sagte Picco. »Gruber schafft das nicht allein, da müssen andere her. Wird nach und nach erledigt werden.«
Als Picco die Tür öffnete, wehte ihnen der süße Geruch von frisch gebackenem Kuchen entgegen. Mächtige Deckenlampen tauchten den Flur in warmes gelbbraunes Licht. Drei hohe Flügeltüren vor ihnen waren verschlossen. Links ging es in eine Art Saal, wo auf einem großen Tisch eine Torte stand, in der brennende Kerzen steckten. Sie mussten gerade erst angezündet worden sein, doch zu sehen war niemand. Mike stürmte vor allen anderen hinein und stieß begeisterte Schreie aus.
»Das ist euer Geburtstagsgeschenk«, sagte Picco.
»Was?« fragte Werner und drehte sich einmal im Kreis. »Der Fußball da?«
»Auch, ja.«
»Und der Kicker in der Ecke?«
»Auch.«
»Und die Torte? Vielen Dank.«
Picco lachte. »Was ihr hier seht, ist eher ein vorübergehendes Geschenk. Das Geschenk ist das ganze Haus. Dieses Zimmer hier ist nur ein Teil, ein erster Teil des ganzen Geschenks. Im Grunde ist das Haus eine Zeitkapsel, die ich euch schenke.«
»Was ist eine Zeitkapsel, Boss?« fragte Jonas.
»Ihr sollt mich nicht so nennen. Ich bin nicht euer Boss.«
»Wir finden es aber lustig, dich so zu nennen. Also, was ist eine Zeitkapsel?«
»Etwas, worin man Zeit einschließt.«
»Und wer hat die Zeit eingeschlossen?«
»Ich.«
»Und warum?«
»Weil es ein Geschenk ist, das auch ich vor sehr langer Zeit von meinem Großvater bekommen habe. Dieses Haus hat ihm gehört, und er hat es mir als Zeitkapsel geschenkt. Jetzt ist es eure.«
»Wie genau schließt man Zeit ein?« fragte Jonas. »Was ist damit gemeint?«
»Wollt ihr nicht lieber die Kerzen ausblasen?«
»Da hat er mal recht«, sagte Werner und ging zum Tisch. »Komm her, oder ich erledige das allein!«
»Du kannst schon mal vier davon ausblasen«, sagte Jonas ernst nach hinten und wandte sich wieder Picco zu. »Was ist eingeschlossene Zeit?«
»Ich glaube nicht, dass ich es so erklären kann, dass du es verstehst.«
»Dann gib dir eben ein bisschen Mühe!«
Picco lächelte. »Na ja, die Welt dreht sich weiter, Menschen entwickeln sich, Regierungen stürzen, unvorhergesehene Ereignisse verändern den Lauf der Welt, doch hier drinnen wird nichts davon zu spüren sein.«
»Aha.«
»Mike, lass das!« rief Werner. »Nicht! Mensch, jetzt hat er alle Kerzen ausgeblasen!«
»Macht ja nichts«, sagte Jonas über die Schulter nach hinten. Und zu Picco gewandt: »Ich verstehe nicht. Was heißt das genau?«
»Was ihr in diesem Zimmer seht, ist ein Geschenk der Gegenwart, es ist ein Zimmer für die Gegenwart. Ihr werdet nicht immer zwölf sein. Es sind noch einige weitere Zimmer da. Es wird sie jedoch niemand mehr betreten, bis ihr kommt, oder euer zukünftiges Ich. Bis dahin werden sie unverändert bleiben. Das sind Zeitkapseln.«
»Heißt das, jedes Jahr gibt’s ein neues Zimmer?« fragte Werner. »Und da ist mehr drin als hier?«
»Nein, nicht jedes Jahr, viel seltener, nur ein paar Mal in eurem Leben. Und die Türen sind versperrt. Und ja, ihr werdet in den Zimmern Dinge vorfinden. Mehr sage ich nicht.« Jonas schnitt zwei Stück Torte ab. Den ersten Teller brachte er Mike, den zweiten Teller Picco.
»Aber«, sagte er, »was heißt das …«
»Mehr sage ich nicht!«
»Ich will aber mehr wissen!«
»Antworten werden überschätzt.«
»Ich frage trotzdem!«
»Du wirst nichts mehr erfahren, also frag nicht!«
»Ich frage trotzdem! Wie finden wir die Schlüssel? Wie suchen wir danach? Die Welt ist groß.«
»Das stimmt, die Welt ist groß, und deshalb sage ich dir, ich weiß nicht, ob es richtig wäre, danach zu suchen. Manche Dinge findet man nicht, wenn man sie sucht, so schlau und kühn man es auch anstellen mag, denn manche Dinge kommen zu einem, wenn man gar nicht danach verlangt. Die große Liebe etwa kommt nur dann, wenn man sie eben nicht sucht. Anderes wieder muss man suchen, suchen, suchen, nur dann gibt es eine Chance, es zu finden. Ich kann nicht sagen, was ihr hier tun sollt. Ich kann euch bloß verraten, dass sich hinter all diesen Türen hier weitere Räume befinden, Räume mit weiteren versperrten Türen, und dass ihr sehr alt werden müsst, um alle Zimmer sehen zu können.«
»Wann finden wir den nächsten Schlüssel?« mischte sich Werner ein. »Was ist in diesen Zimmern?«
»Lasst euch überraschen. Ihr könnt jederzeit hierher kommen, aber ihr seid auch für diesen Ort verantwortlich.«
»Dürfen wir Freunde mitbringen?«
»Nein. Die einzige Person, der ihr dies hier zeigen dürft, ist die Frau, die ihr liebt. Aber dafür ist es noch ein wenig früh.«
»Nur weil wir welche sind, brauchst du uns nicht immer wie Kinder zu behandeln«, sagte Jonas.
»Entschuldige«, sagte Picco.
»Hat das Haus einen Namen?« fragte Werner. »Hier sind wir Könige, die Könige von – wie heißt das Haus?«
»Die Könige der Zeitkapsel«, sagte Jonas, »das sind wir.«
Viel später würde Jonas die Geschichte dieses Nachmittags Marie erzählen. Und sie, sie würde ihn einen verrückten König der Zeitkapsel nennen, mehr als einmal. »Betrunkener König der Zeitkapsel« einmal in der Achterbahn in Hamburg, »unsteter König der Zeitkapsel« bei mehr als einem Abschied, »abwesender König der Zeitkapsel« in tausend SMS.
Für Jonas und Werner hieß das Haus bald nur noch die Burg. Zu Anfang nutzten sie sie fast jeden Tag, ließen sich von Zach oder dem traurigen Gruber hochfahren, tranken Kakao und wetteten, wer von dem nach Fisch schmeckenden Kuchen, den ihnen Regina mitgegeben hatte, mehr verdrücken konnte. Sie spielten Fußball und Drehfußball, hüpften auf dem Trampolin, das ihnen Picco noch von Gruber hatte bringen lassen, schossen mit Pfeil und Bogen durch den Saal, suchten nach einem weiteren Schlüssel, übten das Chi Sao. Letzteres nur, wenn Mike nicht dabei war, denn ihre Bewegungen waren ihm nicht geheuer, und er versteckte sich unter einem Tisch.
Mit der Zeit wurde es allerdings auch ihnen unheimlich allein in dem riesigen Haus, in dessen Nähe überdies je nach Jahreszeit oft dichter Nebel auf den Feldern lag. Sie glaubten Stimmen oder Schritte zu hören, mal ein Klopfen, mal das Quietschen eines Bettes, mal gar ein heiseres Lachen. Sie versuchten die Phantasie des jeweils anderen mit Spekulationen über das anzuheizen, was rund um sie vorging.
»Glaubst du, es gibt Gespenster?« fragte Werner.
»Natürlich gibt es sie.«
»Hast du schon mal eines gesehen?«
»Na, das wüsstest du bestimmt.«
»Wieso glaubst du dann an sie?«
»Weil es logisch ist, dass es sie gibt, oder etwas, was man so nennen könnte. Wohin soll denn die Energie der Menschen verschwinden? Sie sind alle noch da, irgendwo da draußen, auf die eine oder andere Weise. Spürst du sie nicht?«
»Nein, zum Glück nicht!«
»Solltest du aber, denn sie sind da. Oft spüren wir etwas, einen Schauer, haben ein seltsames Gefühl, sind irritiert, ohne zu wissen warum. Oder? Kennst du das nicht? Wir sehen Dinge, die nicht da sind, wir haben Ahnungen, und die Dinge sind vielleicht wirklich kurz dagewesen, für einen Sekundenbruchteil nur sichtbar für uns, und die Ahnungen sind mehr, als wir verstehen können, meinst du nicht? Um uns gibt es sicher einiges, das wir nicht sehen und nicht begreifen.«
»Hör auf«, sagte Werner, »mir wird echt ganz anders.«
»Mir ist immer ganz anders.«
»Was machst du, wenn jetzt ein Gespenst reinkommt? Läufst du davon, oder kämpfst du?«
»Wie soll man denn gegen ein Gespenst kämpfen? Mit einem Brotmesser oder einem Laserschwert? Außerdem tun die uns nichts.«
»Glaubst du, dein Vater ist ein Gespenst?«
Jonas sprang so heftig auf, dass sein Stuhl krachend nach hinten umstürzte. »Mein Vater ist kein Gespenst, das ist mal sicher! Gespenster sind irgendwelche Trottel. Man muss schon eine sehr dumme Seele sein, um sich ein Vergnügen daraus zu machen, durch die Welt der Menschen zu geistern.«
»Meinst du, du siehst ihn wieder?«
»Ich weiß nicht«, sagte Jonas und stellte den Stuhl wieder auf. »Hoffentlich. Dafür würde ich alles hergeben, was ich habe.«
»Vielleicht erscheint er dir mal.«
»Das soll er schön bleibenlassen! Ich würde mich zu Tode fürchten.«
»Aber wenn du vorbereitet bist? Und weißt, na gut, es ist ein Geist, aber eben dein Vater, der wird dir schon nichts tun?«
»Das funktioniert doch nicht«, sagte Jonas. »Ich bin nun mal nicht vorbereitet darauf, dass plötzlich mein Vater um die Ecke biegt, der zufällig ein Gespenst ist.«
»Wir könnten etwas vereinbaren«, sagte Werner. »Derjenige von uns beiden, der als erster stirbt, gibt dem anderen ein Zeichen.«
Jonas sprang erneut auf. »Tolle Idee!« rief er. »Was für ein Zeichen? Das ist nicht einfach, man muss ja zweifelsfrei feststellen können, dass es vom anderen stammt, das können keine Buchstaben aus abgebrochenen Zweigen auf der Straße sein, und vor allem sollte man dabei nicht zuviel Angst kriegen!«
»Ich bin auch dafür, dass es nicht zuviel Angst macht.«
»Was kommt von einem Toten und macht keine Angst?«
»Das ist eine sehr gute Frage«, sagte Werner.
Sie schwiegen eine Weile.
»Okay, überspringen wir den Punkt«, sagte Jonas und strich sich über das Kinn, wie er es bei Zach gesehen hatte. »Eine Blume, die plötzlich an einem Ort auftaucht, wo sie normalerweise nicht hingekommen sein kann. Im Winter, auf der Terrasse … Ich meine, sie wächst nicht aus dem Boden, sie liegt da im Schnee … Nein, totaler Mist. Klopfzeichen kommen auch nicht in Frage, da trifft einen ja sofort der Schlag. Irgendwas mit Licht … Wärme …«
»Etwas Geschriebenes wäre gut«, warf Werner ein.
»Wir sollten unsere Fähigkeiten als Tote nicht überschätzen.«
»Was ist mit einfach dasein? Vielleicht, wenn der andere gerade Hilfe braucht?«
»Was meinst du mit dasein?« fragte Jonas. »Das klingt gar nicht gut.«
»Ich meine, der Tote gibt sich durch seine Präsenz zu erkennen.«
»O Gott.«
»Du hast gemeint, die Toten sind da, ihre Energie ist da draußen«, sagte Werner. »Was ist, wenn derjenige, der tot ist, dem anderen auf ruhige Art zeigt, dass er da ist?«
»Die ruhige Art müssen wir besonders beachten«, sagte Jonas. »Aber hast du dir überlegt, dass das kein Beweis ist? Der Lebende wird bloß glauben, er ist verrückt geworden.«
»Das wird der Tote schon hinkriegen. So, dass der andere keinen Schock kriegt, das schaffen wir. Oder glaubst du, du musst Angst vor mir haben?«
»Nein, ich weiß es sogar.«
»Ich trau dir auch einiges zu, du Spaßvogel«, sagte Werner, »aber wenn du tot bist, wirst du dir schon gut überlegen, wie du mir erscheinst und was du mir zumuten kannst. Außerdem sind wir jetzt Kinder, und wenn wir tot sind, werden wir ja Erwachsene gewesen sein und das eine oder andere können, was wir jetzt nicht können.«
»Stimmt auch wieder.«
»Glaubst du wirklich, du musst Angst vor mir haben, wenn ich tot bin?« fragte Werner.
»Ich weiß ja nicht, ob du dann noch du bist«, sagte Jonas.
»Ob ich noch ich bin?«
»Ja. Ob du noch du bist.«
5
Jonas lag auf seinem taub werdenden Arm. Er war zu schwach, um sich wegzurollen. Seine Augen brannten, doch wenn er sie länger geschlossen hielt, strömten Bilder und Gedanken ungehindert auf ihn ein.
Die erste Nacht im Basislager hatte er in einer gnädigen Ohnmacht verbracht, er war in seinen Schlafsack gefallen, und mehr wusste er nicht, Stunden später war er einfach wieder dagewesen, umgeben von Stimmen und fremden Geräuschen, dem Kunststoffgeruch des Zelts und einer Ahnung von Tageslicht, das ins Tal fiel.
Diese zweite Nacht war viel qualvoller. Todmüde und doch weit vom Schlaf entfernt, schüttelte ein Reizhusten seinen Körper, die Kopfschmerzen mahlten, ihm war übel, und ihn suchten Gedanken heim, die er nicht aus seinem Bewusstsein verdrängen konnte. Dabei war es nicht der Charakter der Gedanken, was ihn quälte, sondern schlicht der Dauerzustand des Denkens und Grübelns.
Gesichter. Szenen. Episoden. Ängste. Gedanken. Und Marie. Immer in seinem Kopf, immer, immer, immer, ob er mit jemandem redete oder ob er auf dem Boden lag oder ob er las. Die einzige Flucht: der Schlaf. Der Schlaf aber kam nicht.
Draußen heulte der Wind. Ab und zu hörte Jonas das ferne Grollen abgehender Lawinen. Irgendwo schluchzte eine Frau, in den Zelten ringsum wurde gehustet und gestöhnt, dann und wann tanzte der Lichtkegel einer fremden Taschenlampe über seine Zeltwand. Jonas hatte das Gefühl, dass im ganzen Lager keiner schlief, obwohl es nach zwei Uhr morgens war. Die einen saßen in den Essenszelten und tranken das ungefilterte Chang-Bier, die anderen lagen leidend in ihren Zelten, und manche dachten wohl an das, was gerade auf diesem Berg vorging. An die Menschen, die gestorben waren. An die Menschen, die womöglich gerade in diesen Minuten starben, ohne dass man ihnen helfen konnte. Manch einer dachte vielleicht auch daran, wie es sein würde, wenn er selbst da oben unterwegs war, was auf ihn zukäme, ob er dem, was er für sich heraufbeschworen hatte, auch gewachsen war.
Sollte er ein Schlafmittel nehmen? Wahrscheinlich würde er trotzdem nicht einschlafen und nur noch matter werden. Er kannte das bereits von früheren Besteigungen, er akklimatisierte nur langsam, und in dieser Höhe regenerierte sich der Körper kaum oder gar nicht. Die Wunde etwa, die er sich gestern mit einem Zacken seiner Steigeisen in den Handballen geschlagen hatte, als er seine Ausrüstung kontrollierte, sah nicht viel anders aus als kurz nach dem Missgeschick.
Er setzte den Kopfhörer auf und schaltete den iPod ein. Die ersten Lieder waren sanft und melodisch, und es gelang Jonas, einige Minuten dahinzudämmern.
Maries Stimme riss ihn aus dem Halbschlaf. Er hörte die Worte, die sie neben ihm im Hotelbett auf Ko Phangan geschrieben hatte, und die Melodie, die ihr Tage danach bei einem Ausflug ins Landesinnere eingefallen war, auf der Ladefläche eines holpernden Jeeps, zwischen ihm und einem schwitzenden älteren Amerikaner, der bei jeder Bodenwelle gekreischt hatte.
Jonas schaltete ab und schleuderte die Kopfhörer in die Ecke.
Das Thermometer an der Zeltdecke zeigte minus 10 Grad Celsius. Jonas schlüpfte in seine Hosen und streifte zwei Pullover über. Als er den Reißverschluss am Eingang öffnete und den Kopf aus dem Zelt steckte, rutschte ihm eine Ladung Schnee von oben in den Nacken. Er hatte nicht einmal gemerkt, dass es begonnen hatte zu schneien.
Den Reißverschluss zog er nicht wieder zu. Er stand eine Minute vor dem Zelt und beobachtete, wie der Wind die Schneeflocken durch den Kegel seiner Stirnlampe in das Innere des Zeltes trieb.
Im Essenszelt traf er auf Padang und Ngawang, den Bergsirdar der taiwanesischen Expedition. Bei seinem Anblick lachten sie. Offenbar sah er so aus, wie er sich fühlte.
»Du kannst auch nicht schlafen?« fragte Padang.
»Merkt man das?«
»Du bist schon der Dritte diese Nacht. Willst du Tee?«
»Und eine Kopfschmerztablette. Irgendeine von deinen. Die von Helen wirken einfach nicht.«
Während Padang im Arzneischrank kramte, wurde Jonas von einem Hustenkrampf geschüttelt, der ihn beinahe von seinem Klappstuhl riss. Als er sich gefangen hatte, wischte er sich die Tränen aus den Augen und betrachtete den Bergführer, der mit gekreuzten Beinen bequem auf einer Bank lag, eine Dose Bier in der Hand.
»Und wieso schläfst du nicht?« fragte Jonas. »Musst du morgen nicht früh raus?«
»Nicht so schlimm«, antwortete Ngawang und rülpste. »Ich gehe erst mittags los. Jetzt betrinke ich mich. Solltest du auch tun. Dann weißt du wenigstens, warum du Kopfschmerzen hast.«
»Neuigkeiten von den Franzosen?«
Die Sherpas schüttelten stumm den Kopf.
»Was meinst du?«
»Hoffen kann man immer. Klar, es haben schon Leute allerhand da oben überlebt, was man nicht für möglich gehalten hätte. Aber realistisch ist das in dem Fall nicht. Sie sind eben nicht nur ohne Sherpas, sondern auch ohne Puja gegangen. Wer auf die Zeremonie verzichtet, beschwört den Zorn der Götter herauf.«
Jonas presste die Fäuste gegen seinen schmerzenden Kopf. Erneut ein Hustenanfall.
»Na den hat’s erwischt«, rief Padang. »Wo sind denn diese …«
Jonas räusperte sich. »Darf ich dich mal was fragen, Ngawang?«
»Schieß los.«
»Wie oft warst du auf dem Gipfel?«
»Dreimal. Und genauso oft habe ich keine hundert Meter davor umgedreht.«
»Ist dir einmal ein Kunde gestorben?«
Der Sherpa zögerte. »Einmal. Es war nicht meine Schuld.«
»Davon bin ich überzeugt. Darum geht es mir nicht.«
»Worum dann?«
»Das habe ich vergessen«, sagte Jonas, und während die Sherpas lachten, schluckte er die Tablette mit dem Tee, den ihm Padang reichte.
Ngawang setzte sich auf. »Darf ich dich auch einmal etwas fragen?«
»Nur zu.«
»Wieso sprichst du unsere Sprache?«
»Tue ich das?«
»Du antwortest auf Englisch, aber du verstehst offenbar jedes Wort, das wir mit dir reden. Wie kommt das? Wo hast du das gelernt?«
»Das ist eine gute Frage.«
»Und die Antwort?«
»Die habe ich auch vergessen.«
»Hirnödem«, sagte Padang. »Wir müssen ihn nach unten schaffen.«
»Komm schon«, sagte Ngawang und ging zum Kühlschrank. »Trink ein Bier mit uns und erzähl uns das.«