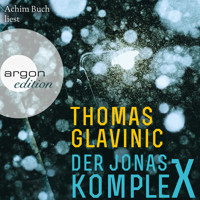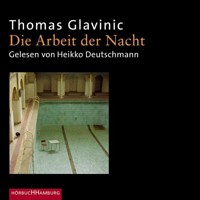8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein großartig erzähltes Schelmenstück.« Deutsche Welle Karl »Charlie« Kolostrum ist jung und stellt sich die entscheidende Frage, wie man eigentlich leben soll. Als Teil einer völlig überspannten Familie und Sohn einer Mutter, deren Neigung zu Alkohol und Promiskuität den Vater beizeiten verjagte, war er früh sich selbst überlassen und beschäftigte sich hauptsächlich mit der eigenen Person und ihrer Wirkung auf andere. Jetzt scheint es ihm an der Zeit, ein paar Lebensregeln aufzustellen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Thomas Glavinic
Wie man leben soll
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ausgabe 2010
© 2004Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40665-9 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13903-8
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
An dem Abend, an ...
Wenn morgens um sechs ...
Man ist Teil einer ...
Wenn man in Claudia ...
Ich glaube es einfach ...
In der Schule gibt ...
Wenn man sehr einsam ...
Zu den Initiationsriten des ...
Gerichtserfahrung als mehr oder ...
Die einmal entfesselte Sexualität ...
Wenn man Tante Ernestine ...
Wenn man eine Beziehung ...
Tanzen ist kein würdiger ...
Mit achtzehn ruft das ...
Für den Schüler eines ...
Wenn man das Schulabschlusszeugnis ...
An Tagen, an denen ...
Wenn man die erste ...
Wenn man Mirkos Schwanz ...
Der hirnerweichenden Praxis des ...
Wenn man zwanzig ist, ...
Wenn man das Glück ...
Wenn man keinen Partner ...
Da Tante Kathi der ...
Dass man aufgrund diverser ...
Wenn man einen Brief ...
Wenn man am 24. ...
Da die Erlebnisse der ...
Allgemeine Unsicherheit führt zu ...
Wenn man verliebt ist, ...
Merke: Einem Ziel hinterherzulaufen ...
Wenn man in würgenden ...
Da Hilde keine Schlampe ...
Im Leben gelangt man ...
Wenn man Mutter die ...
Lässt man Fräulein Alexandra ...
Wenn man eine Beziehung ...
Wenn man mit einer ...
Wenn man von einem ...
Das Team besteht aus ...
Am zweiten Tag schreibt ...
Wenn man vom Werben ...
Da man einer Familie ...
Wenn eine alte Frau ...
Da man sich die Wohnung ...
Die Lieblingsradiosendung der Bewohner ...
Da Mirkos vermögender Vater ...
Ob ein Mann ein großes ...
Da man kein Meister ...
Tags darauf läutet es ...
Inge ist gar nicht ...
Der Samstag ist heilig. ...
Der Katzenfresser Eberhart hat ...
Wenn man feststellt, dass ...
Wenn man eine Weile ...
Wenn man auch von ...
Obwohl Laura Traditionen aller ...
Wenn man nach Kenntnis ...
Wenn man ein paar ...
Wenn man als Taxifahrer ...
Wenn man mit den ...
Wenn man nach einem ...
Merke: Wenn man sich ...
Wer mich nicht liebt, darf mich nicht beurteilen.
Johann Wolfgang von Goethe
An dem Abend, an dem drüben in Amerika die Challenger über Cape Canaveral explodiert, liegt man zum ersten Mal mit einem Mädchen im Bett. Von dem Unglück ahnt man nichts, man konzentriert sich auf unsittliche Berührungen. Aus einem Kassettenrecorder dringt Musik, von der man weiß, dass sie dem Mädchen gefällt. So ist das Objekt der Sehnsucht in der gleichen Stimmung wie man selbst. Auch wenn man das für unmöglich hält.
Berührt man die weibliche Brust, stellt man fest, dass sie sich ähnlich anfühlt wie ein Tafelschwamm.
– Hoppla, Entschuldigung, murmelt man.
Claudia schweigt.
Zweifelhafte Gazetten verbilden Jugendliche und treiben sie scharenweise den Psychoanalytikern in die Arme. Entgegen deren Informationen schätzen es Mädchen nämlich unter bestimmten Umständen, an den Geschlechtsteilen befummelt zu werden, so sehr die Kirche und der bärtige Schularzt, dessen Atem nach Marillenlikör riecht, einem das ausreden wollen. Gottlob sind Neugier und Natur stärker als alle zusammen.
Man schließt die Augen und genießt Claudias Duft. Sie riecht blumig. So frisch, so fremd. Der Geruch eines anderen Menschen, so nah. Ein wunderbares Erlebnis. Man kann kaum glauben, dass es passiert, dass man plötzlich vom Glück verfolgt sein soll. Wenn man Karl Kolostrum heißt und immer schon der dickste der Klasse war, ist man einiges an Spitznamen und Bösartigkeiten gewohnt und in Liebesdingen alles andere als verwöhnt.
Man liegt unbequem da. Wagt nicht, den steif gewordenen Arm unter dem Körper wegzuziehen. Man befürchtet, diese Bewegung könnte Claudia so verschrecken, dass sie sich die Sache noch einmal überlegt und Hals über Kopf zur Tür hinausstürzt. Doch das Risiko ist es wert. So bewegt man die Lippen auf jene des Mädchens zu. Dabei achtet man darauf, nicht zu hastig vorzugehen. Wenn endlich Mund auf Mund trifft, staunt man über den Eindruck, den diese Intimität erzeugt.
Vorsichtig schiebt man die Zunge in Claudias Mund, ohne sich vom Klopfen seines Herzens irritieren zu lassen. Man bemüht sich, dass es zu keiner Kollision der Gebisse kommt. In Das erste Mal hat man gelesen, solches sei der Romantik des Moments abträglich und nur durch Lachen zu kompensieren. Das aber setzt ein gewisses Maß an bereits vorhandener Harmonie voraus. Und so lange ist man ja nicht zusammen. Drei Wochen, was ist das schon.
Beflissen vermeidet man ferner, der Geliebten in den Mund zu speicheln. Jedenfalls in übertriebenem Ausmaß. Ein wenig Speichel bringt Vertrautheit, doch dosis venenum facit.
Die Küsse sind lang und innig.
In regelmäßigen Abständen donnert Mutter mit ihrem Gipsarm, den sie einem Alkoholexzess verdankt, gegen die versperrte Tür, um den Kindern keine Zeit für eine Schwängerung zu lassen. Vor Claudias Ankunft hat sie allen Ernstes behauptet, sie selbst müsse in diesem Fall für die Alimente aufkommen, da man noch unmündig sei, und daher solle man, wie sie sich ausdrückte, den Hengst im Stall lassen.
Man reagiert nicht. In Claudias Beisein will man der eigenen Mutter unterkühlt-lässig begegnen. Dies wird der Freundin das Gefühl vermitteln, einen reifen Partner gewählt zu haben, der sich wohltuend von den kreidewerfenden, kraftmeiernden und Allotria treibenden Kindsköpfen in ihrer Klasse unterscheidet.
Obwohl 1986, läuft mittlerweile dieselbe Kassette von Simon & Garfunkel zum sechsten Mal. Insgeheim träumt man davon, das Kabel des Recorders durchzuschneiden. Dennoch widmet man sich mit Hingabe der ersten Erforschung der weiblichen Anatomie.
Merke: Wenn man beim Streicheln abrutscht und aus Versehen mit der Hand zwischen den Beinen des Mädchens landet, ist Aufregung unangebracht.
Claudia reagiert darauf nicht. Tut, als sei nichts passiert. Sie hat keinen Schock erlitten. Und sie macht keine Anstalten, zu protestieren oder gar zu fliehen.
Man greift noch einmal zwischen ihre Beine. Und noch einmal. Denn hinter dem Reißverschluss der Stonewashed-Jeans verbirgt sich das größte Geheimnis des Lebens, vom Tod vielleicht abgesehen. Obwohl man keine Ahnung hat, was es bedeutet, miteinander zu schlafen, will man es. Leider will Claudia nicht. Noch nicht. Und es ist keine Frage von Jahren, sondern von Wochen. Aber das weiß man nicht, weil man erst sechzehn ist.
Wenn morgens um sechs der Radiowecker dröhnt, sitzt man in der nächsten Sekunde aufrecht im Bett und schreit Huuuuch!, weil man enorm schreckhaft ist.
Sobald man sich beruhigt hat, denkt man an Claudia. Man bleibt fünf Minuten liegen. Mutter klopft an die Tür und meckert, man sei nie aus dem Bett zu kriegen. Man ist versucht zu entgegnen, es sei kein Wunder, dass es ihr leichtfalle aufzustehen bei den Mengen an Psychopharmaka, die sie sich in den Frühstückskaffee rühre. Um des lieben Friedens willen verkneift man sich diesen Hinweis.
– Charlie, roll dich endlich da raus!
Früher hat man ungern geduscht. Den Anblick findet man nicht sehr einnehmend, denn um die Hüften schwabbelt es. Außerdem ist man träge. Doch seit man zu zweit Blümchen pflückt und Sonnenuntergänge bewundert, stellt man sich bei jeder Gelegenheit unter die Brause. In Ovids Ars amandi hat man gelesen, es sei ratsam, die Geliebte nicht mit der Ziege Gemahl zu belästigen, womit der Bocksgeruch unter der Achsel gemeint ist.
Während man sich Duschgel auf die Haut schmiert, schmettert man Jumping Jack Flash. Den Originaltext, den man nicht auswendig weiß, ersetzt man wie üblich durch spontane Interpretation. Man ist überzeugt, eine schöne Stimme zu haben und alle Töne zu treffen. Dennoch protestiert Mutter durch Schreie und Schläge gegen die Tür. Man stöhnt auf und verstummt, um kurz darauf wenigstens die Melodie weiterzusummen.
Da die Mutter faul und dem Alkohol ergeben ist, was neben ihrem Hang zur Promiskuität den Vater bewogen hat, das Weite zu suchen, steht auf dem Frühstückstisch nur ein Aschenbecher, aus dem es qualmt. Sie hat vergessen einzukaufen. Oder einen selbst zum Einkaufen zu schicken. Nun redet sie sich heraus, man sei ohnehin schon zu dick und zu pickelig. Je weniger man esse, desto schöner werde die Haut.
Wenn man verliebt ist, sind derartige Pannen, die andernfalls gleich am Morgen zu einer gehässigen Auseinandersetzung geführt hätten, nicht der Rede wert. Ohne Groll gießt man heißes Wasser in den Kaffeefilter vom Vortag.
Wie jeden Morgen legt Mutter einen Geldschein auf den Tisch. Zu kochen hat sie keine Lust. Deshalb isst man seit Monaten auswärts. An sich würde einen das nicht stören, kocht Mutter schließlich nicht gerade exzeptionell, doch auch die Küche in den umliegenden Gasthäusern verbessert den Ruf des Viertels nicht. Wortlos schiebt man den Schein in die Hosentasche.
Da noch Zeit bleibt, kehrt man in sein Zimmer zurück, dreht den Schlüssel um, legt sich aufs Bett und setzt Kopfhörer auf. Gewöhnlich hört man Hard Rock. An diesem Morgen jedoch gleitet man zu John Lennons Woman in einen jener Tagträume, denen man sich gern hingibt.
Man stellt sich vor, man ist stark, schön und besitzt ein Motorrad. Damit fährt man vor der Schule vor. Alle starren einen bewundernd an. Natürlich trägt man keinen Helm, und an den Oberarmen ist man tätowiert. Lässig steigt man ab. Claudia läuft herbei. Man umarmt und küsst sie. Alle schauen zu. Das Motorrad ist eine Riesenmaschine, wie man sie aus Hippiefilmen kennt. Claudia nimmt auf dem Sozius Platz, man dreht eine Runde, verfolgt von den neidischen Blicken sämtlicher Mädchen der Schule.
Erst wenn die Tür aufgebrochen wird und Mutter gestikulierend im Zimmer steht, merkt man, dass man den Stecker des Kopfhörers falsch angesteckt und somit auch das ganze Haus mit betäubender Lautstärke beschallt hat. Mit einem Hieb schaltet sie die Stereoanlage aus. Einen Blick auf die aus den Angeln gerissene Tür werfend, drückt man sich an Mutter vorbei. Man beeilt sich, zum Bus zu kommen. In der Schule wartet Claudia.
Kurz nach dem sechzehnten Geburtstag hat man sich verliebt. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal wird diese Liebe erwidert. Also ist es die erste Liebe.
Da man nach einigen Zurückweisungen nicht mehr wählerisch ist, handelt es sich bei Claudia keineswegs um die Klassenschönste. Auch nicht zu den hübschesten Fünf darf man sie zählen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, wird sie von den wenigsten als attraktiv bezeichnet werden. Und um ganz ehrlich zu sein, sieht sie mit ihrem Mondgesicht und ihrer Krankenkassenbrille aus wie die Fliege Puck. Aber was soll man machen. Man liebt, was man kriegen kann. Und da sie ein Hippie ist und nett und für ihr warmherziges Wesen bekannt, begnügt man sich mit dem, was einem das Schicksal zugewiesen hat.
Man trifft sie vor der Schule. Bange fragt man, ob sie einen noch liebt.
– Natürlich liebe ich dich. Du bist die große Liebe meines Lebens.
– Und du meine.
Hach!
Hand in Hand macht man sich auf den Weg zur Klasse.
Im Klassenzimmer umarmt und küsst man Claudia, um das Geheimnis zu lüften. Den Knutschfleck unter Claudias Ohr versteckt man nicht, im Gegenteil, er hat Arbeit gemacht, ebenso wie der an Claudias Hals.
Bei den Klassenkameraden erntet man verwunderte, teils neidische Blicke und jenes verschämte Lächeln, das mit amourösen Sensationen einherzugehen pflegt. Sogar das Unglück der amerikanischen Raumfähre tritt in den Hintergrund. Für den Stolz, den man dabei fühlt, braucht man sich nicht zu schämen. Eine Freundin zu haben bedeutet, zu einer Siegerkaste zu gehören. Damit hat man, wenigstens theoretisch, selbst vielen Erwachsenen etwas voraus.
Überdies gilt es zu bedenken, dass wohl auch Lehrerinnen und Lehrer zu jenem traurigen Kreis von Gottverlassenen zählen mögen, die seit langer Zeit sexuell abstinent leben, etwa deshalb, weil sie aussehen wie Eulen oder in den Keller lachen gehen. Und die dürfen nun zuschauen, wie zwei der ihnen zur Kultivierung Zugewiesenen jene Freuden genießen, die ihnen selbst verwehrt bleiben.
Als Teil eines Pärchens steigt man im Ansehen anderer automatisch, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Was macht es da, dass es in der Klasse reizvollere Mädchen gibt? Solche mit anziehenderen Gesichtern, mit entwaffnenderen Brüsten? Freilich würde eine Beziehung mit einer von ihnen noch mehr Aufsehen erregen. Aber die dummen Gänse wollten ja nicht. Nun sollen sie sehen, wo sie bleiben.
Merke: Wenn man Gelegenheit findet, eine Partnerschaft einzugehen, sollte man sie nützen. Es ist gut für die Hormone, die Lebenserfahrung und den Ruf.
Man ist Teil einer überspannten Familie. In ihrem Zentrum stehen Großtante Kathi und Großonkel Johann. Der Einfachheit halber nennt man sie Tante und Onkel. Tante Kathi, eine betont korrekt Deutsch sprechende Juristin, war früher eine hohe Beamtin in der Stadtverwaltung. Onkel Johann trug die grüne Uniform der Polizei. Angeschossen wurde er nie, aber er tut so. Er gibt sich als Patriarch. Die letzte Entscheidung trifft in Wahrheit Tante Kathi. Niemand darf wissen, dass Onkel Johann bügelt und abwäscht. Alle wissen es. In der Familie haben Frauen das Sagen.
Tante Kathi und Onkel Johann, vor diesen beiden zittern alle. Auch Mutter. Die ist in ihrem Büro – sie arbeitet als Sekretärin in einem Mineralölkonzern – eine gefürchtete Person, die jedem die Meinung sagt. Sie hat die Figur einer Ringerin und ist gewohnt, sich auf jede erdenkliche Weise durchzusetzen. Im Freibad macht sie sich den Spaß, gegen Männer armzudrücken. Meistens gewinnt sie.
Sie hat alles Mögliche ausprobiert. Einige Jahre lebte sie auf einem Bauernhof, wo sie versuchte, die Hühner zu hypnotisieren, um den Eierertrag zu maximieren. Da es sich sowohl bei Federvieh als auch bei Schweinen und Schafen um nicht allzu hypnoide Wesen handelt, gab sie den Bauernhof auf und versuchte sich mit einer Schmuckkollektion. Darin zeigte sie solches Geschick, dass sie bis zum Jahr 2017Zeit hat, die Schulden mit ihrem Sekretärinnengehalt zu begleichen.
Ihre geharnischte Art ist ihr trotzdem geblieben. Nur gegen die Tankels, wie Tante Kathi und Onkel Johann nach einem für Onkel Hans typischen Wortspiel genannt werden, sagt auch sie nichts, niemals, auf keinen Fall, nie-, niemals.
Ihre seit einigen Monaten anhaltende Trunksucht findet man ekelhaft. Doch man ist dankbar dafür, dass sie weiß, wie es in der Welt zugeht. Mit ihrer Meinung hält sie nicht hinter dem Berg, so dass man von ihr über internationale Zusammenhänge aufgeklärt wird. Sie ist für die netten Israelis und gegen die stinkenden Araber, in Nordirland für die Protestanten und gegen die Katholiken, obwohl sie nicht ganz sicher ist, zu welcher Seite die IRA gehört, und die Amerikaner hasst sie. Sehr stolz ist sie auf fremdländische Ausdrücke, die sie irgendwo aufgeschnappt hat. Wenn man sich eine Weile nicht duscht, ist man bei ihr ein »Feute«, was angeblich französisch ist, und wenn man feig ist, hat man keine »Kotschons«, was immer das auch bedeuten mag.
Tante Wilma ist Tante Kathis Schwester. Sie und Onkel Hans sind das Gegenteil der Tankels. Sanft, umgänglich, einigend. Und den beiden Alten natürlich überhaupt nicht gewachsen. Bei Familienfesten sind sie die Lichtblicke. Onkel Hans merkt man an, dass er nicht blutsverwandt ist, denn er macht Scherze und zwinkert einem zu. Früher hat er einem zuweilen etwas mitgebracht. Man mag ihn.
Die Familie besteht aus lauter Onkeln und Tanten. Wäre da nicht Mutter, würde man sich fühlen wie ein Mitglied der Familie Duck. Die Großeltern sind tot, der Vater schickt Briefe aus Schweden, in denen fremde Geldscheine stecken. Einmal im Jahr trifft sich die ganze Verwandtschaft, das gibt ein Höllenspektakel. Zwölf Onkel und Großonkel, sechzehn Tanten und Großtanten. Und man ist der Einzige aus der Generation darunter. Man hat sich eine Liste gemacht, was man Petrus eines Tages zu fragen gedenkt, und diesen Punkt will man zuerst ansprechen.
Selbstverständlich sind auch immer die besten »Freunde der Familie« zugegen, die Seifensieder aus Tulln. So werden sie von Onkel Hans genannt, der für die Handwerkskünste des Seifensieders milden Spott übrig hat. Wenn man den Seifensieder trifft, könnte man meinen, einen Kriegsinvaliden vor sich zu sehen. Doch sein extremes Schielen ist angeboren, und das Fehlen von drei Fingern verdankt er seiner Ungeschicklichkeit beim Basteln. Seinen Heimwerkerkeller musste man schon des Öfteren bewundern. Eigentlich ist er Orthopäde, und es wird erzählt, er sei ein Kurpfuscher. Gewiss scheint laut Onkel Hans nur, dass der Seifensieder kein großes Licht ist, da er »Seifensieder« für ein Kompliment hält und begonnen hat, sich selbst so zu nennen. Er stammt zwar aus Tulln, ist aber schon vor langer Zeit von dort fortgezogen. Er hat eine Praxis in der Innenstadt.
Das netteste Familienmitglied ist Urgroßtante Ernestine. Bei ihr ist man halb und halb aufgewachsen. Niemand hat sich so sehr um einen gekümmert wie sie. Bei ihr hat man ferngesehen, als Mutter noch zu arm und die Tankels noch zu geizig für einen Fernsehapparat waren. Bei ihr hat man Schokolade gegessen und Taschengeld gekriegt und all die Dinge getan, die überall sonst verboten waren.
Tante Ernestine wohnt am Stadtrand und gilt als das schwarze Schaf der Familie. Seit Tante Kathis erfolglosem Versuch, sie entmündigen zu lassen, haben sich die beiden bei Familienfeiern Plätze nebeneinander ausbedungen, um einander schweigend kalte Blicke zuzuwerfen. Man ist der Einzige, der Tante Ernestine besucht. Sie ist siebenundneunzig Jahre alt, äußerst sparsam, wenn auch keineswegs geizig, und hat eine rätselhafte Zuneigung zu Autos.
Die in der Familie übliche physische Robustheit ist ihr geblieben. Wenn vor ihrem Haus Jugendliche Unfug treiben, kann es sich nur um neu Zugezogene oder um frühgereifte Masochisten handeln. Wie der Blitz ist sie unten und schafft Ordnung. Ab und zu beschweren sich Leute bei ihr, dass sie ihre Jungen verdroschen hätte, und drohen mit der Staatsgewalt. Dann schwingt Tante Ernestine ihren Stock und schaut so irre, dass die Besucher es in der Regel vorziehen, von weiteren Verhandlungen Abstand zu nehmen.
Einmal erschien aufgrund eines derartigen Vorfalls die Polizei. Tante Ernestine legte sich ins Bett und weinte über solche Niedertracht, sie sei eine schwache alte Frau und tue niemandem etwas zuleide.
– Und wie steht es mit den blauen Flecken, woher hat der Junge die?
– Er wird auf dem Weg zum Verhör gestolpert sein, Herr Inspektor.
Es gibt noch ein Familienmitglied. Sein Name ist Nero. Nero ist der siebenjährige Yorkshire-Terrier der Mutter, den sie vor Jahren aus dunklen Motiven ihren einzigen Freunden, den Kleibers, abgekauft hat. Dieses sinnlose Vieh nimmt sie sogar zur Arbeit mit. Er ist nicht größer als eine Katze und kläfft beim geringsten Anlass. Man mag den Hund, aber man ist gegen den Geruch, den er verströmt, allergisch. Außerdem hat man ihn im Verdacht, an einer Geisteskrankheit zu leiden, da er verschiedene seltsame Vorlieben hegt, etwa für Socken und Zimmerpflanzen, aber auch für Schallplatten, die er mit Begeisterung spazierenträgt, besabbert und zerkratzt.
Wenn man Tante Ernestine besucht, bekommt man Geld. Sie ist etwas wunderlich und hat Sonne im Herzen.
– Wie du aussiehst, sagt sie schon an der Tür, man muss sich schämen!
– Wieso? Was meinst du?
– Deine Frisur! Schau auf die Gasse, wie nett die anderen Burschen aussehen! Und du…
Man sieht sich die Burschen auf der Gasse an. Sie tragen Dauerwelle und bemühen sich um einen Schnauzbart. Das gefällt ihr.
Wenn man von einer Autoritätsperson des nachlässigen Umgangs mit dem eigenen Äußeren geziehen wird, hilft nur ein Ablenkungsmanöver. Da Tante Ernestines Groll gegen die Familie längst biblische Wucht erreicht hat, genügen einige Bemerkungen über Tante Kathis neuen Haarschnitt, die man mit der Floskel »a propos Frisur« einleitet. Danach ist keine Rede mehr vom eigenen Schopf. Tante Ernestine flucht wie ein Kutscher.
Erst dann folgt die eigentliche Begrüßung. Von einer Sekunde zur anderen ist Tante Ernestine milde und fröhlich. Man wird von ihr geküsst, sie nennt einen Goldkind. Man ist ihr unbestrittener Liebling. Wenn man sie besucht, sieht man, wie sich ihre Miene aufhellt. Und man freut sich ebenfalls, sie zu sehen, mehr als bei allen anderen Menschen. Claudia nunmehr natürlich ausgenommen.
Man muss sich mit ihr ans Fenster stellen. Die Ereignisse auf der Straße zu verfolgen ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Ein Auto fährt vorbei. Sie streckt den Arm aus.
– Das ist dieser neue Mazda. Mazda… dreihundertzwanzig. Den sollte sich deine Mutter kaufen.
Man quittiert diesen Ratschlag mit Schulterzucken. Mutter wird sich nie ein Auto kaufen, sie fährt zu schnell und hat Angst vor der eigenen Courage. Aber das ist Tante Ernestine nicht beizubringen. Man hört sich eine Weile ihre automobilistischen Vorträge an, für die sie in der Familie berühmt ist.
Es wird Zeit fürs Café. Sie liebt es, im Café zu sitzen und von den Wirtsleuten über aktuelle Vorgänge in der Nachbarschaft unterrichtet zu werden.
– So nehme ich dich nicht mit! Da muss ich mich ja genieren!
– Was passt denn schon wieder nicht?
– Deine Frisur! Othmar… Wolfgang… Martin… Hans…– sie zählt alle männlichen Vornamen auf, die in der Familie vorkommen, ohne den richtigen zu finden – geh ins Bad! Frisier dich!
Aussichtslos, darüber zu streiten. Tante Ernestine ist stur. Und im Café gibt es Malakofftorte und ein paar Hunderter. Man geht ins Bad. Frisiert sich. Merkt, dass man aufs Klo muss. Unbedingt, auf der Stelle, jetzt und hier. Das ist fatal. Denn in ihrer krankhaften Sparsamkeit weigert sich Tante Ernestine, Klopapier zu kaufen. Man muss sich mit der Kronenzeitung den Hintern abschinden.
Merke: Wenn man auf dem Klo sitzt, singt man, das tut man schon seit jeher.
Da man ein miserables Gedächtnis hat, merkt man sich die Texte nicht, und so erfindet man zu einer bekannten Melodie etwas Eigenes, noch nie Dagewesenes. Dabei erlegt man sich beim Dehnen von Silben und Verstümmeln von Wörtern keine Hemmungen auf, und auch die Sinnfrage ist keine absolute. Hauptsache, die Worte passen zum Rhythmus. Zuweilen vergisst man dabei, wo man sich befindet.
Und so schmettert man auf Tante Ernestines Toilette zur Melodie von Yellow Submarine einen Text, der einem gerade so einfällt:
In der Stadt, wo ich geborn
Lebt ein Mann mit einem Horn
Er ist gelb und er ist fett
Nur die Viecher finden ihn nett
Und der Sieg ist deshalb mein,
(…)
Weiter kommt man nicht, weil Tante Ernestine an die Tür trommelt, man solle auf der Stelle aufhören, so ordinär zu singen, und überhaupt sei das Katzenmusik. Tante Ernestine ist die Einzige, die so etwas sagen darf und einen nicht kränkt.
Wenn man in Claudia verliebt ist und dennoch romantische Gefühle für deren Freundin Veronika hegt, deren Herz man jedoch nie gewinnen wird, weil man weder über die dazu erforderliche Schönheit noch über Ausstrahlung verfügt, ganz zu schweigen vom Mut und vom Charakter und vom Temperament und von der Fortune und vom Sex-Appeal und vom Charme und von der Geduld und von der Weisheit, ist das Grund genug, sich ein wenig dem Weltschmerz zu ergeben.
In verschiedenen Ratgebern, deren Lektüre man seit Längerem schätzt, hat man gelesen, Selbstmitleid sei eine Haltung, über die man die Nase rümpfen sollte, aber ein wenig Geschluchze hier und ein paar Verschwörungstheorien da könne man sich gestatten, weil man danach wieder freier atme.
Da es Februar ist, beginnt es schon nachmittags zu dunkeln. Um etwas Draufgängerisches zu tun und sich selbst zu imponieren, was zuweilen eine kathartische Wirkung hervorzubringen imstande ist, sperrt man sich in seinem Zimmer ein. Depressiv ist man sowieso, weil man Die letzten Kinder von Schewenborn gelesen hat und sich seither noch mehr vor einem Atomkrieg fürchtet.
Man dreht das Licht ab. Zieht die Vorhänge zu. Aus einer mächtigen Tasse trinkt man schwarzen Kaffee, obwohl man ihn ohne Milch und Zucker grässlich findet und einem schon nach ein paar Schlucken speiübel ist. Man raucht filterlose Zigaretten. Selbstgedrehte wären eindrucksvoller, doch man hat nicht die nötige Fingerfertigkeit, sie herzustellen.
So sitzt man da, starrt in die Dunkelheit, in der in regelmäßigen Abständen die Spitze einer teuflisch starken Zigarette aufleuchtet, und lauscht dabei der Led-Zeppelin-LP Houses Of The Holy.
In Situationen wie dieser kommen die Tagträume von allein.
Man sitzt rauchend und mit einer Flasche Alkohol auf einer Bank vor der Schule. Andere Schüler gehen achtlos vorbei. Man summt vor sich hin, man steht über den anderen, und es ist einem egal, was sie denken. Da kommt Jimmy Page vorbei, er macht Urlaub und fährt durch Europa. Er setzt sich auf die Bank. Unbeeindruckt summt man weiter. Jimmy ist so hingerissen, dass er mitswingen muss, ob er will oder nicht. Man unterhält sich mit Blicken. Da ist ein tiefes Einverständnis. Zwei verwandte Seelen treffen sich. Leider muss Jimmy weiter, aber jeder schreibt sich die Telefonnummer des anderen auf.
Merke: Wenn man mit schwarzem Kaffee und Zigaretten in seinem dunklen Zimmer sitzt, sehnt man sich sehr nach Jimmy Page.
Da niemand zugegen ist, um dieses Stillleben zu bewundern, ruft man Harry an und bittet ihn, vorbeizukommen. Solche Manöver hat man leider nötig. Man sollte sich stets ein objektives Selbstbild bewahren: Wenn man weiß, dass man nicht gerade ein Leitwolf ist, sondern nur ein allseits geschätztes Dickerchen, hat man sich dann und wann mit Geheimnissen zu umgeben.
Rätselhafte Persönlichkeiten sind nie einsam. Sie brauchen nur die Hand auszustrecken, sofort eilt jemand herbei, der noch weniger zum Leitwolf taugt.
Einige Zeit, nachdem man die Musik leiser gedreht hat, läutet es. Sogleich schaltet man wieder lauter. Die Tür öffnet man mit zerstreuter Miene, auf der sich zugleich Weltschmerz spiegelt. Wortkarg bittet man den Freund, ins Zimmer zu folgen. Eine glückliche Fügung hat die Mutter auf eine Sauftour gehen lassen, wodurch sie die Zusammenkunft nicht torpedieren kann.
Verflucht!
Man hat vergessen, Bücher von Autoren mit klingenden Namen aufgeschlagen herumliegen zu lassen.
– Tu mir den Gefallen und hol dir dein Glas selbst. In der Küche.
In Windeseile drapiert man den Zarathustra diskret an den Rand des Tisches. Dann gewährt man dem Besuch Einlass.
Harry will wissen, was mit der Zimmertür passiert sei. Man antwortet, man habe sie in einem Anfall herausgetreten, aber das werde nächste Woche repariert.
– In einem Anfall? Was für ein Anfall?
Man brummt vor sich hin, man wolle lieber nicht darüber reden.
Nun ist das Glas überflüssig, was soll man mit einem Glas, wenn es um Kaffeetrinken geht. Man tut, als sei man verwirrt, was ja allen begabten Menschen nachgesagt wird. Aus der Küche holt man extra starken Kaffee. Harry bekommt auch eine Zigarette. Die wird ihn mit einiger Wahrscheinlichkeit überfordern. Sie abzulehnen wagt er jedoch nicht.
Das Gespräch zu eröffnen, fällt einem nicht ein. Erstens muss man so tun, als stehe man unter Tabletteneinfluss, wie es sich für einen sensiblen Menschen gehört. Zweitens handelt es sich hier nicht um einen Kindergeburtstag mit guter Laune und Geschwätz, sondern um das Zusammentreffen zweier Personen, die bereits an der Schwelle zur späten Adoleszenz stehen.
Im Bewusstsein, sich auf dünnem Eis zu bewegen, rüttelt Harry einen schließlich am Knie und brüllt schüchtern, ob es nicht vielleicht zu dunkel sei, so ganz im Dunkeln, da es zweifelhaft bleibe, wo der andere sich befinde. Außerdem sei die Lautstärke der Musik dazu angetan, Schädeldecken bersten zu lassen. Ob man vielleicht leiser drehen und ein klein wenig Licht machen könne, und Musik und Kaffee wie auch die Zigarette seien delikat. Im Übrigen huste er wegen einer Erkältung.
Man macht deutlich, als Gastgeber den Wünschen seines Besuchs entgegenkommen zu müssen, auch wenn sie mit den eigenen nicht konform gehen, und schaltet die Tischlampe an, deren Schein – auf den Zarathustra fällt.
Das weitere Gespräch ist nicht mehr wichtig. Tatsächlich kann man nur mehr verlieren, den bisherigen Eindruck abschwächen. Insbesondere, wenn man den Mund aufmacht.
– Vielleicht solltest du besser gehen. Entschuldige, dass ich dich hergebeten habe.
– Was ist denn los, Charlie?
– Nichts. Hab mir drei Fincis eingeworfen.
– Was sind denn Fincis?
– Beruhigungstabletten. War etwas aufgekratzt.
Harry reibt sich bewundernd das Kinn. Aus glasigen Augen starrt man ihn an. Man überlegt, ob man speicheln sollte, entscheidet sich jedoch dagegen. Es könnte übertrieben wirken.
– Das heißt, du bist müde?
– Wäre ich gern. Aber ich habe dann zwei Uzis genommen.
– Uzis? Sind das nicht Maschinengewehre?
Da hat er einen allerdings an der schwachen Seite erwischt. Verflixt, man wusste ja, dass es das Wort gibt. Doch mit Improvisationstalent kann man jede Situation retten.
– Aufputscher. Uzis werden sie genannt, weil sie wirken wie ein Maschinengewehr, ratatatatata, so geht das im Kopf hin und her.
– Ach richtig. Und warum machst du das?
– Hab’s gebraucht.
Merke: Wenn man sich für keine Albernheit zu schade ist, entstehen Legenden.
Sobald Harry gegangen ist, schüttet man den entsetzlichen Kaffee weg und nimmt sich einen Apfelsaft. Der Aschenbecher wird geleert, das Fenster geöffnet. Die Musik macht einen allmählich wahnsinnig, sie wird abgestellt. Da man sich nun schrecklich einsam fühlt, ist der Genuss einer Tafel Schokolade erlaubt, obwohl man schon gut zehn Kilo zuviel hat.
Man sieht unter Flutlichtbedingungen fern. Jedoch achtet man darauf, rechtzeitig ins Bett zu gehen, um einer Konfrontation mit der angetrunken heimkommenden Mutter auszuweichen. Zu essen hat es außer Chips und Pralinen und Kuchen und Eis nichts gegeben. Man verschiebt die Nahrungsaufnahme auf den folgenden Tag.
Ich glaube es einfach nicht, sagt Paul.
– Ich auch nicht.
Da Mutter »krank« ist, muss man Nero ausführen. Die Nachbarin hat eine junge Katze, die durch den Hof schleicht. Seit Nero die Katze gesehen hat, dreht er durch. Er verfolgt sie durch den Garten, aber keineswegs, um sie zu beißen. Mit den Vorderbeinen bringt er sie in die passende Stellung, und dann bemüht er sich, das Kätzchen zu vergewaltigen. Er hat schon ein paar Ohrfeigen von ihr bekommen, doch er probiert es immer wieder.
Man sitzt mit Paul vor dem Haus und verfolgt das Schauspiel.
– Ist er nicht kastriert?, fragt Paul.
– Weiß nicht. Glaube schon.
– Aber was tut er dann da?
– Ich bin mir nicht sicher.
Man zieht Nero ein weiteres Mal von der Katze weg. Er gehorcht, doch schon nach ein paar Minuten wandelt er wieder auf Freiersfüßen. Es ist drollig, die Qual des Hundes zu beobachten, seine Zerrissenheit, wie er sein Opfer umschleicht, eine Pfote hebt, sich dann in den Kampf wirft oder doch noch einmal zurückzuckt.
– In einem Jahr frisst sie ihn, behauptet Paul.
– Das dauert kein Jahr mehr.
Um das Ganze nicht auf die Spitze zu treiben, bringt man den Saukerl zurück ins Haus. Paul verabschiedet sich. In entschuldigendem Ton sagt er, er müsse lernen, er wolle nicht noch einmal sitzenbleiben. Man nickt ihm zu.
Nachdem der Triebtäter an seinen Platz in der Küche zurückgebracht worden ist, schneidet man sich eine Scheibe Brot ab, öffnet eine Dose Sardinen und setzt sich vor den Fernseher. Den Ton dreht man leise. Man ist müde. Der Tag war anstrengend. Man macht es sich auf dem Sofa gemütlich und hofft, dass Mutter die Nacht durchschläft. Man liebt sie und wird von ihr geliebt, und nüchtern ist sie durchaus zu ertragen. Aber ihre Anfälle lassen einen erzittern.
Mitten in der Nacht erwacht man. Was einen geweckt hat, weiß man nicht. Man hatte einen Albtraum, in dem Tante Ernestine eine Rolle spielte. Im Schock wickelt man sich aus der Decke, springt vom Sofa hoch und versucht sich zu orientieren.
Wenn aus Mutters Schlafzimmer Geräusche dringen, ist es für das Seelenheil eines Jugendlichen vorteilhaft, wenn er zu schlaftrunken ist um zu verstehen, was da vor sich geht.
Man trinkt einen Schluck abgestandene Limonade. Was war in dem Traum? Tante Ernestine ging es schlecht. Sie brauchte Hilfe.