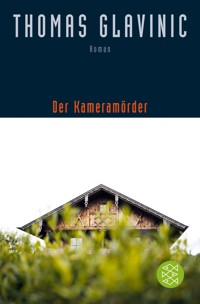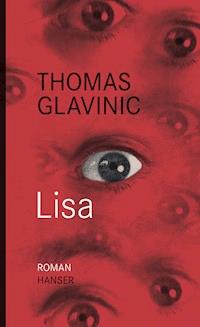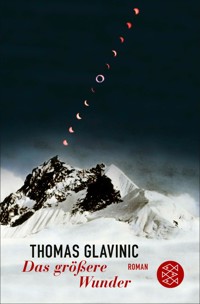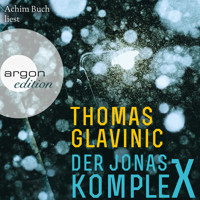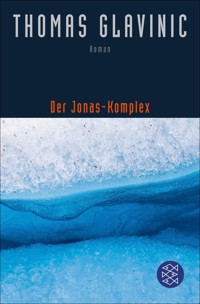
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der furiose neue Roman von Thomas Glavinic Die Summe eines Jahres, der Querschnitt eines Lebens, das Abenteuer der Liebe. Ein Jahr im Leben eines Wiener Schriftstellers, zwischen Drogen, Alkohol und Frauen. Ein Abenteuer, das Jonas und seine große Liebe Marie bis zum Südpol führen soll. Und ein dreizehnjähriger Junge, der leidenschaftlich Schach spielt, um seinem Alltag zu entfliehen. Dazu Nebenfiguren wie aus einem Tarantino-Film: Ein Anwalt der Hells Angels, ein WingTsun-Großmeister und eine Mörderin, die die Leichen ihrer Liebhaber mit einer Kettensäge zerlegt. Die wirkliche Welt trifft auf die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und Thomas Glavinic gelingt das große Kunststück, all das in einen mitreißenden Roman über die entscheidenden Fragen zu verwandeln: Wer will ich sein? Und habe ich den Mut, die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Thomas Glavinic
Der Jonas-Komplex
Roman
Über dieses Buch
Ein Jahr im Leben eines Wiener Schriftstellers, zwischen Drogen, Alkohol und Frauen. Ein Abenteuer, das Jonas und seine große Liebe Marie bis zum Südpol führen soll. Und ein dreizehnjähriger Junge, der leidenschaftlich Schach spielt, um seinem Alltag zu entfliehen. Dazu Nebenfiguren wie aus einem Tarantino-Film: Ein Anwalt der Hells Angels, ein WingTsun-Großmeister und eine Mörderin, die die Leichen ihrer Liebhaber mit einer Kettensäge zerlegt. Die wirkliche Welt trifft auf die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und Thomas Glavinic gelingt das große Kunststück, all das in einen mitreißenden Roman über die entscheidenden Fragen zu verwandeln: Wer will ich sein? Und habe ich den Mut, die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Thomas Glavinic wurde während des Jahres 2015 für dieses Werk von der Guntram und Irene Rinke Stiftung im Rahmen des Projekts TAGEWERK-Reihe unterstützt.
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403607-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
WIEN
WIEN
MÜNCHEN
TOKIO
WIEN
WIEN – HAMBURG
TOKIO
SCHWARZAU AM STEINFELD
TOKIO
WIEN
WIEN
ROM
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WIEN
TOKIO
TOKIO
?
PODGORICA
PODGORICA
WIEN
WESTSTEIERMARK
ZUHAUSE
WIEN
WIEN
WESTSTEIERMARK
TOKIO
TOKIO
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WESTSTEIERMARK
TOKIO
WIEN
WIEN
WIEN
CARLISLE
OSLO
CARLISLE
CARLISLE
WESTSTEIERMARK
ZUHAUSE
LISSABON
CARLISLE
ROM
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
TOKIO
CARLISLE
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
TOKIO
LONDON
CHANTY-MANSIJSK
CHANTY-MANSIJSK – TOKIO
CARLISLE
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
TOKIO
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
CARLISLE
ZUHAUSE
CARLISLE
?
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
?
WESTSTEIERMARK
CARLISLE
WESTSTEIERMARK
NEW YORK CITY
BOSTON
WARREN, VT
WESTSTEIERMARK
WARREN, VERMONT
CARLISLE
CARLISLE
WESTSTEIERMARK
?
WESTSTEIERMARK
?
WESTSTEIERMARK
TOKIO
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK – MOSTAR
CARLISLE
?
TOKIO
CARLISLE
?
TOKIO
?
TOKIO
CARLISLE
?
?
?
ZWEI
?
TOKIO
CARLISLE
?
TOKIO
CARLISLE
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
ZUHAUSE
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WESTSTEIERMARK
TIROL
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
TIROL
?
TOKIO
WIEN
WIEN
WIEN
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WESTSTEIERMARK
WIEN
GRAZ
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
BERLIN
TOKIO
TOKIO
WIEN
WIEN
WESTSTEIERMARK
WIEN
GOLDEGG
WESTSTEIERMARK
SANTIAGO DE CHILE
WESTSTEIERMARK
WIEN
WESTSTEIERMARK
PUNTA ARENAS
WIEN
WIEN
PUNTA ARENAS
WESTSTEIERMARK
WIEN
WIEN
WIEN
PUNTA ARENAS
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, PATRIOT HILLS
WESTSTEIERMARK
WIEN
WIEN
ANTARKTIS, PATRIOT HILLS
MARIA LORETTO
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° SÜDLICHER BREITE
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° SÜDLICHER BREITE
ANTARKTIS, 89° 8' SÜDLICHER BREITE
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° 23' SÜDLICHER BREITE
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° 39' SÜDLICHER BREITE
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° 35' SÜDLICHER BREITE
ANTARKTIS
ANTARKTIS
ANTARKTIS, 89° 52' SÜDLICHER BREITE
ANTARKTIS, 89° 56' SÜDLICHER BREITE
TRIEST
KRK
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, 89° 56' SÜDLICHER BREITE
KRK
AUFZEICHNUNGEN VOR MIAMI
ANTARKTIS, 89° 59' SÜDLICHER BREITE
ANTARKTIS, 90° SÜDLICHER BREITE
CARLISLE
ANTARKTIS, 90° SÜDLICHER BREITE
ANTARKTIS
ANTARKTIS
ANTARKTIS
ANTARKTIS
HARRISBURG
ANTARKTIS
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS
MEXICO CITY
GUADALAJARA
GUADALAJARA – PUNTA ARENAS
WESTSTEIERMARK
KRK
ANTARKTIS
?
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS
WESTSTEIERMARK
ANTARKTIS, PATRIOT HILLS
WESTSTEIERMARK
?
WESTSTEIERMARK
KRK
ANTARKTIS
WESTSTEIERMARK
KRK
KRK
Für Stani
WIEN
Wer wir sind, wissen wir nicht. Beim letzten Durchzählen kam ich auf mindestens drei Personen, die jeder von uns ist. Erstens die, die er ist, zweitens die, die er zu sein glaubt, und drittens die, für die ihn die anderen halten sollen.
Als ich aufwache, geht es mir so elend, dass ich mit keinem der drei etwas zu tun haben will.
Ich bin zu Hause. Im Fernseher läuft das Neujahrskonzert. Ohne Ton. An der Wand hat sich jemand Notizen gemacht. Überall im Zimmer liegt Geschenkpapier. Neben mir liegt eine Frau. Ich kenne sie. Sie heißt Ina. Ich frage mich bloß, was sie da macht. Immerhin hebt und senkt sich ihr Brustkorb.
Ich versuche mich an den Sex zu erinnern. In meinem Gehirn, oder was ich dafür halte, finde ich keine Bilder davon. Vielleicht besser so.
Ich erlaube mir eine kurze Zimmerinspektion. Dem Zustand meiner Kleidung nach hatte ich eine verlustreiche Auseinandersetzung mit einem Autobus. Die Konföderiertenflagge in der Vase mit der undefinierbaren Flüssigkeit verbreitet eine gewisse Revolutionsstimmung, die mir unlieb ist. Aus den Notizen an der Wand werde ich erst recht nicht schlau, es geht um irgendeinen Bären und einen Peter. Die Schrift erinnert mich an meine.
Mir ist dieses Jahr schon jetzt nicht ganz geheuer.
Als ich meinen Körper nach Anzeichen von Gewalt absuchen will, läutet es an der Tür. Eine Sekunde Pause, dann wird wieder geläutet. Und das dritte Läuten hört gar nicht mehr auf. Es hört einfach nicht mehr auf. Es läutet. Es läutet. Es läutet. Es läutet. Es läutet. Es läutet.
Vor der Tür steht entweder
a) der Wahnsinn oder
b) die Polizei.
Panisch suche ich nach meinen Koksvorräten. Dass ich keine finde, beruhigt und ärgert mich gleichermaßen. Dann hört das Läuten auf. Also war es die Polizei. Der Wahnsinn hört nämlich nie auf.
Ina hat sich nicht gerührt, sie ist demnach entweder taub oder doch tot.
Am Stil der Frauen, neben denen ich aufwache, kann ich gut ablesen, wie schlimm der Abend davor gewesen ist. Ihr Äußeres, im angezogenen Zustand freilich, dient mir als Indikator für die Heftigkeit meiner Umtriebe. Am Haken über dem Fernseher hängt Inas Fransenlederjacke. Wenn Ina nicht einiges an Herz, Verstand und Hemmungslosigkeit zu bieten hätte, wäre ich jetzt allein hier. Oder wer weiß, wer dann erst da drüben im Bett taub oder tot wäre.
Ina schnarcht. Ich ziehe mein blutiges Kopfkissen ab und werfe es zur Schmutzwäsche, dabei stolpere ich über einen Motorradstiefel. Er ist ziemlich lädiert.
Alles in allem muss ich einräumen, dass es Jahre gab, die einen Tick eleganter begonnen haben.
Überhaupt interpretieren manche Menschen in den 1. Januar zu viel hinein. Sie sagen, so wie der erste Tag wird das ganze Jahr. Als ob der Rest des Jahres etwas für den Anfang könnte. Außerdem brauche ich nicht den ersten Tag, um zu wissen, wie dieses Jahr wird. Dieses Jahr ist die logische Fortsetzung des vergangenen. Die Stimmung bleibt dieselbe. Es liegt etwas in der Luft, schon seit einigen Jahren, das sich nun mehr und mehr verdichtet. Die Neunziger waren hell, und da, wo sie dunkel waren, waren sie prickelig dunkel. Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts ging es mit uns bergab. Wir wollten es noch nicht wahrhaben, wir hatten auch noch Restlicht von früher. In diesem Jahrzehnt nun sind wir angekommen, wo wir hingehören. Die Dunkelheit ist da.
In der Kochnische nehme ich das Morgenmüsli zu mir. Es besteht aus einem Antidepressivum, weil ich mich ohne die regelmäßige Einnahme dieses Mittels aus dem sechsten Stock stürze, einem Phasenprophylaktikum, weil ich ohne die regelmäßige Einnahme dieses Mittels andere aus dem sechsten Stock stürze, einem Antibiotikum, weil ich Angina habe, einer Magnesiumtablette wegen der nächtlichen Krämpfe in den Beinen, die eine Folge übermäßigen Alkoholkonsums sind, sowie einiger Vitamintabletten, weil ich gesund leben möchte.
Heute ergänze ich mein pharmakologisches Menü durch zwei Schmerztabletten, für Hals, Nase und Schädeldecke. Überdies schlucke ich zwei Xanor, das Beruhigungsmittel meiner Wahl, weil mir wegen des unkontrollierten Konsums stimmungsverändernder Substanzen die Panik bereits auf den Fersen ist.
Diese Angstattacken kommen selten aus dem Nichts, und dank meiner Routine kann ich sie gewöhnlich mit Benzodiazepinen abfangen. Wenn ich den point of no return versäume und die Pillen zu spät einnehme, sitze ich eine Stunde lang zitternd in einer Ecke, und über mir bricht die Welt zusammen. Selbst wenn die Panik verschwindet, bleibt die Selbstanklage,laut oder leise, bewusst oder als Hintergrundrauschen.
Um es klar zu sagen: Xanor ist meine last line of defense.
Ich esse eine Banane, wegen der Gesundheit, und mache mir Kaffee. Die Espressomaschine dröhnt wie ein Schlagbohrer, aber zumeist wachen meine Gäste davon nicht auf, vermutlich sind sie zu betäubt, wer geht denn auch nüchtern mit einem wie mir nach Hause.
Mir wäre es lieber, eine separate Küche zu haben. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Küche sind derselbe Raum. Das liegt daran, dass ich mir keine größere Wohnung leisten kann. Ich verdiene nicht schlecht, aber ich habe ein lockeres Händchen mit Geld. So würde ich es nennen. Ich kenne allerdings Leute, die haben eine andere Interpretation der Sachlage und sprechen von kostspieligen Hobbys und aufwendigem Lebenswandel.
Eigentlich drücken sie es gnadenloser aus, doch Unterschied macht das keinen. Ich bin ständig pleite, dafür hat mein Dealer einen Porsche in der Garage.
Mit meinem Kaffee setze ich mich an den Schreibtisch. Das Handy liegt da. Immerhin liegt es hier und nicht in irgendeiner Kaschemme. Ich werde es trotzdem nicht anrühren, zumindest nicht, solange ich keine Ordnung in meine Erinnerung gebracht habe. Ich kann mir schon vorstellen, wem ich wieder geschrieben und was für Fotos ich verschickt habe. Die Reaktionen kommen zumeist am Morgen, und wenig überraschend sind nicht alle so positiv, wie ich mir nachts noch gedacht hatte.
Am Vorabend, dem 31. Dezember, hatte ich eine Lesung. Das hat sich ungefähr abgespielt wie folgt:
16.00: Ich begebe mich ins Café Anzengruber, um mich zu stärken. Ich schäkere mit den Kindern der Wirtsleute und diskutiere mit Tomy, dem Chef, das Lotterleben eines anderen Stammgasts. Von Zeit zu Zeit kommen irgendwelche Galgenvögel auf ein Bier herein. Sie bestellen, reden drei Minuten über dies und jenes, zahlen und gehen. Ich frage mich, ob die das in jedem Lokal der Schleifmühlgasse machen.
17.00: Es gesellen sich mehr und mehr Bekannte und Freunde hinzu. Mehr als einen anderen Menschen auf einmal ertrage ich schwer. Ein Weißer Spritzer könnte die Situation entspannen. Ich vertrage mehr Weiße Spritzer als Menschen.
17.05: Ich habe verinnerlicht, dass angesichts des Menschenauflaufs ein Weißer Spritzer zu wenig ist, und bestelle noch einen.
17.10–18.00: Die Bestellung wiederholt sich mehrfach. Die vielen Menschen machen mir nichts mehr aus.
18.20: Um diese Zeit ist Friedrich mit dem Fuß, der Koksdealer vom Stephansplatz, am Naschmarkt anzutreffen. Ich verlasse das Lokal für fünf Minuten, kehre zurück, verschwinde auf der Toilette, fühle mich endgültig der Situation gewachsen.
18.30: Es erscheint mein Anwalt und Freund Werner Tomanek, einer der besten Strafverteidiger des Landes, wenn nicht der beste, und nebstbei Erfinder der Schweineblutspritzpistole gegen islamistische Attentäter. Wir trinken einige Magenbitter und machen uns auf den Weg in das srilankische Lokal, in dem die Lesung stattfindet.
19.00: Ankunft. Werner und ich, beide kahlköpfig und robust, werden angestarrt.
19.05: Toilette.
19.10: Mit Werner und dem Wirt Umtrunk im Backstage-Raum (Küche).
19.50: Toilette.
20.05: Beginn der Lesung. Angelika Hager moderiert. Zum Glück ist sie eine langjährige Freundin von mir, kennt mich entsprechend gut und stellt ihre Fragen langsam.
21.00: Pause. Toilette.
21.15: Fortsetzung der Veranstaltung. Ein Zwischenrufer wird vom überdies stets bewaffneten WingTsun-Kämpfer Werner ohne großes Federlesen zum Schweigen gebracht.
22.00: Ende der Veranstaltung. Toilette. Trinken. Ich bekomme Wallungen und knöpfe mir das Hemd auf.
22.30: Ich Trottel gebe in diesem Zustand auch noch ein Interview fürs Radio.
23.30: Übersiedelung insOtto e mezzo. SMS mit guten Wünschen für 2015 werden versendet.
Ca. 0.00: Werner und ich begrüßen das neue Jahr mit Spirituosen.
Irgendwann zwischen 1.00 und 5.00: erfolgreicher booty call.
Ich klappe das Notebook auf. Bevor ich meine Mails abrufe, lese ich Nachrichtenseiten. Die Spitzenmeldung neben der Silvesterberichterstattung handelt vom abgestürzten Airbus der AirAsia. Wrackteile davon sind aus der Java-See geborgen worden.
Gierig suche ich auf anderen Nachrichtenportalen nach mehr Informationen. Ich bin von Flugzeugabstürzen besessen. Ich kenne fast alle. Zumindest die Abstürze von Verkehrsmaschinen. Ich schaue nämlich jede Folge von Mayday – Alarm im Cockpit. Eine lehrreiche Sendung, und wenn man Flugangst hat, ist sie besonders aufregend.
Nun wage ich mich auf meine Facebook-Seite.
Danke an alle Frauen, die 2014 mit mir geschlafen haben.
Kommentar Nummer 1: »Bei der einen, die sich erbarmt hat, hättest du dich auch persönlich bedanken können.«
Es muss endlich jemand den Alkomaten für Elektronikgeräte zum Patent anmelden. Ich träume von einem Computer, den ich nur bedienen darf, wenn ich ihm zuvor alkoholfreien Atem in irgendeine USB-Öffnung gehaucht habe. Und von einem Handy mit derselben Funktion. Die Welt wäre weniger bunt, aber mein Leben um einiges einfacher.
Mein Handy läutet. Damit Ina trotz Taubheit nicht aufwacht, hechte ich ins Badezimmer und drücke sanft die Tür zu. Es ist nicht so, dass mir Inas Schlummer so wichtig wäre, obwohl ich ein rücksichtsvoller Mensch bin, mir geht es mehr um meine Privatsphäre, die ich gerade morgens dringend gewahrt sehen muss. Wenn Ina aufwacht, beginnt sie sich unter Garantie auszubreiten, sie geht herum und redet und ist da, und ich ertrage in der Früh niemanden, der herumgeht und redet und da ist, es sei denn, es wäre eine Frau, die ich liebe und die mich liebt, aber so eine ist schon seit einer Weile nicht aufgetaucht.
Else ist es, die anruft. Ich melde mich flüsternd.
»Kannst du nicht lauter reden?«
»Besuch.«
»Wer denn schon wieder?«
»Ist doch egal, was gibt’s um die Zeit?«
»Na, noch einmal gratulieren wollte ich dir!«
»Danke.« Ich lausche hinaus, doch es rührt sich nichts.
»Ich weiß, ich sollte das gerade heute nicht …«
»Sag schon.«
»Es geht um deine Kreditkartenabrechnung.«
Aus Gründen der Paranoia bin ich noch immer bei ihr angemeldet, weswegen alle Post an ihre Adresse geschickt wird. Darüber hinaus hat sie auch nach unserer Trennung die Obergewalt über meine Finanzen, sie tätigt alle Überweisungen für mich, sie bewahrt die TAN-Briefe auf, ich brauche mich um nichts zu kümmern. Ich vertraue ihr vollkommen.
Natürlich entlohne ich sie für ihre Arbeit. Genau genommen überweist sie sich selbst Geld von meinem Konto dafür, dass sie Geld von meinem Konto an andere überweist.
»Da ist eine Hotelrechnung von 760 Euro aus Berlin, das verstehe ich überhaupt nicht. Die Übernachtung hat doch Karin bezahlt!«
»Hat sie ja auch. Das waren die Extras.«
»Welche Extras? Hast du dir Koks aufs Zimmer bringen lassen?«
Ich unterdrücke einige naheliegende Beleidigungen. Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, von der Polizei abgehört zu werden, auf fünfzig Prozent, und das weiß sie, sie vergisst es nur immer wieder.
»Sehr witzig!«, sage ich in einem Ton, den sie versteht. »Als ob ich Drogen nehmen würde!«
»Entschuldige. Ja, stimmt. Aber welche Extras waren das?«
»Zimmerservice.«
»700 Euro für Zimmerservice? Hast du dir einen Rasenmäher bestellt?«
»Was weiß ich … zwei Flaschen Wodka, ein paar Flaschen Wein, Zigarren, das Hotel ist eben nicht ganz billig.«
»Wieso bringt dich Karin in so einem teuren Hotel unter?«
»Das war ein Geschenk!«
»Ein Danaergeschenk!«
»Also bitte, das war nett von ihr! Welche Agentin schenkt einem zum Agenturjubiläum eine Übernachtung in einem Nobelhotel?«
»Eine, die nicht zurechnungsfähig ist oder dich nicht kennt. Wer dich kennt und mag, schenkt dir einen Monat in der Betty-Ford-Klinik. Du musst dich wirklich einkriegen. Pause machen.«
Sie hat recht, ich muss mich einkriegen und Pause machen. Aber ich habe mich vom Tag meiner Geburt an noch nie eingekriegt, und wovon soll ich Pause machen, vom Leben? Ich kann mich ja nicht in Kryostase versetzen. Das Leben ist ständig um mich herum oder tobt aus mir heraus, und wie es tobt, kann ich nicht beeinflussen.
»Wie geht es dem Kind?«, erkundige ich mich.
»Hervorragend geht es ihm! Hat gerade einen Freund hier.«
»Könntest du mir bitte neue Rezepte organisieren?«
»Natürlich«, sagt sie, wobei sie dem ü mindestens fünf weitere folgen lässt, wodurch dieses an sich zustimmende Wort einen kritischen Charakter bekommt.
Else hat den besseren Draht zu unserer Hausärztin, deswegen besorgt sie regelmäßig neue Rezepte. Die Ärztin nennt Else die »Mutter Teresa unter den Exfrauen«.
Nachdem wir besprochen haben, welche Tage der kommenden Woche das Kind bei mir verbringt, lege ich auf und schleiche hinaus. Ich nehme noch ein Xanor.
Ich lese meine SMS. Neben einigen Gratulationen massenhaft Neujahrsgrüße. Ein paar Nachrichten, denen man an Uhrzeit und Grammatik anmerkt, in welchem Zustand die Verfasser gewesen sind.
Eine SMS von Daniel: Morgen esse ich mit Salman zu Abend.
Als ich mich im Bad ausziehe, entdecke ich allerhand obszöne Zeichnungen, die mir irgendein Trinkkumpan mit Edding auf den Oberkörper gemalt hat. Die Geschwindigkeit, mit der Säufer regredieren, war mir schon immer unheimlich.
Ich verzichte auf Versuche, die Kunstwerke wegzurubbeln. Nach der Dusche putze ich mir die Zähne, dann tappe ich in der Hoffnung, Ina noch schlafend anzutreffen, zurück ins Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer.
Meine Hoffnung wird nicht erfüllt. Ina sitzt nackt im Bett, steckt ihre Ohropax in eine Dose, zieht an einer Zigarette und will Sex. Im Moment bin ich auf Sex so scharf wie auf drei Stunden Ringelreihen, aber das wird ihr nicht beizubringen sein.
Ich lege mich zu ihr. Sie bläst mir einen. Ohne entscheidenden Durchbruch. Irgendwie schaffen wir es dann doch. Während ich in einem etwas verkrampften Rhythmus in sie hineinstoße, schwitze ich, ich schwitze Schnaps und Koks. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich beim Sex frage, wieso um alles in der Welt ich gerade Sex habe.
Nachdem sie gekommen ist, wobei sie sich wer weiß was vorgestellt haben muss, rolle ich von ihr herunter und mache die Augen zu. Ich höre, wie sie an der Espressomaschine hantiert. Ich weiß, ich sollte ihr Kaffee machen, aber ich kann nicht. Mein Herz hämmert von der Anstrengung, und das Gewackel hat die Kopfschmerzen nicht eben gelindert. Ich hoffe, sie ist nicht gekränkt, ich mag sie nämlich wirklich gern.
»Gehen wir frühstücken?«
Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. Sie verschwindet im Bad.
Ich versuche meine Gedanken auf etwas Erfreuliches zu richten. Den heutigen Tag habe ich immerhin für mich. Das ist ja schon was. Aber morgen steht wieder ein Termin im Kalender, den ich nicht absagen kann und der mit Sicherheit übel enden wird. Ich halte es unter Menschen nicht aus, ohne zu trinken. Sie verbreiten so viel Unruhe. Ich muss diese Empfindungen dämpfen, sonst fahre ich aus der Haut.
Also morgen wieder. Zuerst Kaffee mit Ela, das ist nett. Danach habe ich eine Besprechung mit zwei Opernmenschen, die von mir ein Libretto wollen, und ich habe schon am Telefon gemerkt, was für Nervensägen das sind.
Vielleicht schaffe ich es wenigstens, keine Drogen zu nehmen und nur beim Alkohol zu bleiben. Ohnedies gibt es kein Geld für Koks, das Konto ist gesperrt. Obwohl. Die VISA-Card. Die müsste noch funktionieren.
Als Ina aus dem Bad kommt, fällt mir ein, dass ich ja für spätabends mit Helen ausgemacht habe, gemeinsam TheWalking Dead anzusehen. Ein Lichtblick. Helen ist noch keine dreißig, aber schon eine tolle Schriftstellerin, und es ist auch ziemlich toll, mit ihr zu schlafen. Genau das machen wir eigentlich immer, wenn wir ein paar Folgen Walking Dead hinter uns haben, als ob die Zombieapokalypse in uns die Lebensgier wecken würde. Das bedeutet ferner, dass ich heute vermutlich auf Koks verzichten werde, denn Koks hat Nebenwirkungen. Und vor die Wahl gestellt, mit Helen zu schlafen oder neben ihr mein Nasenbluten zu stillen, wähle ich den Sex.
Eigentlich habe ich es immer vermieden, etwas mit Schriftstellerinnen anzufangen. Man weiß nie, was die danach daraus machen. Zumal Helen ihrerseits ja sagt, ich dürfe über sie schreiben und sogar über unseren Sex, sie vertraue mir vollkommen. Natürlich würde ich darüber nie schreiben, frage mich jedoch, wie das umgekehrt aussieht. Jedenfalls finde ich, man muss die Sexpartner, über die man schreibt, entweder vorher um Erlaubnis fragen oder sie gleich erfinden.
»Was ist jetzt mit Frühstück?«, fragt Ina.
Im Treppenhaus begegnen wir meiner dementen Nachbarin. Wenigstens trägt sie ihren verschlissenen Morgenmantel und Hauspantoffeln aus den Siebzigern, das ist mehr als beim letzten Mal. Sie scheint etwas zu suchen. Zwar erkennt sie mich nicht, lässt sich aber dennoch von mir zurück in ihre Wohnung geleiten, zu der ich einen Schlüssel habe, ausgehändigt von ihrem Enkel, der wenig Lust zeigt, sich in die Betreuung seiner Verwandten einzubringen.
Ich dirigiere die alte Frau zur Couch, suche ihr Kuscheltier, finde den klebrigen Elefanten mit dem einen Auge schließlich im Backofen und drücke ihn ihr in die Hand. Kurz glaube ich ein Zeichen von Erkennen in ihren Augen zu sehen.
Sie fragt nach ihrer Schwester und nach jemandem, der bislang noch nicht Gegenstand unserer Unterhaltungen war. Ich lege eine Platte von Mario Lanza auf, die sie beruhigt. Zuletzt kontrolliere ich, ob der Herd ausgeschaltet und die Badewanne leer ist.
»Bist du mit der verwandt?«, fragt Ina, während wir auf den Lift warten.
»Leider nicht.«
»Wieso leider?«
»Weil das eine großartige Frau ist.«
»Viel ist von der Armen ja nicht übrig.«
Ich sage nichts.
»Kennst du sie besser?«
»Ein bisschen.«
Ich mag mit Ina nicht teilen, was mir diese Frau erzählt hat, als sie noch halbwegs wach war. Ich habe einige Nachmittage bei ihr verbracht. Kaffee machen konnte sie nicht, aber wenn sie redete, sah man ihre Mutter oder das Haus ihrer Kindheit oder ein Lager plastisch vor sich. Ich habe ihr damals versprochen, dass ich ihre Geschichte für mich behalten werde, obwohl ich finde, jeder sollte wissen, wie diese Frau zu der tätowierten Nummer an ihrem linken Arm gekommen ist. Aber sie wollte es nicht.
Der Lift in meinem Haus war in seinem früheren Leben garantiert Polizist oder Justizvollzugsbeamter. Er handelt vollkommen nach eigenem Gutdünken, und einige seiner Macken sind furchteinflößend. Jetzt etwa schließt er die Tür, macht jedoch keine Anstalten, hinunterzufahren oder die Tür wieder freizugeben.
Ina beginnt zu zittern. Sie ist klaustrophob. Ich taste meine Taschen nach Xanor ab, finde jedoch nur eine zerbröselte Zigarette, was bei einem Nichtraucher bemerkenswert ist. Die Tür öffnet sich wieder. Warum auch immer.
Ina rennt nach unten, als stünde das Haus in Flammen. Ich folge ihr und bekomme die nächste Schwitzattacke.
»Dieser Scheißlift!«
»Ja, er ist gewöhnungsbedürftig.«
»Nie wieder! Nie wieder steige ich da ein!«
»Ist okay.«
Ihre Hand liegt auf der Klinke der Haustür, doch anstatt aufzumachen, mustert sie mich. Etwas geht in ihr vor. Sie scheint ihre Gedanken zu sammeln.
»Weißt du eigentlich noch, was du heute Nacht am Telefon alles gesagt hast?«, fragt sie.
Das weiß ich nicht im Geringsten, und das gebe ich freimütig zu.
»Du hast von Thailand geredet. Und dass du mit mir hinfliegen willst.«
Das hört sich nicht unplausibel an. Ich will ständig nach Thailand. Aber ich will nicht mit einer Frau nach Thailand, die Fransenlederjacken trägt. Das habe ich gestern offenbar nicht bedacht. Wenn ich betrunken bin, werde ich rührselig, und wenn ich eingekokst bin, werde ich geil. Diese Kombination bringt immer wieder aufs Neue Probleme in mein Leben. Und auch in das anderer.
»Manchmal weiß ich echt nicht, was du von mir willst«, sagt Ina.
Ein Taxi fährt vorbei. Sie hält es auf und ist so schnell darin verschwunden, dass ich keine Gelegenheit habe, sie zurückzuhalten oder mich wenigstens zu verabschieden.
Ich wundere mich nicht, ich kenne ihre Art. Ich schreibe ihr eine SMS, in der ich mich für die schöne Nacht bedanke. Ich will nicht, dass sie mit einem schlechten Gefühl nach Hause fährt.
Und was jetzt? Jetzt schon anfangen? Was ist mit den guten Vorsätzen?
Na ja, warum nicht. Aber aufpassen! Auf alle Fälle für Helen fit bleiben! Mit ihr wegen zu viel Koks nicht schlafen zu können wäre ungefähr so dumm, wie eine Reise nach New York nicht antreten zu können, weil man sich den Magen bei McDonalds verdorben hat.
Während ich mich Richtung Café Rudi quäle, den Kokainkater wieder als Alpdruck im Hinterkopf, denke ich über die Art meiner Beziehungen zu Frauen nach. Ich kann sie nicht mehr definieren.
Also die mit Ina schon, die sogar sehr leicht. Bei der zu Helen etwa wird es schwieriger. Wir haben Sex, wir trinken, wir haben Sex, wir trinken, all das so lange, bis wir uns lieben. Nach ein paar Tagen Innigkeit meldet sich einer von beiden zwei Wochen lang nicht.
Alles ist lose. Wir leben allein mit anderen. Keiner ist mit jemandem fest zusammen, jeder hat ein paar Menschen, mit denen er ab und zu ins Bett geht. Ich weiß nicht, ob dieses Modell eine Erscheinung unserer Zeit ist, und ich glaube nicht, dass ich mich daran gewöhnen möchte.
Im Café Rudi hängen nur Schnapsleichen herum. Gegen die Leute, die hier an der Theke am 1. Januar aufgereiht sind, bin ich in einem hervorragenden Zustand. Das gedenke ich jedoch bald zu ändern. Heute darf ich ja. Dass es für mich ein spezieller Tag ist, weiß zum Glück so gut wie niemand, also sollte er nicht eskalieren.
Mein Handy läutet.
Auf dem Display lese ich entsetzt:
DSCHINGIS KHAN
WIEN
Neben mir schläft das Kind. In meiner Wohnung gibt es für ein zweites Bett keinen Platz. Was mir in diesem Fall nur recht ist. Ich liebe es aufzuwachen, und da liegt es. Einen schöneren Anblick kenne ich nicht.
Ich lausche seinem weichen, regelmäßigen Atem. Eigentlich müsste ich zur Toilette, doch ich will es nicht wecken.
Ich betrachte sein Gesicht. Früher war es noch ein wenig zarter. Die Zeit schreibt sich in seine Züge. Aber es hat noch immer einen unbeschwerten Ausdruck, schlafend wie wach. Ich hoffe, dass das so bleibt. Möglichst lange. In seinem Alter haben viele Kinder schon diese dunklen harten Augen und diesen verletzten Blick. Hoffentlich kriegt meines den nie.
Es gähnt und streckt sich, zwinkert, sieht mich, lächelt, schlingt den Arm um mich und schläft wieder ein.
Ein Gefühl, das zu beschreiben nutzlos wäre. Wer ein Kind hat, versteht es. Wer keines hat, kann es sich nur ungefähr vorstellen.
Ich schmiege mich vorsichtig an das Kind. Tagsüber ist es aufgekratzt und wild, man kann keine Zärtlichkeiten abstauben. Morgens, wenn es erst langsam in den Tag gleitet, kann man es überlisten und sich ein paar Minuten Kuschelei stehlen.
MÜNCHEN
Etwas verstört sehe ich der Frau zu, mit der ich heute Nacht Sex hatte und deren Name mir entfallen ist. Sie trippelt in meinem Hotelzimmer herum und beschnuppert meine Wäsche.
Das geht seit Minuten so. Sie sucht die Kleidung, die ich gestern getragen habe und die nicht einfach zu finden ist, weil wir beim Heimkommen, falls man das bei einem Hotelzimmer sagen kann, uns quasi stehend ausgezogen haben, also in großer gieriger Sexualhast, weswegen alles im Zimmer verstreut ist. Vorhin hat sie ein T-Shirt vom Vorabend erwischt und daran geschnuppert, dann hat sie am Pullover geschnuppert, jetzt ist ihr eine Socke untergekommen, und sie schnuppert. Ich schaue ihr zu und sage lieber nichts.
In den vergangenen Monaten hat sich die Zahl meiner Konfrontationen mit psychisch auffälligen Menschen nach der Fibonacci-Folge entwickelt.
Ich weiß, mein Anwalt sieht im Anblick einer an Wäsche schnuppernden Nackten nicht viel mehr als ein ganz normales Symptom meines kleinen Lifestyle-Problems, aber mir wird das langsam zu viel.
Was ist mit den Leuten los? Kann man sich nicht normal benehmen? Muss es Wahnsinn sein? Und muss der Wahnsinn ausgerechnet mir ins Haus geliefert werden?
Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Ich muss etwas unternehmen. Ich weiß bloß nicht, was.
Wie ist es überhaupt schon wieder so weit gekommen?
Gestern früh holt mich mein Anwalt zu Hause ab. Er ist strahlender Laune, denn er hat in den Tagen zuvor einen Unschuldigen herausgepaukt, einen Mörder zum Totschläger gemacht und einen Totschläger zum fahrlässigen Todesfolger. Er hat seit seiner frühen Jugend ein kritisches Verhältnis gegenüber Amtsträgern und anderen Autoritäten und hält Widerstand gegen die Staatsgewalt nicht für ein Delikt, sondern für einen Beruf, und zwar weitab jeder Sozialromantik. Es mag nicht den Eindruck machen, aber Menschen mag er.
Im Café um die Ecke trinken wir ein paar Gläser. Er sieben, ich drei. Auf dem Weg zum BMW wird Werner von jemandem angerempelt, ein bemerkenswertes Schauspiel, denn Werner ist zwar einen Kopf kleiner als ich, jedoch so stark und breit wie ein Lastwagen. Er hilft dem Gestürzten höflich auf.
Über die Westautobahn nach München. Wie üblich muss ich fahren, das faule Schwein schnarcht neben mir. Mein Lebtag habe ich nie einen Menschen so schnarchen gehört, das waren nur großkalibrige Tiere.
Und wie tief der schläft! Ich fahre 250, er schläft. Ich lege wegen eines schleichenden Linksspurungarn eine Notbremsung hin, er schläft. Ich drehe die Musik so laut, dass beinahe das Dach abhebt, er kuschelt sich wohlig in seinen beheizten Sitz, und sein Schnarchen übertönt David Bowie. Nur wenn er das Rascheln meiner Zeitung hört, ist er gleich wach.
Fahrtunterbrechung an einer Raststätte. Ich esse eine Suppe, mein Anwalt isst eine Suppe und zwei Hühner. Fünf große Schnäpse zum Nachtisch. Wir fahren weiter, er schläft nach wenigen Sekunden ein. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Hätte ich nicht das Auto zum Spielen, mir wäre langweilig. Ich fahre und grüble, fahre und grüble.
Wir checken im Hotel ein. Stärkung an der Hotelbar, mein Anwalt trinkt derzeit nur Schnaps. Zuerst die Lesung, kein Honiglecken, weil sie vor zweihundert Schülern stattfindet, von denen nicht alle freiwillig erschienen sind, und bei solchen Veranstaltungen muss man immer gegen eine gewisse Unruhe anlesen.
Nach dem Abendessen beim Italiener mit Werner ab zum Konzert von Arcade Fire. Das ist so großartig wie alle, die ich von ihnen gesehen habe. Ich finde, Arcade Fire ist die beste Live-Band der Welt. Da stehen acht, neun Menschen auf der Bühne, und bei jedem von ihnen wirkt es, als würde er mit seinem Instrument ficken. Sie wirken, als würden sie nur durch unsichtbare Fesseln daran gehindert, in ihr Publikum zu laufen. Es zu überrennen. So viel Energie. Und die kriegen wir. Wenn der rothaarige Typ in seine Trommel hineinprügelt und ins Mikrophon schreit, habe ich das Gefühl, etwas ganz Neues zu sehen. Und ich sehe fast nie Neues.
Außerdem erinnert mich die ganze Truppe frappant an die Familie Cullen aus Twilight.
Nach dem Konzert sind Werner und ich beinahe nüchtern. Wir ändern diesen Zustand im Schumann’s, wo wunderschöne Frauen herumsitzen, die mich leider nicht ansprechen.
Ich warte immer darauf, dass die schönen Frauen mich ansprechen. Ich spreche nie sie an. Die werden sowieso dauernd angesprochen, und mit meinem Gestammel werde ich sie nicht genügend beeindrucken.
In der Hotelbar werden die Bilder langsam dunkler. Mein Anwalt erzählt mir ausführlich, dass er nach seinem Tod ausgestopft werden möchte. Von diesem van Dings. Er will mit einer Zigarette in der einen und einem Glas in der anderen Hand in einer Ecke stehen, in seiner Brust soll eine Tür angebracht sein, und wenn man die öffnet, findet man eine beleuchtete Hausbar vor. Außerdem will er bei seiner Witwe gelagert werden, und wenn sie Sex mit einem anderen hat, beginnt er zu knurren.
Dann kam irgendwo die Frau her. Die, die jetzt gerade an meinem Mantel schnuppert. Ich hätte mir gleich denken können, dass mit der etwas nicht stimmt, denn einer ihrer ersten Sätze an unserem Tisch war: »Ich bin gestern im Traum mit einem Hund spazieren gegangen, der vorne tot war.«
Die Erleuchtung. Jetzt und hier. Neben der Duftfetischistin. Ich werde mich in dem Sanatorium anmelden, von dem mir eine junge Frau erzählt hat.
In diesem Sanatorium bleibt man drei bis sechs Monate. Man hat jeden Tag Therapiestunden, nicht mal Bier zum Essen ist erlaubt, und nach der Zeit dort ist man zwar nicht geheilt, denn von Kokain und Alkoholismus kann niemand geheilt werden, das bleibt einem für immer, wie ein Virus, der im Körper schlummert und jederzeit ausbrechen kann. Aber man hat gelernt, mit der Sucht umzugehen. Und mit ein wenig Glück und einiger Disziplin hat man die Sache weitgehend hinter sich.
Drei bis sechs Monate in so einer Anstalt klingt nach Horror. Einzeltherapie und Gruppentherapie. Ich in einer Gruppentherapie, da werde ich schnell meinen Anwalt brauchen. Aber was sich da vor mir präsentiert, die schon am nächsten Kleidungsstück schnuppernde Wahnsinnige, dazu das Verlangen nach Rausch, nach irgendeinem Rausch, der die Angst vertreibt, das ist auch Horror. So kann das nicht weitergehen.
Im Nachbarzimmer schnarcht Werner, das Schlachtschiff. Die Frau ist mit der Wäsche fertig. Ich nehme mein Tablettenmüsli zu mir, suche meine gekaperte Kleidung, ziehe mich an und verdrücke mich Richtung Frühstücksraum, als die Frau unter der Dusche steht.
Die Serviererinnen sind schon dabei, das Buffet abzuräumen. Ich versuche es mit meinem niedlichsten Hundeblick, aber offenbar gelingt mir der mit suffgeschwollenen Backen und Schweinsaugen nicht überzeugend genug. Gerade ein weichgekochtes Ei und zwei Stück Brot kann ich den ordnungsgierigen Pranken der dicken Oberserviererin entreißen.
Ich setze mich in die hinterste Ecke und checke am Handy meine Nachrichten. Eine liebe SMS von Helen, eine nette von Daniel, eine von David Schalko, der nicht ganz nüchtern gewesen zu sein scheint, eine von Stefan Beuse, dem es offenbar ähnlich ging, eine kuriose von Ela und eine von Dschingis Khan, der aufgewacht ist und wissen will, wo ich stecke.
Ich habe einige Male miterlebt, wie es einen arglosen Tischgenossen geradezu vom Stuhl gehoben hat, wenn mein Handy klingelte und auf dem Bildschirm das Bild des Führers erschien, unter dem auch folgerichtig der Name Adolf Hitler stand. Diese Zwischenfälle führten mehrfach zu Missverständnissen und wurden alsbald so unangenehm, dass ich Werner lieber als Dschingis Khan eingespeichert habe. Mit dem Bild eines feisten Mongolen hat niemand ein Problem, obwohl sein historisches Vorbild auch nicht gerade ein Albert Schweitzer war.
Schon viele Menschen haben mich gefragt, wieso in meinem Handy niemand so heißt, wie er eigentlich heißt.
Zunächst einmal handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Meine Handys haben die kritische Tendenz, in der Nacht verlorenzugehen, und einige Male haben sich Menschen, die man gemeinhin kennt und deren Nummern bei mir gespeichert sind, über Anrufe Unbekannter beschwert.
Zweitens passen diese Namen besser zu den Betreffenden als ihre echten. Ich stehe Fuchur und Stalin nahe, Ulrike Meinhof schickt mir fast jeden Tag SMS, die schweinischen Nachrichten um drei Uhr nachts kommen leider nicht von der echten Lady Gaga, auch wenn ihr Bildschirmfoto das vorgaukeln mag. Nina ist bei mir Amanda Palmer, eine Ex firmiert als Calamity Jane 1 und eine andere Ex als Calamity Jane 2, Tomy aus dem Anzengruber heißt seiner Frisur entsprechend Prinz Eisenherz, und so weiter. Bei Eduard Habsburg lag Kaiser Franz Josef nahe, doch auf den Einfall, Fiva Marlene Dietrich zu nennen, halte ich mir noch immer einiges zugute.
Ich bin im Übrigen ziemlich froh, dass meine Agentin keine Ahnung davon hat, dass bei ihren Anrufen das Gesicht von Angela Merkel aus meinem Handy strahlt, und Daniel sollte besser auch nicht Wind davon kriegen, dass er bei mir Heinz Rühmann heißt.
Sonst keine aufregenden Nachrichten. Das Übliche eben. Anzüglichkeiten, Informationen, Grüße, Einladungen zu Lesungen. Auf Facebook ein Irrer, der mich beschimpft, fünf Hallowiegehtsdirs, eine Freundin will, dass ich sie in Amsterdam besuche. Und Tic, mit der ich dieses eine seltsame Jahr zusammen war, schickt Grüße.
Aber dann, gerade als ich mir den zweiten Kaffee auf den Tisch stelle, den die Jungserviererin noch gnädig ausgeschenkt hat, sehe ich in meiner Timeline einen Strom von Kondolenzen und begreife, dass der Journalist Kurt Kuch gestorben ist.
Scheiße.
Er hat öffentlich gegen den Lungenkrebs gekämpft, er hat monatelang Bilder von sich im Krankenhaus gepostet, von seinen Chemotherapien, von seiner Familie, er hat von sich und seiner Familie erzählt und davon, wie gern er leben will, wie sehr er sich verflucht dafür, dass er geraucht hat, täglich drei Schachteln. Mist.
Wenn ein so mutiger Mensch eine so tapfere Entscheidung trifft, nämlich sein Sterben öffentlich zu machen, um andere aufzurütteln und vor Schaden zu bewahren, ist sein Tod eine Tragödie. Man stirbt selbst ein klein wenig mit. Man trauert um ein ausgebliebenes Wunder. Eigentlich ist man traurig über das existentielle Drama des Menschseins an sich und weiß, man ist Teil dieses Dramas und wird ihm nicht entkommen. Ich glaube, wir trauern alle ständig über die totale Abwesenheit von Wundern, weil sie uns spüren lassen, dass unser Schöpfer uns alleingelassen hat.
Mein vierter toter Facebook-Freund. Ihre Accounts schweben allesamt noch in der virtuellen Cloud. Werden die eigentlich irgendwann von allein gelöscht? Oder leben wir alle auf Facebook weiter, bis die Welt untergeht?
Von Tic kommt noch eine SMS. Wie üblich lese ich zwischen den Zeilen Gefühle, die nicht da sind. Aber warum schreibt sie mir dann so? Warum schreibt sie mir überhaupt? Sie ist die Einzige unter den Frauen, mit denen ich wichtige Beziehungen hatte, die für eine normale Freundschaft nicht zu haben ist.
Ich war nur mit großartigen Frauen zusammen. Keine Ahnung, was die von mir wollten, irgendwas muss sie hinters Licht geführt haben. Sie waren aber auch ihrerseits nicht gerade das, was man Prototypen nennen könnte. Eine war besessen von Natur und Nacktheit, eine zerschnitt sich monatlich die Arme und ließ sich von mir ins Krankenhaus bringen, eine hatte einen Jesuskomplex und wollte die Welt retten, eine glaubte an Tantra, eine war Kifferin und selten ansprechbar, eine litt unter schwerer pseudologia phantastica und eine war lesbisch. Sie alle sind mir davongelaufen. Die einzige Normale war Else, und die habe folgerichtig ich verlassen. Vielleicht sollte ich beginnen, die Sache umgekehrt zu sehen, die anderen passten zu mir und Else dürfte eine psychotische Episode gehabt haben.
Ich muss an Kuchs Frau denken. Wie es ist, wenn man den Lebenspartner auf diese Weise verliert. Ob irgendwann die Dankbarkeit für die Zeit, die man hatte, stärker sein kann als der Schmerz darüber, dass sie enden musste. Ich wünsche es allen.
Das Handy läutet. Gewöhnlich hebe ich nicht ab, ein Handy ist für SMS und Emails da, doch am Display erscheint der Name Waldorf Astoria. Ich nehme an, Ela will über Kuch reden.
»Auf dich ist Verlass«, bringt sie hervor, dann folgt lang anhaltendes Gelächter.
Ich kenne das, und ich mag es. Es gibt viel zu wenige Menschen, die herzlich lachen können. Wenn Ela lacht, rückt jede Depression in den Hintergrund. Im Augenblick finde ich es allerdings etwas unpassend.
»Furchtbar, oder?«, sage ich.
»Clemens Rettenbach-Hollenstein hat es mir erzählt …«
»Du immer mit deinen Adeligen.«
»Er hat dich in einer Bar an der Theke angesprochen …«
»Hä? Was? Wovon redest du?«
»Von der Bar. In der Clemens dich angesprochen hat.«
»Wer ist das? Wann und wo hat er mich angesprochen?«
»Keine Ahnung. Vor ein paar Wochen, glaube ich. Er spricht dich an, um dir zu sagen, dass du sein absoluter Lieblingsautor bist. Er schwärmt von deinen Büchern. Du stierst ihn nur mit glasigem Blick an. Hahahahaha …«
Das klingt nicht, als wollte sie mit mir über einen tragischen Todesfall reden. Sie weiß es noch gar nicht. Gegen meinen Willen zieht mir ihr Gequieke die Mundwinkel hoch.
»Ela, bitte. Ich komme mir komisch vor, wenn ich jetzt lache.«
»Sei ruhig! Hahahaha … Er denkt sich, was ist denn … hahahahaha … was ist denn das für ein unfreundlicher Typ. Er macht dir noch mehr Komplimente. Du stierst und sagst nichts. Erst dann … hahaha … erst dann merkt er, dass neben dir eine Frau sitzt, die dir einen runterholt, hahahahahaha …«
»Bitte was?«
Das Gelächter geht in Kreischen über.
»Ela, willst du mich auf den Arm nehmen?«
»Ich schwöre dir … Er war ziemlich geschockt.«
»Kannst du ihn bitte fragen, in welcher Bar das war und wie die Frau ausgesehen hat?«
Sie ringt vor Lachen nach Luft.
»Beruhig dich. Bitte.«
»Das ist nicht so leicht. Hahahaha …«
»Ela, Kurt Kuch ist gestorben.«
Im Hörer Stille.
»Hallo? Bist du noch da?«
»Ach, ist das traurig! Der Arme! Weißt du etwas Näheres?«
»Da gibt es nicht viel Näheres zu wissen, oder? Er hat es nicht geschafft.«
»Stimmt, ja. Nein, nein, nein, das darf nicht wahr sein.«
Ich finde, es ist viel zu viel wahr, aber Lamentieren hilft ja nicht. Ich finde, wir müssen uns irgendwie durchlügen, solange es geht. Die Notlüge der Existenz. Humor und Lügen, viel mehr haben wir ja nicht.
Aber so wenig ist das gar nicht.
TOKIO
Im Morgenlicht, das schwach ins Zimmer fiel, sah er allmählich die Umrisse von Maries Rücken vor sich, der durch seine Stöße vor und zurück geworfen wurde. Der Anblick trieb ihn noch mehr an, bis er etwas hörte, das er, würden sie sich nicht so gut kennen, für Schmerzenslaute gehalten hätte.
Kein Gefühl machte ihn leichter als jenes, das von ihrem krampfartigen Pulsieren beim Höhepunkt ausgelöst wurde. Wenn er in ihr spürte, wie sie kam, wenn er sich an sie presste, während sie sich aufbäumte und in sich zusammenfiel, ein Wesen, Hunderttausende Jahre alt in dieser Sekunde, fühlte er eine Art Einvernehmen mit allem, was geschehen konnte und geschehen war. Dieses Gefühl wich auch niemals, nachdem er selbst gekommen war. Es versickerte langsam, ohne Bitterkeit zu hinterlassen.
Sie drehte sich auf den Rücken und verlangte mehr. Ihm war es recht. Er ließ sich nicht mehr viel Zeit. Er kam tief in ihrem Mund, wie es ihr nachts am liebsten war, wenn ihr nicht alle Sinne zur Verfügung standen. Er wurde laut, dann wurde es still.
Beim Sex mit anderen waren seine Gedanken manchmal abgeschweift. Während er sich in einer Frau bewegte, spürte er, dass etwas Entscheidendes fehlte, für das ihm nicht das richtige Wort einfiel. Er machte weiter, sein Körper nicht minder gierig als zuvor, aber sein Geist schon jetzt am anderen Ende der Welt und darüber hinaus.
Mit Marie kam er gar nicht zu solchen Gedanken. Sie war überall. Sie umfasste ihn, sie war so sehr in ihm wie er in ihr, ohne die Leidenschaft durch zu viel Wärme zu ersticken. Die Wärme war vorher da und danach da, und dazwischen tat sie ihnen den Gefallen, sie nicht zu stören.
Sie blieben nebeneinander liegen. Er merkte, wie noch etwas aus ihm herausrann. Marie, die ihn mit der Hand umfasste, verrieb es zwischen ihren Fingern.
Keine Scham. Kein Weltschmerz. Die Dankbarkeit dafür, da zu sein und das Gefühl zu haben, etwas stimmt.
»Glückliches neues Jahr«, sagte sie. »Erinnerst du dich noch genau, wo du heute vor einem Jahr warst? Und fragst du dich, wo du heute in einem Jahr sein wirst?«
»Ich habe komischerweise im Moment gerade ganz andere Dinge im Kopf. Frag mich in ein paar Minuten. Oder einer Stunde. Ich bin im Augenblick … ein bisschen …«
Sie lachte. »Ich auch, keine Sorge. Trotzdem, ich möchte heute in einem Jahr am Südpol gewesen sein. Mit dir.«
»Jaja, gute Idee«, sagte er und drehte sich noch einmal um.
Maries Sex war wie der, den er sonst nur von den Verzweifelten, von den Unsteten kannte, von denen, die eine Bindung suchten, die sie niemals länger als eine Woche ertragen würden. Aber sie war nicht eine von diesen Frauen. Sie war ganz bei ihm. Sie konnten sich fast jeden Tag oder jede Nacht so weit voneinander entfernen, wie es diese Augenblicke verlangten. Augenblicke waren es, einer folgte dem nächsten.
Er wusste nicht, was das zwischen ihnen war, doch es war da und schien bleiben zu wollen.
Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass es schön ist, dachte er, während er hörte, wie sie im Schrank bei der Suche nach einer Hose die Kleiderbügel zum Klingen brachte. Und: Sie ist unglaublich schnell.
Jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit. Manche müssen sich quälen, um sich schneller zu bewegen, worin auch immer, im Gehen, im Rausch, im Denken, im Handeln, im Entscheiden, in der Liebe, im Leben schlechthin. Anderen wiederum hat die Natur eine so hohe innere Geschwindigkeit mitgegeben, dass sie sich kaum oder gar nicht bremsen können, sie haben enorme Energien, wissen sie aber nicht richtig einzuteilen. Die brennen irgendwann aus.
»Jonas? Hörst du mir zu?«
»Entschuldige. Was hast du gesagt?«
»Ich würde gern über den Südpol reden.«
Er schüttelte sein Kopfkissen auf und drückte das Gesicht hinein. Es roch warm nach Schlaf.
»He«, sagte Marie und kitzelte ihn, bis er es nicht länger ertrug und sie abschüttelte.
»Zum Südpol ist es weit«, sagte er. »Sehr weit.«
»Weiter geht es nicht. Das reizt mich ja.«
»Sag mal, ist das dein Ernst?« Er setzte sich auf. »Südpol? Du willst da hin?«
»Und zwar mit dir!«
»Glaubst du, Ärzte sind unsterblich?«, fragte er.
»Generell nicht, aber bei mir könnte ich es mir vorstellen.«
»Äh … na gut.«
»Also? Also? Los, los, los, sag etwas!«
»Weiterschlafen kann ich vergessen, oder?«
Die Kaffeetasse in der Hand, stellte er sich ans Fenster und schaute in den Regen hinaus. Trotz all der Jahre überwältigte ihn der Blick über Tokio immer wieder. Eine Stadt unter ihm, die Häuser wie gebastelt, manchmal von Erdstößen erschüttert. Ein Gewirr von Menschen, Autos, Bussen. Menschen im Gleichschritt. Menschen in Gedanken. Fremd, fern, ungreifbar. Trotzdem wie er.
»Willst du wirklich?«, fragte er. »Und nur wir beide?«
»Selbstverständlich.«
»Zum Südpol zu marschieren haben schon einige nicht überlebt.«
»Das waren andere Zeiten. Und den Everest haben gewisse Leute auch nur mit viel Glück überlebt.«
Er begann mit den Händen einen Gummiball zu kneten, wie es ihm die Ärzte geraten hatten, damit die Nerven für die Heilung die nötigen Reize bekamen.
»Aber warum? Was suchst du dort?«
»Was hast du am Everest gesucht?«, fragte sie.
»Ich könnte sagen, dich. Ich könnte sagen, mich. Beides wäre nicht falsch. Aber genau kann ich es nicht sagen.«
»Siehst du, und mir geht es genauso. Ich weiß bloß, dass ich ständig Abenteuer erlebe, in denen es nur um das Leben anderer geht. Jeden Tag hängt von meinen Entscheidungen ab, ob jemand lebt oder stirbt. Nie geht es darum, ob ich lebe oder sterbe. Ich denke, es hat damit zu tun.«
»Du suchst den Nervenkitzel?«
»Nein, oder nicht in erster Linie. Ich suche eine existentielle Erfahrung, dir mir abgeht. Ich suche eine Grenze, an der ich noch nie war.«
»Die Todesnähe?«
»Das nicht. Aber eine Situation, in der alles passieren kann.«
Prima, dachte er, das klingt nach einem Himmelfahrtskommando.
»Und es muss ausgerechnet der Südpol sein? Du könntest doch Fallschirmspringen gehen.«
»Oh! Nein, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Natürlich will ich die Natur dort erleben. Die blauen Eisberge, das Licht, die grenzenlose Weite, die Einsamkeit! Die Stille. Ich stelle mir das überwältigend vor. Eingeschlossen von Eis und Stille, marschieren wir dem Südpol entgegen!«
»Und du meinst, du schaffst das?«
»Ich war Landesmeisterin im 1500-Meter-Lauf. Ich war in der Biathlon-Staffel. Ich war bis zwanzig Leistungssportlerin. Und du? Schaffst du es?«
Da komme ich wohl nicht raus, dachte er.
»Willst du nicht?«, fragte Marie. »Wirst du schon alt?«
Sie lachte, sprang auf und kniff ihn in die Seite. Das genügte. Er musste lachen, aus keinem anderen Grund als dem, dass sie da war.
WIEN
Ich mag meine Wohnung nur, wenn draußen Schnee liegt, das sieht hübsch aus und erinnert mich an eine Zeit, die ich offenbar verkläre. Eine Zeit, in der es nichts als Schneeballschlachten und Geborgenheit und alltägliche Wunder gab. Im Sommer sind mir die dreißig Quadratmeter viel zu heiß, in einer Wellblechhütte kann es kaum heißer sein. Wir haben zwar Winter, aber von Schnee seit Wochen keine Spur. Ich will raus und in ein Café. Leider muss ich auf den Boten der Schuhfirma Dachstein warten.
Ich lese im Schwejk. Den habe ich schon fünfzehnmal gelesen, doch das stört mich nicht. Wenn mir mein Leben gerade besonders zerbrechlich vorkommt, suche ich beim Schwejk Schutz. Das ist, als würde ich von einem Freund aufgemuntert werden. Die Szene mit dem Feldkuraten kann ich immer wieder lesen. Vermutlich bin ich ein schlichter Mensch. Aber darauf hat man selbst keinen Einfluss, also belastet mich das nicht.
Mir ist, als hätte ich draußen etwas gehört. Ich öffne die Tür, kein Bote da. Ich horche an der Tür der Nachbarin. Auch kein Laut.
Zurück in der Wohnung fällt mir auf, dass es darin kälter ist als im Treppenhaus. Ich drehe die Heizung höher. Im Heizkörper rauscht etwas. Ich bin über vierzig und habe noch immer keine Ahnung, was das ist. Wasser, das heiß wird? Einströmendes Gas? Aber ich heize mit Fernwärme, nicht mit Gas, glaube ich. Natürlich habe ich keinen Schimmer, was Fernwärme ist. Es klingt, als würde irgendwo in der Ferne geheizt und die Wärme dann geliefert. Doch wie liefert man Wärme? Die braucht einen Träger, die fliegt ja nicht einfach im Vakuum herum. Das spricht wieder für Wasser. Nein, ich kapiere das ganze Fernwärme- und Heizkörperkonzept nicht.
Am späten Vormittag läutet es endlich. Vor der Tür schweben zehn Schuhkartons. Dahinter wird gestöhnt. Eine freundliche Stimme bittet um Hilfe. Als ich die oberen fünf Kartons nehme, entdecke ich einen lustig zwinkernden Boten, der eine intelligente Bemerkung über unsere Konsumgesellschaft macht.
Ich packe die Schuhe aus und probiere sie an. Bis auf zwei Paar passen alle, bis auf eines sehen alle gut aus. Die drei Paar lege ich in die Schachteln zurück. Die anderen schichte ich ins Regal, bis auf eines, das ich gleich anlasse.
Ambassador von Dachstein bin ich seit einem Jahr. Werbeträger für Schuhe zu werden hat mir sofort gefallen, schon wegen Al Bundy. Wie ironisch Ambassador in Kombination mit Schuhen klingt, macht mir immer wieder gute Laune. Daniel ist auf meine Rolle neidisch und nennt mich Schuhbotschafter. Ich nenne mich selbst gern Schuhbotschafter. Irgendeine Botschaft muss der Mensch ja haben.
Daniel beschwert sich oft, dass er und Zadie Smith so etwas nicht kriegen. So etwas kriegt kein Schriftsteller, er verstünde überhaupt nicht, wieso ich so etwas kriege. Ich habe ihm erklärt, dass er niemals Schuhbotschafter werden wird, denn die Leute wollen ihre Schuhe ja auch verkaufen. Das hat er nicht gut aufgenommen.
Im Otto e mezzo, dem italienischen Restaurant, das mein Freund Massimo führt und das neben dem Café Anzengruber mein Hauptquartier ist, treffe ich Nina. Früher musste sie noch nebenbei in einem Lokal kellnern, um durchzukommen, mittlerweile kann sie als Künstlerin leben. Dass sie nicht mehr mit mir zusammen sein wollte, hat mir damals nicht gefallen, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, und wir sind Freunde.
Sie zeigt mir die neueste Entwicklung ihres Ganzkörpertattoos. Sie und ihr Mann Chris – heiraten hat sie nach mir auch gleich müssen, und da ist sie nicht die Einzige, nach mir nehmen sich die Frauen gern nette junge heiratstaugliche Männer – lassen sich von einem Tattookönner in ein zusammengehöriges Kunstwerk verwandeln, was bedeutet, da, wo an ihren Fingerspitzen ihr Tattoo endet, beginnt an seinen Fingerspitzen seines, und zusammen ergeben sie ein Tattookunstwerk.
Für mich wäre das nichts. Nina sieht damit ein bisschen aus wie eine Verkäuferin in einem Indie-CD-Laden, die nebenbei irgendwas mit Pornos macht, aber weil sie wirklich schön ist, stört nicht einmal das.
Besonders mag ich ihre Körpersprache. Sie hat eine Siehst du, ich habe es ja gesagt-Bewegung, die sie mit dem ganzen Körper vollführt. Der Oberkörper bäumt sich auf, die rechte Schulter dreht sich nach vorne, die linke zurück, das alles binnen einer Sekunde, und dazu verzieht sie das Gesicht ein wenig bitter, danach schlägt sie sich aufs Knie. Seit wir nicht mehr zusammen sind, sind wir meistens einer Meinung, und die Siehst du, ich habe es ja gesagt-Bewegung kommt nicht gegen mich zum Einsatz. Heute verrenkt sie sich oft.
»Ich bin fett«, sagt sie.
»Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die das nicht von sich behauptet hat.«
»Aber bei mir stimmt es.«
»Das sagen auch alle.«
»Drei Kilo noch.«
Drei Kilo Gewicht abwerfen, mein Gott, wir haben Sorgen. Aber früher hatte sie existentielle Probleme, kein Geld, mich als Freund, das waren harte Zeiten. Ich bin froh, dass sie jetzt nur die Speckneurose plagt.
Am Nachmittag stößt Chris zu uns. Wir bestellen noch eine Flasche Wein.
Am Abend fahren wir zu ihnen, weil Ninas alte Hündin Lima nicht so lang allein sein darf. Nina kocht vegan. Entweder ist das Rezept ein Nebenprodukt altchinesischer Folterexperimente, oder sie hat mehr auf die Weinflasche aufgepasst als auf den Topf mit den Zucchini und dem Ersatzkäse.
Nach ein paar Joints beginne ich eine weitere Person wahrzunehmen.
Ich fühle eine vierte Präsenz im Raum.
»Wollen wir schlafen gehen?«, fragt Nina.
»Ich werde mir ein Taxi rufen.«
»Nein, bleib doch. Kannst ja hier übernachten.«
Wenn ich nicht wüsste, dass sie wirklich nur übernachten meint. Sie meint schlafen, sie meint nicht Sex zu dritt. Sie meint es harmlos. Wie kann man so etwas harmlos meinen? So etwas habe ich mein Lebtag nicht harmlos gemeint, ich habe bloß so getan.
Ich strecke mich auf der Wohnzimmercouch aus. Die beiden legen sich nebenan ins Bett. Eine Tür dazwischen gibt es nicht.
»Willst du dich nicht zu uns legen?«, fragt Nina nach ein paar Minuten.
Und noch immer weiß ich’s. Wir sind Freunde. Sie meint: In aller Unschuld bequemer liegen.
Ich taumele hinüber. Chris liegt links, Nina rechts. Ich lege mich ganz nach links.
Kurz darauf schlafen beide.
Ich bin putzmunter. Die Situation ist seltsam. Das erste Mal im Bett mit Nina nach einer ganzen Weile.
Chris rollt sich auf die Seite und schnarcht mir ins Gesicht.
Ich wechsle wieder ins Wohnzimmer. Der Vierte ist da. Hier scheint es in jedem Zimmer Geister zu geben. Was soll’s. Ich nehme die Couch.
WIEN – HAMBURG
Seit 116 Stunden nüchtern. Zum Ibiza-Urlaub von Friedrich mit dem Fuß habe ich keinen Cent beigetragen. Und gestern dann, zack, da habe ich mir, ohne viel nachzudenken, bei seiner Urlaubsvertretung Koks für unterwegs besorgt. Weil ich bei der Lesung in Hamburg sowieso trinken werde. Da ist es auch egal …
Ich bin kein Dummkopf. Genau hier müsste mein Bewusstsein einschreiten und nein sagen. Aber Bewusstsein gegen Unbewusstes ist wie Bambi gegen Godzilla. Wir sind naiv, wenn wir denken, wir träfen freie Entscheidungen. Das Unbewusste trifft sie eine Sekunde, bevor wir glauben, uns soeben bewusst und frei entschieden zu haben.
Wir sind keine freien Menschen. In jedem von uns ist etwas, das ihn belagert. Ein Parasit. Das Schlimme daran ist: In Wahrheit sind wir dieser Parasit und nicht das, wofür wir uns halten. Wir sind unser Unbewusstes, nicht unser Bewusstes. Was wir zu sein glauben, ist nicht viel mehr als ein Bagger und dessen Greifarm, bedient von einer überlegenen Kraft.
Beim Online-Check-in wird mir angeboten, »heute einmal Business Class zu fliegen«, für einen Aufpreis von 99 Euro.
Warum nicht? Die Kreditkarte verträgt noch etwas Belastung.
Ehe ich das Taxi rufe, drehe ich den geöffneten Laptop um und klopfe auf die Unterseite. Es schneit auf den Schreibtisch. Ich schiebe das Gerät, das demnächst sowieso den Geist aufgeben wird, in die Umhängetasche, danach ziehe ich eine frisch gewaschene Hose an und schrubbe meine Hände mit zwei verschiedenen Desinfektionsmitteln. Mich haben sie an Flughäfen schon sechsmal der beunruhigenden Prozedur eines chemischen Abstrichs unterzogen, der mal an den Händen, mal an den Hosentaschen durchgeführt wird, und die Aufregung während der minutenlangen Wartezeit will ich mir ersparen.
Zum Schluss wickle ich die drei Koksbriefchen in eine Plastikfolie und schiebe sie wie üblich in meine zu diesem Zweck gewählte enge Unterhose. Ich bin von Sicherheitsleuten ja wirklich schon überall durchsucht worden, aber da noch nie. Man darf nur nicht den Fehler begehen, die Sicherheitsschleuse mit dem Nacktscanner zu wählen, denn dort sehen sie’s.
In der Abflughalle ziehe ich mit meiner VISA-Card ein paar Hunderter aus dem Automaten. Sollte auch diese Karte gesperrt werden, will ich noch etwas Bargeld dabeihaben.
Geld hilft fast immer. Zeit ist Geld, welch Unsinn. Geld ist Zeit. Mit Geld kauft man Zeit und Freiheit, man erwirbt die Freiheit, sich die Zeit zu nehmen für das, was immer man tun will. Zu dumm, dass ich damit schlecht umgehen kann. Sowohl mit Geld als auch mit Zeit, und mit meiner Freiheit sowieso.
Ab und zu schaue ich mich um, ob jemand aussieht, als hätte er Ebola. Ich weiß schon, dass man das vermutlich nicht erkennen wird, aber ich traue Flughäfen nicht, was das anbelangt. Ich mag Flughäfen wirklich, aber wenn sich eines Tages die widerlichsten Erreger des Planeten in irgendwelchen asiatischen Hühnerwohnungen zu einem Superbug zusammengeschlossen haben, wird dieser Armageddon-Erreger an genau so einem Flughafen mit seinem Vernichtungswerk beginnen. Und mir ist schon Ebola unsympathisch. All diese Krankheiten, die die Organe in Schlamm verwandeln, finde ich unzumutbar. Und Ebola haben sie da unten in Afrika noch immer nicht ganz unter Kontrolle. Das geht schon fast ein Jahr so.
An der Sicherheitskontrolle leere ich meine Taschen, wobei ich mit der Securityhexe scherze, und achte darauf, wirklich jedes Stück Metall abzulegen. Verlogen schmunzle ich über ein räudiges Kleinkind, das vor mir partout nicht durch die Metalldetektorschleuse gehen will, dabei möchte ich diesem verzogenen Mädchen mit dem bösen, arroganten Gesicht in Wahrheit Beine machen.
Die allgemeine Begeisterung für kleine Kinder teile ich nicht im Mindesten. Das können bereits ganz üble Menschen sein, boshaft und kaltherzig, und im konkreten Fall kann ich mir gut vorstellen, was aus dieser Prinzessin wird. Brauche mir nur die Mutter anzusehen, eine teuer gekleidete, modelschöne Frau mit Minirock und einem hochnäsigen Ausdruck, der alle Menschen ringsum zu Lakaien degradiert. Mit solchen Frauen war ich im Bett, in solche Frauen war ich verliebt, gut ausgegangen ist das nie.
Nachdem ich es ohne Zufallsalarm durch die Schleuse geschafft habe und auch mein Handgepäck keinen Anstand erregt hat, mache ich mich auf den Weg Richtung Business-Lounge.
Ich steuere die Ecke mit dem gekühlten Weißwein und den Spirituosen an. Da ich weiß, dass ich in Hamburg trinken werde (wieso weißt du das, fragt irgendjemand in meinem Kopf, weil ich Stefan Beuse treffen werde, antworte ich), kann ich genauso gut hier damit anfangen. Außerdem sind da diese verlockenden, herrlichen, alles verändernden Päckchen in meiner Hose, also darauf gepfiffen, auf alles, nach mir die Sintflut.
Ich tue so, als würde ich nicht merken, was vor sich geht. Das Bewusstsein des eigenen Fehlverhaltens sitzt bei mir links hinten im Kopf, eher oben. Ich schaue in eine andere Richtung.
Ich suche mir einen einsamen Winkel, stelle meine Flasche Weißwein und einen Whisky auf den Tisch und beeile mich, aufs Klo zu kommen, denn länger halte ich es nicht aus. Jetzt ist es so weit, jetzt ist es wirklich so weit, jetzt MUSS ich mir etwas in die Nase pfeffern, sonst zerspringe ich.
Zurück an meinem Platz ist die Gleichförmigkeit der letzten zehn Tage endlich wie weggeblasen. Unterstützt von Wellen substanzinduzierter Euphorie beginne ich mit der dringendsten Email- und SMS-Korrespondenz.
Zuallererst meine Tierärztin. Ich habe zwar kein Tier und kann auch gut weiterhin darauf verzichten, aber von ihr beziehe ich alle erdenklichen Medikamente, und mir gehen allmählich Xanor und Cialis aus. Ohne Benzodiazepine, ohne diese kleinen großartigen Angstlöser, ist in meinem Alltag der Teufel los, und ohne Potenzmittel ist mein Sexualleben zum Scheitern verurteilt. Auf Koks tut sich da unten bei mir nicht viel, das fordert dann nur der Kopf vehement, ohne dass ihm der Körper folgen kann.