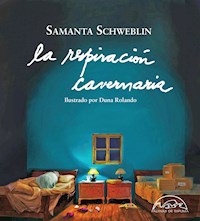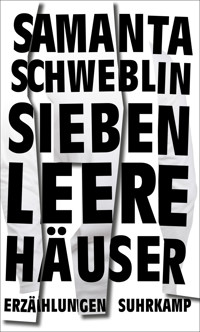21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Grauen lauert im Vertrauten
Hinterm Haus liegt ein tiefer See, da sitzt sie stundenlang auf dem Grund und hält die Luft an – zurück bei Mann und Kindern wird sie den bohrenden Wunsch nicht los, für immer unter Wasser zu wollen. Ein Junge hat ein Loch in der Kehle und die Stimme verloren – und um die Aufmerksamkeit seines gebrochenen Vaters zu wecken, greift er zu immer abgründigeren Methoden. Eine im Sterben liegende Frau ruft eine Freundin an, mit der sie seit dreißig Jahren nicht gesprochen hat, seit dem tragischen Unfall damals – wer von den beiden trug daran eigentlich die Schuld?
In den gestochen scharfen Horrorgeschichten von Das gute Übel kommen uns die Monster des Alltäglichen so nahe, dass wir ihren Atem im Nacken spüren. Samanta Schweblin ist eine Magierin und schreibt mit einem übernatürlichen Gespür über den Einbruch des Bösen in unsere Welt – und das perfide Gute, das darin aufscheint.
Alle Dutzend Jahre erscheint dieses eine Buch, das ein Loch in den Himmel reißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Samanta Schweblin
Das gute Übel
Erzählungen
Aus dem argentinischen Spanisch
von Marianne Gareis
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2025 unter dem Titel El buen mal bei Planeta S. A. und Literatura Random House.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag GmbH, Berlin, 2025© Samanta Schweblin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung des Originalumschlags von Luísa Dias. Umschlagillustration: uma Joana
eISBN 978-3-518-78337-5
www.suhrkamp.de
Motto
Das Seltsame ist immer wahrer.
Briefe
von Silvina Ocampo
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Willkommen im Club
Ein fabelhaftes Tier
William am Fenster
Das Auge in der Kehle
Die Frau von Atlántida
Der Allmächtige macht einen Besuch
Über die Erzählungen
Danksagung
Informationen zum Buch
Willkommen im Club
Ich springe vom Ende der Mole aus ins Wasser, sinke hinab und halte mir die Nase zu. Nach dem Eintauchen öffne ich die Augen, gebe mich bewusst dem langsamer werdenden Fall hin, den neuen Farben um mich herum, satter, schillernder. Ich sinke und halte die Luft an.
Vielleicht vergeht eine Minute. Schließlich berühre ich behutsam mit den Füßen den modrigen Grund, wie eine Astronautin, die auf dem Mond landet. Ich nehme die Hand von der Nase und senke die Arme, mein Körper spannt sich an. Eine Kontraktion erfasst meine Lungen, sie verkrampfen sich, ich warte noch ein wenig. Befühle die Steine, die an meiner Taille befestigt sind, der Knoten lässt sich jederzeit lösen. Damit ich es nicht bereue, atme ich ein. Ich fülle meine Brust mit Wasser, und eine neue, harte Kälte legt sich auf meine Rippen. Ich möchte, dass es ohne Schmerz abläuft. Ein paar Blasen entweichen aus Mund und Nase und steigen auf. Ein weiterer Krampf durchzuckt mich, und ich habe Angst vor dem, was jetzt passieren kann. Ich stoße die letzte Luft aus den Lungen. Bin überrascht von dem flüssigen Gefühl, wo vorher Luft war, aber vor allem überrascht mich die Klarheit, die Ruhe. Ich betrachte meine Hände, sie sind größer und weißer als an der Oberfläche, und frage mich, wie lange es dauern wird, bis ich das Bewusstsein verliere. Algen, Plankton, Fischschwärme mit Silberaugen gleiten wie Brillantine an mir vorüber. Mein Körper fühlt sich gelöst an, ich spüre die Strömungen, warm, kalt und wieder warm. In der Ferne trübt sich der Hintergrund. Wie viel Zeit wohl vergangen ist? Drei Minuten, fünf, ich kann es nicht mehr schätzen. Ich war mir sicher, dass es schnell gehen würde.
Ich berühre die Steine, suche den Knoten. Es gibt keine Reue, zu diesem Zeitpunkt ist alles schon passiert. Es ist Neugier. Ich lockere den Strick, und die Steine sinken hinab. Ihr Aufprall verursacht eine Erschütterung an meinen Füßen, die sich langsam vom Boden lösen. Ich verbleibe in der Schwebe, weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, genau in diesem Augenblick, erinnere ich, dass ich mich gefragt habe: Und wenn das alles ist? Wenn ich dort hänge und bis in alle Ewigkeit zweifle: die erste reelle Angst an diesem Tag. Nicht vor und nicht zurück zu kommen, nie mehr, in keine Richtung.
Ich rolle mich etwas ein, stemme meine Füße gegen den Boden und stoße mich ab. Was ist schiefgegangen? Ich versuche es zu verstehen. Das Aufsteigen kommt mir anfangs leicht vor, doch nach ein paar Metern hält der Körper inne, fühlt sich wohl im Schweben. Es dauert eine Weile, bis ich oben bin, bis ich schließlich die kristallene Wärme der Oberfläche erreiche. Werde ich wieder atmen können, wenn ich aus dem Wasser steige? Ich frage mich, ob mich jemand sucht, und fürchte einen Skandal. Ich mache ein paar Schwimmzüge, hebe schließlich den Kopf und spüre die erlösende kalte Luft in meinem nassen Gesicht.
Ich gelange zum Steinufer, es ist wie immer leer, strample bis zu der Treppe aus Baumstämmen und steige zur Mole hoch. Ich muss aufstoßen, beuge mich über den Steg und warte darauf, dass ich all das Wasser erbreche, aber nichts passiert. Das heiße Holz saugt die Tropfen, die von meinem Kinn herabfallen, augenblicklich auf. Ich möchte mich aufrichten, aber mein Körper ist schwach und schlaff, ich warte einen Moment und versuche es noch einmal. Die Sonne, die auf der anderen Seite des Gartens die Fenster des Hauses anstrahlt, schmerzt mich in den Augen. Ich wringe meine Haare aus, versuche dasselbe auch mit meinem T-Shirt und den Hosenrändern und gehe dann ans Ende der Mole. Meine Sandalen stehen noch auf der Wiese, genau so, wie ich sie dort abgestellt habe. Ich ziehe sie an und kämpfe mit der Steigung, als ich durch den Garten nach oben gehe.
Ich erinnere mich daran, wie ich nach Hause komme. Ich betrachte mich in der hinteren Glasfront, die nasse Kleidung klebt an meinem Körper, meine Hand greift nach der Terrassentür, sie quietscht, als ich sie aufschiebe, nimmt in ihrem Rahmen die Spiegelung mit, dahinter das Wohnzimmer, der Esszimmertisch mit den Resten vom Frühstück. Ich halte mich am Rahmen fest, und mit einer letzten Anstrengung trete ich über die Schwelle.
Drinnen ist alles ruhig. Die Hortensien, die ich am Morgen abgeschnitten habe, stehen noch immer unberührt in den beiden Blumenvasen in der Küche. Ich entferne die Briefe, die ich neben die Sträuße gelegt habe, den für ihn und den für die Mädchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine gute Entscheidung ist, die Briefe wegzunehmen, bin mir nicht einmal sicher, ob ich sie, wenn ich sie wegnehme von diesem Tisch, auch wirklich von demselben Tisch wegnehme, auf den ich sie vorher gelegt habe. Nichts ist für mich mehr sicher, weder damals noch jetzt, aber auf der Uhr ist es schon zwanzig nach zwölf, also gehe ich hoch ins Schlafzimmer, packe die Briefe in die Nachttischschublade, ziehe meine nassen Kleider aus und trockene an und gehe wieder hinunter, um das Mittagessen zu kochen.
Sie kommen hupend an, und die Mädchen stürmen wie ein Wirbelwind ins Haus. Sie haben ein Kaninchen in einem Käfig dabei.
»Wir müssen uns bis Donnerstag darum kümmern«, sagt er, »eine Woche pro Familie.«
Ich schlage die Eier. Das Eierschlagen ist übermäßig anstrengend, aber ich zittere und vertraue darauf, dass die Bewegung meinen Zustand verbirgt. Die Mädchen klammern sich an meine Hüften, und ich muss die Schüssel hochheben, damit ich ihre Gesichter sehen kann.
»Es heißt Tonne.«
»Ja! Tonne.«
Die Stimmen hallen in meinem Kopf nach. Die Ältere bohrt ihre Nase in meinen Bauch und atmet heftig ein.
»Du riechst modrig, Mami.«
Die Jüngere macht es ihr nach.
»Ja! Nach schmutzigem Schlamm.«
»Na los«, sage ich, »lasst uns essen.«
Ich erinnere mich an meine Angst, mit dem Schlagen aufzuhören. Aber ich höre auf, und es passiert nichts, niemand schaut mich an. Die Ältere schubst den Käfig an die Wand und lässt das Kaninchen heraus. Ihr Vater schließt schnell die Terrassentür, und als er zurückkommt, ermahnt er uns mit einem dreifachen Klatschen herbei:
»Von jetzt an bleibt alles gut verschlossen«, sagt er.
Ich lasse das fünfte Omelett in der Pfanne und serviere die fertigen. Er weiß, dass das auf dem Herd für ihn bestimmt ist, denn er isst als Einziger zwei. Wir setzen uns an den Tisch, und als die Mädchen ihre ersten Bissen machen und zumindest für ein paar Sekunden still sind, finde ich endlich ein wenig zur Ruhe.
Alles ist gut, sage ich mir, mach dir keine Sorgen.
Ich betrachte das Kaninchen, das ohne größere Vorsicht oder Umschweife das Esszimmer durchquert und zu dem Wasserteller läuft, den sie für Tonne hingestellt haben. Die Selbstverständlichkeit, mit der er sich außerhalb des Käfigs bewegt, überrascht mich. Wenn er in neuen Gefilden ein geschickter Reisender ist, bin ich die Frau, die stets am selben Ort verhaftet bleibt. Das Kaninchen nähert sich mir und schnuppert an meinen Füßen. Kitzelt mich mit seiner Nase, und sicherheitshalber halte ich mich am Tischrand fest.
»Er heißt Tonne, weil er so dick ist.«
»Das ist nicht wahr.«
»Doch, das hat die Lehrerin gesagt.«
Die Mädchen fechten kurz mit ihren Gabeln und essen dann weiter. Er steht auf, um das letzte Omelett zu holen, und spricht dabei mit jemandem am Telefon.
Alles ist gut, sage ich mir, und dass das Kitzeln so angenehm ist, überrascht mich.
»Freust du dich, Mami?«
Das Besteck in der Luft haltend wartet die Jüngere gespannt auf meine Antwort. Plötzlich springt sie auf und rennt mit erhobenem Besteck um den Tisch herum.
»Tonne! Tonne! Mami freut sich!«
»Aber essen ist schon zu viel verlangt, oder wie?«, sagt er, als er mit seinem zweiten Omelett zurückkommt und feststellt, dass ich mein Essen nicht angerührt habe.
Die Ältere sieht und hört uns zu. Am schlimmsten ist, dass sie solche Dinge von uns lernt.
Das Mittagessen endet, und meine Familie verschwindet nach oben. Ich mag dieses Haus wegen seiner porösen Fähigkeit, uns in seinen Zimmern aufzusaugen. Der Käfig im Wohnzimmer bleibt offen und leer, und der Gedanke, dass die Mädchen mit dem Kaninchen spielen können, wenn ich nicht mehr bin, tröstet mich. Das ist, wie wenn ich die Waschmaschine oder Mikrowelle höre, das entspannt mich, weil dann im praktischen Leben etwas geschieht, selbst wenn ich gelähmt bin.
Ich gehe zurück zur Terrassentür, mache sie auf und betrachte den Garten. Alles, was gerade passiert, erscheint mir möglich, aber wie ist es möglich, wie kann es sein, dass passiert ist, was passiert ist, und ich mich so gut fühle und sogar meine Haare bereits trocknen. Ich atme durch, hole von der Garderobe mein Portemonnaie und verlasse das Haus durch die vordere Tür. Sein Auto steht wieder diagonal in der Einfahrt, es sieht aus wie eine Barrikade. Wir streiten uns schon nicht mehr deswegen, ich habe es gelernt, mich zwischen Schutzblech und Wand hindurchzuzwängen, fast ohne mich schmutzig zu machen. Wenn er zu Hause ist, scheint ›weggehen‹ so etwas zu sein wie einen Zugang zu ›erobern‹ oder zu ›erkämpfen‹, und wenn ich ihn erobern will, muss ich wirklich entschlossen sein.
Der Nachbar von nebenan fährt gerade mit seinem Pick-up vor. Es ist der Tag, an dem ich verstehe, was er wirklich macht. Doch im Moment glaube ich nur, dass er wie jeden Nachmittag von der Jagd kommt, mit seinem Basecap auf dem Kopf. Über der Tür seines Windfangs hängen Hirschgeweihe, und obwohl er kein Soldat ist, kleidet er sich wie einer.
Vor drei Jahren kam er in die Schlagzeilen der Lokalpresse, weil er in einem Strafverfahren bezichtigt wurde, eine Frau, die in Tonis Café arbeitete und die wir nach diesem Artikel nie mehr wiedersahen, belästigt zu haben. Und danach passierte das mit dem Stacheldraht. Wir versuchten, noch an dem Tag, als er den Zaun aufstellte, mit ihm zu reden, erklärten ihm mehrmals, dass die Mädchen dort in der Nähe spielen und sich verletzen könnten. Er sagte, genau dafür seien die Stacheln da, nur so würden die Eltern dafür sorgen, dass sich ihre Kinder davon fernhielten:
»Der Zaun ist für die Eltern.«
Ich erinnere mich, dass es an diesem Tag viele Dinge gibt, an die ich nicht denken möchte. Anfangs steht der Nachbar auch auf der Liste.
Auf der Straße, im Schutz der Bäume, ist die Hitze weniger drückend. An der nächsten Ecke klingele ich bei Daniela und mache mich ein bisschen zurecht. Ich fahre mir mit den Fingern durchs Haar und finde eine eingerollte, noch feuchte Alge. Ich ziehe daran, bis sie sich wie ein Kaugummi dehnt, und werfe sie dann auf den Boden. Ich trockne meine Hände an der Hose, klingele noch einmal. Als ich genug habe vom Warten, gehe ich die Straße hinunter zu dem kleinen Platz.
Das Viertel sieht immer noch so übertrieben weitläufig und neureich aus wie an dem Tag, als wir hier ankamen, vor einigen Jahren. Ein paar Straßen weiter ist das Café. Zwei Tische sind besetzt, Toni wäscht in der Küche das Geschirr ab, ich sehe ihn durch das kleine Fenster, und er zwinkert mir zu. Ich gehe hinein und frage nach Daniela, aber er weiß nicht, wo sie ist, also setze ich mich kurz an die Theke. Vor einiger Zeit haben wir ein paarmal miteinander geschlafen, auf dem Küchenboden, in der Umkleidekammer und in der Toilette der Angestellten. Und dann sagte Toni irgendwann, ›Jetzt reicht’s, oder?‹ Und er sagte es so resigniert, als hätte er eine Weile an einem Fleck herumgebürstet, der nicht ganz rausging, weshalb er am Ende aufgegeben hatte.
Eine Frau kommt an die Theke, nimmt sich eine Zuckerdose, und bevor sie an ihren Tisch zurückgeht, lächelt sie mir zu. Ich fasse mir ins Haar, um mich zu vergewissern, dass keine Algen mehr drin sind. Ich finde ein kleines Fädchen, vielleicht ein Rest der vorherigen. Dass niemand etwas merkwürdig an mir findet, beruhigt mich, ich habe Lust, mich aufzurichten und zu strecken, mehr zu tun, als nur dort zu sitzen und zu warten.
Ich gehe hinaus und rauche eine Zigarette, ein Auto kommt durch die Hauptzufahrt, fährt an mir vorbei und entfernt sich. Auf dem Bürgersteig gibt es keine Säulen, Wände oder Pfosten zum Abstützen, dafür hat jeder sein eigenes Haus; die Straße ist nur ein großer Garten, in dem man herumlaufen kann. Auf dem kleinen Platz setze ich mich auf eine Bank. Ich erinnere mich, dass ich denke, ich zähle jetzt bis zehn, und wenn ich dann immer noch Lust habe, zünde ich mir eine weitere Zigarette an. Ich zähle, um nicht zu denken.
Da sehe ich das Kaninchen, es überquert genau in diesem Augenblick die Straße, ein Kaninchen, das dick genug ist, um Tonne zu heißen. Es flüchtet und verschwindet im Gestrüpp. Danach sehe ich eines der Mädchen. Sie weint und fasst sich mit ihren Händen an den Kopf, ihr Gesicht ist rot und mit Nasenschleim verschmiert, sie ist so in Panik, dass die Suche nach dem Kaninchen zu einer unlösbaren Aufgabe für sie wird. Ob die Ältere wohl meine schwache emotionale Intelligenz geerbt hat? Die Jüngere folgt auf die Ältere, sie fasst sich auch an den Kopf, aber ohne zu weinen, und durchsucht mit aufmerksamem Blick jeden Winkel. Ich stehe auf und gehe auf sie zu. Da kommt er hinterher, mit dem Telefon in der Hand.
»Du hast die Terrassentür aufgelassen«, sagt er.
»Mama! Tonne!«
Die Jüngere umarmt mich. Die Ältere weint.
»Was machen wir jetzt, Mami?«
Wir teilen uns in zwei Gruppen auf, er mit der Jüngeren, ich mit der Älteren, und jede Mannschaft durchforstet auf einer Straßenseite das Gebüsch zwischen den Gärten der Nachbarn. Einmal habe ich von der Küche aus ein Bettlerpärchen gesehen, das etwas Ähnliches in meinem Garten machte, keine Ahnung, was sie suchten. Ich habe den Sicherheitsdienst gerufen, sie sind gekommen und haben sie mitgenommen. Aber ein gelber Frauenpullover hing noch eine Woche lang über unserem Rosenbusch. Schließlich habe ich ihn hereingeholt und in die Waschmaschine gepackt, allein und im Schnellwaschgang. Ich ließ ihn trocknen, legte ihn zusammen, ging mit ihm die sieben Querstraßen bis zur Bushaltestelle und ließ ihn dort auf der Bank liegen. Mir war klar, dass das nicht wirklich zurückgeben hieß, aber zumindest habe ich ihn irgendwo abgelegt. Ich wollte keine Dinge im Haus haben, die mir nicht gehörten.
Wir gehen zum nächsten Garten. Eine Nachbarin taucht am Fenster auf. Ich erkenne sie, es ist die Mutter der Zwillinge, die in dieselbe Klasse gehen wie meine jüngere Tochter. Sie wird herauskommen und uns helfen, denke ich. Wird fragen ›Was ist passiert?‹ Und sie wird sagen ›Ich habe das Kaninchen gesehen!‹ Sie sieht mich an und entfernt sich, ich suche mit den Augen die Tür und warte darauf, dass sie herauskommt. Einmal hat sie vor dem Schuleingang, mit meinen Töchtern an der Hand, zu mir gesagt, ›Das ist das letzte Mal, dass ich auf Sie warte, ist das klar? Sie sind nicht die Einzige hier, die es schwer hat.‹
Aber die Haustür geht nicht auf.
Die Ältere kommt zwischen den Büschen zu mir, umarmt mich, und mit ihrer Umarmung schubst sie mich auch weiter. Wir durchqueren noch einen Garten. Als er keine Lust mehr hat zu suchen, klatscht er dreimal in die Hände. Die Familie versammelt sich mitten auf der Straße, und wir gehen zurück zu unserem Haus. Er ist verärgert, das erkenne ich an seinem Tonfall.
»Ich weiß, wo wir ein anderes Kaninchen herkriegen.«
Er sagt es vor den Mädchen, und schon klammern sich vier Hände heftig an mich.
»Nein. Nein, nein! Tonne!«
Wir sind bereits in unserer Einfahrt, als im Rücken meines Mannes der Nachbar auf uns zukommt.
»Guten Tag«, sagt er.
Da erst dreht mein Mann sich um und sieht ihn. Er bringt uns das baumelnde Kaninchen, hält es an den Ohren fest.
»Ist es tot, Mama? Mami!«
Die Mädchen springen verängstigt um uns herum. Das Kaninchen strampelt kurz in der Luft und gibt sich dann wieder seinem Schaukeln hin.
»Und wenn es ihm weh tut«, fragt die Jüngere.
»So hält man Kaninchen«, beruhigt mein Mann sie.
Aber Tonne ist zu dick, und der Mann ist schon dicht genug herangekommen, dass man die angespannten Sehnen an seiner Faust sieht. Der Mund des Tiers ist zu einem grausamen Lächeln verzerrt, die Zähne sind gebleckt, die Augen weinerliche Schlitze.
»Gibt es heute Kaninchen zum Abendessen?«, fragt der Mann.
Die Mädchen schreien. Der Mann lacht.
»Hier, nehmen Sie es in Gottes Namen.«
Er hält uns das Kaninchen hin, und mein Mann versucht es zu packen, weiß aber nicht, wie.
»Sie müssen schon Ihr Telefon loslassen, wenn Sie das Kaninchen nehmen wollen«, sagt der Mann.
Ich höre ihm zu und lächle, trotz der Verachtung, die ich für den Mann empfinde. Und als das Kaninchen schließlich übergeben ist, die Mädchen sich losreißen, auf ihren Vater zurennen und der sich bückt, damit sie Tonne begrüßen können, wendet der Mann sich mir zu, sieht mich eine Weile an und zieht schließlich die Augenbrauen hoch.
»Was ist mit Ihnen los?« Er betrachtet meinen Mund, meine Augen, meine Haare.
»Das ist das Kaninchen der Mädchen«, sage ich, »nun ja, eigentlich das Schulkaninchen, das …«
»Ich meine Sie. Sind Sie okay?«
Er kommt einen Schritt auf mich zu. Ich denke an die Algen und fahre mir mit den Fingern durchs Haar. Ich blicke auf meine Familie, vergewissere mich, dass sie sich bereits entfernt.
»Mit mir ist nichts los«, sage ich, »ich habe Sie nur mit dem Kaninchen kommen sehen und bin erschrocken, da Sie ja gerne jagen …«
»Glauben Sie, ich jage, weil es mir Spaß macht?«
Er lächelt, ist aber genauso verärgert wie mein Mann. Dann schüttelt er langsam den Kopf, ohne den Blick von mir zu wenden.
»Ich kann es kaum glauben, dass ich Sie hier so ruhig rumlaufen sehe, nach dem, was Sie heute Morgen gemacht haben.«
Es ist, als hätte er mit beiden Händen an meine Kehle gefasst. Und würde jetzt abwarten, ohne den Druck seiner Finger zu verringern. Er hat mich gesehen, denke ich. Ich erinnere mich, dass ich denke, er hat mich gesehen, und kann an nichts anderes mehr denken, weder an das Kaninchen noch an die Mädchen noch an das, was danach passieren wird. Er kommt noch einen Schritt näher, und jetzt ist es mir zu nah. Sein Finger zeigt mitten auf meine Brust.
»Glauben Sie, Sie können machen, wozu Sie Lust haben, und es dann hinterher bereuen?«
Ich suche meine Familie, sehe sie aber nicht.
»Glauben Sie wirklich, dass das so funktioniert?«
Ich mache einen Schritt zurück.
»Wohin gehen Sie?«
Ich möchte antworten, kann aber nur weggehen.
»He! Warten Sie, hören Sie mir zu.«
Ich mache einen weiteren Schritt rückwärts, dann noch einen, entferne mich von dem Mann, und jedes Mal, wenn ich mich zu ihm umdrehe, steht er nur da und beobachtet mich. Ich gehe schneller und schaue nicht mehr zurück. Ich überwinde die Barrikade, betrete das Haus, schließe die Tür. Da es mein Haus ist, gibt es auch etwas, woran ich mich festhalten kann. Säulen, Wände, ich brauche eine Weile, um mich wieder zu fangen.
Die Terrassentür ist bereits zu, und die Mädchen sind damit beschäftigt, Tonne zu jagen. Kurz darauf saugt das Haus uns erneut in seine Zimmer auf, spuckt uns in regelmäßigen Abständen aus und fängt uns wieder ein. Nach dem Abendessen geht er zum Arbeiten in sein Büro, und ich schicke die Mädchen ins Bett. Es dauert, bis sie zur Ruhe kommen, die Jüngere schläft als Letzte ein. Als sie endlich die Augen zumacht, warte ich noch einen Moment, sitze neben ihr und beobachte sie. Danach konzentriere ich mich auf meine Füße, denn zwischen den Zehen ist immer noch grünlicher, getrockneter Schlamm. Ich ziehe meine Sandalen aus und rieche daran. Ich möchte mich duschen, diesen Geruch loswerden, mir den Schlafanzug anziehen und ins Bett gehen, aber mir ist auch klar, dass ich zu nichts dergleichen in der Lage bin. Jedes Mal, wenn ich an den Mann denke, schnürt es mir wieder die Kehle zu. Schließlich nehme ich all meine Kraft zusammen und stehe auf. Ich erinnere mich daran, wie ich langsam die Treppe hinuntergehe: Ich sage mir, dass ich dieses Bein bewegen muss, dass ich das andere bewegen muss, rufe mir ins Gedächtnis, wie man atmet, und zum ersten Mal an diesem Tag, den ich nie vergesse, gebe ich mir selbst eine Anweisung.
Ich verlasse noch einmal das Haus, überwinde die Autobarrikade und gelange auf die Straße. Der Mann sitzt auf der Treppe zu seiner Veranda. Es ist das einzige eingezäunte Grundstück im Viertel, aber als ich herantrete, sehe ich, dass dieses Mal das Gartentor angelehnt ist. Ich stoße es auf und gehe hinein. Reglos wartet er darauf, dass ich näher komme. Zwei starke Bewegungsmelder gehen an und erhellen den Garten. Zu seinen Füßen drei Eimer, schmutzige Lappen und ein paar Werkzeuge. Nach wenigen Sekunden gehen die Lichter wieder aus.
»Ich habe Sie erwartet.« Er hält ein halb leeres Bier in der Hand.
Er bietet mir auch eines an, macht es auf und reicht es mir.
»Entschuldigen Sie, wenn ich etwas brüsk war. Ich verliere schnell die Geduld.«
Ich greife nach dem Bier.
»Kein Problem.«
Er sieht mich an, bis ich trinke. Ich weiß, er möchte, dass ich weiterrede. In meinem Haus geht das Licht in unserem Schlafzimmer aus, und alles ist noch ein bisschen dunkler. Der Mann trinkt sein Bier aus.
»Ich höre.«
Will er eine Erklärung? Will er, dass ich ihm eine Frage stelle? Ich denke an die Mole, an das fast schmerzliche Bedürfnis, Wasser zu erbrechen, obwohl meine Kehle vollkommen trocken war.
»Wenn Sie nichts zu sagen haben, können Sie gleich gehen.« Er deutet mit dem Kinn auf mein Haus. »Ich habe genug eigene Probleme.«
Er wartet schweigend, während ich zu verstehen versuche, weshalb ich gekommen bin. Ich erinnere mich, dass ich, bevor ich die Mädchen ins Bett brachte, noch einmal die Terrassentür aufmachte und mich mit solcher Kraft an ihren Rahmen klammerte, dass ich die gespannten Sehnen spüren konnte. Der ganze Körper wollte sich losreißen und wieder zum See rennen, und ich war mir sicher, ich hätte ihn, wenn ich losgelassen hätte, nicht zurückhalten können.
»Es ist, als ob …« Ich strecke meine Finger aus und betrachte meine Hände.
Er nickt, klopft auf den Treppenabsatz und lädt mich ein, mich zu setzen. Ich setze mich neben ihn.
»Als würde ich immer noch hinabsinken.«
Er zieht einen der Eimer zu sich heran, sucht sich aus den Werkzeugen ein Messer aus, vergräbt seine Hände in dem Eimer und beginnt zu hantieren. Er hält etwas in Händen, das im Halbdunkel nicht richtig zu erkennen ist.
»Mich erschreckt, dass …« Ich suche angestrengt nach Worten, weil ich möchte, dass er es versteht.
»Sie müssen sich daran gewöhnen«, befiehlt er und spuckt zur Seite aus.
Er ist weiter mit seinem Eimer beschäftigt, seine Finger sind blutig, auch seine Handgelenke. Er holt das Messer aus dem Eimer und kratzt sich mit dessen Rücken am Kinn. Er häutet ein kleines Tier, zieht an der Haut und lässt sie sanft über die roten Muskeln der Läufe gleiten.
»Versuchen Sie es«, sagt er.
Ohne seine Beschäftigung zu unterbrechen, schiebt er mir mit dem Fuß einen anderen Eimer zu.
»Ihr Messer ist schon drin.«
Fast erwarte ich, dass es mein Küchenmesser ist, und ein solcher Fund würde mich noch mehr erschrecken als das, was ich offensichtlich tun soll.
»Der erste Schnitt muss von einem Ende zum anderen verlaufen.«
Er beugt sich zu mir herüber und zieht mit der freien Hand einen Hasen aus meinem Eimer, hält ihn direkt vor meinen Augen kopfüber an den Läufen, es ist ein außergewöhnlich großes Tier, dem der Kopf bereits abgetrennt wurde.
»Man muss es öffnen wie ein Buch. Wenn es Ihnen auf der Rückseite schwerfällt, dann setzen Sie doch am Bauch an und schneiden von dort nach oben und unten. Danach müssen Sie ziehen, die Haut geht von allein ab.«
Mit einer Bewegung seiner Hände zeigt er mir an dem Tier die richtige Richtung, und da sehe ich sein Handgelenk: zwei lange Narben, parallel zu den Venen, dick wie Würmer. Er legt den Hasen zurück in meinen Eimer und macht mit seiner Arbeit weiter.
Das für mich bestimmte Messer ist klein und hat einen Elfenbeingriff. Ich nehme es in die Hand, zu mehr bin ich nicht in der Lage.
»Wie haben Sie es gemacht?«, frage ich ihn, ohne ihn anzusehen, weil ich vielleicht gar nicht weiß, was ich da gerade frage, oder es mir peinlich ist oder ich es lieber gar nicht wissen will. Er antwortet nicht, also warte ich ab. »Um sich daran zu gewöhnen, meine ich, um weiterzumachen.«
»Das sage ich Ihnen gerade.«
Ich höre ihm so aufmerksam zu, wie ich kann. Wir sind zwei bekleidete Menschenaffen, unsere Hände stecken in Eimern. Er dreht seinen Kopf zur Seite und deutet auf meinen Eimer.
»Ich leihe es Ihnen, dann können Sie üben. Aber Sie haben Ihr eigenes Kaninchen.«
Er überlässt mir sein Messer.
»Ich verstehe Sie nicht«, sage ich. »Sie müssen sich klarer ausdrücken, die Dinge Wort für Wort sagen.«
Er macht ein weiteres Bier auf und trinkt.
»Glauben Sie, ich hatte jemanden, der mir gesagt hat, wie das funktioniert?«
Ich antworte nicht. Er nähert sein Bier meiner Brust und klopft mit dem Flaschenboden auf mein Brustbein. Es ist ein sanftes Klopfen, trotzdem bleibt mir fast das Herz stehen.
»Sie wollen sich also mit einem steinernen Amboss um den Bauch ins Wasser stürzen?«
Jetzt spricht er es aus. Wort für Wort.
»Na schön, wenn es wirklich das ist, was Sie wollen, alles gut. Sie wollen unter den Lebenden herumspazieren, als wäre nichts passiert? Auch gut: willkommen im Club.«
Was ich will, ist, dass er mich häutet, ich will meine Hände in den Eimer stecken, und der Schmerz soll mich ganz auslöschen.
»Aber dafür zahlen Sie einen Preis.«
Er zieht an einem langen Stück Haut, reißt es komplett ab und legt es zurück in den Eimer.
»Warum? Ich habe doch niemandem was getan.«
»Wirklich? Glauben Sie das wirklich?«
Ich stehe auf. Mein halb ausgetrunkenes Bier lasse ich auf dem Boden stehen.
»Sie werden bezahlen müssen«, sagt er.
Ich schüttle den Kopf, und ohne dass es mir bewusst wird, entferne ich mich. Ich bin wütend.
»He!«, ruft er.
Die Lichter im Garten gehen an. Einige Sekunden lang ist alles so hell, dass ich mir den Arm vor die Augen halten muss. Meine Sehnen sind so angespannt, als würden meine Hände sich weiterhin an den Türrahmen klammern, sie erinnern mich daran, dass ich mich immer noch losreißen und wieder zum See rennen kann. Ich senke den Arm, der Mann ist mit seinem Eimer beschäftigt. Ich gehe wieder zurück.