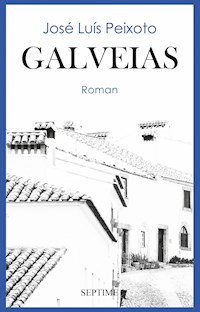13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Erzähler, ein junger erfolgreicher Atutor, führt den Leser in ein altes, von einem verwilderten Garten umgebenes und für einen Monat im Jahr in Dunkel versunkenes Haus. Er bewohnt dies mit seiner vom Lebensschmerz gezeichneten Mutter, der stillen Sklavin Miriam und unzähligen, sämtliche Räume bevölkernden Katzen. In ihm selbst lebt seine Geliebte, eine wunderschöne, der eigenen Fantasie entsprungene Frau. In diesem, nach festen Regeln uralter Ordnung lethargisch dahindämmernden Mirkokosmos taucht plötzlich ein alter Freund aus Kindertagen auf, der Prinz von Calicatri. Eine vom Prinzen angekündigte »Invasion von Barbaren« wird zur schrecklichen Realität. Viele Menschen fliehen aus der Stadt, doch einige bleiben, um sich schicksalsergeben dem Unvermeidlichen zu fügen. In furchtbarer Grausamkeit werden sie von den Invasoren entsetzlich zugerichtet, und auch das Haus im Dunkel und seine Bewohner werden von ihnen heimgesucht und nicht verschont.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
1 - Die Liebe
2 - Die Liebe ist alles, was existiert
3 - Die Invasionen
4 - Die Liebe ist unmöglich
5 - Die Pest
6 - Liebe ist Einsamkeit
7 - Der Tod
Quellenangaben
Leseproben
Ryu Murakami - Das Casting
Tobias Sommer - Jagen 135
Jürgen Bauer - Was wir fürchten
Clint Hutzulak - Ein wunderschön tödliches Ende
Fußnoten
Originaltitel: Uma Casa na Escuridão
© 2002 José Luís Peixoto
Funded by the Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas
José Luís Peixoto, Das Haus im Dunkel
© 2015, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christie Jagenteufel
Umschlag und Satz: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © PackShot - Fotolia
ISBN: 978-3-903061-14-9
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-34-2
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag | www.twitter.com/septimeverlag
José Luís Peixoto
Jahrgang 1974, studeirte Moderne Sprachen und Literaturen (Englisch und Deutsch) an der Universidad Nova de Lisboa. Er ist Autor von Romanen, Gedichten, Theaterstücken sowie von Reiseliteratur und Kolumnen. Für seine Werke erhielt der portugiesische Autor zahlreiche Auszeichnungen wie den Literaturpreis »José Saramago«. Seine Romane wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Mit Das Haus im Dunkel liegt nun erstmals eines seiner Werke auf Deutsch vor.
Klappentext
Der Erzähler, ein junger erfolgreicher Atutor, führt den Leser in ein altes, von einem verwilderten Garten umgebenes und für einen Monat im Jahr in Dunkel versunkenes Haus. Er bewohnt dies mit seiner vom Lebensschmerz gezeichneten Mutter, der stillen Sklavin Miriam und unzähligen, sämtliche Räume bevölkernden Katzen. In ihm selbst lebt seine Geliebte, eine wunderschöne, der eigenen Fantasie entsprungene Frau. In diesem, nach festen Regeln uralter Ordnung lethargisch dahindämmernden Mirkokosmos taucht plötzlich ein alter Freund aus Kindertagen auf, der Prinz von Calicatri. Eine vom Prinzen angekündigte »Invasion von Barbaren« wird zur schrecklichen Realität. Viele Menschen fliehen aus der Stadt, doch einige bleiben, um sich schicksalsergeben dem Unvermeidlichen zu fügen. In furchtbarer Grausamkeit werden sie von den Invasoren entsetzlich zugerichtet, und auch das Haus im Dunkel und seine Bewohner werden von ihnen heimgesucht und nicht verschont.
José Luís Peixoto
Das Haus im Dunkel
Roman | Septime Verlag
Aus dem Portugiesischen von Ilse Dick
misericordia tua magna est super me
Nicht, sagt sie. Es ist nicht meine Schuld.
Meine auch nicht. Sagen wir einfach, dass wir
nicht von den Sünden der Eltern loskommen.
Das ist unnötig grausam, sagt sie kalt.
Wann ist Grausamkeit je nötig? sagt er.
Und wie viel davon? Lies die Zeitungen,
ich hab die Welt nicht gemacht.
Margaret Atwood, Der blinde Mörder
1
Die Liebe
Lobet den Herrn, alle Völker,
preist ihn, alle Nationen!
Denn mächtig waltet über uns seine Huld,
die Treue des Herrn währt in Ewigkeit.
Halleluja!
Ps. 117, 1,2
Es war einmal ein Spätnachmittag. In einem September unter den Septembern meines Lebens. Ich saß im Schaukelstuhl auf der Veranda und las ein Buch, dessen Seiten vom letzten Licht des Tages gelb getönt waren. Ich schaukelte ganz sachte, als wäre ich beim Schaukeln eingeschlafen und als würden die Beine mechanisch damit fortfahren, mich vom Boden abzustoßen und langsam zurückzuschwingen. Am anderen Ende der Veranda, vor der Küchentür, saß meine Mutter in einem Lehnsessel. Die Sklavin Miriam hatte sie eben gebadet und gekämmt. Die Katzen lagen in kleinen Hügeln da und atmeten in den Boden. Hin und wieder erhob sich eine von ihnen majestätisch und strich an den Beinen meiner Mutter entlang, oder an den Beinen der Sklavin Miriam oder an meinen Beinen. Meine Mutter hielt die Augen geschlossen, während sie gekämmt wurde. Ihr Haar war über die Sessellehne gebreitet, ihr Körper noch weich vom Wasser, die Haut gerötet. Die Sklavin Miriam trat vor meine Mutter, ohne dass die Schritte ihrer kleinen Füße zu hören gewesen wären, und beugte sich nieder. Sie zog aus der Schürzentasche eine Schere, stützte einen der Füße meiner Mutter auf ihrem Schoß ab und begann, ihr die Fußnägel zu schneiden. Ich hob den Blick von meinem Buch, um ihr zuzusehen. Zwischen ihren zarten Fingern nahm sich der dicke Fuß meiner Mutter wie ein grotesker Gegenstand aus. Ich kehrte zu meinem Buch zurück und fühlte, wie die Wörter meinem Blick zu entschwinden suchten. Fahrig bewegten sie sich hin und her, als wollten sie aus der Seite schlüpfen und in die Freiheit der am Himmel verstreuten Wörter entwischen. Ich ließ das Buch sinken und blickte geradeaus. Die Berge vor mir, die ganze Landschaft, die letzten Vögel, der Garten und die Gräser, alles blieb, wie es war. Mit einem Finger zwischen den zuletzt gelesenen Seiten klappte ich das Buch zu und sah, wie das ganze Buch zitterte. Dieses Buch war Jahre hindurch in der Bibliothek gestanden. Sein blauer Rücken war Jahre hindurch auf dem zweiten Regalbrett gleich gegenüber der Tür gestanden. Jahre hindurch hatte sich der blaue Buchrücken zwischen roten Buchrücken befunden. Als ich noch klein war und mit meinen Autos spielte, schob ich sie über die Regalbretter, die Autobahnen waren, und von all den Büchern, die für mich hohe Häuser darstellten, war das Buch mit dem blauen Rücken immer mein Haus. Ich hielt mein Spielzeugauto mit Daumen und Zeigefinger fest und fuhr es zu meinem Haus, dem Buch mit dem blauen Rücken, parkte es neben den roten Häusern, und in meiner Fantasie ging ich nach Hause, schlief dort eine sekundenlange Nacht, setzte mich wieder in mein Auto und lenkte es über die Regalautobahnen. Dieses Buch zitterte nun in meiner Hand. Einen Augenblick lang befürchtete ich einen Aufstand der Wörter. Als ich das Buch weglegte, bemerkte ich jedoch, dass es meine Hand war, die zitterte. Es war meine rechte Hand, die zitterte. Mit Unbehagen betrachtete ich eine Weile meine zitternde Hand, als gehörte sie nicht zu mir, als gehörte sie jemand anderem. Ich betrachtete sie, ohne sie zur Ruhe zu bringen. Von diesem Tag an und an allen darauf folgenden Tagen begann meine rechte Hand bei Sonnenuntergang zu zittern und zitterte die ganze Nacht hindurch.
Ich wusste nie, weshalb ich schrieb. Wenn ich schrieb, setzte ich mich an den Schreibtisch, zog ein weißes Blatt Papier hervor, griff nach meinem Stift und fand die Worte, eines nach dem anderen. Jahrelang sah ich meinen Vater dasselbe Ritual vollziehen. Mein Vater schrieb Sonette. Jeden Abend setzte er sich nach dem Essen an den Schreibtisch, zündete eine Pfeife an und begann zu schreiben und durchzustreichen, zu schreiben und durchzustreichen, zu schreiben, das Geschriebene leise zu lesen, nachzudenken, durchzustreichen und zu schreiben. Meine Mutter setzte sich an ihre Stickerei. Am Ende des Abends hatte mein Vater ein Sonett fertig, und wir gingen zu Bett. Wenn jemand zu uns zum Abendessen kam, verließen wir danach das Speisezimmer und begaben uns in den Salon. Die Damen hüstelten verhalten, und mein Vater las einige Sonette vor. Am Ende klatschten alle lautlos in die Hände. Die Damen nickten einander zu. Die Herren sagten sehr gut und schüttelten meinem Vater die Hand. Als ich sechzehn Jahre alt war, schenkte mir mein Vater den Stift, mit dem ich meine erste Kurzgeschichte, meine erste Novelle, meinen ersten Roman schrieb. Alles, was aus mir einen Schriftsteller gemacht hat, wurde mit diesem Stift geschrieben. Mit demselben Stift, den ich genau zehn Jahre, nachdem ich ihn geschenkt bekommen hatte, ins Feuer werfen würde, bis ich ihn als ein Nichts sehen sollte, nicht einmal als verglimmende Glut, nicht einmal als Häufchen Asche in der Form eines Stifts.
An diesem Abend betrat und verließ die Sklavin Miriam während der Mahlzeit immer wieder das Speisezimmer mit vollen und leeren Platten, von denen meine Mutter aß, als hätte sie noch nichts zu sich genommen. Meine Mutter, der Sauce über das Kinn lief. Meine Mutter, die früher stets mit Messer und Gabel gegessen hatte, schaufelte mit einem Löffel klein geschnittenen Braten und Reis in den Mund. Wir aßen jeden Tag Braten und Reis. Jeden Tag lief meiner Mutter Sauce über das Kinn. Als wir jeden Tag Braten und Reis zu essen begannen, als meine Mutter aufhörte, mit Messer und Gabel zu essen, versuchte ich, es ihr gleichzutun. Vielleicht versuchte ich, sie auf mich aufmerksam zu machen. Vielleicht wollte ich, dass sie mich ansah. Eine Zeit lang versuchte ich, genauso viel zu essen wie sie, mir im selben Moment wie sie noch einmal nachzunehmen. Die Sklavin Miriam kam herein, um meiner Mutter Braten und Reis auf ihren und auch auf meinen Teller zu legen. An diesen Tagen war ich sehr voll. Das Essen machte mich bis oben hin voll. Ich hatte Braten und Reis in den Armen, in den Beinen, im ganzen Körper. Mir schien, mein Blut bestünde aus Sauce und mein Herz aus Braten und Reis. Meine Lunge bestand aus Braten und Reis, denn ich atmete Braten und Reis aus. Eines Abends erbrach ich mich am Schreibtisch nach dem Essen über drei Seiten einer Kurzgeschichte, die ich zu schreiben begonnen hatte. Diese Kurzgeschichte schrieb ich nie zu Ende und ich hörte auf, es meiner Mutter gleichzutun. Die Wochen voller Mühen hatten keinerlei Wirkung gezeigt: Meine Mutter nahm keinerlei Notiz von mir, und wenn sie in meine Richtung sah, tat sie es mit blicklosen Augen, mit großen wässrigen Augen, die nicht den Ort sahen, auf den sie blickten. Ich aß wieder normal mit Messer und Gabel, achtete nicht mehr auf meine Mutter. An diesem Abend saß ich, die Serviette auf dem Schoß, vor dem leeren Teller und betrachtete meine zitternde rechte Hand. Am Tisch gesprungene Platten, altes und von vielen Jahren abgenütztes Besteck, von Großeltern der Großeltern abgeschlagene Teller. Ich stand auf, als meine Mutter aufstand. An diesem Abend setzte ich mich nicht an den Schreibtisch. Die Hand hörte nicht auf zu zittern, und in mir zitterte eine Sorge. Ich blieb im Wohnzimmer. Damals war die Schlossherrin von Siliae die beste Freundin meiner Mutter. Ohne mich zu rühren, hörte ich die beiden telefonieren. Die Stimme meiner Mutter erklang verzerrt durch die Korridore und kam mir wie eine Erinnerung oder irgendetwas Unbestimmtes und Unpersönliches vor. Ich nahm eigentlich nicht wahr, was sie sagte, denn es interessierte mich nicht. Aber ich hörte sie, denn es waren die einzigen Laute, die im ganzen Haus zu hören waren. Bevor sich meine Mutter mit der Schlossherrin von Siliae zerstritt, sie eine dumme Ziege nannte und sie mit Fußtritten die Treppe hinunterstieß, kam diese für gewöhnlich zu uns, um bei einer Kanne Tee mit meiner Mutter zu tuscheln. Sie hatte eine Sklavin, ich glaube, sie hieß Maria, die eine weiche und mütterliche Miene hatte. Sie hatte eine Miene, die Trost spendete, eine Miene, die sagte ist schon gut, ist ja schon gut, eine Miene, die einen liebkoste, wenn man sie nur ansah. Sobald sich meine Mutter und die Schlossherrin von Siliae in ihrem Gemurmel einschlossen, war ich auf der Suche nach der Sklavin Maria und himmelte sie von meinem Versteck ausstundenlang für so viel Sanftheit an. An dem Tag, an dem sich meine Mutter mit der Schlossherrin von Siliae zerstritt, sie eine dumme Ziege nannte und sie mit Fußtritten die Treppe hinunterstieß, spürte ich, dass damit eine Phase meines Lebens abgeschlossen war.
Ohne schreiben, ohne denken zu können, ging ich niedergeschlagen zu Bett. Ich zog den Pyjama an und schlüpfte unter das Gewicht der Decken und Laken. Obwohl es noch zu früh zum Schlafen war, wollte ich mich dazu zwingen. Die Hand zwischen den Laken zitterte. Nach dem letzten Buch, das ich geschrieben hatte, war ich vollkommen erschöpft. Ein Roman, in dem ein Vater und ein Sohn sterben, in dem siamesische Zwillinge sterben, in dem ein greiser Mann stirbt. Ein Roman, der ein Jahr lang mein Leben beherrschte. Ein Roman, in dem die Worte all das waren, woran ich glaubte. Ich dachte schon, daher käme das Zittern meiner Hand. Ich habe stets mit dem Stift geschrieben, den mein Vater mir geschenkt hatte. Ich habe stets mit der rechten Hand geschrieben. Meine rechte Hand hat Geschichte. Als ich klein war, bemerkte die Sklavin Madalena, die Mutter der Sklavin Miriam, dass ich alles mit der linken Hand machte. Sie ließ es meine Mutter wissen, meine Mutter ließ es meinen Vater wissen, und mein Vater wies die Sklavin Madalena an, mir meine linke Hand in einem Beutel am Rücken festzubinden. Zwei Monate verbrachte ich mit festgebundener Hand, machte alles mit der Rechten. Nachdem man mir in einer Zeremonie, bei der die gesamte Familie bis hin zu den Cousins aus dem Ausland anwesend war, die Hand losgebunden hatte, konnte ich nie wieder irgendetwas mit der linken Hand tun. Jetzt war ichein normaler Junge. Ich glaube, daran habe ich mich erinnert, als ich im Bett lag und nicht einschlafen konnte. Ich wälzte mich hin und her. Drehte mich von einer Seite auf die andere, vom Rücken auf den Bauch und dann auf die Seite, warf mich herum, ohne eine Position zu finden, die mir behagte. Die frischen Laken verwandelten sich in eine warme Masse, die an der Haut klebte - zähflüssiges, teigiges Unbehagen. Da schloss ich ganz fest die Augen und konzentrierte mich auf das, was ich sah. Etwas, das ich schon von klein auf getan habe. Ich hatte es durch Zufall entdeckt und dachte, niemand sonst auf der Welt würde es tun. Ich schloss die Augen und sah. Sah, was man sieht, wenn man die Augen geschlossen hält. Sah das Dunkel in mir und die Lichtpunkte, die es brachen, Lichtwellen, abstrakte Lichtfiguren, Lichtgestalten, Lichtschatten im Licht des Dunkels in mir. Schließt man die Augen und fährt fort zu schauen, sieht man ein Dunkel mit kleinen Lichtwesen darin. Und man kann weder direkt auf das Dunkel noch auf das Licht blicken. Die Lichtpunkte, Lichtlinien und Lichtgestalten entziehen sich dem Blick. Das Dunkel ist so vollkommen, so tief und so unendlich, dass der Blick es nicht durchdringt und keinen Ort findet, an dem er sich niederlassen kann. In dieser Nacht begann ich jedoch, etwas in diesem Dunkel auszumachen. Allmählich glitten die kleinen Lichtpunkte, einer nach dem anderen, durch das Dunkel, und zum ersten Mal sah ich, dass sie einer Richtung folgten. Ganz langsam näherten sie sich einander in einer Harmonie, in der es noch keine Logik gab. Dann bildeten die Lichtpunkte langsam, ganz langsam Lichtketten, die wiederum Lichtlinien vor dem Dunkel bildeten. Allmählich zeichneten sich die Umrisse eines Gesichts und eines Körpers ab. Langsam, ganz langsam zeichneten sich die Züge des schönsten Gesichts ab, das ich je gesehen, und die Gestalt des schönsten Körpers, den ich je erblickt hatte. Ein Körper aus Licht inmitten des Dunkels. Eine Frau. Ich betrachtete sie, bis sie vollendet war. Ich betrachtete sie so lange, bis ich die Gewissheit hatte, ich würde niemals, nie wieder in meinem Leben eine schönere Frau sehen. Betörend schön. Und selbst als ich diese Gewissheit hatte, hörte ich nicht auf, sie zu betrachten. Sie betrachtete mich ebenfalls. Scheu, vielleicht ohne zu wissen, ob sie lächeln sollte. Und die Haut, die ich nicht berühren konnte, war die Haut einer makellosen Braut, die man küssen möchte, ohne es tun zu können, die unwirklicheHaut einer Braut, die mit Blumen im Haar zum Altar schreitet. Die Hände waren die zartesten und grazilsten der Welt, wäre die Welt nur groß genug für so viel Zartheit und Grazie. Sie trug ein leichtes Kleid aus weißem Stoff, das ihren Körper betonte. Ihre Lippen waren fein, ihr Haar lang. Als ich die Augen aufschlug und das Bett verließ, hatte ich dieses lebende Wunder in mir. Barfuß, ungekämmt ging ich im Schlafanzug durch das Haus. Ich setzte mich an den Schreibtisch. Mit zitternder Hand hielt ich den Stift fest. Und sobald ich die Spitze des Stiftes auf das Blatt Papier setzte, hörte die Hand auf zu zittern. Ich begann, die ersten Wörter des Buches zu schreiben, das, wie ich mir als absolut sicher ausmalte, mein bestes sein würde. Ich war fünfundzwanzig Jahre, sechs Monate und neunzehn Tage alt.
Ich schrieb, bis sich der Tagesanbruch im Fenster zeigte. Die Sonne, die die Augen der im ganzen Wohnzimmer verstreuten, dahockenden, daliegenden Katzen zum Leuchten brachte. Die Sonne, die das große Sofa, das verblichene Rot unter einer Schicht vonKatzenhaar zumLeuchten brachte. Die Sonne, die zum Schreibtisch gelangte und es auf den weißen Blättern Tag sein ließ. Ich schrieb zwei Seiten. Beschrieb ihr Gesicht, die Augen, die Lippen, die Haut, das Haar. Beschrieb ihren Körper unter dem Kleid, die Brüste, den Bauch, die Beine. Ich beschrieb ihre Stille. Und als mir schien, es gäbe nicht genug Worte für solche und so viel Schönheit, schloss ich die Augen und hielt still, um sie zu betrachten. Mit ihrem Glanz kam der Wunsch, sie zu beschreiben, und immer wenn ich dies tat, brachte ich zwei Wörter oder bestenfalls einen Satz zustande. Wenn sich der Tagesanbruch im Fenster zeigte, stand ich vom Schreibtisch auf und ging wieder zu Bett. Beim Einschlafen sah ich sie an. Mit ihr in mir schlief ich ein.
Ich hatte mich nie leidenschaftlich verliebt. Ab meinem siebzehnten Lebensjahr lernte ich viele Frauen kennen, und für sie alle empfand ich etwas. Las ich in ihrer Miene diesen besonderen, versonnen langen Blick, ließ ich mich beeindrucken und dachte für ein paar Wochen, ich wäre entbrannt und würde sie lieben. Aber dann die Zeit. Die Zeit stets gleich einer Brise. Eine sanfte Brise, die mir die Gefühle austrieb und mir auf die Entfernung zeigte, wie kümmerlichsiewaren, arg kümmerlich und ohne Wert. Und immerzu nur Einsamkeit. Immerzu. Ich allein in meinem Leben. Dabei allein, Dinge zu sehen, die sich nicht wiederholen würden; allein zu sehen, wie das Leben verschliss, da meine Erinnerungen verschlissen. Allein mit lächerlichem Selbstmitleid, aber in echtem Leid. Nie hatte ich mich wirklich leidenschaftlich verliebt. Ich sagte viele Male ich liebe dich, aber ich bereute es immer. Immer bereute ich diese Worte.
Ich wachte mit einem Lächeln auf. Ich schlüpfte schnell in die Kleider. Ich zündete mir eine Zigarette an. In der Küche kratzte die Sklavin Miriam den Rücken meiner Mutter, ich sagte auf Wiedersehen und verließ das Haus. Auf der Veranda gab es Katzen. Auf der Treppe musste ich mir meinen Weg bahnen, um nicht auf eine der Katzen zu treten, die auf den Stufen lagen. Im Hof kamen Katzen auf mich zu, um ihr Fell an meinen Beinen zu reiben und mir adieu zu sagen. Im Auto sitzend, schloss ich die Augen und in mir drin sah ich, dass sie noch schlief. Ihre Hände, die zarten Finger unter ihrem Kopf verschränkt. Die Haut ihres Gesichts entspannt. Sie atmete ruhig, wie ein Feld im Frühling. Mit weit geöffnetenAugen fuhr ich mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn. Ich war dabei, meinem Verleger einen Besuch abzustatten und war schon spät dran. Ich hatte ihm versprochen, noch vor Jahresende einen Roman abzuliefern und brachte Neuigkeiten, die ihn erfreuen würden. Auf dem Beifahrersitz lagen die beiden Blätter, die ich in der Nacht zuvor beschrieben hatte, und ich wusste, er würde lächeln, wenn ich sie ihm zeigte, denn er wie auch ich wussten, dass ich, wenn ich erst einmal ein Buch zu schreiben beginne, nicht aufhöre, bis ich beim Schlusspunkt des letzten Absatzes der letzten Seite angelangt bin. Zweimal streifte ich die Mittelleitplanke der Autobahn. Einmal, da ich auf die Blätter auf dem Beifahrersitz blickte, das zweite Mal, da ich die Augen geschlossen hatte, um zu sehen, ob sie bereits aufgewacht war. Sie schlief noch, wie eine Blume, wie ein wolkenloser Himmel. Ich fuhr in die Stadt ein, und auf meinem Weg blinkten mir sämtliche Ampeln entgegen. Ich war fünfzehn Minuten zu spät. Für gewöhnlich schimpfen die Wachen bei Verspätungen und erwidern auf sämtliche Entschuldigungen, Besuchszeit sei um vier Uhr, aber an diesem Tag waren sie seltsam freundlich. Sie nahmen nicht einmal eine Leibesvisitation vor, fragten mich lediglich, in welchem Pavillon er sich befinde und ob ich ihm ein Päckchen Zigaretten mitgebracht habe, und als ich verneinte, forderten sie mich auf, ihnen zu folgen. Als ich im Besuchsraum ankam, war er schon da. In seiner blauen Anstaltskleidung kam er mit ausgebreiteten Armen auf mich zu und sagte du bist der Einzige, der an mich denkt. Zu diesem Zeitpunkt saß mein Verleger beinahe schon drei Jahre ein. Er war in flagranti dabei erwischt worden, das Buch eines jungen Autors zurückzuweisen, indem er ihm mitteilte Sie wissen schon, wie es ist, die Leute lesen heutzutage wenig, und schon gar nichts von einem jungen Autor, von dem sie noch nie gehört haben. Bei Gericht, wo ich als Zeuge der Verteidigung auftrat, wog vor allem eine Reihe von Briefen schwer gegen ihn, die er eigenhändig unterschrieben und in denen er stets nur den einen Satz geschrieben hatte: In der Anlage retournieren wir das eingesandte Original und bedauern, Ihnen mitzuteilen, dass wir von einer Veröffentlichung Abstand nehmen müssen. Er fasste eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren aus. Zu Beginn war es für ihn sehr schwierig. Verleger und Pädophile werden in Gefängnissen besonders schlecht behandelt. Obwohl er es mir nie erzählte, nehme ich an, er wurde vergewaltigt.
In der Besuchszeit blickten uns alle von der Seite an. Die ärgsten, zerrauftesten Rotznasen, Kinder von Drogenhändlern und Zuhältern, zeigten auf meinen Verleger, kamen näher und traten ihm gegen das Schienbein. Alte Zigeunerinnen spuckten im Vorbeigehen auf den Boden und verfluchten ihn. Männer fragten ihn grundlos,ob er die Fresse poliert haben möchte. Strohblonde Mädchen bewarfen ihn mit brennenden Zigarettenkippen. Jeder dort wusste, dass er Verleger war, und alle verachteten ihn. Mir selbst haben Verleger nie etwas ausgemacht. Von Kind an war ich es gewohnt, sie zu sehen. Ich sprach mit ihnen. Die Verleger wunderten sich darüber und wussten nicht, ob sie mir antworten sollten. Sie sahen die Sklavin Madalena an, die ihren Blicken auswich. Ich sprach erneut zu ihnen. Die Verleger antworteten und machten mit mir Späße, wie man sie mit Kindern macht. Die Sklavin Madalena redete mit niemandem darüber. Ich war klein und wusste nicht, dass dies unser Geheimnis war. So machten mir Verleger nie etwas aus. Sie kamen durch die Küchentür herein. Voller Mitleid bot ihnen die Sklavin Madalena einen Teller Suppe an, betrat das Wohnzimmer und teilte unter vielen Entschuldigungen meinem Vater mit, dass ein Verleger in der Küche sei. Mein Vater trug ihr auf zu fragen, welches Anliegen ihn hierher gebracht habe. Die Sklavin Madalena ging zurück in die Küche und unterbreitete dem verlorenen Blick des Verlegers die Frage, und dieser sagte jedes Mal, er wolle wissen, ob der neue Band mit den Sonetten fertig sei. Die Sklavin Madalena ging abermals ins Wohnzimmer, und wenn sie in die Küche zurückkehrte, sagte sie einmal einfach nein, ein anderes Mal brachte sie auf einem Silbertablett ein kleines Bündel handbeschriebener Blätter, um die ein rotes Band geschlungen war. Ich war noch sehr klein und spielte oft in der Küche, und oftmals bekam ich all das mit. Drei Tage nach Beendigung meines ersten Romans war ich mit meinem Vater im Wohnzimmer, als die Sklavin Madalena eintrat. Sie sagte, ein Verleger sei in der Küche. Mein Vater trug ihr auf zu fragen, welches Anliegen ihn hierher gebracht habe. Als sie wiederkam und sagte, er wolle wissen, ob der neue Band mit den Sonetten fertig sei, hieß mein Vater sie nein, noch nicht zu sagen, dass ich jedoch einen Roman geschrieben hätte, und er wies sie an zu fragen, wann dieser publiziert werden könne. Die Sklavin Madalena ging in die Küche und kam wieder, sagte, in einem Monat. Mein Vater nahm aus der Schublade ein rotes Band und schlang es um das Manuskript. Die Sklavin Madalena holte aus dem Speisezimmer das Silbertablett.
Auch wenn ich auf sonst so viele Menschen treffe, die an Bushaltestellen meine Bücher lesen, auch wenn ich sonst so viele Studenten mit meinen Büchern unter dem Arm unbekümmert umherwandern sehe, werde ich niemals gleichgültig bleiben, wenn jemand in meiner Nähe eines meiner Bücher liest, niemals, in wie viele Sprachen auch immer meine Bücher übersetzt und von Menschen in Sprachen voller Konsonanten gelesen werden. In den Worten, die ich geschrieben habe, bleibt das, was ich einen Augenblick oder ein Jahr oder mein ganzes Leben lang dachte. In den Worten, die ich geschrieben habe, bleibt das, was ich war, das, von dem ich nicht weiß, ob ich es noch bin. Wenn jemand in meiner Nähe eines meiner Bücher liest, bin ich ein verschämtes Kind. Während mein Verleger las, schlug ich im Besuchsraum des Gefängnisses die Beine übereinander und stellte sie wieder nebeneinander auf den Boden, schlug ein Bein über das andere und stellte es wieder auf den Boden, zündete mir eine Zigarette an und drückte sie aus, zündete die nächste Zigarette an und drückte sie aus. Sie in mir wachte ganz langsam auf, streckte die schlanken Arme aus, schloss die Hände mit den zarten Fingern zu einer Faust und rieb sich die Augen mit dem bezaubernden Liebreiz eines erwachenden Kindes. Die Ruhe, mit der sie mich anlächelte, brachte auch mich zum Lächeln und beruhigte mich. Ich öffnete die Augen. Mein Verleger war mit dem Lesenfertig. Er hob seinen Blick vom Papier und ließ ihn auf mir ruhen. Zwei echte Männer. Wir standen auf und umarmten einander, Freunde, Brüder in diesem großen Augenblick. Da standen wir inmitten des Besuchsraums und umarmten einander. Die anderen, Häftlinge und ihre Familien, bewarfen uns mit allem möglichen Abfall: mit Dosen, schmutzigen Servietten, Obstschalen, benutzten Taschentüchern.
In den folgenden Wochen legte sich meine Mutter jeden Abend nach dem Essen zur Seite gedreht auf das große Sofa. Die Katzen legten sich wie eine aus vielen Farben bestehende Decke auf sie und ließen nur ihren Kopf frei. Die Sklavin Miriam setzte sich mit einem Gefäß voll aufgeschnittener Oliven und mit einem leeren Gefäß auf den Boden. Ich setzte mich an den Schreibtisch. Mit zwei Fingern nahm die Sklavin Miriam eine Olive aus der Schüssel und ließ sie zwischen den Lippen meiner Mutter verschwinden. Die kleine Frucht wanderte durch den Mund meiner Mutter, der Kern wurde in die Hand der Sklavin Miriam gespuckt und machte tock am Boden des Gefäßes oder tick, wenn der Boden schon mit einem Berg von Kernen bedeckt war. Wenn ich dort am Schreibtisch saß, war mein Warten süß, da voller Gewissheit, ein bestimmter Augenblick würde sich einstellen. Wenn ich dort am Schreibtisch saß, war die Süße meines Wartens überall im Zimmer: im abgenutzten Kalk der Wände; im Licht, das den schemenhaftenSchatten meines Wartens zeichnete; in den ausgeblichenen und abgetretenen Teppichen; in den Bildern, die ich schon nicht mehr sah, da ich all die Landschaften so gut kannte; im Fenster und in der Nacht, die sie in die Ferne bis zu den Bergen trug: groß und schwarz.
Wenn meine Mutter und die Sklavin Miriam den Raum verließen, begann ich zu schreiben. Niemals war ich so glücklich wie in diesen Nächten. Ich schloss die Augen und sah sie in mir. Die schönste Frau der Welt. Und ich lernte ihr Gesicht immer besser kennen, lernte ihren Blick immer besser kennen, mit dem sie mich ansah und anstrahlte. Stundenlang verharrten wir so und sahen einander an. Manchmal schloss ich des Nachts die Augen, um sie zu sehen. Dann war da ein Licht, das allmählich durch meine Lider drang. Ich schlug die Augen auf, und es war bereits Tag. In diesen Stunden lernten wir einander kennen. Ich sah eine Frau, die mich ansah: Ihr aufmerksamer Blick verfolgte jedes Aufstrahlen, mit dem meine nach innen gerichteten Augen ihr sagten, wie sehr ihre Schönheit mich zu ihr hinzog. Ohne miteinander zu sprechen, entstanden in diesen Stunden in uns Gewissheiten. Auch heute noch kann ich das nicht erklären. Schönheit und Liebe sind verbotene Geheimnisse. In diesen Stunden waren Schönheit und Liebe etwas Einfaches. In unseren Blicken taten sich Wege zu Schönheit und Liebe auf. Ich sah sie im selben Augenblick an, in dem sie mich ansah. Dies war das Geheimnis, das Wunder, die einfachen verschlungenen Wege, die wir gingen, um einander kennenzulernen und stille Worte auszusprechen: große, tiefe Worte, Abgründe, Worte des Blutes und die nun - ich ein junger Mann, sie eine junge Frau - Worten sanfter Sonne glichen, und milder Sonne, und zarter Sonne. Heute weiß ich, dass ich damals liebte und geliebt wurde. Die Schönheit der Frau aus Licht, die in mir war, wurde damals mit diesem Gefühl eins. Diesem Gefühl. Diesem Gefühl der Begeisterung, das jeden Moment meines Lebens beherrschte, dem Fieber, aus dem ich nicht erwachte, selbst wenn ich es gewollt hätte, diesem Gefühl, das ein Wort war: Liebe: ein ungewöhnliches, da bedeutendes Wort, ein in meinen Augen bedeutendes Wort, auch wenn ich doch wusste, dass es ein Wort war, das ich seit meinem siebzehnten Lebensjahr ins Banale gezogen hatte. Dieses Gefühl, das ein Wort war; und ich fragte mich, wie viele Menschen es wohl ins Banale gezogen haben mögen. Ich fühlte, dass ich dieses Gefühl in seiner Gänze empfand. Ich liebte und wurde geliebt. In diesen Nächten schrieb ich. Und die Worte, der Text vor mir, gaben ihr ein Leben außerhalb von mir. Nachdem meine Mutter alle Oliven gegessen hatte, nachdem sie sich schwerfällig erhoben hatte und zu Bett gegangen war, nachdem die Sklavin Miriam das Gefäß mit den Kernen in das andere, bereits leere, gestellt hatte und ebenfalls zu Bett gegangen war, schrieb ich. Ich lehnte mich im Sessel zurück. Wenn ich beim Schreiben innehielt, legte ich den rechten Arm neben die beschriebenen Blätter und sah ihn zittern. Es machte mir schon nichts mehr aus. Die Gewissheit unserer Liebe war beruhigend. Beim Schreiben berührte sich irgendetwas von uns. Beim Schreiben fühlte ich sie durch mich gleiten, fühlte ich sie mich durchgleiten. Dann schloss ich die Augen und sah sie lächeln. Denn selbst wenn in mir, gab es doch auch auf dem Blatt Papier, im Text, ein wenig von ihrem Engelsgesicht, von der Weite ihres Blicks und ihren weichen Bewegungen. Manchmal stand ich auf, nahm die Blätter, die in meiner Hand zitterten und las langsam, was ich geschrieben hatte. Nach jedem einzelnen Satz hielt ich inne und hörte ihn in meiner Erinnerung gelesen. Sie war der Text. Sie war jedes Wort, jedes einzelne Wort bezeichnete ihre Gesten und all das, was an ihr schön war. Sie war der Sinn der Worte. Sie war weder Körper noch Geist. Sie war der Sinn der Worte. Nicht Erde, nicht Himmel und auch nicht Nacht oder Sterne. Ihr Sein war viel mehr, als wir zu berühren oder zu verstehen vermögen. Es war sie, die existierte, da von mir gefühlt. Sie existierte in mir und im Text für all jene, die ihn lesen würden. Sie existierte, weil es sie gab, weil es sie gab, um gefühlt zu werden. Die Nächte verstrichen, und wir lernten einander kennen. Da sie in mir war und auch im von meiner Hand geschriebenen Text, dachte ich schon, sie wäre ein Teil von mir. Ich täuschte mich. Sie war mehr als ich. Sie existierte in mir weit über mich hinaus. Sie war schön. Ich dachte, nun würde ich die Bedeutung der Liebe kennen.
Die Liebe ist das Blut der Sonne in der Sonne. Die tausendfach wiederkehrende Unschuld im ernsthaften Verlangen zu wünschen, der Himmel möge verstehen. Leichte und linde Stürme erheben sich im sanften Atem der Liebe. Wie eine Pflanze, die durch die Erde bricht. Die Liebe ist das Sonnenlicht, das die süße Stimme dieser Pflanze trinkt. Etwas, tief im Tiefen. Die Liebe ist der Sinn aller unmöglichen Worte. Die Liebe ist, das Innere eines Gebirges zu durchqueren, die Urstunden der Welt zu durchlaufen. Die Liebe ist der frischeFrieden und Nahrung eines Feuers tief, tief, tief, tief, tief im Inneren der Tage. Der Morgenhimmel, der wie ein Fluss dahingleitet. Die Nachmittagssonne als Gewissheit. Die Liebe entspringt der Fülle des Lichts und der Urkraft von Felsen. Die Liebe entspringt dem Meer, den Wellen in der Weite des Ozeans und dem ewigen Sand. Die Liebe entspringt so vielen gegensätzlichen und wahren Dingen. Es entstehen Orte für die Liebe, und in diesen himmlischen Gärtenbedeutet eine Brise, die sanft auf das Gesicht fällt, die Rettung.
Ich dachte wirklich, die Liebe wäre das Blut der Sonne in der Sonne. Die tausendfach wiederkehrende Unschuld im ernsthaften Verlangen zu wünschen, der Himmel möge verstehen. Ich dachte, im sanften Atem der Liebe würden sich leichte und linde Stürme erheben. Wie eine Pflanze, die durch die Erde bricht. Etwas, tief im Tiefen. Ich dachte, die Liebe wäre der Sinn aller unmöglichen Worte. Ich dachte, die Liebe wäre, das Innere eines Gebirges zu durchqueren, die Urstunden der Welt zu durchlaufen. Ich dachte, die Liebe wäre der frische Frieden und Nahrung des Feuers tief, tief, tief, tief, tief im Inneren derTage. Der Morgenhimmel, der wie ein Fluss dahingleitet. Die Nachmittagssonne als Gewissheit. Ich dachte, die Liebe entspränge der Fülle des Lichts und der Urkraft von Felsen. Ich dachte, die Liebe entspränge dem Meer, den Wellen in der Weite des Ozeans und dem ewigen Sand. Ich dachte, die Liebe entspränge so vielen gegensätzlichen und wahren Dingen. Ich dachte, es würden Orte für die Liebe entstehen, und in diesen himmlischen Gärtenbedeute eine Brise,die sanft auf das Gesicht fällt, die Rettung.
Am Morgen legte ich mich hin. Am späten Nachmittag wachte ich auf. Ich setzte mich in den Schaukelstuhl und rauchte auf nüchternen Magen eine Zigarette, starrte auf die Berge dort in der Ferne. Ihr Korpus aus Bäumen und Erde war mir seit meiner Kindheit ein Schrecken. Jahre hindurch sah ich mich, wenn ich auf die Berge blickte, als kleinen Stein, als winzigen Stein, von Dunkel umhüllt, erstickt, sah mich als kleines Erdkorn im dunklen Inneren von etwas Riesigem, das ich mir dort im unendlichen Dunkel nicht vorstellen konnte. Und ich dachte an das Dunkel, jahrelang, jahrzehntelang leblos umgeben von Toten, tot zwischen Millionen von Toten im Dunkel. Ohne dass ich es bemerkt hätte, verflüchtigte sich dieser Schrecken in jenen Tagen, in denen ich die Liebe kennenlernte und in sie eingewiegt war. Und dort in der Ferne waren die Berge eine Stille, immens und sattgrün. Die Berge waren die Weite und der unendliche Himmel, der sie umgab. Ich rauchte auf nüchternen Magen, bis mein Arm zitterte. Ich lächelte. In einem Licht, das die Welt durchsichtig machte, zitterte meinArm, und ich spürte mich lächeln, da sie in mir es war, die meinen Arm zum Zittern brachte. Und da saß sie, von einer Dunkelheit umgeben, die mir wohlig erschien. Ihr blasses Gesicht wandte sich mir zu. Ihre Knie, die unter dem Kleid hervorsahen, waren ein Morgen aus Licht. Ihre Hände auf dem Schoß waren die wunderbare Ruhe von Schönem und Reinem. Ich sah sie lächelnd an, und auch sie lächelte. Sie lächelte immerzu. Legte sich über alles die Nacht, stand ich auf und verschwand im langen Korridor des Hauses. Vielleicht ging ich an meiner Mutter vorüber, die telefonierte, vielleicht an der Sklavin Miriam, die irgendetwas erledigte oder mit bis zum Ende des Besens gesenktem Blick fegte, vielleicht ging ich an meiner Mutter vorüber, die starr dasaß und irgendetwas vergaß, ging vielleicht an einer Erinnerung an die Sklavin Madalena, die sich einst um alles kümmerte, vorüber, vielleicht an der Sklavin Miriam, die meiner Mutter mit einem Fächer oder einem Glas Wasser folgte, ging vielleicht an der Sklavin Miriam oder an meiner Mutter vorüber, und ich betrat das Wohnzimmer, setzte mich von leidenschaftlicher Liebe entflammt an den Schreibtisch, um an Wörter und Sätze zu denken.
Der Oktober brachte pausenlosen Regen, brachte einen Wind, der die Welt blank putzte. In der ersten Wochedrang der Geruch von feuchter Erde und Gras ins Haus und erfüllte es mit Oktober. Gleichgültig gegenüber allem mein Lächeln. Meine Freude. Lächelnd wachte ich auf, behielt das Lächeln allerorten und schlief lächelnd ein. Und sie lächelte mich an, mit einem Strahlen und mit Liebe, die ich in ihren ebenfalls lächelnden Augen las. Ihre Lippen ein innerer Wunsch nach Glück. Ihr Blick ein innerer Wunsch nach Glück und ein Lächeln. Dieses fortwährende Lächeln übertrug sich. Ich glaube, ich sah meine Mutter mehr als sonst lächeln, alle Menschen lächelten, wenn sie mit mir sprachen, und ich glaube sogar, dass die Sklavin Miriam beinahe lächelte. Dies geschah eines Tages, nachdem ich ein Bad genommen hatte. Die Sklavin Miriam kam mit Kleidung über einem Arm, und mit dem anderen streckte sie mir ein altes und abgenutztes Handtuch entgegen. Ich stieg aus der Badewanne, und als ich sie nackt und lächerlich ansah, kam mir vor, auf ihrem Gesicht den Ansatz eines scheuen Lächelns zu sehen. Die Sklavin Miriam hat seit dem Tod ihrer Mutter nicht mehr gelächelt. Als mein Vater krank im Bett lag, umgeben von meiner Mutter, die ihm die Hand hielt, von der Sklavin Madalena, die in einiger Entfernung stand, von der Sklavin Miriam und mir, wies er die Sklavin Madalena an, von der Wand der Waffenkammer das Beil zu holen. Auf dem Gesicht meiner Mutter lag unendliche Traurigkeit, lag ein ganzes Leben voll in Demütigung geendeter Hoffnung. Meine Mutter hatte sich aufgegeben. Tieftraurig, in ihrem Inneren weinend, aus ihrem Inneren große Bitterkeit hinausschreiend, mit einem Meer von Erbitterung in ihrem Inneren, Schmerz. Meine Mutter ging aus dem Raum, mit ihr auch ihr Leid, ihr ganzes Leben. Die Sklavin Miriam und ich blieben allein und schweigend an der Seite meines kranken Vaters. Die Sklavin Madalena trat ein, sie hielt mit beiden Händen das Beil und legte es meinem Vater auf den Schoß. Mein Vater, blass und mager, nahm das Beil und sagte komm näher. Die Sklavin Madalena näherte sich ihm mit gesenktem Kopf, die Arme dicht am Körper. Starr rissen die Sklavin Miriam und ich die Augen auf. Mein Vater nahm seine letzten Kräfte zusammen, hob das Beil und ließ es auf die Brust der Sklavin Madalena sausen. Die offenen Augen an die Decke geheftet, fiel sie rücklings auf das Bett. Niemand schrie. Zu hören war nur das Geräusch des Beils auf dem Fleisch, das Geräusch von brechenden Rippen. Niemand schrie. Die Klinge des Beils löste sich vom Fleisch und vom Blut, als es aus der Brust glitt. Kühles und frisches Blut auf der Haut, das tiefrot in die weißen Laken sickerte. Und als die Sklavin Madalena auf das Bett fiel, betrachtete mein Vater den Körper und das Blut, betrachtete sie, hob das Beil und hieb es ihr ins Gesicht. Die Klinge grub sich seitlich der Nase zwischen die Lippen und Augen. Mit Augen wie zwei tiefe Brunnen voll klarem Wasser verlor mein Vater die Kraft und fiel tot über den Leib und das Blut der Sklavin Madalena. An diesem Tag dachte ich mit einer vagen Vorstellung vom Leben, gelernt zu haben, was echte Liebe war.
Die Nacht, die Zeit, in der meine rechte Hand zitterte und in der ich schrieb, war der Weg, der die Tage lenkte. Sie in mir verbrachte die Zeit in süßer Schläfrigkeit, nachdem sie geschrieben worden war, nachdem ich sie geschrieben hatte, nachdem wir in den Worten eins geworden waren. Und sie betrachtete mich. Sah mich lange an. Die Zeit verfloss beinahe unmerklich. Ich hatte meinem Verleger versprochen, ihn zu besuchen, und mit einer Woche Verspätung tat ich es nun. Ich musste früh aufstehen, um mein Versprechen zu erfüllen. Mit trüben Augen, mit vom Schlaf noch schwerem Kopf entfernte ich die Efeuzweige vom Garagentor. Unser Haus war vollkommen von Efeu überwuchert. Einmal im Monat holte die Sklavin Miriam die Leiter und entfernte die jungen, üppigen Triebe und kleinen Blätter von den Fenstern und dem Familienwappen. Im Frühling bauten Vögel Nester in den Efeuzweigen zwischen den Blättern. Auch dann holte die Sklavin Miriam die Leiter, und mit einem Stock stieß sie die Nester zu Boden. Die eben geschlüpften Vögelchen piepten dort verlassen in ihren nackten und hässlichen Körpern, in ihrer dunklen Haut und in ihren großen Köpfen, sie piepten, bis ihre Stimme ermattete, bis sie starben und ihre Haut sich mit der Erde vermengte und sie verwesten, nur noch ihre winzigen Gerippe vom Regen gewaschen wurden. Unser Haus war zur Gänze von Efeu überwuchert. Von den Bergen aus nahm sich unser Haus als kleiner grüner Hügel mit Fenstern, einer Veranda und einem steinernen Familienwappen aus. Ich hatte jede Nacht mit Schreiben zugebracht, und auf dem Beifahrersitz lagen bereits dreißig beschriebene Blätter. Als ich sie schrieb, fühlte ich Wort für Wort, nahezu Buchstaben für Buchstaben. Es waren die wichtigsten dreißig Seiten meines Lebens. Beim Schreiben war ich lebendig. Es waren dreißig Seiten, die meine ganze Liebe und Hoffnung darstellten. Wenn ich am Schreibtisch saß, der die Jahre verstreichen sah, betrachteten wir einander häufig: sie in mir und mein Blick in mich, an ihre Seite. Mein Arm zitterte, und mit dem Stift schrieb ich auf weiße Blätter all die Worte nieder, die sie waren. Sie fühlte jedes Wort sie berühren. Langsam schloss sie die Augen. Und die Zeit, in der sie die Lider geschlossen hielt, hieß, mich zu berühren, die Sonne zu berühren, all ihr Licht in der Haut zu absorbieren. Ich, der ich dieses Leben in mir, das mein ganzes Leben war, nicht in meinen Armen halten konnte, der ihr nicht die Hand reichen konnte, der nicht einmal die Finger langsam über ihr Gesicht gleiten lassen konnte, tat dies alles schreibend. In den geschriebenen Worten berührten wir einander tatsächlich. Wie zwei Menschen aufder Erde. In den Worten gab es unsere zärtlichen Blicke. In jedem einzelnen dieser Worte gab es tausend Worte, und jedes dieser tausend Worte enthielt wiederum tausend andere Worte. Und selbst diese in anderen Worten enthaltenen Worte waren gigantisch, denn auch sie enthielten wieder tausend Worte, die weitere tausend Worte enthielten. In den geschriebenen Worten waren wir möglich. Unsere Liebe. Alles. Die Welt. Deshalb waren jene dreißig Seiten die wichtigsten meines Lebens. Ich lenkte das Auto auf der kleinen Schotterstraße zur Autobahn und wusste, dass ich sie liebte. Die Bäume neigten sich ein wenig tiefer, als ich an ihnen vorüberfuhr, und warfen vor mir gelbe Blätter ab, als würden sie Tränen fallen lassen.
Als die Wache das Tor öffnete, warteten schon viele Menschen. Wir traten in einer Schlange ein. Der Wachmann überprüfte die Namen der Häftlinge, die Besuch bekamen. In welchem Pavillon befindet sich der Häftling? Wir traten ein. Dann schrieben wir auf einem Stück Papier alles auf, was wir mitgebracht hatten. Wie viele Päckchen Zigaretten? Der Wachmann schöpfte bei meinen dreißig Seiten Verdacht und unterzog sie einer Überprüfung. Dann leerten wir die Taschen aus und legten den Inhalt auf den Tresen, zogen die Schuhe aus, nahmen den Gürtel ab und gingen durch die Sicherheitsschleuse. Es piepte. Die Ringe ablegen, Armbänder und Ketten! Noch einmal durchgehen! Es piepte. Abermals durchgehen! Es piepte. Piepte. Irritiert von uns oder dem Gerät durchsuchte uns der Wachhabende. Sie können weitergehen! Im Besuchsraum die blaue Anstaltskleidung meines Verlegers. Ich setzte mich, und er sagte nicht einmal hallo, fragte auch nicht wie geht es dir? Er blickte auf die dreißig Seiten in meiner Hand, als würde er danach verlangen. Ich streckte sie ihm entgegen. Hastig griff er danach, riss die Augen weit auf und versenkte sie in den Blättern. Ohne sich um die Kinder zu kümmern, die ihn umringten und im Chor Schlappschwanz,Schlappschwanz schrien, las er. Las, als ob er allein auf der Welt wäre. Ich sah ihn voller Unbehagen an. Und zum ersten Mal war die schlichte Freude meiner Liebe getrübt. Ich sah ihn lesen, als würde er etwas in sich hineinschlingen, als würde er sie, die mir gehörte, verschlingen, als würde er sie, die rein war und die ich in reiner Liebe anbetete, verschlingen. Ich sah ihn lesen, als würde er sie berühren oder zu berühren wünschen, was für mich dasselbe Vergehen war. Widerlich. Mit beiden Händen hielt er die Seiten, als würde er ihre nackte Taille umfassen. Seine aufgerissenen Augen prüften jede Einzelheit ihres Körpers und sahen nur Haut und Geschlecht, wo ich Liebe sah, Liebe, Zärtlichkeit, Reinheit. Dann und wann streckte er die Zunge heraus, um sich die Lippen zu lecken, das war noch widerlicher. Ich ertrug es nicht mehr, spürte ein Feuer, das mich verbrannte. Ich versuchte die Augen zu schließen, um sie in mir zu sehen, und es gelang mir nicht. Ich versuchte krampfhaft die Lider zuzukneifen, gab mir alle erdenkliche Mühe, konnte jedoch die Augen nicht schließen. Nur die Gier in seinen Augen konnte ich sehen, vermochte nur die große Stille meines langsamen Todes zu sehen, meine unendliche Qual, die Flammen, die mich mit glühenden Klingen zerreißen würden. Und als er mir schließlich befriedigt die Blätter entgegenstreckte und mir einen Blick gestillten Vergnügens zuwarf, stand ich auf und ging. Ich weiß, dass mein Verleger mir sprachlos hinterherblickte. Ich durchbrach den Ring, den die Kinder um uns gebildet hatten und hörte sie hinter meinem Rücken in immer weiterer Ferne Schlappschwanz,Schlappschwanz schreien.
Dann kam der Monat der Nacht. Während des ganzen Monats wurde es nicht Tag. Die Uhren, die von der Wirklichkeit nichts wussten, zeigten weiterhin die Stunden an, aber es war immer Nacht. Das elektrische Licht hatte nicht genug Kraft, das Dunkel des Monats der Nacht zu erhellen. Schaltete man eine Lampe ein, war ihr schwaches Licht nicht einmal wahrzunehmen. Manchmal ging ich auf die Veranda hinaus. Ich blickte in den dunklen Himmel, dorthin, wo ich mir Wolken vorstellte, die langsam an der Stelle vorüberzogen, an der ich mir den verschwommenen Mond dachte, die Sterne, auf ihren Plätzen erloschen. Ich sah absolute Finsternis, die Straßen leer, Angst vor den nächtlichen Geräuschen. Ich hörte den Regen. Spürte den Regen auf meiner Haut, wie feine Stiche erdachten Lichtes. In mir war ihr Gesicht eine erboste Stimme: ihre Augenbrauen gerunzelt und verärgert, ihre Blicke voller Anklage und Ärger: gleich einer ärgerlichen Stimme im Streit mit mir, da ich nicht an sie glaubte. Ich glaubte an sie, aber ich konnte nicht vergessen, was ich vor meinen Augen hatte, als mein Verleger sie las, konnte nicht vergessen, was für mich schrecklich war. Wir kannten einander gut genug, um uns übereinander zu ärgern. Wir dachten, wir würden einander kennen. Mich selbst kannte ich nicht, aber sie dachte ich zu kennen. Wir gehörten einander genug, um uns übereinander zu ärgern. Um mich herum der Monat der Nacht. Meine Mutter verbrachte die Zeit damit, zu schlafen, wo auch immer sie sich befand. Wo auch immer die Sklavin Miriam auftauchte, funkelten ihre Augen selbst in den dunkelsten Ecken des Hauses. Meine rechte Hand zitterte den ganzen Monat der Nacht hindurch. Und ich konnte nicht schreiben. Ich schrieb wenig. Wenn ich die Augen schloss, um sie in mir zu betrachten, konnte ich in ihrem verärgerten Gesicht nur ihre betrübte Schönheit sehen. Ich sah nur ihren schönen und traurigen Blick, da sie mir in mir geraubt worden war. Ihre Haut, ihre Schultern, ihr Haar wirr, da die Unschuld verloren, ein einziges trauriges Bild. Und ich konnte nicht schreiben. Ich schrieb wenig. Meine rechte Hand zitterte den ganzen Monat der Nacht hindurch, und daher nichts als Leid, nichts als Herzensangst. Und ich konnte nicht schreiben. Ich schrieb wenig. Ich grübelte viel. Und ich schrieb ein Wort und einen Schlusspunkt: Wort. Stundenlang zwang ich mich, ein Wort zu schreiben, und dann wiederholte ich es stundenlang, verzaubert von seiner Traurigkeit, denn alle Worte waren trist. Wenn ich aufwachte, öffnete ich sogleich das Fenster meines Zimmers, zündete mir eine Zigarette an, stützte meine rechte Hand auf dem Sims auf und dachte immerzu an sie und an meinen Verleger und an mich. Manchmal hörte ich in der Ferne einen Nachtvogel singen oder einen Hund heulen. Wie weit auch immer entfernt, schien es mir stets ganz nah in diesem Dunkel ohne Distanz.
Eifersucht bedeutet Hass und Angst. Es bedeutet, ein Gesicht lächeln zu sehen, und dieses lächelnde Gesicht und diesen Kopf mit einem Stein zermalmen zu wollen, diesen Kopf auf den Boden drücken und einen schweren Stein darauf donnern lassen zu wollen, einen Stein diesen Kopf zermalmen sehen zu wollen, einen Stein hinunterdonnern lassen und ihn das Gehirn zerschmettern, die Zähne und all das Lächeln zerschlagen, die Augen wie Eidotter bersten und all das sich über den Boden ergießen sehen zu wollen, was sich in diesem Kopf befindet: Blut, zerquetschtes Hirn, Fragmente von Knochen und Knorpeln. Es bedeutet, den vom Kopf getrennten Hals mit zerrissenen Adern, aus denen Blut fließt, sehen zu wollen und dabei zu lächeln. Irgendwohin fliehen zu wollen, wo all das nicht existiert. Es bedeutet, nur die Stille der Stimmen wahrzunehmen und zutiefst zu erschrecken. Es bedeutet, in all den Nächten in dieser großen, einzigen Nacht des Monats der Nacht über die Maßen zu zittern.
Wenn ich nicht gerade schrieb, wanderte ich durch das Haus, als ginge ich irgendwohin, als würde ich fliehen. Als hätte ich ein Ziel, als würde ich irgendetwas zu tun haben, ging ich durch das Haus, da ich nicht stillhalten konnte, da ich von dem Ort, an dem ich mich eben befand, zu einem anderen gehen musste, den ich wiederum verlassen musste, um zu einem anderen Ort zu gehen, den ich ebenso verlassen musste. Sie folgte mir in mir. Zwischen Katzenleibern wanderte ich durch den Korridor. Betrat das Wohnzimmer. Setzte mich. Sie sah mich an, klagte mich an oder bat mich, ihr zu glauben. Und ich stand auf. Wanderte durch den Korridor. Betrat das Speisezimmer, ging um den Tisch herum. Betrat eines der Gästezimmer, roch die dumpfe Luft, legte mich auf das kühle Bett, hörte vielleicht den Regen da draußen. Sie in mir stand da und teilte mir mit großen Augen mit, dass ich keinen Grund zu leiden hätte. Und ich stand auf. Wanderte durch den Korridor: Und mit mir wanderte der Klang der Schritte einer Heerschar von Katzen. Ich betrat die Küche, trat in die Speisekammer. Sie in mir folgte mir. Ich ging in den Salon, setzte mich auf einen der mit Seide bezogenen Stühle. Sie. Die Männer auf ihren endlosen Jagdzügen auf den Bildern an der Wandblickten mich durch das Dunkel an, bewaffnet mit einem Speer, der innehielt und auf ein Wildschwein zielte. Sie. Die Engel auf dem Deckengemälde reckten die Köpfe hinter den Wolken hervor, um mich zu sehen. Sie. Ich wanderte durch den Korridor. Betrat das Badezimmer. Ließ Wasser ins Becken laufen, in meiner Erinnerung weiße und dicke Keramik, tauchte meine Hände ein, tauchte die Arme bis zu den Ellenbogen ein, trocknete mich mit dem vom vielen Gebrauch weichen Handtuch ab. Sie bat mich mit einem Blick, ihr zu glauben. Ich ging in den unteren Stock. Sie folgte mir in mir. Ich betrat die Bibliothek, zog blind ein Buch aus dem Regal, schlug es auf und wieder zu. Sie betrachtete mich. Ich betrat die Waffenkammer und verließ sie wieder mit der Kälte von Metall unter der Haut und darin eingehüllt. Sie betrachtete mich. Ich setzte mich ans erloschene Kaminfeuer im unteren Wohnzimmer. Ihr Blick nahm mir den Atem. Efeublätter peitschten an die Fensterscheiben. Zwischen den Ästen und Blättern die Schwärze der Nacht und des Regens. Als ich da saß, drückte mich das Gewicht der Wände nieder, das Gewicht des Hauses. Dieses Hauses, das älter als sämtliche lebenden Personen war. Dieses Hauses, das in seiner Gewichtigkeit die gesamte Zeit der Verstorbenen und der Generationen bewahrte. Dieses Hauses, das immer noch älter wurde: Porzellan, das in den Wandborden Sprünge aufwies, die alten Porträts an den Wänden des Korridors, deren Gesichter fremd waren, die abgenutzten Teppiche, die Gegenstände, die im Laufe der vielen Jahre langsam entzweigegangen waren. Ich stand auf und ging die Treppe hinauf. Wanderte durch den Korridor, und die Katzen wichen mir aus. Ich betrat mein Zimmer. Sie folgte mir in mir. Sie fand mich überall. Als ich mich mit geschlossenen Augen auf das Bett legte, um sie zu sehen, brauchte ich sehr lange, bis ich einschlief.
Im Monat der Nacht ohne Gefühl für die Zeit waren alle Stunden gleich. Eingeschlossen verfinsterten mich Hass und Schmerz noch mehr. Die Stille ein Messer, wenn mein Verleger in meinen Gedanken war. Das Gesicht meines Verlegers, seine Hände, seine Lippen: ein Messer. Im Monat der Nacht mein zerrissenes Dunkel. Und sie mit ihrem weißen Kleid, ihrem Körper, der einst rein und lauter, in meinen Augen nun seine Unschuld verloren hat. Hass und Schmerz: All das, was im Spiegel nicht zu sehen und nun ein Teil von mir war. Mein Gesicht, das brannte. Ein Messer, das mir die glühende Haut zerfetzte. Und die den Atem nehmende Dunkelheit, schwarz, nachtschwarz, schwärzer als schwarz, absolut schwarz. Lastende Dunkelheit. Ein Haus der Schatten. Und meine rechte Hand, die die Welt zum Zittern brachte, Unbehagen, das von allen Gegenständen ausging und sich in Bange und Beklemmung niederschlug. Ihr Blick verärgert, traurig, und sie entfernte sich in mir von mir, wurde immer kleiner, in der Ferne immer zarter und verschwand langsam im Dunkel, das sie umgab. Ich, meine zitternde Hand, ich, die in allen Minuten endlose Nacht, ich, das Feuer, ich, die Klinge eines Messers, das Blut in meine Haut zeichnete, ich, der Monat der Nacht und all das, was mich vergebens zu töten versuchte.
Im Monat der Nacht ohne Gefühl für die Zeit klingelte das Telefon zu jeder beliebigen Stunde. In den nächtlichen Tagen, an denen es ohne Unterlass regnete, Regen und wieder Regen im Dunkel, Regen, der die Dunkelheit der Welt da draußen zeigte, war es fast immer die Schlossherrin von Siliae, die uns anrief. Häufig klingelte das Telefon, wenn meine Mutter schlief, und die Schlossherrin von Siliae fragte verwundert sie schläft schon? und gähnte. Im Monat der Nacht ohne Gefühl für die Zeit war es für meine Mutter, wenn sie nach dem Mittagessen telefonierte, Nachmittag, während es für die Schlossherrin von Siliae Morgengrauen war. Ohne Gefühl für die Zeit klingelte das Telefon zu jeder beliebigen Stunde. Es klang in uns wie ein Alarm, wie ein Schrei im immensen Dunkel des Hauses. Als zu jener Stunde der Nacht das Telefon klingelte, hörte ich die Schritte meiner Mutter auf dem Holzboden, die unsicheren Schritte meiner unförmigen Mutter, hörte danach die leichten Schritte der Sklavin Miriam immer näher kommen, hörte ihre kleinen Hände an die Tür meines Zimmers pochen, hörte ihre leise Stimme mich rufen. Der Korridor und die Katzen. Ich nahm den Hörer, am Apparat war ein Dichter. Er sagte mir, ich solle schnell zum Gefängnis fahren, denn mein Verleger, denn mein Verleger … Nachtschwarzer nächtlicher Vorhang. Ich dachte bei jedem Wort an meinen Hass, ging aber in mein Zimmer, um die Jacke überzuziehen, in deren Tasche sich der Autoschlüssel befand. In mir kam sie verärgert näher. Aber, es tat mir später leid, meine Eifersucht war stärker als ihr Blick. Die Scheinwerfer machten den Weg auf der Straße frei. Es gab keine anderen Autos. Niemand ging außer Haus. Der Regen hatte aufgehört. Durch das Fenster drang der Geruch nach feuchter Erde, der Geruch von keimendem Leben in der Erde, durchtränkt von Unkraut, das da vielleicht grün im Dunkel gedieh. Quer über die Straße lagen abgebrochene Äste, ganze Baumstämme versperrten den Weg, es gab Steine und Schlamm, tote Tiere: ertrunkene Hunde, Ziegen und Schafe, Kühe im Todesschlaf. Die Autobahn leer. Die Stadt leer. Selbst auf den turbulentestenStraßen niemand. Kein einziges Auto vor Ampeln bei Rot. Ich fuhr in der Dunkelheit durch die ganze Stadt. Der Fluss war ein schwarzer und riesiger Ort. Die Häuser formten Hügel. In diesem Dunkelwusste ich, dass die Hügel der Stadt aus Dächern und Fenstern bestanden.
Als ich beim Gefängnis ankam - als wäre es in einer anderen Stadt, als wäre es in einem anderen Land - war dort eine kleine Menschenmenge, waren dort hinter Sandsäcken verbarrikadierte Wachen mit auf das Gefängnisdach gerichteten Pfeilen und viele Menschen, die hinstarrten. Ich stieg aus dem Auto und konnte nicht fassen, was ich beim Näherkommen sah. Sämtliche Häftlinge befanden sich auf dem Gefängnisdach, unter ihnen, wie ein Anführer, mein Verleger. In ihren Händen hielten sie Eisenstangen, Teile von Betten, Ketten. Auf einen Schrei meines Verlegers hoben sämtliche Häftlinge die Eisen und schrien ebenfalls. Hinter ihren Schreien stiegen von brennenden Matratzen hohe Flammen auf, die ihre Schatten zeichneten. Die Flammen dort oben auf dem Gefängnis waren ein Punkt von Licht und Hass in der schwarzen Unermesslichkeit der Welt. Ein vom gänzlich schwarzen Himmel und von der gänzlich schwarzen Erde umgebener Lichtpunkt. Mein Verleger stieß einen Schrei aus, und sogleich schrien alle Häftlinge auf dem Gefängnisdach mit. Endlich wurde mein Verleger geachtet. Die Flammen trachteten, in den Nachthimmel aufzusteigen. Unter den vollkommen stillen Wachmännern, die jede Bewegung beobachteten, gab es einen, der sich erhob und mit seiner Lanze drei Schritte nach hinten tat. Plötzlich setzte er einen Fuß vor den anderen, neigte seinen Körper nach vorne, holte aus und warf die Lanze. Zeit undRaum sind das Maß für Entfernung. Eine Minute kann einen oder tausend Meter heißen, und ein Meter kann eine Sekunde oder Stunden oder Kilometer bedeuten. Gerät die Entfernung aus dem Lot, verwandeln Zeit und Raum sich ineinander. Zeit, Raum, Entfernungsind die Figuren innerhalb von Zeit, Raum und Entfernung. Deshalb löste sich die Lanze aus der Hand des Wachmanns in einem Augenblick, der tausend Augenblicke oder eine Stunde oder ein ganzes Lebensjahr dauerte. Deshalb blieb die Lanze allein in der Luft, stand still für Sekunden, die weiter vergingen. Deshalb so viele Nächte in dieser in die Luft und auf die Augen meines Verlegers gezielten Lanze. Die Männer auf dem Gefängnisdach mit Wut im Gesicht. Die Flammen der Matratzen wie glühende Schilde. Diese einzelne Lanze, die langsam entschwand. Fest der Schaft aus dickem Holz. Die Spitze aus schwarzem Eisen. Die Stimmen verstummten. Die Entfernung sehr groß: entfernte Zeit, entfernter Raum. Und die Lanze, die wie ein Nachtwesen weit ins Dunkel drang. Das schweißnasse Gesicht meines Verlegers. Und diese einzelne Lanze, die die Brust meines Verlegers erreichte. Die Spitze, die lautlos und langsam zur Gänze in ihn eindrang und aus dem Rücken wieder austrat. Getränkt in Blut, das von ihr tropfte.
Von der Lanze durchbohrt, tat mein Verleger zwei Schritte nach hinten und dann zwei vorwärts, ging erst zu Boden, als seine Beine die Kraft verließ. Er fiel auf die Knie, danach leblos nach vorne. Immer noch auf den Knien, der Körper vom Schaft der Lanze gehalten. Mit nach unten hängendem Kopf, mit baumelnden Armen. Und alle waren erstarrt: die Häftlinge mit den Eisen in den Händen, der Wachmann, der die Lanze geworfen hatte, die Wachleute, die ihren Kopf hinter den Sandsäcken hervorstreckten, die Menschenmenge. Und der erste Tag nach dem Monat der Nacht begann zu erwachen. Das Licht begann ruhig, stark und bestimmt aufzugehen. Der Körper meines Verlegers. Das Licht, das ihn beschien. Besiegt, traurig und ernst ließen die Häftlinge ihre Eisen fallen. Zwischen Aschehaufen kehrten sie in ihre Zellen zurück. Die Wachleute kamen hinter ihren Sandsäcken hervor und machten sich ohne Eile auf den Weg zum Gefängnis. Nach und nach entfernten sich still die Menschen und ließen mich allein dort stehen. Der Morgen erwachte immer mehr in allem. Hier und dort flogen kleine Vögel auf und erfüllten den Himmel. In der frischen Luft lag kristallener Glanz. Die erste Helle. Die Welt, die erwachte. Ich blieb. Mein Blick, der durch den Morgen glitt. Mein Blick auf der Gestalt meines Verlegers. Ich blieb. Bis zwei Wachmänner auf dem Gefängnisdach auftauchten. Bis sie ihn an den Armen und Beinen packten und wegtrugen. Mit der Lanze, die ihn durchbohrte.
Die Welt erwachte. Türen öffneten sich. Licht stieg zum Himmel auf und fiel in feinen Fäden zur Erde. Ich war glücklich, da mein Verleger gestorben war. Ich lächelte, da ich wusste, er würde sie nie wieder berühren können. Nie wieder würde er die Seiten lesen können, die sie beschrieben und die auch ihr Gesicht und ihre Haut waren. Aber meine Augen hatten sich noch nicht an die Helle des ersten Morgens nach dem Monat der Nacht gewöhnt, noch sahen meine Augen seine Gestalt, von der Helligkeit in Linien auf das Dach gezeichnet, und ich schämte mich bereits vor mir selbst, über seinen Tod froh zu sein. Ich dachte an meinen Verleger, wenn er samstags zur Besuchszeit in seiner blauen Anstaltskleidung auf mich wartete. Mein Verleger lächelte dann. Ich dachte an noch früher, wenn er lebhaft in der Küche auftauchte und die Sklavin Madalena anwies zu melden, ich hätte einen Preis gewonnen, in einem Land, in dem die Menschen viele Kilometer reisten, um meine Bücher zu kaufen. Mein Verleger lächelte dabei. Die Erinnerung war eine Zeit, in der die Morgen erwachten und alles gut endete. Ich schloss die Augen, um sie in mir zu sehen. Nach diesem Schrecken war sie traurig. In ihren großen Kinderaugen lag ein stiller See, auf der hellen und glatten Stirn stand eine kleine Falte, und ihre zarten Lippen zitterten ganz leicht. In mir sahen meine Augen sie ruhig an. Als würde ich ihr die Hand reichen, sprach ich zum ersten Mal mit ihr. Ich sagte zu ihr gehen wir nach Hause. Als würde sie mir die Hand reichen, waren ihre Augen noch bezaubernder, und ihre zarten und schönen Lippen glätteten sich in einem Lächeln.