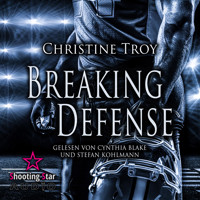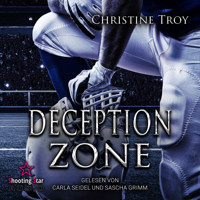3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
"Ich dachte, du wohnst lange genug in diesem Haus, um zu wissen, dass es mehr auf dieser Welt gibt als das Leben und den Tod." Ist dir je etwas so Unglaubliches passiert, dass du keinem davon erzählen konntest? Nein? Mir schon! Bis vor wenigen Tagen dachte ich, verwunschene Häuser und Geister gäbe es nur in Filmen und Märchen. Inzwischen weiß ich es besser. Und noch etwas weiß ich: Geister können nicht nur schrecklich und gefährlich, sondern auch unfassbar attraktiv sein. Wie, du glaubst mir nicht? Dann überzeug dich selbst. Mein Name ist Katharina Geiger und dies ist meine Geschichte. Dies ist der 1. Band der "Das Haus in der Birngasse"-Dilogie. Eine Geschichte voller Herzklopfen, Mystery und Liebe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Table of Contents
Kurzbeschreibung
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Weitere Bücher von Christine Troy
Die Autorin
CHRISTINE TROY
Copyright ©2021 Christine Troy
Alle Rechte vorbehalten.
Eine Kopie oder anderweitige Verwendung ist nur mit schriftlicher Genehmigung von Seiten der Autorin gestattet. Personen und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Menschen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Korrektorat: SW Korrekturen
Covergestaltung: Michael Troy / MT-DESIGN
Verwendete Bilder (Cover): ©slava77777, www.123RF.com, ©kotangens, www.123RF.com, ©tomertu, www.123RF.com,
Verwendete Bilder (Kapitel): © kamphi, www.123RF.com, © slalomp, www.123RF.com, © andreypopov, www.123RF.com, © borzebra, www.123RF.com, © kannaa123rf, www.123RF.com, © arcady31, www.123RF.com, © vadimmmus, www.123RF.com, © alisared, www.123RF.com, © boombellman, www.123RF.com, © juliarstudio, www.123RF.com, © berkut2011, www.123RF.com, © iunewind, www.123RF.com, © pandavector, www.123RF.com, © martialred, www.123RF.com, © robuart, www.123RF.com, © theerakit, www.123RF.com,
Homepage: www.christinetroy.at
Facebook: www.facebook.com/ChristineTroyAutorin
Anmeldung zum Newsletter
Widmung
Für meinen Großvater Hermann. Danke für all die Dinge, die du mich gelehrt hast. Du bist und bleibst mein großes Vorbild.
Kurzbeschreibung
„Ich dachte, du wohnst lange genug in diesem Haus, um zu wissen, dass es mehr auf dieser Welt gibt als das Leben und den Tod.“
Ist dir je etwas so Unglaubliches passiert, dass du keinem davon erzählen konntest?
Nein? Mir schon!
Bis vor wenigen Tagen dachte ich, verwunschene Häuser und Geister gäbe es nur in Filmen und Märchen. Inzwischen weiß ich es besser. Und noch etwas weiß ich: Geister können nicht nur schrecklich und gefährlich, sondern auch unfassbar attraktiv sein.
Wie, du glaubst mir nicht? Dann überzeug dich selbst.
Mein Name ist Katharina Geiger und dies ist meine Geschichte.
Dies ist der 1. Band der „Das Haus in der Birngasse"-Dilogie. Eine Geschichte voller Herzklopfen, Mystery und Liebe!
Vorwort
Das Haus in der Birngasse existiert tatsächlich. Es ist das Geburtshaus meiner Großmutter und war viele, viele Jahr im Besitz unserer Familie, bis es vor einiger Zeit verkauft wurde. Die neuen Eigentümer waren so lieb, mich noch mal einen Blick in ihr Heim werfen zu lassen, damit ich meine Erinnerungen auffrischen konnte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Familie Sandulovic.
Bereits als Kind haben mich die schweren Mauern, der finstere Keller und der Brunnen im Schuppen fasziniert. Katharinas und Alexanders Geschichte spukte mir lange Zeit durch den Kopf, weshalb ich schließlich entschloss, sie aufs Papier zu bringen. Und ich kann dir sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt. Wie du vielleicht weißt, bin ich selbst in Dornbirn aufgewachsen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, über meine alte Heimat zu schreiben und meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Übrigens gibt es sämtliche im Buch erwähnten Geschäfte und Schauplätze wirklich. Die Silvretta Eisdiele zum Beispiel ist tatsächlich die älteste im ganzen Land. Solltest du sie je besuchen, empfehle ich dir die Sorte Heiße Liebe. Ich stehe auf dieses Eis und könnte mich darin baden!
So, nun will ich dich aber nicht länger aufhalten und wünsche dir viel Spaß in Dornbirn und spannende Stunden in der Birngasse 3.
Alles Liebe,
Deine Christine
Kapitel 1
Das Ticken des Blinkers, den meine Mutter setzt, erfüllt das Innere des Autos.
„Da wären wir“, verkündet sie und biegt in eine mit Löwenzahn und Unkraut überwucherte Einfahrt. Mein Blick springt auf das alte Haus, das wie ein gewaltiger, quadratischer Steinklotz vor uns aufragt.
Unser neues Zuhause. Großartig …
Während der Mantel aus Schwermut, der kalt und eng um meine Brust liegt, noch eine Spur drückender wird, stellt Mama den Motor ab. Die Hände am Lenkrad beugt sie sich vor und betrachtet mit einem strahlenden Lächeln den Altbau.
„Ist es nicht traumhaft?“ Ihre Stimme sprüht vor Begeisterung.
Traumhaft? Du meinst wohl eher albtraumhaft, würde ich am liebsten sagen, bleibe jedoch stumm. Das Ding ist steinalt und heruntergekommen. Nicht zu vergleichen mit unserer gemütlichen Dreizimmerwohnung in Frankenberg. Obwohl wir erst heute Morgen von dort aufgebrochen sind, überkommt mich bereits ein Anflug von Heimweh. Ich will nicht hier sein, will kein neues Zuhause und erst recht keinen Neuanfang! Dieser Break ist vielleicht das Richtige für meine Mutter, aber ganz bestimmt nicht für mich.
„Ich kann es kaum erwarten, mich umzusehen. Komm, Kathi!“ Mama löst ihren Gurt und schwingt sich zur Tür hinaus, während ich mit Tränen ringe. Ich schlucke den Kloß, der in meiner Kehle klemmt, hinunter und wische mir schniefend über die Nase. Ob es mir gefällt oder nicht, das hier wird unser neues Zuhause.
Es ist das Richtige für sie, rufe ich mir in Erinnerung. Sie hat es verdient, wieder glücklich zu sein.
Um eine fröhliche Miene bemüht lange ich nach dem Türgriff unseres VW Golf Rabbit und steige aus.
Kies knirscht unter meinen Füßen, als ich an die Seite meiner Mutter trete, um wie sie das Haus genauer zu betrachten. Es ist mehrstöckig und besitzt ein verhältnismäßig steiles Dach. Über den hohen, von Holzstäben unterteilten Kastenfenstern entdecke ich abgebröckelte Verzierungen im Mauerwerk. Mein Blick wandert die eierschalengelbe Fassade herab und bleibt auf der linken Seite am Hausnummernschild hängen. Birngasse 3 steht in alter schnörkeliger Schrift auf der von Rostblumen gesäumten Tafel. Neben dem Schild führt eine Steintreppe auf eine schmale, längliche Veranda. Mein Blick fällt auf die oberste Stufe der Treppe, auf der eine schwarze Katze sitzt. Sie beobachtet uns argwöhnisch aus ihren grünen Augen und erinnert ein wenig an Luzifer, den streitsüchtigen Kater meiner verstorbenen Großmutter.
„Oh, Besuch“, sagt Mama, als sie das Tier entdeckt. Sie macht einen Schritt auf die Katze zu. Die jedoch lässt ein Fauchen hören, stürmt wie ein ertappter Eindringling die Treppe herab und über die Einfahrt davon. Mama, die wie ich dem schwarzen Wollknäuel überrascht hinterhersieht, schmunzelt und meint: „Da hat wohl jemand einen schlechten Tag.“
„Sieht ganz danach aus“, gebe ich stirnrunzelnd zurück. Bleibt bloß zu hoffen, dass die Leute hier freundlicher sind als ihre Haustiere.
„Also, was sagst du?“ Mama hat sich wieder dem Haus zugewandt und die Arme ausgebreitet, als würde sie es am liebsten umarmen. Ihr Blick schweift über die einst weiß gestrichene Holzverkleidung der Veranda, deren Lack größtenteils abgeplatzt ist. Direkt darüber befinden sich zwei Balkone – der untere ist verglast, der obere offen. Beide sehen verfallen und einsturzgefährdet aus.
„Ist es nicht wunderschön?“, seufzt sie versonnen. „Es sieht aus wie eines dieser alten Stadthäuser aus dem neunzehnten Jahrhundert“, schwärmt sie, die Hände auf die Brust gedrückt.
Neunzehntes Jahrhundert? Ich ziehe eine Braue hoch und betrachte die alten Mauern. Wohl eher achtzehntes! Einfach alles an dem Kasten wirkt renovierungsbedürftig.
„Ich wollte immer schon in so einem Haus wohnen. Komm, lass uns reingehen.“ Damit hängt sie sich bei mir unter und zieht mich die Treppe hinauf. Die wuchtige Eingangstür, die am Ende der Veranda liegt, ist genauso in die Jahre gekommen wie der Rest des Hauses. Sie gibt ein müdes Ächzen von sich, als Mama sie aufschließt und wir eintreten.
Das Erste, was ich im Inneren wahrnehme, ist ein modriger, leicht erdiger Geruch. Das Zweite ist eine ungewöhnlich bedrückende Stimmung, die sich wie Grabeskälte in meine Knochen schleicht.
An der linken Seite des sich vor uns erstreckenden Eingangsbereichs befindet sich eine Treppe, die in die oberen Stockwerke führt. Sie ist ungewöhnlich breit – ich schätze sie auf über einen Meter fünfzig – und in der Mitte mit einem ausgeblichenen, rot-grün gesprenkelten Teppich überzogen.
„Und wo werden wir wohnen?“, erkundige ich mich und spähe hoch zum ersten Stock.
„Da drüben. Unser Reich liegt im Erdgeschoss.“ Mama steuert eine vergilbte Tür an, die zu unserer Rechten liegt. Während sie aufsperrt, schaue ich mich noch einmal um. Am hinteren Ende des länglichen Eingangsbereichs entdecke ich eine kurze, schmale Treppe. Sie führt hinab zu einer Tür, durch die man vermutlich in den Hinterhof gelangt. Daneben, direkt unter der schweren Treppe, über die man in die oberen Stockwerke kommt, sieht es so aus, als würde eine weitere in den Keller hinab führen. Dieser Bereich liegt im Halbdunkel und wird nur durch ein kleines Glasfenster in der Hintertür erhellt. Es hat etwas Gespenstisches, wie der dünne Lichtstrahl, einem langen Finger gleich, die Dunkelheit durchsticht und auf das Untergeschoss weist. Je länger ich zur Kellertreppe hinüberschaue, desto unwohler fühle ich mich. Gänsehaut kriecht über meinen Körper und lässt mich schaudern. Unbehaglich reibe ich mir über die Arme.
„Tritt ein, bring Glück herein“, zitiert Mama unseren alten Fußabtreter, öffnet die Wohnungstür und lässt mich ein. In der Diele, die ich betrete, herrscht eine deutlich angenehmere Atmosphäre als im Hausflur. Aus den fünf Türen, die in die angrenzenden Räume führen, fällt warmes Herbstlicht.
„Okay, also das hier dürfte das Badezimmer, das die Küche, das die beiden Schlafzimmer und hier drüben das Wohnzimmer sein“, erklärt Mama und zeigt im Uhrzeigersinn der Reihe nach auf die Räume. „Tatsächlich, hier ist das Wohnzimmer.“ Sie tritt durch die erste Tür auf der rechten Seite, während der Dielenboden unter ihren Füßen knarzt. Ich folge ihr und sehe mich um. An den Wänden hängen Blumentapeten, die ihre besten Tage lange hinter sich haben und sich in den Ecken lösen. Zu meiner Linken befindet sich ein hässlicher, moosgrüner Kachelofen, der in die Wand eingelassen wurde. Das Teil ist museumsreif. Die Decke ist beinahe doppelt so hoch wie die in unserer Wohnung in Frankenberg, und unter einer Plastikplane mache ich in der Mitte des Zimmers einen klobigen Couchtisch sowie eine braune Stoffcouch aus. Die Lehne der Couch ist ungewöhnlich hoch und reicht mir bis zur Brust. Neben den beiden Möbelstücken befindet sich nur ein weiterer Gegenstand im Raum: eine gewaltige Standuhr. Sie ist um Punkt ein Uhr stehen geblieben. Das wuchtige Teil mit dem erstarrten Pendel, das wie eine tote Zunge hinter der Glasscheibe hängt, hat etwas Unheimliches an sich.
„Das gibt’s doch nicht! Genau so eine hatte mein Uropa“, schwärmt Mama und fährt mit den Fingern über das filigran verzierte Holzgehäuse der Uhr. „Die ist mindestens hundert Jahre alt und …“ Der Klingelton ihres Handys unterbricht sie. Sie zieht ihr Smartphone aus der Manteltasche und wirft einen Blick auf das Display. „Es ist Dani. Sie will bestimmt wissen, ob wir heil angekommen sind. Einen Moment, ja?“
Dani ist die eineiige Zwillingsschwester meiner Mutter. „Hey, Schwesterchen“, hebt Mama ab und lächelt mich an. „Ja, wir sind angekommen und du hast nicht übertrieben, das Haus ist wundervoll.“
In welchem Universum ist dieses Haus wundervoll?, würde ich sie am liebsten fragen, bleibe aber wie zuvor stumm und lächle zurück.
„Nein, wir haben noch nicht alles gesehen. … Die Garage?“ Ihr Blick huscht in Richtung Küche. „Hinter dem Haus sagst du?“ Mama lauscht den Worten meiner Tante und kramt währenddessen den Schlüsselbund aus ihrer Tasche. „Ist das der klobige Eisenschlüssel?“ Sie fummelt am Bund herum und löst einen großen dunklen Schlüssel von den anderen. „Ja, ich hab ihn.“ Unsere Blicke treffen sich. Sie hebt einen Zeigefinger und flüstert: „Bin gleich zurück.“ Dann verlässt sie das Wohnzimmer und geht hinaus zum Auto. Ich warte, bis ich sie durch die vergilbten Gardinen, die vor den Fenstern hängen, draußen in der Einfahrt sehe. Dann erlaube ich mir ein schwermütiges Seufzen, während meine aufgesetzte Fröhlichkeit wie eine Maske von mir abfällt. Meine Schultern und Mundwinkel sacken herab und in meiner Brust breitet sich eine bleierne Schwere aus.
„Reiß dich zusammen, Kathi“, murmele ich, während in meiner Kehle ungeweinte Tränen brennen. Ich hasse das alles. Hasse es, Frankenberg verlassen zu haben, hasse es, mir ein neues Leben aufbauen zu müssen, und das alles nur seinetwegen! Das ist nicht fair, das haben wir nicht verdient. Eine Träne stiehlt sich aus einem meiner Augenwinkel und rollt über meine Wange. Mist! Ich lege den Kopf in den Nacken, kämpfe gegen meine hilflose Wut an. „Wir schaffen das. Es wird alles wieder gut – wir schaffen das“, bete ich wie ein Mantra leise vor mich hin. Dann straffe ich die Schultern und wische mir mit den Handballen über die Augen. Ich darf nicht schwach sein, darf mir nichts anmerken lassen. Mama hat zu viel durchgemacht! Wenn sie mitbekommt, wie es in mir aussieht, wird ihr das zusätzlich das Herz brechen. Das darf niemals geschehen. Sie ist ein guter Mensch und soll nicht auch noch meinetwegen leiden.
Also schlucke ich meinen Kummer hinunter und mache mich daran, den Rest der Wohnung zu erkunden.
Das Bad ist ein schmaler, schlauchartiger Raum mit einer Dusche, einem altbackenen Waschbecken mit Drehknöpfen und einer Toilette. Die Wände sind dunkelblau und der Boden weiß gefliest. Wie ich feststelle, ist es der einzige Raum ohne Dielenboden. Die Küche ist genauso veraltet wie der Rest der Wohnung und kommt mir vor wie aus einem anderen Jahrhundert. Das tiefe, mit Mosaiksteinen geflieste Waschbecken, die Küchenschränke aus wuchtigem Holz, der Gasherd und der einfache Tisch mit den sechs Stühlen darum – alles wirkt wie aus einer anderen, einfacheren Zeit. Das einzig einigermaßen Moderne ist der vergilbte Standkühlschrank.
Im rechten Schlafzimmer – es liegt gegenüber dem Wohnzimmer – entdecke ich die andere Hälfte des in der Wand verbauten Kachelofens. Hier klebt eine Tapete an den Wänden, die mir unheimlich ist. Ähnlich wie bei jenen im Wohnzimmer und der Küche sind darauf Blumen abgebildet. Doch im Gegensatz zu den cremefarbenen Tapeten in den anderen Räumen ist diese hier von einem sehr dunklen Blau. Die großköpfigen Blumen darauf wirken fast schwarz und lassen das Doppelbett – das einzige Möbelstück, das sich hier herinnen befindet – wie ein Totenbett aussehen.
Ein blumengesäumtes Totenbett, denke ich bei mir. Mich gruselt, weshalb ich lieber einen Blick in das andere Schlafzimmer werfe. Es ist der einzige Raum, der renoviert wurde. Na gut, renoviert ist übertrieben. Eigentlich hat man nur die Wände weiß gestrichen. Aber das macht einiges aus. Das Zimmer wirkt freundlicher und moderner als die übrigen. Ich trete ein und sehe mich um. Von der Decke baumelt eine nackte Glühbirne und auf dem Fenstersims liegt eine Rohrzange. Ansonsten ist der Raum vollkommen leer. Ich gehe zum Fenster, durch das ich einen Blick nach draußen in den Garten werfe. Er ist etwa so groß wie ein halbes Handballfeld, mit einem Birnenbaum in der hinteren Ecke, und wirkt genauso verwahrlost wie das Haus. Statt eines gepflegten Rasens, wie in den Nachbargärten, wächst hier hüfthohes Gras und tonnenweise Unkraut. Nur der Eisenzaun, der das Grundstück umfasst, verhindert einigermaßen, dass das Grünzeug raus auf die Straße wuchert.
Der gedämpfte WhatsApp-Benachrichtigungston meines Handys erklingt. Ich ziehe das Gerät aus der hinteren Hosentasche meiner Jeans und entsperre den Bildschirm. Ein heißer Stich durchfährt mein Herz, als ich sehe, dass die Nachricht von Leon ist. Meinem Exfreund. Er schreibt:Hi Babe, ich hoffe, du bist gut angekommen!
„Blöder Sturkopf“, zische ich verärgert. Ich habe ihn gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Er sollte mich weder anrufen noch mir schreiben. Die Sache hier ist auch so schon schwer genug für mich. Da brauche ich nicht zusätzlich an das erinnert zu werden, was ich aufgeben musste. Mit einem beengten Gefühl in der Brust stecke ich das Telefon zurück in meine Hosentasche und schaue wieder zum Fenster hinaus.
„Da bist du ja“, überrascht mich die Stimme meiner Mutter und lässt mich wie ertappt zusammenfahren. „Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken.“
Ich drehe mich zu ihr um und sehe sie im Türrahmen lehnen. „Hübsches Zimmer“, meint sie und sieht sich ebenfalls um. „Möchtest du es haben?“
Hübsch würde ich es nicht nennen, aber definitiv besser als die Alternative – das gruselige Totenbett-Schlafzimmer.
„Ja, bitte“, antworte ich und überlege, wo ich mein Bett hinstellen könnte.
„Sehr schön. Dann ist das entschieden. Und jetzt …“ Gut gelaunt streckt sie eine Hand nach mir aus, „… komm, lass uns was essen gehen. Mir knurrt der Magen.“
Kapitel 2
Zu Fuß machen wir uns auf den Weg und finden einen Dönerladen ganz in unserer Nähe. Das Neseli ist ein kleiner, gemütlicher Imbiss, dessen Essen ausgezeichnet schmeckt. Ich nehme einen Dürüm und Mama bestellt sich eine Salamipizza, die – auch wenn ich es nicht gerne zugebe – besser ist als die in unserem Stammdönerladen in Frankenberg.
Eines steht fest: Hier werden wir häufiger herkommen!
Zu meiner Freude hebt das Essen meine Stimmung und stopft das Loch aus Heimweh, das in meiner Brust klafft.
Als wir fertig sind, spazieren wir ins Zentrum der Stadt und bummeln durch die Fußgängerzone. Zugegeben, Dornbirn ist ein hübsches Fleckchen mit freundlichen Leuten. Hier gibt es vom Kino über ein Hallenbad, Eisdielen, Boutiquen, Konditoreien und einem Einkaufszentrum alles, was das Herz begehrt. Wir kaufen ein paar Lebensmittel und machen uns schließlich auf den Heimweg.
Es ist etwa siebzehn Uhr, als wir in die Birngasse abbiegen. Während wir die Straße entlangschlendern, betrachte ich die Häuser in unserer neuen Nachbarschaft. Dabei fällt mir auf, dass es in der Gegend jede Menge Altbauten gibt. Mehr als die Hälfte der Häuser sind von derselben altmodisch klobigen Sorte wie das unsere. Unauffällig reihen sie sich zwischen die Neubauten und verleihen der Straße dennoch ein nostalgisches Flair.
„Es ist so anders als in Frankenberg“, murmele ich gedankenverloren vor mich hin.
„Ja, das finde ich auch.“ Mama hängt sich bei mir unter und sieht mich lächelnd aus ihren großen, grünen Augen an. „Kannst du dir vorstellen, wie die Leute hier damals lebten?“ Ihr Blick gleitet an mir vorbei und zu einem Haus mit Veranda. „Ganz ohne Internet, Fernsehen und all dem anderen Technik-Schnickschnack?“
Ein Leben ohne Internet? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. „Das klingt ziemlich langweilig.“
„Quatsch, das war großartig! Die Leute hatten Spaß zusammen.“
„Und das weißt du woher?“
„Na von deiner Uroma.“
„Oma Isolde?“
„Genau.“
Oma Isolde war einer von Mamas Lieblingsmenschen. Sie hatte italienische Wurzeln und dementsprechend Temperament. Wie der Rest unserer Familie lebte sie in Deutschland … in Frankenberg, um genau zu sein. Da, wo wir vor nicht einmal vierundzwanzig Stunden alles, was uns lieb und teuer gewesen ist, zurückgelassen haben. Heimweh wallt wie gleißendes Feuer in meiner Brust auf. Ich richte den Blick auf das alte Haus auf meiner Seite der Straße, damit Mama nichts bemerkt.
„Und was haben die Leute so gemacht ohne Netflix und Disney Plus?“, erkundige ich mich – in erster Linie, um mich vom Heimweh abzulenken.
„Sie haben sich am Abend getroffen, haben Karten gespielt, gesungen oder auf der Straße Völkerball gespielt.“
„Völkerball, auf der Straße?“
„Ja, früher gab es kaum Verkehr.“
„Schwer vorstellbar“, sage ich und mache einer Radfahrerin, die hinter mir klingelt, Platz.
„Ja, oder? Trotzdem, ich glaube, dass es damals eine tolle Zeit war.“ Die Traurigkeit in der Stimme meiner Mutter ist nicht zu überhören. Bevor ich dazu komme, sie darauf anzusprechen, sehe ich aus dem Blickwinkel etwas auf mich zuspringen. Ich stoße keinen Schrei aus, weiche jedoch instinktiv einen Schritt zur Seite und knalle gegen Mama.
„Hey … was?! Ach, du schon wieder“, sagt sie und späht an mir vorbei auf die schwarze Katze, die auf die Mauer neben mir gesprungen ist und uns nun beobachtet.
„Ist das nicht dieselbe wie heute Vormittag?“, frage ich.
„Sieht so aus. Und weißt du, an wen sie mich erinnert?“ Mama hebt die Hand, um das Tier zu streicheln.
„Luzifer?“, mutmaße ich, als die Katze just in dem Moment ein Fauchen von sich gibt und sich trollt.
„Luzifer, genau!“, bestätigt Mama und lacht, weil das Tier tatsächlich genauso miesepetrig ist wie der Kater meiner Oma damals. Gerade als wir uns abwenden und weitergehen wollen, entdecken wir eine Gestalt, die uns aus einem der Fenster des Hauses hinter der Mauer beobachtet. Durch einen Spalt im Vorhang sehen wir die Gesichtszüge einer älteren Person.
„Hallo!“, ruft Mama gut gelaunt und winkt. „Wir sind die Geigers“, erklärt sie und deutet auf das nächste Haus – unser Haus. „Wir sind die neuen Nach…“ Der Vorhang schließt sich, das Gesicht verschwindet. „Oookay“, sagt sie leise, damit nur ich es hören kann. „Dann eben nicht.“
In der Welt meiner Mutter bedeutet ein dann eben nicht in etwa dasselbe wie: dann eben ein andermal. Sie ist einer dieser Menschen, die mit allen Leuten gut auskommen wollen – was ihr in der Regel auch gelingt.
„Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, richtig. Die alten Zeiten.“ Während wir weitergehen und sie erzählt, wie Uroma Isolde damals mit den Nachbarn zusammensaß und bis in die späten Abendstunden Lieder sang, die heute kaum einer mehr kennt, beobachte ich weiter das Nachbarhaus. Es hat denselben Baustil wie das unsere, ist allerdings in einem besseren Zustand. Die Fassade ist frisch gestrichen und die Fenster sind neu. Auch der Garten und die Apfelbäume, die darin wachsen, sind gepflegt – was das Anwesen gleich viel freundlicher wirken lässt. Mein Blick pendelt zwischen unserem und dem Nachbarhaus hin und her. Obwohl die Gebäude in etwa gleich alt sind, wirken sie grundverschieden. Unseres, das verwahrlost und verlassen daliegt und an ein Spukhaus erinnert, und das der Nachbarn, das an ein altes, aber gemütliches Omihäuschen erinnert.
Wie Tag und Nacht, denke ich bei mir. Beim einen hat man das Gefühl, den Duft von frischer Wäsche und Keksen wahrzunehmen, beim anderen den Geruch von Tod und Verdammnis.
Gerade als ich mich im Stillen für meine gedanklichen Übertreibungen schimpfe, bewegt sich der Vorhang an einem der anderen Fenster des Nachbarhauses. Reflexartig schaue ich hin. Wieder späht jemand aus dem Inneren zu uns heraus. Diesmal erkenne ich noch weniger als zuvor. Alles, was ich sehe, ist ein Auge. Ein Auge, das uns erst anstiert und sich, kaum dass wir in unsere Einfahrt abbiegen, boshaft zusammenzieht.
Was für unheimliche Nachbarn.
Ein beklemmendes Gefühl überkommt mich, weshalb ich stehen bleibe. Irgendetwas sagt mir, dass es schlauer wäre, mir mein Unbehagen nicht anmerken zu lassen. Deshalb drehe ich mich zum Fenster und suche den Blick der Person im Inneren. Doch da verschwindet das Auge bereits wieder hinter dem Vorhang.
„Was ist?“ Mama bleibt ihrerseits stehen und folgt meinem Blick.
„Nichts. Ich dachte nur, ich hätte etwas gesehen.“ Wer auch immer da drüben wohnt, es scheint ihm oder ihr nicht zu passen, dass wir hier einziehen.Willkommen im Klub!
„Wollen wir noch unsere Sachen aus dem Auto holen?“, fragt Mama und geht weiter über den Kiesweg, der seitlich am Haus vorbeiführt.
„Klar“, sage ich und folge ihr. „Apropos Sachen, wann kommt eigentlich der Umzugswagen?“
„Wenn alles klappt, morgen Vormittag“, antwortet sie und öffnet die Doppeltür, die zur Garage führt. Diese befindet sich am Ende der Einfahrt, an einen von der Sonne verbrannten Holzschuppen gedrängt. Der Schuppen liegt versteckt hinter dem Haus und ist genauso lang wie dieses.
Ungewöhnlich für ein Stadthaus, überlege ich und entdecke drei Türen. Zwei davon dicht nebeneinander im hinteren Bereich, die dritte ganz vorn, unmittelbar neben der Garage.
„Was ist da drin?“, erkundige ich mich. Mama folgt meinem Fingerzeig.
„Gute Frage. Ich schätze, der Schuppen gehört zu den Wohnungen. Eins, zwei, drei …“, zählt sie die Türen ab. „Ja, das würde passen. Für jede Wohnung ein Abteil. Willst du reinschauen?“
Um ehrlich zu sein, würde ich nichts lieber tun – der seltsame Schuppen zieht mich wie magisch an. Doch ich weiß, dass Mama müde ist – auch wenn sie es sich nicht anmerken lässt. Die letzten Tage mit dem Umzug und all dem Stress hatten es in sich. Darum schüttle ich den Kopf. „Nein, schon gut. Ein andermal.“
„Wie du willst. Dann komm, hilf mir mit den Koffern.“
Wir tragen unsere Sachen durch die Hintertür hinein. Das geht schneller, denn so müssen wir nicht ums Haus herumlaufen. Als wir eintreten, fällt mein Blick sogleich auf die Treppe, die in den Keller hinunterführt. Ein halsbrecherisch steiles Teil. Im Vorbeigehen spähe ich in den dunklen Schacht hinab und bin mir sicher, dass ein düsterer Ort wie dieser die Fantasie eines jeden Mörders beflügeln muss. Sofort stelle ich mir vor, wie jemand in diesen Keller Kinder verschleppt und Menschen mit rostigen Zangen und Sägen Körperteile abgetrennt werden. Wie heute Vormittag stellen sich die Härchen an meinen Armen auf und eine Gänsehaut überzieht meinen Körper. Schon krass, was alte Häuser wie dieses mit einem anstellen können. Mörder und Zangen? Ich schüttele über mich selbst den Kopf. Was ist denn nur los mit mir? Normalerweise bin ich kein Angsthase. Im Gegenteil, zu Hause habe ich mir mit Leon fast jedes Wochenende Horrorfilme reingezogen. Dämonen, Zombies, Psychopathen – alles kein Problem! Mich wirft nichts so schnell aus der Bahn. Warum also mache ich mir wegen des Kellers ins Hemd?
Übernächtigt, überlege ich. Ja, das muss es sein. Ich bin genauso übernächtigt wie Mama und dementsprechend sensibel.Eine Mütze voll Schlaf und ich bin wieder die Alte.
Zwanzig Minuten später haben wir alle Sachen im Haus und die Einkäufe im Kühlschrank verstaut. Mit einer Thermoskanne Tee – die wir für die Fahrt mitgenommen haben –, zwei Bechern und einer Packung Kekse setzen wir uns an den Küchentisch.
„Was meinst du, wollen wir morgen noch mal in die Stadt spazieren und schauen, ob wir das Gymnasium finden?“, erkundigt sich Mama und gießt uns dampfenden Tee ein.
„Nein, schon gut. Dafür bleibt noch die ganze Woche Zeit.“ Das im Herzen der Stadt liegende Gymnasium ist das letzte, was ich sehen will. Es ruft mir in Erinnerung, dass ich meine bisherige Schule, meine Freunde und meine Heimat hinter mir gelassen habe. Unter anderen Umständen hätte ich mich gefreut, neue Leute kennenzulernen. Ich bin ein offener Mensch und mit meinen siebzehn Jahren kein schüchternes Kind mehr. Mein Problem ist nur, dass ich keine Lust habe, jemand Neuen kennenzulernen. Ich will nach Hause, zurück in mein altes Leben.
„Hast recht. Es ist wahrscheinlich besser, wenn wir uns erst mal ein wenig einleben und hier zurechtfinden. Wie du schon sagst, wir haben noch die ganze Woche Zeit.“
Stimmt. Dank der Herbstferien bleiben mir fünf Tage, bevor die Schule wieder losgeht. „Was ist mit dir? Hast du Lust, Tante Dani morgen im Rathaus zu besuchen und deinen neuen Arbeitsplatz unter die Lupe zu nehmen?“, frage ich und nehme einen Schluck.
„Liebend gern.“ Mamas Augen leuchten vor Begeisterung. „Ich kanns kaum erwarten, anzufangen.“ Sie lacht und zeigt dabei eine Reihe hübscher weißer Zähne. Es tut gut, sie glücklich zu sehen. Ich nehme noch einen Schluck Tee und betrachte sie über den Rand meines Bechers. Bianca Geiger ist eine attraktive Frau. Wie ich hat sie langes, haselnussbraunes Haar, eine kleine sommersprossengesäumte Nase und ein schmales Gesicht mit vollen, markant geschwungenen Brauen. Früher war sie schmäler als ich heute mit meinen fünfundfünfzig Kilo auf einen Meter siebzig. Heute hat sie ein bisschen was auf den Hüften – Stressspeck, wie sie es nennt. Sie ist keine typische Schönheit wie auf den Modemagazinen, aber sie hat etwas ganz Besonderes an sich. Etwas, was Leute magisch in ihren Bann zieht. Mit den auffallend grünen Augen und markanten Brauen bin ich ihr zwar wie aus dem Gesicht geschnitten, verfüge jedoch nicht über ihre einnehmende Art, was mir ganz recht ist. Ich bin nicht scharf darauf, im Mittelpunkt zu stehen.
„Bist du einverstanden, wenn wir uns gleich in der Früh auf den Weg machen? Ich möchte rechtzeitig zurück sein, bevor der Umzugswagen eintrifft.“
„Klar, warum nicht.“ Je voller der Tag, desto besser. Das wird mich vom Heimweh ablenken.
„Perfekt! Dann hüpfe ich rasch unter die Dusche, und wenn du willst, können wir uns nachher auf dem Laptop einen Film ansehen.“
„The Nun“, schlage ich vor, was Mama das Gesicht verziehen lässt. Sie ist ein Angsthase und hasst Horrorfilme. Mir zuliebe schaut sie sich manchmal einen an – was sie jedes Mal bereut.
„Was hältst du von Life in Pieces?“
Ich verdrehe die Augen. Life in Pieces ist ihre Lieblingsserie, die wir uns bestimmt schon ein Dutzend Mal reingezogen haben. „Keine Chance, heute bin ich an der Reihe mit aussuchen“, erinnere ich sie.
„Meinetwegen.“ Sie seufzt, stellt ihren Becher ab und zeigt mit dem Finger auf mich. „Aber wenn ich mir diesen Horrorfilm schon anschaue, lasse ich in der Nacht, wenn ich aufs Klo muss, auch das Licht an.“
Was so viel bedeutet wie: Jammere nicht, wenn ich dich deshalb aufwecke. Es ist ihr schwacher Versuch, mich umzustimmen.
„Kein Problem“, versichere ich und zucke mit den Schultern.
„Mist“, grummelt sie und verlässt die Küche. Schmunzelnd höre ich, wie sie aus einem der Koffer im Flur frische Klamotten holt und ins Badezimmer geht. Wenige Sekunden später, als sie das Wasser anstellt, schallt ein schrilles Ächzen durchs Haus. Das Geräusch ist so laut, dass ich vor Schreck fast den Keks, den ich mir gerade nehme, fallen lasse. Die Augen zusammenkneifend halte ich mir die Ohren zu und bin sicher, dass jeder Zentimeter des Hauses von diesem grellen Geräusch erfüllt sein muss. Nach wenigen Sekunden wird das Ächzen dumpfer und mischt sich mit einem gespenstischen Kreischen, das aus dem Wasserhahn am Waschbecken dringt.
Es ist, als würde das Haus zum Leben erwachen, denke ich bei mir und hebe den Blick zur Decke. Irgendwo in den oberen Stockwerken hat es angefangen, in den Rohren zu klopfen. Ich höre ein Gurgeln und Rauschen, das aus den Wänden kommt, und bin mir sicher, dass Mama jeden Augenblick nach mir rufen wird. Doch das tut sie nicht. Das Ächzen verklingt und auch der kreischende Hahn verstummt. Nur das Klopfen und Gurgeln hält an.
Ganz schön spooky dieses Haus.
Mein Smartphone, welches vor mir auf dem Küchentisch liegt, leuchtet auf. Ich nehme es in die Hand und sehe, dass mir Leon eine neue WhatsApp geschickt hat.
Er schreibt:
Hey Babe,
mir ist klar, du bist der Meinung, eine Fernbeziehung kann auf Dauer nicht funktionieren. Aber ich sehe das anders. Wir zwei gehören zusammen! Ich weiß das, und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, weißt du es auch. Ich habe nicht vor, uns aufzugeben! Deshalb werde ich weiter um uns kämpfen, hörst du, ich werde uns NICHT aufgeben.
Love ya! Leon
Mehr noch, als ich sauer darüber bin, dass er mir schon wieder schreibt, lässt mir seine Nachricht das Herz schwer werden. Leon war mein erster fester Freund. Wir waren zwei Jahre lang zusammen und das Traumpaar der Schule. Er der Ringerstar der Jungenmannschaft, ich die Kapitänin der Mädchen-Handballmannschaft. Wir passten in jeder Hinsicht perfekt zusammen. Beide waren wir beliebt, standen auf Sport, Horrorfilme, italienisches Essen und heiße Sommertage. Außerdem hassten wir Mathe und den Sauerkrauteintopf der Mensa.
Ich atme gequält durch, während meine Daumen über das Display huschen und eine Antwort tippen.
Leon, die Zeit mit dir war unvergesslich. Aber es ist vorbei. Bitte akzeptier das …
Mit einem Gefühl, als würde eine zentnerschwere Last auf meine Schultern drücken, lese ich die wenigen Worte noch einmal, bevor ich sie lösche und neu anfange.
Ich vermisse dich auch, aber das ändert nichts an der Situation …
Nachdem ich eine Weile mit mir gerungen habe, habe ich mir gestern Abend ein Herz gefasst und die Beziehung mit Leon beendet. Auch wenn er es nicht einsehen will, aber ich habe es ihm zuliebe getan. Er soll seine Jugend nicht darauf verschwenden, auf mich zu warten. Ich weiß, ich habe ihm versprochen, nach Frankenberg zurückzukehren, sobald sich Mama hier richtig eingelebt hat. Aber wer weiß, wie lange das dauern wird. Ein paar Monate, ein Jahr … oder noch länger? Es ist unmöglich zu sagen. Und weil ich nicht will, dass er zu Hause herumsitzt und auf mich wartet, habe ich das in meinen Augen einzig Richtige getan. Ich habe ihn verlassen und ihm damit seine Freiheit geschenkt. Er ist jung, gut aussehend und ein verdammt toller Mensch! Ich weiß, noch sitzt der Schmerz tief, weshalb er nicht einsehen will, dass es besser für ihn ist, dass ich ihn habe gehen lassen. Aber irgendwann wird auch er einsehen, dass es die richtige Entscheidung war, und dann wird er mir dankbar sein.
Ein schwerer Seufzer rollt über meine Lippen, als ich die Nachricht wieder lösche.
Wenn ich Leon antworte, wird er sich Hoffnungen machen,und das soll er nicht. Also verzichte ich darauf, ihm eine Antwort zu schreiben. Die Last auf meinen Schultern ist erdrückend und mir ist nach wie vor zum Weinen zumute. Doch ich verkneife mir die Tränen, weil ich drüben im Bad Mama das Wasser abstellen höre.
Niedergeschlagen lege ich das Telefon beiseite und stehe auf. In letzter Zeit habe ich angefangen zu essen, wenn ich frustriert bin. Darum gehe ich an den Kühlschrank und mache für uns eine Geigerplatte. Das ist ein großer Teller mit mundgerechten Leckereien, die wir mögen. Ich lege Salami, Käse, Paprika und Gurken an den Rand des Tellers und schneide von dem Vollkornbrot, das wir in der Stadt gekauft haben, ein paar Scheiben ab, die ich noch mal teile und neben das Gemüse lege. In die Mitte des Tellers kommt ein großer Klecks Streichkäse. Wir lieben es, unsere Häppchen darin zu dippen.
„Eine Geigerplatte?“, erkundigt sich Mama, die, gerade als ich fertig bin, in die Küche kommt.
„Jap, dachte mir, die passt zum Fernsehabend.“
„Da bin ich ganz deiner Meinung“, stimmt sie gut gelaunt zu, nimmt sich ein Stück Paprika und tunkt es in den Frischkäse.
Wir machen es uns am Küchentisch gemütlich und stellen den Laptop auf. Nach der Gruseldusche – Mama berichtet, dass das Wasser anfänglich eine bröcklige braune Suppe gewesen sei und sie an gestocktes Blut erinnert hätte – beschließe ich, ihre Nerven nicht zusätzlich zu strapazieren. Statt The Nun schauen wir uns eine Komödie an. Norbit mit Eddie Murphy, superlustig und genau das, was wir nach einem Tag wie diesem brauchen. Wir lassen uns die Geigerplatte schmecken und genießen den Abend. Im gedämpften Licht des Laptops hat die Küche etwas Gemütliches an sich. Zum ersten Mal, seit ich hier bin, fühle ich mich wohl. Ich genieße den Abend und schaffe es, mein Heimweh für ein paar Stunden zu vergessen. Diese Leichtigkeit hält genauso lange an, bis wir ins Bett gehen. Da unsere Möbel noch nicht da sind, bleibt uns nichts anderes übrig, als in dem Zimmer mit den dunklen Tapeten zu schlafen.
Widerstrebend beziehe ich die Matratze des Doppelbettes, während Mama unsere Decken und Kopfkissen holt, die wir mitgebracht haben. Steif wie ein Stock lege ich mich schließlich in das fremde, mindestens hundert Jahre alte Bett. Im Gegensatz zu Mama, die sich offensichtlich pudelwohl fühlt und innerhalb weniger Minuten einschläft, fühle ich mich unbehaglich und liege lange wache. Den Blick an die dunkle Zimmerdecke geheftet, lausche ich auf Geräusche im Haus. Die Wasserleitungen gluckern gelegentlich und der Kühlschrank in der Küche surrt laut vor sich hin. Ich frage mich, warum die Wohnungen über uns leer stehen. Wahrscheinlich, weil niemand in einem so alten Gebäude leben will.
Niemand außer uns, überlege ich grimmig. Ich drehe mich um, betrachte im fahlen Licht der Straßenlaterne, das zu uns ins Zimmer fällt, den Kachelofen und die Tapete. In dem schwachen Licht sind die Blumen darauf nicht auszumachen, weshalb die Wand wie ein dunkler Morast wirkt. Ein Sumpf, der mir das Gefühl vermittelt, mich anziehen und einsaugen zu wollen. Plötzlich überkommt mich das unheilvolle Gefühl, beobachtet zu werden. Es ist absurd, ich weiß, aber etwas tief in mir ist davon überzeugt, dass wir nicht allein in dem Zimmer sind. Mein Blick wandert langsam über die Wände und den Boden, sucht den Raum nach einem Eindringling ab. Doch natürlich ist da niemand. Ich schimpfe mich in Gedanken eine feige Nuss, drehe mich wieder auf den Rücken und versuche zu schlafen. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, will einfach nicht verschwinden. Es ist fast fünf Uhr, als mir endlich die Augen zufallen und ich in einen unruhigen Schlaf sinke.