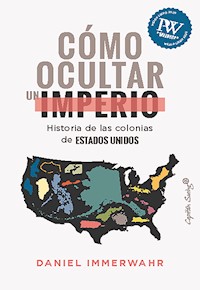19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Territorium der USA ist viel größer als die offzielle Landkarte zeigt. Der amerikanische Historiker Daniel Immerwahr entlarvt, wie es gelang, ein ganzes Weltreich zu errichten, ohne dass die Welt es merkte. Zu den Vereinigten Staaten gehörten (und gehören zum Teil bis heute) unter anderem: die Philippinen und Puerto Rico, verschiedene Inseln im Pazifik sowie Teile Samoas. Einst Kolonien oder zur Ausbeutung von Rohstoffen annektiert, wurden sie nach 1945 als Außengebiete der USA bezeichnet. In fesselnden Episoden schildert Immerwahr die Geschichte des verborgenen US-Imperialismus. Er schreibt über Menschenversuche in Puerto Rico, über den Spanisch-Amerikanischen Krieg auf den Philippinen, dem eine Million Menschen zum Opfer fielen, und über den Rohstoffraub im Pazifik. Um die dortigen Guano-Vorkommen abbauen zu können, erließ der US-Kongress 1856 ein Gesetz, nach dem US-Bürger unbewohnte Inseln für ihr Land annektieren konnten. Über 50 Inseln wurden damit dem US-Territorium hinzugefügt, einige davon sind bis heute unter amerikanischer Kontrolle. Ein spannend erzähltes Stück Weltgeschichte, das zeigt: Imperialismus und Globalisierung gehen bis heute Hand in Hand. Es ist Zeit, dass die Weltgemeinschaft den Kolonialismus endgültig überwindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Daniel Immerwahr
Das heimliche Imperium
Die USA als moderne Kolonialmacht
Über dieses Buch
»Eine lebensnahe Erzählung über die unrühmliche Geschichte des US-Imperialismus.«
Kirkus Review
Das Territorium der USA ist viel größer als die Landkarte zeigt. Daniel Immerwahr deckt auf, wie die Vereinigten Staaten ein ganzes Weltreich errichteten, ohne dass die Welt es merkte. In fesselnden Episoden erzählt er die Geschichte des verborgenen US-Imperialismus. Er schreibt über Menschenversuche in Puerto Rico, über Massaker auf den Philippinen, über den Widerstand gegen den Raub des Rohstoffs Guano im Pazifik. Ein skandalöses Kapitel der amerikanischen Geschichte und Gegenwart, dessen Bedeutung für die Weltgeschichte kaum zu unterschätzen ist.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daniel Immerwahr, geboren 1980, lehrt Geschichte an der Northwestern University in Illinois. Er zählt zu den vielversprechendsten Nachwuchshistorikern der USA. Für sein Buch »Thinking Small« (erschienen 2015 bei Harvard University Press) erhielt er den Merle-Curti-Preis des amerikanischen Historikerverbands.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel ›How to Hide an Empire. A History of the Greater United States‹ bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
© 2019 Daniel Immerwahr
Für die deutschsprachige Ausgabe: © 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann und Kompanie Werbeagentur, Zürich
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490231-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Einleitung Jenseits der Logokarte
Anmerkung zur Terminologie und Schreibweise
Erster Teil Das Kolonialreich
Erstes Kapitel Fall und Aufstieg des Daniel Boone
Zweites Kapitel Indianerland
Drittes Kapitel Was Sie immer schon über Guano wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten
Viertes Kapitel Teddy Roosevelts sehr guter Tag
Fünftes Kapitel Imperiale Gesinnung
Sechstes Kapitel Der Schlachtruf der Freiheit
Siebtes Kapitel Außerhalb des Zauberkreises
Achtes Kapitel White City
Neuntes Kapitel Ärzte ohne Grenzen
Zehntes Kapitel Festung Amerika
Elftes Kapitel Der Kriegsstaat
Zwölftes Kapitel Es gibt Zeiten, da müssen Menschen sterben
Zweiter Teil Das pointillistische Imperium
Dreizehntes Kapitel Kilroy was here
Vierzehntes Kapitel Die Dekolonisierung der Vereinigten Staaten
Fünfzehntes Kapitel Nobody knows in America, Puerto Rico’s in America
Sechzehntes Kapitel Synthetische Stoffe
Siebzehntes Kapitel Das hat Gott gewirkt
Achtzehntes Kapitel Das Reich des roten Achtecks
Neunzehntes Kapitel Die Sprache ist ein Virus
Zwanzigstes Kapitel Macht bedeutet Souveränität, Mister Bond
Einundzwanzigstes Kapitel Baselandia
Zweiundzwanzigstes Kapitel Krieg der Punkte
Fazit: Das fortbestehende Imperium
Dank
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsnachweise
Register
Den Ungezählten
EinleitungJenseits der Logokarte
Das einzige Problem ist,
sie denken nicht viel über uns nach
in Amerika.
Alfredo Navarro Salanga, Manila[1]
7. Dezember 1941. Über einem Flottenstützpunkt auf der Insel O’ahu erscheinen japanische Flugzeuge. Sie werfen Torpedos ab, die nach dem Eintauchen ins Wasser den Weg zu ihren Zielen suchen. Vier von ihnen treffen die USSArizona, das riesige Schlachtschiff hebt sich aus dem Wasser. Stahl, Holz, Dieselöl und menschliche Körperteile wirbeln durch die Luft. Die brennende Arizona versinkt im Meer, während die Männer der Besatzung in das ölbedeckte Wasser springen. Nach einem Jahrhundert Frieden ist das ein brutales Erwachen. Für die Vereinigten Staaten ist es der Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Es gibt nicht viele geschichtliche Ereignisse, die tiefer ins nationale Gedächtnis der US-Amerikaner eingebrannt sind als der Angriff auf Pearl Harbor. Er gehört zu den wenigen Ereignissen, deren Datum die meisten Menschen benennen können (der 7. Dezember, »das Datum, das als Schande weiterleben wird«, wie Franklin Delano Roosevelt sagte). Hunderte von Büchern wurden darüber geschrieben – in der Library of Congress finden sich mehr als 350. Und Hollywood hat Spielfilme darüber produziert, von Verdammt in alle Ewigkeit (1953) mit Burt Lancaster in der Hauptrolle, das von der Kritik gefeiert wurde, bis hin zu Pearl Harbor (2001) mit Ben Affleck, über das die Kritiker sich lustig machten.
Diese Filme zeigen indessen nicht, was als Nächstes geschah. Neun Stunden nach dem japanischen Angriff auf Hawai’i erschienen weitere japanische Flugzeuge über einem anderen US-Territorium, den Philippinen. Wie in Pearl Harbor warfen sie ihre Bomben ab und richteten auf mehreren Luftstützpunkten verheerende Schäden an.
Die offizielle Kriegsgeschichte der US-Army stuft die Bombenangriffe auf die Philippinen als ebenso zerstörerisch ein wie die auf Hawai’i.[2] In Pearl Harbor dezimierten die Japaner die amerikanische Pazifikflotte, versenkten vier Schlachtschiffe und beschädigten vier weitere. Auf den Philippinen trafen die Angriffe auf die größte Konzentration amerikanischer Kampfflugzeuge außerhalb Nordamerikas – sie vernichteten das Rückgrat der alliierten Luftverteidigung im Pazifik.
Die Vereinigten Staaten verloren mehr als nur Flugzeuge. Der Angriff auf Pearl Harbor war ein Überraschungsangriff. Die japanischen Bomber schlugen zu, zogen sich zurück und kamen nicht mehr wieder. Nicht so auf den Philippinen. Dort folgten auf die ersten Luftangriffe weitere Attacken, eine Invasion und die Besetzung. Sechzehn Millionen Filipinos – US-amerikanische Staatsbürger, die vor der US-amerikanischen Flagge salutierten und FDR als ihren Oberbefehlshaber ansahen – fielen unter die Herrschaft einer fremden Macht. Sie erlebten einen ganz anderen Krieg als die Bewohner Hawai’is. Das gewöhnlich als »Pearl Harbor« bezeichnete Ereignis war in Wirklichkeit ein umfassender Blitzanschlag gegen amerikanische und britische Besitzungen im pazifischen Raum. An einem einzigen Tag griffen die Japaner die dortigen US-amerikanischen Territorien Hawai’i, die Philippinen, Guam, die Midway-Inseln und das Wake-Atoll an. Zeitgleich attackierten sie auch die britischen Kolonien Malaya, Singapur und Hongkong und begannen mit der Invasion Thailands.
Es war ein phänomenaler Erfolg. Den Japanern gelang zwar nie die Eroberung Hawai’is, doch innerhalb weniger Monate fielen ihnen Guam, die Philippinen, das Wake-Atoll, Malaya, Singapur und Hongkong in die Hände. Sie eroberten sogar die Westspitze Alaskas und hielten sie mehr als ein Jahr lang.
Wenn man sich das Gesamtbild ansieht, fragt man sich, ob denn »Pearl Harbor« – der Name eines der wenigen Angriffsziele, die Japan nicht besetzte – wirklich die beste Kurzbezeichnung für die Ereignisse dieses schicksalhaften Tages sein mag.
Als »Pearl Harbor« bezeichnete man die Luftangriffe damals noch nicht, zumindest nicht zu Anfang.[3] Wie man sie beschreiben sollte, war indessen alles andere als klar. Sollte man den Schwerpunkt auf Hawai’i legen, das dem nordamerikanischen Festland am nächsten gelegene Ziel und das erste Stück US-amerikanischen Bodens, das die Japaner angriffen? Oder doch eher auf die weitaus größeren und verwundbareren Philippinen? Oder auf Guam, das fast unverzüglich kapitulierte? Oder auf alle pazifischen Besitzungen einschließlich des unbewohnten Wake-Atolls und der gleichfalls unbewohnten Midway-Inseln?
»Die Fakten von gestern und heute sprechen für sich selbst«, sagte Roosevelt in seiner Rede vor dem Kongress – der »Infamy Speech«, in der er von einem »Tag der Schande« sprach. Aber taten sie das wirklich? »Japaner bombardieren Manila und Hawaii«, lautete die Schlagzeile einer Zeitung in New Mexico. »Japanische Flugzeuge bombardieren Honolulu und Guam« titelte eine andere in South Carolina.[4] Sumner Welles, Roosevelts stellvertretender Außenminister, beschrieb die Ereignisse als »Angriff auf Hawaii und die Philippinen«.[5] Eleanor Roosevelt verwendete eine ähnliche Formulierung in ihrer Radioansprache am Abend des 7. Dezember, in der sie sagte, Japan »bombardiert unsere Bürger in Hawaii und auf den Philippinen«.[6]
Roosevelts »Tag-der-Schande-Rede« am 7. Dezember 1941. In der 7. Zeile wurde »Geschwader haben mit Bombardements in Hawai’i und auf den Philippinen begonnen« umgeändert in »Geschwader haben mit Bombardements in Oahu begonnen.«
So hieß es auch im ersten Entwurf der Rede des Präsidenten. Dort wurde das Ereignis ursprünglich als »Bombardements in Hawaii und auf den Philippinen« bezeichnet. Aber Roosevelt vergnügte sich den ganzen Tag mit dem Entwurf, fügte Formulierungen mit Bleistift hinzu und strich andere aus. Irgendwann entfernte er die hervorgehobene Nennung der Philippinen und entschloss sich zu einer anderen Beschreibung. Der Angriff war in dieser revidierten Fassung nun ein »Bombardement in Oahu« oder, wie es später in der Rede heißt, auf die »Hawaiianischen Inseln«.[7] Er erwähnte auch weiterhin die Philippinen, allerdings nur innerhalb der knappen Aufzählung anderer japanischer Angriffsziele: Malaya, Hongkong, Guam, die Philippinen, das Wake-Atoll und die Midway-Inseln – in dieser Reihenfolge. Diese Aufzählung mischt amerikanische und britische Territorien, ohne anzumerken, welche davon zu wem gehörten.
Warum diese Herabstufung der Philippinen? Wir wissen es nicht, aber es ist nicht schwer zu erraten. Roosevelt versuchte, eine eindeutige Geschichte zu erzählen. Japan hatte die Vereinigten Staaten angegriffen. Doch da gab es ein Problem. Galten die japanischen Angriffsziele wirklich den »Vereinigten Staaten«? In rechtlichem Sinne handelte es sich unbestreitbar um US-amerikanisches Staatsgebiet. Aber würde die Öffentlichkeit das auch so sehen? Was, wenn es Roosevelts Publikum egal war, dass Japan die Philippinen oder Guam angegriffen hatte? Nach Meinungsumfragen, die kurz vor dem Angriff durchgeführt worden waren, unterstützten in den kontinentalen USA nur wenige eine militärische Verteidigung dieser entfernten Territorien.[8]
Erinnern wir uns, welche Reaktionen ähnliche Ereignisse in jüngerer Zeit auslösten, nämlich am 7. August 1998, als Al-Qaida zeitgleich Anschläge auf US-Botschaften im kenianischen Nairobi und im tansanischen Daressalam verübte. Hunderte Menschen starben (meist Afrikaner) und Tausende wurden verletzt. Doch obwohl diese Botschaften Außenposten der Vereinigten Staaten waren, hatte man in der Öffentlichkeit kaum das Gefühl, das Land selbst wäre angegriffen worden. Es bedurfte weiterer Anschläge, zeitgleich in New York und Washington drei Jahre später, um einen echten Krieg zu entfesseln.
Eine Botschaft ist natürlich etwas anderes als ein Staatsgebiet. Und das war auch 1941 so. Roosevelt wusste zweifellos, dass die Philippinen und Guam zwar formal gesehen zu den Vereinigten Staaten gehörten, vielen US-Amerikanern jedoch als Ausland erschienen. Hawai’i dagegen wurde eher als »amerikanisch« empfunden. Es war zwar kein Bundesstaat, sondern ein »US-Territorium«, doch es lag näher bei Nordamerika und war deutlich »weißer« als die übrigen Territorien. So sprach man denn bereits von der Möglichkeit, dass Hawai’i zu einem Bundesstaat werden würde (während bei den Philippinen die Unabhängigkeit im Raum stand).
Doch selbst mit Blick auf Hawai’i hielt Roosevelt es für nötig, seine Botschaft zu verdeutlichen. Das Territorium hatte zwar eine beträchtliche weiße Bevölkerung, doch drei Viertel der Einwohner waren Asiaten oder Pazifikinsulaner. Roosevelt hatte ganz offensichtlich die Sorge, sein Publikum könne Hawai’i als Ausland empfinden. Deshalb nahm er am Morgen seiner Rede eine weitere Veränderung vor. Nun sagte er nicht mehr, japanische Geschwader hätten »die Insel Oahu« bombardiert, sondern sprach von der »amerikanischen Insel Oahu«. Dort hätten sie »amerikanischen Marineeinheiten und Streitkräften« Schaden zugefügt, wobei »sehr viele Amerikaner ums Leben gekommen« seien.
Eine amerikanische Insel, auf der sehr viele Amerikaner ums Leben gekommen seien – das war die Botschaft, die er vermitteln wollte. Während Roosevelt die Philippinen zu Ausland herabstufte, wertete er Hawai’i auf, indem er es ausdrücklich als »amerikanisch« bezeichnete.
»Gestern, am 7. Dezember 1941 – ein Datum, das als Tag der Schande in Erinnerung bleiben wird –, wurden die Vereinigten Staaten von Amerika unangekündigt und vorsätzlich von See- und Luftstreitkräften des japanischen Reiches angegriffen« – so begann Roosevelt seine Rede. Man beachte, dass in dieser Formulierung Japan ein »Reich« (Empire) ist, während die Vereinigten Staaten dies nicht sind. Man beachte auch die Betonung des Datums. Von allen japanischen Angriffen fielen dank der Wechselfälle der internationalen Datumsgrenze nur die Ereignisse in Hawai’i und auf den Midways auf den 7. Dezember. Überall sonst war es der 8. Dezember – das Datum, das auch die Japaner gewöhnlich für diese Angriffe nennen.
Versuchte Roosevelt mit der Betonung dieses Datums ganz bewusst, Hawai’i allein ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken? Höchstwahrscheinlich nicht. Dennoch förderte seine Rede über ein »Datum, das als Tag der Schande in Erinnerung bleiben wird«, ein enges Verständnis des Geschehens, das für andere Schauplätze wie die Philippinen nur wenig Raum ließ.
Für die Menschen auf den Philippinen konnte das sehr ärgerlich sein. Ein Reporter beschrieb, wie in Manila eine Menschenmenge Roosevelts Rede im Radio verfolgte. Der Präsident habe über Hawai’i und die vielen Todesopfer dort gesprochen. Die Philippinen habe er dagegen nur »äußerst beiläufig« erwähnt. Roosevelt habe den Krieg »als etwas erscheinen lassen, das nahe bei Washington und fern von Manila geschah«.[9] Das erlebte man auf den Philippinen völlig anders, wo weiterhin die Luftschutzsirenen heulten. »Für die Menschen in Manila ist der Krieg etwas, das hier und jetzt geschieht und uns betrifft«, schrieb der Reporter weiter. »Und wir haben keine Luftschutzbunker.«
Hawai’i, die Philippinen, Guam – es war unklar, was man von diesen Orten halten und wie man sie nennen sollte. An der Wende zum 20. Jahrhundert, als viele dieser Territorien erworben wurden (Puerto Rico, die Philippinen, Guam, Amerikanisch-Samoa, Hawai’i), war ihr Status eindeutig. Es waren, wie Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson sie unumwunden nannten, Kolonien.[10]
Aber dieser Geist eines unverblümten Imperialismus währte nicht lange. Als die Gemüter sich nach ein bis zwei Jahrzehnten abgekühlt hatten, wurde das K-Wort zu einem Tabu. »Das Wort Kolonie darf nicht mehr zur Kennzeichnung der Beziehungen zwischen unserem Staat und seinen abhängigen Bevölkerungen verwendet werden«, mahnte 1914 ein Offizieller.[11] Man bevorzugte einen harmloseren Ausdruck, mit dem sie alle bezeichnet werden konnten: Territorien.
Der Ausdruck war harmloser, weil die Vereinigten Staaten auch zuvor schon Territorien besessen hatten, zum Beispiel Arkansas und Montana. Sie hatten einen bevorzugten Platz am nationalen Firmament. Die westlichen Territorien waren die frontier, die vorderste Front bei der Erweiterung des Landes. Sie hatten vielleicht nicht sämtliche Rechte eines Bundesstaates, doch wenn sie erst einmal »besiedelt« (d.h. mit Weißen bevölkert) waren, hieß man sie im Schoße der Nation gerne als Bundesstaaten willkommen.
Wenn Gebiete wie die Philippinen oder Puerto Rico als Territorien bezeichnet wurden, meinte man damit etwas anderes. Im Unterschied zu den westlichen Territorien waren sie nicht selbstverständlich dazu bestimmt, Bundesstaaten zu werden. Und ebenso wenig galten sie als integrale Bestandteile der Nation.
Auffällig an den Überseeterritorien war tatsächlich, dass man selten auch nur über sie sprach. Das Kartenbild des Landes, das die meisten im Kopf hatten, umfasste Gebiete wie die Philippinen nicht. Auf diesen kognitiven Karten (mental maps) erschienen die Vereinigten Staaten als zusammenhängende Einheit aus Bundesstaaten, die von Atlantik und Pazifik, von Mexiko und Kanada begrenzt wurde.
So sehen die meisten Menschen die Vereinigten Staaten auch heute noch, eventuell unter Hinzufügung von Alaska und Hawai’i. Der Politikwissenschaftler Benedict Anderson spricht hier von einer »Landkarte als Logo« oder einer »Logokarte«.[12] Das heißt, wenn das Land ein Logo besäße, wäre es dieses Bild.
Logokarte der Vereinigten Staaten.
Problematisch an dieser Logokarte ist, dass sie nicht stimmt. Die Form entspricht nicht den rechtlichen Grenzen des Landes. Am deutlichsten erkennbar ist hier, dass Alaska und Hawai’i fehlen, obwohl sie 1959 zu Bundesstaaten wurden und heute auf nahezu allen publizierten Landkarten der USA erscheinen. Doch auch Puerto Rico fehlt, das zwar kein Bundesstaat ist, aber seit 1899 zum Land gehört. Haben Sie jemals eine Karte der Vereinigten Staaten gesehen, die auch Puerto Rico umfasst hätte? Oder Amerikanisch-Samoa, Guam, die Amerikanischen Jungferninseln, die Nordmarianen oder eine der kleineren Inseln, die im Laufe der Jahre von den USA annektiert wurden?
1941, im Jahr des japanischen Angriffs, hätte ein akkurateres Bild so ausgesehen, wie in Abb. 3 dargestellt:
Groß-USA, 1941: (obere Reihe von links nach rechts:) Alaska, Hauptland; (mittlere Reihe) Guam, Amerikanisch-Samoa, Philippinen, Hawai’i, Puerto Rico und Amerikanische Jungferninseln; (unterer Reihe – nicht maßstabsgetreu) pazifische Inselbesitzungen (links) und karibische Inselbesitzungen (rechts).
Diese Karte[13] zeigt den vollen territorialen Umfang des Landes: der »Greater United States«, wie manche dieses Gebilde um die Wende zum 20. Jahrhundert nannten.[14] Nach diesem Bild stellt das Gebiet, das normalerweise als Vereinigte Staaten von Amerika bezeichnet wird – die Logokarte –, nur einen Teil des Landes dar. Einen großen und privilegierten Teil, gewiss, aber dennoch nur einen Teil. Die Bewohner der Territorien sprechen hier oft vom mainland, dem »Hauptland« oder auch Kontinent.
Ich habe diese Karte gezeichnet, um die bewohnten Teile der Greater United States im selben Maßstab und mit derselben Flächenprojektion darzustellen. So schrumpft Alaska denn hier auch nicht, damit es auf einer kleinen Nebenkarte Platz findet, wie das meist geschieht. Es ist in der korrekten Größe abgebildet – und es ist riesig. Auch die Philippinen sind groß, und die hawaiianische Inselkette – die gesamte Kette, nicht nur die acht Hauptinseln, die auf den meisten Karten dargestellt werden – erstreckten sich fast von Florida bis nach Kalifornien, wenn man sie dem Hauptland überlagerte.
Die Karte zeigt auch Territorien, die sich hinsichtlich der Größe am anderen Ende der Skala befinden. In den hundert Jahren vor 1940 erhoben die Vereinigten Staaten Anspruch auf gut einhundert unbewohnte Inseln in der Karibik und im Pazifik. Einige dieser Ansprüche gerieten mit der Zeit in Vergessenheit – Washington war gelegentlich erstaunlich nachlässig im Umgang mit tabellarischen Aufstellungen. Die 22 Inseln, die ich hier aufführe, sind jene, die in den 1940er Jahren in offiziellen Dokumenten (in der Volkzählung oder in Berichten der Regierung) erscheinen. Ich habe sie als Punktwolken in der linken und rechten unteren Ecke wiedergegeben, obwohl sie in Wirklichkeit so klein sind, dass sie gar nicht sichtbar wären, wenn ich sie im korrekten Maßstab gezeichnet hätte.
Warum führe ich sie alle auf? Welche Bedeutung hat es, dass die Vereinigten Staaten, um nur ein Beispiel zu nennen, die Howland-Insel besaßen, ein unwirtliches Stück Land mitten im Pazifik, das kaum größer ist als der Central Park in New York? Howland war zwar nicht groß oder bevölkerungsreich, doch im Zeitalter des Flugzeugs durchaus nützlich. Mit beträchtlichem Kostenaufwand schaffte man Baugerät und Baumaterialien auf die Insel und baute dort eine Landebahn – Amelia Earhart befand sich auf dem Flug zu dieser Insel, als sie abstürzte. Die Japaner sorgten sich darum, was die Amerikaner mit dieser günstig gelegenen Landebahn anfangen konnten, und bombardierten Howland einen Tag nach ihren Angriffen auf Hawai’i, Guam, Wake, die Midways und die Philippinen.
In strategischer Hinsicht besaßen diese Pünktchen durchaus eine Bedeutung.
Die übliche Logokarte schließt all das aus – große Kolonien ebenso wie winzige Inseln. Und in noch einer weiteren Hinsicht ist sie irreführend. Sie erweckt den Eindruck, die Vereinigten Staaten wären politisch ein einheitlicher Raum: eine Vereinigung von Staaten, die der Union freiwillig beigetreten wären und auf gleichem Fuß miteinander stünden. Das stimmt jedoch nicht, und es stimmte noch nie. Seit dem Tag, als die Unabhängigkeitserklärung ratifiziert wurde, waren und sind die USA eine Ansammlung von Bundesstaaten und Territorien. Sie waren und sind ein geteiltes Land, gespalten in zwei Gebietsteile mit unterschiedlicher Rechtsstellung.
Die Vereinigten Staaten von Amerika bestehen, wie der Name schon sagt, aus einer Union amerikanischer Staaten. Aber es gibt noch einen anderen Teil, der kein Mitglied der Union, kein Bundesstaat ist und (während des größten Teils der Geschichte) nicht in Amerika lag.
Und mehr noch, in diesem anderen Teil lebten und leben zahlreiche Menschen. Hier die Ergebnisse der Volkszählung in den bewohnten Territorien für 1940, das Jahr vor Pearl Harbor.
Territorium
Zeitraum der Zugehörigkeit
Bevölkerung 1940
Philippinen
1899–1946
16356000
Puerto Rico
1899–heute
1869255
Hawai’i
1898–1959 (seither Bundesstaat)
423330
Alaska
1867 – 1959 (seither Bundesstaat)
72524
Panamakanalzone
1904–1979
51827
US-Jungferninseln
1917–heute
24889
Guam
1899–heute
22290
Amerik.-Samoa
1900–heute
12908
Insgesamt
18833023
Hauptland
131669275
Das sind die bewohnten US-Territorien, wie der Zensus sie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs aufführte. Die 118933 aus dem Hauptland stammenden und in den Territorien stationierten Militärangehörigen wurden nicht der Bevölkerung des jeweiligen Territoriums zugerechnet, so dass Inseln mit militärischen Außenposten, aber ohne lokale Bevölkerung (wie das Wake-Atoll) hier nicht aufgeführt sind. Die Panamakanalzone war in völkerrechtlichem Sinne nur ein von den USA gepachtetes Gebiet, wurde in der Volkszählung aber dennoch berücksichtigt.
Nahezu 19 Millionen Menschen lebten in den Kolonien, der größte Teil davon auf den Philippinen. War das viel? Nicht im Vergleich zum weltumspannenden britischen Empire, das sich damals einer Gesamtbevölkerung von mehr als 400 Millionen Menschen rühmte (deren übergroße Mehrheit in Indien lebte). Dennoch war das Imperium der Vereinigten Staaten von beträchtlicher Größe. Hinsichtlich der Bevölkerungszahl waren die USA zur Zeit von Pearl Harbor das fünftgrößte Land der Erde.[15]
Setzt man diese 19 Millionen Einwohner der Territorien ins Verhältnis zur gesamten US-amerikanischen Bevölkerung, zeigt sich, dass in unserem Bezugsjahr 1940 jeder achte Einwohner der USA(12,6 Prozent) außerhalb der damaligen Bundesstaaten lebte.[16] Zum Vergleich sei angemerkt, dass damals nur jeder zwölfte US-Einwohner ein Afroamerikaner war.[17] Mit anderen Worten, wer am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in den Vereinigten Staaten lebte, war mit größerer Wahrscheinlichkeit kolonisiert als schwarz, in einem Verhältnis von 3:2.
Damit möchte ich natürlich nicht eine Form der Unterdrückung gegen eine andere ausspielen. Tatsächlich sind die Geschichte der Afroamerikaner und die der kolonisierten Völker eng miteinander verbunden (und überlappen sich gelegentlich, wie bei der afrokaribischen Bevölkerung in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln). Der seit der Sklaverei im Lande grassierende Rassismus traf auch die Territorien. Wie den Afroamerikanern, so verwehrte man auch den kolonisierten Bürgern das Wahlrecht und die vollen staatsbürgerlichen Rechte, man bezeichnete sie als »Nigger«, missbrauchte sie für gefährliche medizinische Experimente und nutzte sie im Krieg als Bauernopfer. Auch sie mussten in einem Land zurechtkommen, in dem das Leben mancher Menschen zählte und das Leben anderer nicht.
Nimmt man die Greater United States in den Blick, zeigt sich, dass »Rasse« sogar eine noch zentralere Rolle in der US-amerikanischen Geschichte spielte als gemeinhin angenommen. Es ging nicht nur um Schwarze und Weiße, sondern auch um Filipinos, Hawaiianer, Samoaner, Guamesen und andere Identitäten. »Rasse« prägt nicht nur das Leben von Menschen, sondern das ganze Land – den Verlauf der Grenzen ebenso wie die Definition, wer als »Amerikaner« gilt. Blickt man über die Logokarte hinaus, sieht man plötzlich eine ganze Reihe von Kämpfen um die Frage, was es bedeutet, ein Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein.
Über die Logokarte hinauszublicken konnte jedoch für die Bewohner des Hauptlandes schwierig sein. Die Landkarten, die sie benutzten, zeigten nur selten die Territorien. Selbst die Weltatlanten waren verwirrend. Der in Kriegszeiten bei Rand McNally erschienene Ready Reference Atlas of the World stufte wie viele andere Atlanten der Zeit Hawai’i, Alaska, Puerto Rico und die Philippinen als »Ausland« ein.
Die Mädchen einer siebten Klasse der Western Michigan College Training School in Kalamazoo waren irritiert.[18] Sie hatten versucht, das Kriegsgeschehen auf ihren Landkarten zu verfolgen. Und sie fragten sich: Wie konnte der Angriff auf Pearl Harbor ein Angriff auf die Vereinigten Staaten gewesen sein, wenn Hawai’i doch Ausland war? Sie schrieben an Rand McNally und baten um Aufklärung.
»Hawaii gehört zwar zu den Vereinigten Staaten«, antwortete der Verlag, »ist jedoch kein integraler Bestandteil dieses Landes. Es liegt jenseits der Küsten unseres Kontinents und kann deshalb logischerweise nicht innerhalb der eigentlichen Vereinigten Staaten gezeigt werden.«[19]
Die Mädchen waren mit dieser Auskunft nicht zufrieden. Hawai’i ist kein integraler Bestandteil dieses Landes? »Wir halten diese Aussage für falsch«, schrieben sie. Das sei »keine Erklärung, sondern ein Alibi«. Und sie fuhren fort: »Wir haben den Eindruck, der Rand-McNally-Atlas ist irreführend und ein guter Grund für die Menschen in den Außenbesitzungen, irritiert und beunruhigt zu sein.«[20] Die Mädchen schickten ihre Korrespondenz an das Innenministerium (in dessen Archiv ich sie gefunden habe) und baten um eine Stellungnahme.
Natürlich hatten die Siebtklässlerinnen recht. Ein offizieller Vertreter des Ministeriums stellte klar, dass Hawai’i tatsächlich Teil der Vereinigten Staaten sei.[21]
Das staatliche Vorgehen auf diesem Gebiet konnte allerdings ebenso irreführend sein wie der Atlas von Rand McNally. Man denke etwa an die Volkszählung. Nach der Verfassung betraf die Volkszählung allein die Bundesstaaten, doch sie hatte immer schon auch die Territorien umfasst. Zumindest die Territorien auf dem Kontinent. Bei den Überseeterritorien verfuhr man anders. Dort führte man die Zählung nicht immer in denselben Jahren, mit denselben Erhebungsbögen und unter Einschaltung derselben Behörden durch wie im Hauptland. Daraus folgte, dass die Ergebnisse nicht miteinander vergleichbar waren und hier in statistischer Hinsicht eine Trennung erfolgte.
Doch auch wenn brauchbare Zahlen zu den Überseeterritorien vorlagen, wurden sie nicht verwendet. Der alle zehn Jahre veröffentlichte Volkszählungsbericht nannte zu Beginn zwar pflichtschuldig die Bevölkerungszahlen für die Territorien, ließ sie in fast allen folgenden Berechnungen jedoch stillschweigend weg. Im Bericht von 1910 hieß es, die Statistiken berücksichtigten nur »die eigentlichen Vereinigten Staaten«.[22] Die »eigentlichen Vereinigten Staaten« war kein juristischer Begriff, doch die Verantwortlichen erwarteten, dass alle ihn verstanden. Sie rechtfertigten ihr Vorgehen mit der Behauptung, es gebe »offenkundige Unterschiede« zwischen den Menschen in den Überseeterritorien und denen im Hauptland.
So zeigte man dem Land wie schon bei der Logokarte ein strategisch beschnittenes Familienfoto. Leser des Zensusberichts von 1940 erfuhren, dass die größte Minderheit in den Vereinigten Staaten die Afroamerikaner seien, die größten Städte fast ausnahmslos an der Ostküste lägen und sich das Zentrum der Bevölkerungsverteilung in Sullivan County in Indiana befinde. Hätte man die Überseeterritorien – wie einst die westlichen Territorien – gleichfalls berücksichtigt, hätte sich den Lesern des Berichts ein anderes Bild geboten. Sie hätten ein Land gesehen, dessen größte Minderheit aus Asiaten bestand, zu dessen größten Städten auch Manila gehörte (damals etwa so groß wie Washington D.C. oder San Francisco) und dessen Bevölkerungszentrum sich in New Mexico befand.
Doch das waren nicht die Volkszählungsergebnisse, die den Bewohnern des Hauptlandes präsentiert wurden. Das Land, das man ihnen auf Landkarten, in Atlanten und offiziellen Berichten zeigte, hatte die Gestalt der Logokarte. Und die Folge war eine tiefe Verwirrung. »Die meisten Menschen in unserem Land, darunter auch gebildete Leute, wissen wenig oder gar nichts über unsere Überseebesitzungen«, hieß es in einem amtlichen Bericht aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. »Tatsächlich wissen zahlreiche Menschen nicht einmal, dass wir überhaupt Überseebesitzungen haben. Sie meinen, nur ›Ausländer‹ wie etwa die Briten hätten ein ›Empire‹. Amerikaner sind zuweilen erstaunt, wenn sie hören, dass auch wir ein ›Empire‹ haben.«[23]
Die Behauptung, dass die Vereinigten Staaten ein Imperium seien, ist heute nicht mehr so umstritten. Der linksgerichtete Autor Howard Zinn sprach in seinem äußerst populären Buch A People’s History of the United States von einem »amerikanischen Weltreich«,[24] und dessen in der Art eines Bildromans gehaltener Ableger trägt den Titel A People’s History of American Empire. Der Politiker Pat Buchanan warnt von ganz weit rechts außen, dass die Vereinigten Staaten »denselben Weg wie das britische Empire« gingen.[25] Und in dem gewaltigen politischen Spektrum, das zwischen Zinn und Buchanan liegt, gibt es Millionen von Menschen, die bereitwillig einräumen, dass die Vereinigten Staaten zumindest in gewissem Sinne als Imperium gelten können.
Das lässt sich auf unterschiedliche Weise begründen.[26] Die Enteignung der amerikanischen Indianer und deren Verbannung in Reservate waren ganz eindeutig imperialistisch. In den 1840er Jahren dann führten die Vereinigten Staaten einen Krieg gegen Mexiko und eroberten ein Drittel des Landes. Fünfzig Jahre später folgte der Krieg gegen Spanien, in dessen Gefolge die USA weite Teile der spanischen Überseebesitzungen übernahmen.
Bei Imperien geht es nicht allein um Landnahme. Wie nennen Sie zum Beispiel die Unterdrückung der Afroamerikaner? W.E.B. Du Bois war der Ansicht, die Schwarzen in den Vereinigten Staaten ähnelten eher kolonialen Untertanen als Bürgern. Viele andere schwarze Denker, darunter Malcolm X und die Black Panthers, pflichteten ihm bei.[27]
Oder was ist mit der Ausbreitung US-amerikanischer Wirtschaftsmacht im Ausland? Die Vereinigten Staaten mögen Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht physisch erobert haben, doch das hinderte die Franzosen nicht daran, sich über die »Coca-Cola-Kolonisierung« zu beklagen. Die Kritiker dort hatten das Gefühl, von der amerikanischen Wirtschaft überschwemmt zu werden. Heute, da der Dollar die weltweite Leitwährung darstellt und McDonald’s in mehr als hundert Ländern vertreten ist, kann man sehen, dass an dieser These durchaus etwas dran ist.
Dann sind da noch die militärischen Interventionen. Seit dem Zweiten Weltkrieg rückte das amerikanische Militär in ein Land nach dem anderen ein. Die großen Kriege sind bestens bekannt: Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan. Es gab jedoch auch einen ständigen Strom kleinerer Eingriffe. Seit 1945 wurden amerikanische Streitkräfte wegen bestehender oder potentieller Konflikte in 211 Fällen ins Ausland geschickt, insgesamt in 67 Länder.[28] Das mag man Friedenserhaltung nennen oder Imperialismus. Ganz eindeutig aber sind die USA kein Land, das die Finger bei sich behält.
Bei allem Gerede über ein Imperium wird allerdings eines häufig übersehen, nämlich der territoriale Aspekt. Viele dürften aus den oben genannten Gründen einräumen, dass die Vereinigten Staaten ein Imperium waren und sind. Aber wie viel könnten die meisten von ihnen über die Kolonien selbst sagen? Ich wette, nicht sonderlich viel.
Und wie sollten sie das auch können? In Lehrbüchern und Gesamtdarstellungen der US-amerikanischen Geschichte gibt es stets auch ein Kapitel über den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898, in dessen Anschluss die USA viele der Territorien erwarben, und über den Philippinisch-Amerikanischen Krieg, der darauf folgte (»das schlechteste Kapitel in fast jedem Buch«, wie ein Rezensent klagte[29]). Danach wird es jedoch still, wenn es um diesen Aspekt geht. Das territoriale Imperium wird nicht als solches behandelt, sondern nur als eine Episode. Nachdem die Kolonien erworben sind, verschwinden sie aus dem Blickfeld.
Nicht dass es darüber gar keine Informationen gäbe. Wissenschaftler, von denen viele an der These eines Imperiums an diversen Orten arbeiten, erforschen dieses Thema seit Jahrzehnten intensiv.[30] Nur wenn es darum geht, den Blick zu weiten und die Geschichte des Landes als Ganzes zu betrachten, fallen die Territorien meist heraus. An der Verwirrung und achselzuckenden Gleichgültigkeit der Bewohner des US-amerikanischen Hauptlandes zu Zeiten von Pearl Harbor hat sich nicht sonderlich viel geändert.[31]
Das Problem liegt letztlich nicht in mangelndem Wissen. In den Bibliotheken finden sich buchstäblich Tausende von Büchern zu den Überseeterritorien der Vereinigten Staaten. Das Problem liegt darin, dass diese Bücher gleichsam kaltgestellt wurden – man hat sie gewissermaßen in die falschen Regale eingeordnet. Sie existieren, doch solange die Logokarte unser Denken bestimmt, erscheinen sie als irrelevant. Sie erscheinen als Bücher über fremde Länder.
Ich gestehe, dass mir dieser Einordnungsfehler selbst unterlaufen ist. Obwohl ich in meinem Promotionsstudium US-amerikanische Außenpolitik studierte und zahllose Bücher über das »amerikanische Imperium« – die Kriege, die Staatsstreiche und sonstigen Einmischungen in die Angelegenheiten fremder Länder las, erwartete doch nie jemand von mir auch nur das elementarste Wissen über die Territorien. Sie schienen einfach nicht wichtig zu sein.
Erst als ich nach Manila fuhr, um etwas ganz anderes zu erforschen, machte es bei mir Klick. Wenn ich dort Archive aufsuchte, fuhr ich gewöhnlich mit »Jeepneys« – von den Amerikanern ausgemusterten und umgebauten Militärjeeps. Ich wohnte in einem Viertel der Metropolregion Manila, in dem die Straßen nach US-amerikanischen Universitäten (Yale, Columbia, Stanford, Notre Dame), Bundesstaaten oder Städten (Chicago, Detroit, New York, Brooklyn, Denver) oder Präsidenten (Jefferson, Van Buren, Roosevelt, Eisenhower) benannt waren. Wenn ich mein Ziel, die Ateneo de Manila University, eine der angesehensten Hochschulen des Landes, erreichte, hörte ich die Studenten in einem für meine pennsylvanischen Ohren nahezu akzentfrei klingenden Englisch sprechen.
Das Imperium mag vom Hauptland aus nur schwer zu erkennen sein – an den der Kolonialherrschaft unterworfenen Orten ist es dagegen unmöglich zu übersehen.
Ich las über die philippinische Kolonialgeschichte und wurde dadurch auch neugierig auf andere Orte: auf Puerto Rico, auf Guam und auf Hawaii, bevor es den Status eines Bundesstaates erhielt. Diese Orte sind doch Teil der Vereinigten Staaten, dachte ich. Aber warum hatte ich sie bis dahin nicht auch als Teil der US-amerikanischen Geschichte gesehen?
Als ich meine mentale Bibliothek neu ordnete, kam eine erstaunlich andere Version der amerikanischen Geschichte ans Licht. Ereignisse, die bislang vollkommen vertraut gewirkt hatten, erschienen plötzlich in einem anderen Licht. Pearl Harbor war da nur die Spitze des Eisbergs. Altbekannte kulturelle Artefakte – das Musical Oklahoma!, die Mondlandung, Godzilla, das Friedenszeichen – erhielten eine ganz neue Bedeutung. Obskure historische Episoden, die ich kaum zur Kenntnis genommen hatte, erschienen nun als überaus bedeutsam. Ich erwischte mich dabei, wie ich wehrlose Kollegen auf den Gängen anhielt, um ihnen die Neuigkeiten mitzuteilen. »Wussten Sie, dass Nationalisten in sieben Städten Puerto Ricos eine Revolte anzettelten, die in einem Attentatsversuch auf Harry Truman gipfelte? Und dass diese Nationalisten vier Jahre später sogar das Kapitol angriffen?«[32]
Philippine Islands, USA: ein Zehn-Peso-Schein. Überall in den Territorien waren die Kolonisierten gezwungen, Geldscheine mit den Köpfen amerikanischer Staatsmänner zu benutzen. Ausnahmsweise diente dieser philippinische Geldschein als Grundlage für die Gestaltung des vertrauten US-Dollars und nicht umgekehrt.
In diesem Buch möchte ich zeigen, wie die US-amerikanische Geschichte aussähe, wenn mit »Vereinigte Staaten« die Greater United States gemeint wären und nicht nur die Logokarte. Um es schreiben zu können, bin ich an Orte gefahren, die US-amerikanische Historiker gewöhnlich nicht aufsuchen, von Fairbanks bis Manila. Zugleich stütze ich mich jedoch in beträchtlichem Maße auf Erkenntnisse und Forschungen zu den Territorien, die von Wissenschaftlern über Generationen zusammengetragen wurden. Letztlich ist der wichtigste Beitrag dieses Buchs nicht archivalischen Charakters, wie er es wäre, wenn es einige noch nie ausgewertete Dokumente ans Licht brächte. Es geht vielmehr um die Perspektive und darum, eine bereits bekannte Geschichte anders zu betrachten.
Die Geschichte der Greater United States, wie ich sie inzwischen sehe, lässt sich in drei Akten erzählen. Der erste ist die Expansion nach Westen, bei der die nationalen Grenzen immer weiter nach Westen vorgeschoben und die Indianer vertrieben wurden. Das ist nicht die Hauptgeschichte, die hier erzählt wird, aber deren Ausgangspunkt. Selbst diese gut bekannte Geschichte zeigt bisher unbekannte Aspekte, wenn wir beim Blick in die Vergangenheit die Territorien im Sinn behalten, etwa hinsichtlich der Schaffung eines riesigen gesamtindianischen Territoriums in den 1830er Jahren – die wohl erste Kolonie der Vereinigten Staaten.
Der zweite Akt spielt jenseits des nordamerikanischen Kontinents, und es ist erstaunlich, wie schnell er begann. Nur drei Jahre nachdem die Vereinigten Staaten die Umrisse ihrer Logokarte vollständig ausgefüllt hatten, begannen sie mit der Annexion neuer Territorien in Übersee. Als Erstes erhoben sie Anspruch auf Dutzende unbewohnte Inseln in der Karibik und im Pazifik. Danach war 1867 Alaska an der Reihe. Von 1898 bis 1900 folgte dann die Einverleibung eines Großteils des spanischen Kolonialreichs (der Philippinen, Puerto Ricos und Guams) sowie die Annexion der nicht zu Spanien gehörenden Inselgruppen Hawai’i, Wake und Amerikanisch-Samoa. Schließlich kauften die Vereinigten Staaten 1917 die Amerikanischen Jungferninseln. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs machten die Territorien fast ein Fünftel der gesamten Landfläche der Greater United States aus.
Eine Expansion dieser Art war typisch für das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Wenn Länder an Macht gewannen, wurden sie in der Regel auch größer. So hätte man erwarten können, dass die Vereinigten Staaten weiterwuchsen. Tatsächlich besaßen sie am Ende des Zweiten Weltkriegs die Hoheit über zahlreiche Territorien. Sie hatten die pazifischen Territorien zurückerobert, besaßen Tausende von Militärstützpunkten in aller Welt und hielten Teile von Korea, Deutschland und Österreich sowie ganz Japan besetzt. Fasst man alle unter US-amerikanischer Jurisdiktion stehenden Gebiete – Kolonien und besetzte Länder – zusammen, gehörten zu den Greater United States Ende 1945 gut 135 Millionen Menschen, die nicht im Hauptland lebten.[33]
Bemerkenswert ist, was als Nächstes geschah. Statt die besetzten Gebiete zu annektieren (wie nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898), taten die Vereinigten Staaten etwas bis dahin Beispielloses. Sie hatten einen Krieg gewonnen und gaben Territorien auf. Die Philippinen, die größte Kolonie, entließ man in die Unabhängigkeit. Die Besetzungen wurden rasch zum Abschluss gebracht, und nur eine von zahlreichen dünnbesiedelten Inseln in Mikronesien wurde annektiert. Andere Territorien erhielten zwar nicht die Unabhängigkeit, aber einen neuen Status. Puerto Rico wurde zu einem assoziierten Freistaat, wodurch eine auf Zwang basierende Beziehung nach außen hin durch ein in Zustimmung gründendes Verhältnis ersetzt wurde. Hawai’i und Alaska wurden nach einiger Verzögerung zu Bundesstaaten und überwanden damit eine jahrzehntelange rassistische Entschlossenheit, sie aus der Union herauszuhalten.
Das ist der dritte Akt, und er wirft eine Frage auf. Warum nahmen die Vereinigten Staaten auf dem Höhepunkt ihrer Macht Abstand davon, ein Kolonialreich zu schaffen? Ich werde dieser Frage ausführlich nachgehen, weil sie äußerst wichtig ist, aber selten gestellt wird.
Ein Teil der Antwort liegt in der Tatsache, dass die kolonialen Untertanen Widerstand leisteten und die Vereinigten Staaten zum Rückzug zwangen. Das geschah sowohl innerhalb der Greater United States, wo dies zu Statusänderungen bei den vier größten Kolonien führte, als auch außerhalb, wo der Anti-Imperialismus weitere koloniale Eroberungen erschwerte.
Ein weiterer Teil hat mit Technologie zu tun. Während des Zweiten Weltkriegs perfektionierten die Vereinigten Staaten eine Reihe außergewöhnlicher Technologien, die ihnen viele Vorzüge eines Imperiums verschafften, ohne dass sie tatsächlich Kolonien hätten besitzen müssen. Plastik und andere synthetische Stoffe machten es möglich, tropische Naturprodukte durch künstliche Erzeugnisse zu ersetzen. Flugzeuge, Funk und DDT sorgten dafür, dass man Güter, Ideen und Menschen leicht in fremde Länder bringen konnte, ohne sie zu annektieren. Außerdem gelang es den Vereinigten Staaten, viele ihrer Objekte und Praktiken – vom Schraubengewinde über Straßenschilder bis hin zur englischen Sprache – zu internationalen Standards zu machen, und auch dadurch gewannen sie größeren Einfluss in Gebieten, die nicht ihrer Hoheit unterstanden. Aufgrund dieser genannten Technologien waren die Vereinigten Staaten nicht mehr auf das klassische Modell des Kolonialreichs angewiesen. Sie ersetzten die Kolonisierung durch die Globalisierung.
Globalisierung ist ein Modewort, und es ist leicht, sehr vage darüber zu reden – etwa im Sinne besserer Technologien, die eine Welt voller Ungleichheit immer enger zusammenführen. Doch diese neuen Technologien waren nicht plötzlich da. Viele wurden in den 1940er Jahren innerhalb kürzester Zeit vom US-Militär mit dem Ziel entwickelt, den Vereinigten Staaten ein neues Verhältnis zum Territorium zu ermöglichen. Innerhalb weniger dramatischer Jahre schuf das Militär ein weltumspannendes logistisches Netzwerk, an dem besonders erstaunlich war, wie wenig es von Kolonien abhing. Erstaunlich war auch, wie sehr es die Vereinigten Staaten ins Zentrum des Welthandels, des weltweiten Verkehrsnetzes und der globalen Kommunikation rückte.
Doch auch im Zeitalter der Globalisierung ist das Territorium nicht bedeutungslos geworden. Die Vereinigten Staaten halten nicht nur an einem Teil ihres Kolonialreichs (mit Millionen von Menschen) fest, sondern üben auch die staatliche Hoheit über zahlreiche kleine Punkte auf der Weltkarte aus. Abgesehen von Guam, Amerikanisch-Samoa, den Nordmarianen, Puerto Rico, den Amerikanischen Jungferninseln und einer Handvoll kleinerer Inselbesitzungen unterhalten die USA gut 800 Militärstützpunkte auf der ganzen Welt.[34]
Diese winzigen Flecken – die Howland-Insel und dergleichen – bilden das Fundament der US-amerikanischen Weltmacht. Sie dienen als Bereitstellungsräume, Startrampen, Nachschublager, Leuchttürme und Laboratorien. Zusammen bilden sie ein »pointillistisches« Imperium (wie ich es in Anlehnung an den Historiker und Kartographen Bill Rankin nennen möchte).[35] Heute erstreckt sich dieses Imperium über den gesamten Erdball.
Nichts von alledem – von den großen Kolonien, den kleinen Inseln oder den Militärbasen – hat im Denken der Bewohner des US-amerikanischen Hauptlandes sonderliche Spuren hinterlassen. Eines der wirklich besonderen Merkmale des Imperiums der Vereinigten Staaten liegt in der Tatsache, dass dieses Imperium so durchgängig ignoriert wurde und weiterhin wird. Abgesehen von einer kurzen Phase nach 1898, in der man die imperialen Dimensionen des Landes stolz zur Schau stellte, spielte sich ein Großteil seiner Geschichte hinter den Kulissen ab.
Das ist tatsächlich einzigartig. Den Briten war vollkommen klar, dass es ein britisches Empire gab. Sie hatten einen Feiertag, den Empire Day, an dem sie es feierten. Frankreich vergaß nicht, dass Algerien französisch war. Nur die Vereinigten Staaten litten und leiden an einer chronischen Verwirrung hinsichtlich ihrer Grenzen.
Der Grund ist leicht zu erraten. Das Land versteht sich als Republik, nicht als Reich. Es entstand aus einer anti-imperialistischen Revolte und kämpfte seither immer wieder gegen Reiche, von Hitlers tausendjährigem Reich und dem japanischen Kaiserreich bis hin zur Sowjetunion, dem »Reich des Bösen«. Selbst in seinen Träumen kämpft es gegen Reiche. Star Wars, eine Saga, die mit einer Rebellion gegen das Galaktische Imperium beginnt, ist eine der kommerziell erfolgreichsten Franchise-Film-Unternehmungen aller Zeiten.
Dieses republikanische Selbstbild der Vereinigten Staaten ist angenehm, aber auch kostspielig. Den größten Teil der Kosten tragen jene, die in den Kolonien, in den besetzten Gebieten und im Umfeld der Militärbasen leben. Die Logokarte verweist sie ins Dunkle, und dort ist das Leben gefährlich. Zu verschiedenen Zeiten hat man auf die Einwohner des US-Imperiums geschossen, man hat sie bombardiert, ausgehungert, interniert, enteignet, gefoltert und zu Versuchskaninchen degradiert. Nur eines wurden sie im Großen und Ganzen nicht: in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Auch für die Bewohner des Hauptlandes ist die Logokarte mit Kosten verbunden. Sie vermittelt ihnen ein beschnittenes Bild ihrer Geschichte, das einen Teil ihres Landes ausschließt. Und es ist ein bedeutender Teil. Wie ich zeigen möchte, geschah in den Territorien sehr viel, was von größter Wichtigkeit für die Einwohner des Hauptlandes war. Die Überseebesitzungen der Vereinigten Staaten haben Kriege und Interventionen ausgelöst, Präsidenten hervorgebracht und Beiträge zur Definition dessen geleistet, was es heißt, ein »US-Amerikaner« zu sein. Nur wenn wir sie in das Bild aufnehmen, sehen wir ein vollständiges Porträt des Landes – nicht wie es sich in der Phantasie darstellt, sondern wie es wirklich ist.
Anmerkung zur Terminologie und Schreibweise
Die Hauptthese dieses Buchs lautet, dass wir uns die Vereinigten Staaten von Amerika anders vorstellen sollten. Statt sie uns als eine zusammenhängende Masse auszumalen, sollten wir ihre Überseebesitzungen, von den großen Kolonien bis hin zu den winzigen Inseln, ernst nehmen und im Blick behalten. Deshalb meine ich stets das gesamte Staatswesen, wenn ich von den »Vereinigten Staaten« spreche. Den in sich zusammenhängenden Teil nenne ich »Hauptland«, da viele in den Territorien ihn so bezeichnen.
Das ist jedoch nicht überall so. Puerto-ricanische Nationalisten etwa bezeichnen die USA und Puerto Rico als zwei verschiedene Länder, um ihrer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass die US-Herrschaft illegitim sei. Ich folge ihnen darin nicht, denn ich befürchte, dadurch könnten die Dinge am Ende nur noch verworrener werden, da der Eindruck entstehen könnte, dass die Vereinigten Staaten lediglich ein Staatenbund wären. Und dadurch würden die imperialen Dimensionen des Landes verschleiert.
Der Imperialismus versieht Menschen und Orte mit fremden Namen. Wie man die Örtlichkeiten und Einheimischen nennt, die unter diese Bezeichnungen fallen, kann daher eine politisch belastete Frage sein. Ich schreibe Hawai’i mit einem ’Okina, einem in der hawaiianischen Sprache vorkommenden Konsonanten, der als stimmloser glottaler Plosiv gesprochen wird. Darin folge ich der in Hawai’i üblichen Schreibweise und den Empfehlungen des Hawai’i Board on Geographic Names (aber in »hawaiianisch« lasse ich das Zeichen weg). Gleichfalls in Übereinstimmung mit der lokalen Schreibweise verwende ich bei puerto-ricanischen Namen die dort üblichen Akzente (zum Beispiel José Trías Monge), bei philippinischen (wie Jose Laurel) dagegen nicht. Ich schreibe Puerto Rico auch bei der Erörterung der Kolonie in den ersten drei Jahrzenten der US-Herrschaft, als Washington noch auf der anglisierten Schreibweise Porto Rico bestand. Aktivisten, die gegen die US-amerikanische Militärpräsenz auf Guam protestieren, nennen die Insel inzwischen oft mit ihrem Chamorro-Namen Guåhan, doch da diese Bezeichnung noch keine weite Verbreitung gefunden hat, bleibe ich bei Guam. Und obwohl oft behauptet wird, der Ausdruck Indianer sei eine Beleidigung und man müsse statt seiner den Ausdruck Native American (amerikanischer Ureinwohner) verwenden, benutzen Gemeinschaften und Organisationen der Native Americans doch häufig beide Ausdrücke. Deshalb verwende auch ich sie hier als Synonyme. Wo dies möglich ist, benutze ich jedoch spezifischere Bezeichnungen (wie Cherokee oder Ojibwe).
Erster TeilDas Kolonialreich
Erstes KapitelFall und Aufstieg des Daniel Boone
Die dreizehn Kolonien, aus denen die Vereinigten Staaten von Amerika hervorgingen, erklärten 1776 ihre Unabhängigkeit von Großbritannien. Freiheit findet in unterschiedlichen Formen ihren Ausdruck. Nur ein Jahr zuvor erklärten der Jäger Daniel Boone und etwa 30 Gefolgsleute eine Unabhängigkeit anderer Art.[1] Von Schulden geplagt, verließ Boone seine Heimat am Yadkin River in North Carolina und zog nach Westen. Dabei nutzte seine Gruppe einen günstigen Pass über die Bergkette der Appalachen, den Cumberland Gap. Innerhalb eines Monats legten sie gut 200 Meilen zurück und schlugen sich auf der Suche nach besserem Land durch dichtes Buschwerk, Gestrüpp und Schilf.
In den Ebenen Kentuckys fanden Boone und seine Leute, wonach sie suchten. Die Shawnee, die dort lebten, hatten die Bäume sorgfältig dezimiert, so dass dort hohes Gras wachsen konnte, das von Weidetieren gefressen wurde. Für Männer, die ein mühseliges Leben gewohnt waren, glich das Land einem Paradies. »Einen derart reichen Boden hatten wir noch nie gesehen, überzogen von Klee in voller Blüte«, staunte einer von Boones Holzfällern. »In den Wäldern wimmelte es von Wild.«[2] Sie gaben ihrer neuen Siedlung den Namen Boonesborough, nach dem Mann, der sie dorthin geführt hatte.
Oasen in der Wüste verschwinden oft bei genauerem Hinsehen, und so währte denn auch die Begeisterung bei Boones Gefolgsleuten nicht lange. Die satten Wiesen waren zwar keine Fata Morgana, wohl aber das Jagdrevier der Shawnee, deren Anwesenheit es Boones Gruppe schwermachte, die Umgebung jenseits des verteidigten Umkreises der Siedlung zu erkunden. Auf ihre wenigen rudimentären Bauten beschränkt und von allen Seiten bedrängt, verloren viele der Bewohner den Mut und kehrten noch vor dem Ende des Jahres in ihre Heimat zurück.
Oberflächlich betrachtet war Boonesborough allenfalls eine bescheidene Errungenschaft. Doch auch wenn die Siedlung nicht gerade überwältigend wirkte, war sie doch auf längere Sicht von einiger Bedeutung. Sie lag jenseits der Appalachen, die seit mehr als einem Jahrhundert eine – rechtliche und praktische – Barriere für die britischen Siedler in Nordamerika bildeten. Boone hatte einen Weg durch die Wildnis geschlagen und damit einen Kanal geöffnet, durch den schon bald Hunderttausende von Weißen mit schwarzen Sklaven in ihrem Gefolge strömen sollten. Boone war nicht wirklich der »erste Weiße im Westen«, wie einer seiner Biographen behauptete.[3] Aber er war der erste Tropfen aus einem Hahn, der schon bald voll aufgedreht wurde.
Auf europäische Intellektuelle wirkte der ungehobelte Pionier Boone wie Katzenminze. Aufklärungsphilosophen sahen in ihm einen Menschen im Naturzustand, Romantiker einen Flüchtling aus der Zivilisation. Eine obskure biographische Darstellung, die ursprünglich als Anhang zu einer Geschichte Kentuckys veröffentlicht worden war, machte in Europa die Runde, wo sie nachgedruckt und bald schon ins Französische und Deutsche übersetzt wurde.
Auch in der europäischen Literatur hinterließ er Spuren.[4] Die britische Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft hatte eine Affäre mit einem von Boones Bekannten und veröffentlichte gemeinsam mit ihm eine fiktionalisierte Darstellung seines Lebens. Der französische Romantiker François-René de Chateaubriand übernahm Passagen aus Boones Biographie in seinen einflussreichen Roman Les Natchez über einen Franzosen, der unter nordamerikanischen Indianern lebt. Lord Byron, der führende Dichter der Zeit, widmete Boone in seinem Gedicht Don Juan sieben Strophen (»der glücklichste aller Sterblichen«).
Von alledem bemerkte Boone allerdings nichts. Obwohl im Ausland gefeiert, wurde er in seiner Heimat zu seinen Lebzeiten nicht sonderlich verehrt.[5] Er starb 1820 im Alter von 58 Jahren. Es war dasselbe Jahrzehnt, in dem auch Thomas Jefferson und John Adams verschieden, durch einen nahezu unglaublichen Zufall beide am selben Tag, dem 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Das Land war verständlicherweise erschüttert, als Jefferson und Adams starben. »Wären die Pferde und der Feuerwagen herabgekommen, um die Patriarchen abzuholen, wäre das wohl wunderbarer, aber nicht glorreicher gewesen«, schrieb eine New Yorker Zeitung.[6]
Bei Boones Tod geschah dagegen nichts dergleichen. Er starb im Territory of Missouri, westlich von St. Louis. Er hatte kein Geld und kein Land und lebte als Pensionär auf dem kleinen Anwesen seines Sohnes. Abgeordnete des Territoriums trugen ihm zu Ehren schwarze Armbinden, doch die Zeitungen an der Ostküste brauchten mehr als einen Monat, um seinen Tod zu melden, und taten dies meist nur in einer kurzen Notiz. Boone wurde in einem anonymen Grab beigesetzt.
Wie konnte das geschehen? Warum tat niemand etwas? Wussten die führenden Männer des Landes nichts von Boone? Sie wussten von ihm. Begriffen sie nicht, wofür er stand? Sie begriffen es sehr wohl.
Aber es gefiel ihnen nicht.
Die Missachtung, mit der man Boone bedachte, mag überraschend erscheinen. Die Vereinigten Staaten, so wird oft gesagt, waren von Anfang an eine ungeniert auf Expansion ausgerichtete Macht. Ihre Gründerväter hatten einem unterdrückerischen Reich die Freiheit abgerungen und aus Untertanen Bürger sowie aus Kolonien Staaten gemacht. Und sie waren begierig darauf, ihre republikanische Staatsform nach Westen über den ganzen Kontinent zu tragen, bis sie sich von einer Küste bis zur anderen erstreckte. Männer wie Daniel Boone, so mag man meinen, waren unverzichtbare Werkzeuge dieser nationalen Mission.
Aber Boones Weg war übersät mit Hindernissen. Die Briten hatten den Kamm der Appalachen als Grenze für die Besiedlung durch Weiße gesetzt und Boones Vorstoß nach Westen zu einer Straftat gemacht. Das Ende der britischen Herrschaft änderte wenig an Boones Situation. Die Gründerväter beobachteten Pioniere wie ihn mit Misstrauen. Sie waren der »Abschaum« der Nation (schrieb Ben Franklin[7]), »nicht besser als Raubtiere« (J. Hector St. John de Crèvecoeur[8]) oder »weiße Wilde« (John Jay[9]). George Washington warnte vor einer »Besiedlung oder eher noch Überschwemmung des Westens … durch eine Bande von Banditen, die sich jeglicher Autorität widersetzen werden«.[10] Um das zu verhindern, schlug er vor, eine Besiedlungsgrenze zu ziehen, wie die Briten es getan hatten, und jeden Bürger als Verbrecher zu verfolgen, der sie überschritt.
Die Ablehnung war zum Teil sozial bedingt. Die Gründerväter waren kultivierte, gebildete Männer, die das raue Leben der Pioniere als beunruhigend empfanden. Dahinter steckte jedoch auch ein tieferreichendes Problem. Wie die Boonesborough-Siedler festgestellt hatten, waren die Vereinigten Staaten nicht die Einzigen, die Anspruch auf das Land westlich der Appalachen erhoben. Einheimische Völker – in Nationen, Stämmen, Konföderationen und anderen beständigen politischen Einheiten organisiert – hatten ihre eigene Kartographie, ihre eigene Art, die Karte Nordamerikas zu zeichnen. Und im späten 18. Jahrhundert vermochten sie ihren Karten mit Gewalt Geltung zu verschaffen.
Das war der Nerv, den Daniel Boone getroffen hatte. Als er Siedler nach Westen führte, drang er in Indianerland ein. Das führte zu Kämpfen, in die leicht auch die Regierung der Vereinigten Staaten hineingezogen werden konnte. Zugleich führte es zu einer beunruhigenden Verwischung der Grenzen zwischen Europäern und der autochthonen Bevölkerung. Boone hatte Indianer getötet und war mehrfach von ihnen gefangen genommen worden. Er hatte erlebt, dass ein Bruder und zwei seiner Söhne von Indianerhand starben. Aber er war auch während einer dieser Gefangenschaften von einer Shawnee-Familie adoptiert worden und hatte den Namen Sheltowee, »Große Schildkröte«, erhalten. In dieser Zeit hatte er ein »immer vertrauteres und freundschaftlicheres Verhältnis« zu seinen »Eltern, Brüdern, Schwestern und Freunden« gewonnen, wie er selbst es ausdrückte.[11]
Das waren genau die Unternehmungen, die George Washington eine Besiedlungsgrenze nach britischem Vorbild befürworten ließen.[12] Für ihn war dies keine bloß philosophische, sondern auch eine persönliche Frage. Sein Vermögen bestand zu einem Gutteil aus Landbesitz im Westen. Dieses Land behielt seinen Wert nur, wenn er die Kontrolle über dessen Verkauf und Besiedlung behielt. »Banditen« wie Boone, die sich Land einfach nahmen, ohne deren Besitzer im Osten zu fragen, stellten für ihn eine Bedrohung dar. Und Boone selbst war eine ganz besondere Bedrohung, denn sein Anspruch auf Kentucky stand in direktem Konflikt zu Washingtons eigenen Ansprüchen.
Ein lediglich auf dem Papier bestehender Grundbesitz ließ sich von der Ostküste aus nur schwer sichern. Während des Revolutionskriegs hatte Washington seinen beträchtlichen Grundbesitz in die wenig zuverlässigen Hände seines entfernten Vetters Lund Washington gelegt. Unter Lunds nicht sonderlich aufmerksamen Augen ließen sich wilde Siedler auf Washingtons westlichen Besitzungen nieder (nicht in Kentucky, sondern auf anderen, weiter nördlich gelegenen). Erzürnt machte Washington sich auf den Weg über die Appalachen, um auf einer Art Rachefeldzug selbst Ordnung auf seinen Besitzungen zu schaffen.
Die Expedition trug wenig zu einer Mäßigung seiner Verachtung für die Pioniere bei. Er notierte, ihre Zusammenstöße mit Indianern hätten zu »Mord und allgemeiner Unzufriedenheit« geführt.[13] Sie »arbeiten sehr wenig«, klagte er, und die leichteste »Berührung einer Feder« könne sie veranlassen, den Vereinigten Staaten untreu zu werden.[14]
Washington brachte seine Angelegenheiten in Ordnung, doch er blieb auch weiterhin misstrauisch hinsichtlich der politischen Treue der Pioniere. Seine Befürchtungen bestätigten sich in den 1790er Jahren, als einige von ihnen tief im pennsylvanischen Hinterland sich weigerten, die Bundessteuern auf Alkohol zu zahlen, und mit einer gewaltsamen Abspaltung drohten – eine exakte Wiederholung der Bostoner Tea Party, nur diesmal mit Whiskey. Obwohl Washington erst kurz zuvor selbst eine Revolution gegen die finanziellen Machenschaften einer fernen Regierung angeführt hatte, stieß seine Sympathie für die Rebellen doch rasch an ihre Grenzen. Ihr Widerstand, so klagte er gegenüber Jefferson, sei »inzwischen zu offen, zu gewalttätig und zu ernst, als dass man sie weiterhin ignorieren könnte«.[15]
Nochmals ritt Washington westwärts über die Berge, diesmal um eine Rebellion niederzuschlagen. Letztlich brach der Aufstand zusammen, noch bevor Washingtons Truppen eintrafen. Doch die Episode war und ist bis heute, wie der Historiker Joseph Ellis anmerkt, »das erste und einzige Mal, dass ein amtierender amerikanischer Präsident Truppen ins Feld führte«.[16]
Washingtons Ungeduld hinsichtlich der Pioniere bedeutete nicht, dass er gegen die Expansion gewesen wäre. Auf lange Sicht war er selbst darauf angewiesen – um das Land zu stärken und auch um Gewinn aus seinen eigenen Besitzungen im Westen schlagen zu können. Das Problem war eher kurzfristiger Natur. Das Land war riesig, aber die Regierung war schwach. Wilde Siedler, die westwärts über das Gebirge vorstießen, ließen sich unmöglich regieren, und die Kriege, die sie unvermeidlich begannen, waren sehr teuer. Deshalb bestand Washington darauf, dass die Besiedlung in »kompakter« Weise und unter Kontrolle durch die Elite erfolgte.[17] So sollte die Frontier kein Zufluchtsort für herrenlose Menschen wie Boone werden, sondern die vorderste Front eines mit gebührender Geschwindigkeit erfolgenden Vormarschs der Zivilisation sein.
Zur Verwirklichung dieser Vision erfanden die Gründerväter für die Frontier eine eigene politische Kategorie: Territorium. Die Revolution war von einem Staatenbund getragen worden, doch die Grenzen dieser Bundesstaaten wurden mit dem Vorstoß nach Westen unscharf oder überlappten sich sogar wechselseitig. Statt die Frontier unter den Bundesstaaten aufzuteilen, handelten die Führer der Republik Verträge aus, wonach die am Atlantik gelegenen Bundesstaaten sich nur bis zum Mississippi ausdehnen sollten, der den westlichen Rand des Landes markierte. Die westlich des Mississippi gelegene Region sollte stattdessen dem Bund zufallen und nicht als Bundesstaat regiert, sondern als Territorium verwaltet werden.
Die Regierung übernahm also 1784 die Kontrolle über ihr erstes Territorium, als Virginia seinen Anspruch auf einen breiten Streifen Land nördlich des Ohio River aufgab. Diese Abtretung erfolgte, nicht einmal zwei Monate bevor die Vereinigten Staaten formell ihre Unabhängigkeit erhielten, als Großbritannien den Vertrag von Paris ratifizierte. Das heißt, die Vereinigten Staaten von Amerika waren vom ersten Tag an mehr als eine Union von Staaten. Sie waren ein Amalgam aus Bundesstaaten und Territorien.
Bis 1791 waren alle atlantischen Bundesstaaten außer Georgia dem Beispiel Virginias gefolgt und hatten ihre Gebietsansprüche im fernen Westen aufgegeben – mit der Folge, dass in dem genannten Jahr nur etwas mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der USA (55 Prozent) auf Bundesstaaten entfiel.[18]
Was war nun dieses nicht von Bundesstaaten gehaltene Territorium? Die Verfassung blieb in dieser Frage höchst wortkarg und verwies nur mit einem einzigen Satz darauf. Sie gewährte dem Kongress in Artikel 4 das Recht, »über Gebiet und sonstiges den Vereinigten Staaten gehöriges Eigentum zu verfügen und alle nötigen Regeln und Verordnungen zu erlassen«. Das Grundgesetz, das ansonsten im Blick auf Zusatzartikel, Wahlen und die Gewaltenteilung sehr ins Detail geht, ließ die Frage, wie viel vom Land durch den Bund regiert werden sollte, weitgehend offen.
Die Politik bezüglich der Territorien wurde stattdessen in einer Reihe von Gesetzen geregelt, deren berühmtestes die von Jefferson angeregte Northwest Ordinance von 1787 war, die für einen Großteil des heutigen Mittleren Westens galt (für andere Gebiete wurden ähnliche Gesetze verabschiedet). Die Northwest Ordinance wurde zum Bestandteil der nationalen Mythologie und wird in Lehrbüchern als bemerkenswertes Angebot einer »in jeglicher Hinsicht mit den ursprünglichen Bundesstaaten gleichberechtigten« Staatlichkeit gepriesen.[19] Die Territorien brauchten dazu lediglich bestimmte Schwellen bei den Einwohnerzahlen zu überschreiten. Ab 5000 freien Männern konnten sie eine eigene Gesetzgebung einführen, ab 60000 freien Einwohnern (oder früher, falls der Kongress zustimmte) konnten sie Bundesstaaten werden.
Allerdings war das entscheidende Wort hier »konnten«. Nichts davon geschah automatisch, denn der Kongress behielt sich das Recht vor, Territorien zu befördern oder zu behindern, und beides tat er auch. Manchmal lehnte er Anträge auf Eigenstaatlichkeit ab oder ignorierte sie. Deshalb wurden Lincoln, West Dakota, Deseret, Cimarron und Montezuma – die sämtlich um Aufnahme in den Bund baten – keine Bundesstaaten.
Außerdem bedeutete die uneingeschränkte Autorität des Kongresses, dass die Bundesregierung absolute Macht über die Territorien besaß, solange sie nicht in Bundesstaaten umgewandelt worden waren. Anfangs wurden die Territorien von einem ernannten Gouverneur und drei Richtern regiert. Und selbst wenn sie das Recht auf eine eigene Gesetzgebung erlangt hatten, behielt der Gouverneur das Recht, ein Veto gegen Gesetze einzulegen und das Parlament aufzulösen.
James Monroe, der die Northwest Ordinance entworfen hatte, meinte dazu, es handle sich letztlich um ein »Kolonialregime ähnlich jenem, das in diesen Staaten vor der Revolution geherrscht hatte«.[20] Und Jefferson räumte ein, die erste Phase gleiche einer »despotischen Oligarchie«.[21]
Das war eine treffende Bezeichnung. Der erste Gouverneur des Northwest Territory, Arthur St. Clair, ein konservativer Schotte, der Washingtons Adjutant gewesen war, hatte wenig Geduld mit der wilden Frontier. Er empfand sich als einen »auf einen anderen Planeten verbannten armen Teufel«.[22] In seinen Augen war das Territorium eine »abhängige Kolonie«, die nicht von »Bürgern der Vereinigten Staaten« bewohnt wurde, sondern von »Untertanen« der USA[23] (von »weißen Indianern«, wie einer der Richter des Territoriums sie nannte[24]). Da St. Clair die Bewohner des Territoriums für allzu »unwissend« und allzu »schlecht qualifiziert« hielt, um sich selbst zu regieren, nutzte er seine weitreichende Macht, um die Herausbildung von Bundesstaaten zu behindern.[25]
Dasselbe Muster zeigte sich auch im Louisiana Territory, dem Land, das Jefferson 1803 von den Franzosen erwarb. Politiker an der Ostküste regten sich über die Bewohner des gerade annektierten Landes auf: englische Siedler, Katholiken, freie Schwarze, Indianer und Gemischtrassige. »Diese Verfassung wurde niemals so weit ausgelegt und kann niemals so weit ausgelegt werden, dass sie die ganze Wildnis des Westens umfasst«, warnte der Kongressabgeordnete Josiah Quincy, der später Präsident der Harvard University wurde.[26]
Jefferson verstand dieses Gefühl. Die Menschen in Louisiana seien »ebenso unfähig zur Selbstregierung wie Kinder«, meinte er und fügte hinzu, die »Prinzipien der Volksregierung liegen weit jenseits ihrer Verständnismöglichkeiten«.[27] Statt Louisiana das übliche Procedere der Northwest Ordinance durchlaufen zu lassen, fügte Jefferson eine neue Anfangsphase, die Militärregierung, hinzu und schickte die U.S. Army dorthin, damit sie den Frieden sicherte. Um 1806 beherbergte das Territorium Louisiana das größte Militärkontingent des ganzen Landes.[28]
Der von Jefferson ernannte Gouverneur des Louisiana Territory stänkerte in ähnlicher Weise wie St. Clair über die »geistige Dunkelheit« der Einwohner Louisianas. Ihnen das Wahlrecht zu geben, so glaubte er, »wäre ein gefährliches Experiment«.[29]
Einwohner Louisianas protestierten gegen ihre Entrechtung. »Werden am Atlantik geltende politische Grundsätze zum Problem, wenn man sie ans Ufer des Mississippi überträgt?«, fragten sie auf einer Reise in die Hauptstadt.[30] Jefferson zuckte mit den Schultern und tat nichts.[31]
Thomas Jefferson war ebenso wenig gegen die Expansion wie George Washington. Nur stellte er sie sich als einen kontrollierten Prozess vor.
In seinen phantasievolleren Augenblicken träumte Jefferson davon, dass die Vereinigten Staaten sich »über den gesamten nördlichen und vielleicht auch südlichen Kontinent« ausbreiteten, »mit einem Volk, das dieselbe Sprache spricht, mit ähnlichen Staatsformen und mit ähnlichen Gesetzen«.[32] Doch diese vage Phantasie war in seinen Augen allenfalls für »ferne Zeiten« bestimmt. Hinsichtlich der Geschwindigkeit der Expansion waren seine Ambitionen erstaunlich bescheiden. In der Rede zu seiner ersten Amtseinführung verwies er voll Staunen auf das »weite und fruchtbare Land« vom Atlantik bis zum Mississippi und sagte voraus, es werde »genug Raum geben für unsere Nachfahren bis in die tausendste und abertausendste Generation«.[33]
Trotz seiner scheinbaren Zufriedenheit mit den ursprünglichen Dimensionen des Landes gilt Jefferson als Expansionist, und zwar wegen seines Erwerbs Louisianas, durch den er das Land bis weit westlich des Mississippi ausdehnte. Es handelte sich jedoch eher um einen Impulskauf als um eine wohlüberlegte Erwerbung. Als er Unterhändler zu Verhandlungen mit Napoleon nach Paris schickte, machte er nicht einmal den Versuch, größere Gebiete im Westen zu erlangen. Er wünschte sich lediglich brauchbare Häfen am Golf von Mexiko. Die ursprüngliche Antwort, die Jeffersons Emissär auf Napoleons Angebot der gesamten französischen Besitzungen in Nordamerika gab, ist aufschlussreich: »Ich sagte nein, weil unsere Wünsche lediglich New Orleans und die Floridas betreffen.«[34]
Jefferson war mehr an den Häfen als an dem Land interessiert, denn er suchte nicht nach Raum für Siedler. Selbst nach der Annexion Louisianas sah er darin keine Heimstätte für Weiße. Ein Großteil des Landes gehörte weiterhin den Indianern, und »der beste Gebrauch, den wir für eine Weile von dem Land machen können«, so schrieb Jefferson, sei es, die Dinge beim Alten zu belassen.[35]