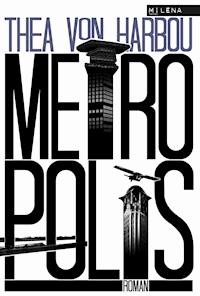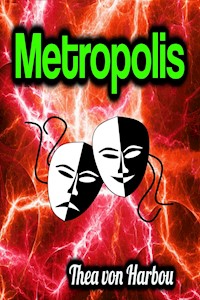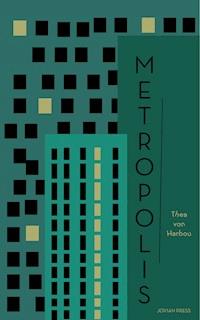3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der junge Baumeister Fürbringer erhält einen seltsamen Auftrag: Er soll für den Maharadscha von Eschnapur ein wundersames, riesiges Grabmal bauen – zum Andenken an dessen verlorene Liebe. Zu niemandem darf er von diesem Auftrag sprechen, in derselben Nacht noch muß er abreisen. Im fernsten Indien, in einem märchenhaften Palast, inmitten eines unheimlichen Sees, begrüßt ihn der Fürst. Trotz des freundlichen Empfangs und der großzügigen Gastfreundschaft ahnt Fürbringer bald, daß irgend etwas nicht stimmt. Der finstere Ramigani belauert ihn, eine geheimnisvolle Frau wandelt nachts durch den Palast, rastlos brüllen gefangene Tiger. Ist Irene, Fürbringers Frau, wirklich auch im Palast gefangen, oder bildet sich der junge Mann das nur ein? Und eines Tages erfährt der entsetzte Fürbringer von dem Maharadscha, daß das Grabmal, das er baut, für eine Lebende bestimmt ist … (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Ähnliche
Thea von Harbou
Das indische Grabmal
Roman
FISCHER Digital
Inhalt
Die Hauptpersonen
Michael Fürbringer
ein junger deutscher Architekt, dem der Auftrag seines Lebens in den Schoß fällt
Irene
seine Frau
Der Maharadscha von Eschnapur
ein unermeßlich reicher indischer Fürst, der einer lebenden Frau das Grabmal seiner Liebe zu ihr errichten will
Ramigani
sein finsterer Vertrauter
Miriam
ein junges Mädchen, das einen schrecklichen Tod sterben muß
Mohammed ben Hassan
ein Juwelenhändler und Weiser
I
Michael Fürbringer erwachte, als die Uhr im Nebenzimmer zehn schlug.
Er war allein. Auf dem Tisch am Kopfende seines Bettes brannte die Lampe unter einem goldfarbenen Seidentuch und ließ den großen Raum in sehr sanfter Dämmerung. Das Fenster stand halb offen, und der eindringende Windhauch brachte den Duft der blühenden Weiden und der regenfeuchten Erde mit. Das Schlagen der Kirchenuhren, ferner und naher, vermischte und entwirrte sich ernst und anmutig und ließ die folgende Stille vollkommener erscheinen, als sie vordem gewesen war.
Michael Fürbringer lag auf dem Rücken ausgestreckt und spürte in allen Gelenken die wohlige Erschöpftheit nach dem großen Kampf mit dem Tode. Nun war er ausgekämpft. Er lebte. Er fühlte das noch matte, doch zuverlässige Schlagen seiner Pulse mit einer etwas schwermütigen Zärtlichkeit gegen diesen tapferen Rhythmus des Lebens.
Er wußte nicht, wie lange er krank gewesen war. Das Fieber war sein Meister geworden und hatte das Augenblickliche gegenstandslos gemacht. Endlose Wegstrecken hatte er durchwandert, gehetzt und verdurstend, den eigenen Körper schleppend als zu schwere Last. Eine fürchterliche Sonne hatte scheitelrecht über seinem Kopf gestanden und ihm das Hirn aus dem Schädel gesogen. Hinter dicken, trüben Glaswänden hatte er Menschen gesehen, die sich über ihn beugten, bekannte – unbekannte …
Das Gesicht des berühmten Arztes, das die Säbelnarben, schlecht geheilt, verzerrten, indem sie sein Lächeln zum Grinsen werden ließen; es forschte ihn aus ohne Ergriffenheit mit der selbstsicheren Neugier der Wissenschaft. Und die Wissenschaft schüttelte den Kopf über einen Aufgegebenen.
Aber die Sehnsucht und der grimmige Wille, von all den noch ungelebten Stunden des Lebens keine zu verlieren, nahmen ihn auf, den großen Ringkampf mit dem Sterben …
Und dann war sie dagewesen, Irene, seine Frau. Einmal, und es war in der Stunde gewesen, da ihm die Kräfte zu versagen drohten und er sich fallen lassen wollte in grenzenloses Nichts, da hatte sie ihn bei Namen gerufen. Und er hatte die Stimme vernommen und war umgekehrt, aus dem Nichts in das Etwas, das Leben heißt. Aber mit ihr zu leben, das war viel …
Er wunderte sich, daß sie nicht neben ihm saß. Er war daran gewöhnt, mit dem ersten Blick des Bewußtseins diesen Augen zu begegnen, die des Wachens niemals müde wurden. Sie fehlte ihm. Vielleicht war sie im Nebenzimmer, dessen Tür halb offen stand. Er hätte sie rufen können, aber er tat es nicht, weil er zu träge war. Er hätte nur die Hand zu heben brauchen, um die Klingel zu berühren, aber er unterließ auch das. Er verspürte nicht die geringste Lust, eine noch so kleine Bewegung zu machen. Das Bewußtsein, es zu können, genügte ihm völlig.
In die tiefe Stille, die das Haus beherrschte, klang das Anschlagen der Torglocke, nicht laut, aber mit einer merkwürdigen Bestimmtheit.
Fürbringer hörte die Schritte des Dieners, der die Treppe herunterkam und über den Flur an seinem Zimmer vorbei nach der Haupttüre ging. Dann längere Zeit nichts mehr.
Das Warten auf den nächsten Laut ermüdete ihn; er schloß die Augen.
Als er sie wieder öffnete, geschah es unter dem Druck der Vorstellung, daß ein Mensch ihn ansah. Er wandte den Kopf …
An seinem Bett stand der Diener.
»Verzeihung, gnädiger Herr«, sagte er murmelnd, »da draußen ist jemand, der den gnädigen Herrn zu sprechen wünscht.«
»Es tut mir sehr leid«, entgegnete Fürbringer mit einem Gefühl unbekannter Gereiztheit, »ich kann niemand empfangen.«
»Das habe ich dem Herrn auch gesagt, er hat sich jedoch nicht abweisen lassen«, berichtete der Diener.
Der Ton dieser Antwort veranlaßte Fürbringer, ihn anzusehen. Das Gesicht des jungen Menschen, das der Lampenschein mit einem bronzenen Goldton färbte, war etwas verstört.
»Was ist denn?« fragte Fürbringer. »Kennen Sie den Herrn nicht?«
»Nein. Ich habe ihn noch nie gesehen. Er ist bestimmt noch nie hier gewesen.«
»Wie sieht er denn aus?« erkundigte sich Fürbringer, weit mehr zum Fragen angeregt durch den Ausdruck im Gesicht seines Dieners als durch die Gegenwart des Unbekannten an sich.
»Es muß ein Ausländer sein, gnädiger Herr. Er hat eine Haut wie Lehm und spricht ein fremdes Deutsch.«
»So … Dann sagen Sie dem Herrn, ich bedauerte, ihn jetzt nicht annehmen zu können, denn erstens wäre es zehn Uhr vorbei, und zweitens läge ich zu Bett und hätte gerade eine schwere Krankheit überstanden.«
Der Diener zögerte.
»Auch das habe ich dem Herrn gesagt«, meinte er mit einer gewissen Hilflosigkeit.
»Und trotzdem bestand er darauf, mich sprechen zu wollen?«
»Jawohl, gnädiger Herr.«
»Und er hat seinen Namen nicht genannt?«
»Nein, gnädiger Herr.«
»Dann gehen Sie und bitten Sie ihn um seine Karte, oder er soll Ihnen sagen, wie er heißt.«
Der Diener verschwand und kam nach einer halben Minute wieder.
»Der Herr will seinen Namen nicht nennen«, berichtete er. »Er wiederholte jedoch, daß er den gnädigen Herrn unter allen Umständen sprechen müsse, da es von allergrößter Wichtigkeit sei, was er ihm zu sagen habe.«
Fürbringer stieß die Luft durch die Nasenlöcher.
»Wo ist meine Frau?« fragte er.
»Die gnädige Frau ist vor einer halben Stunde telephonisch angerufen worden und ist dann fortgegangen.«
»Wer hat sie angerufen?«
»Das weiß ich nicht. Die gnädige Frau ging selbst an den Apparat.«
»Hat sie nicht gesagt, wann sie wiederkommen würde?«
»Nein …«
»Hm … Also, sagen Sie dem Mann, ich wäre heute abend für niemand zu sprechen; er möchte morgen früh wiederkommen.«
»Morgen früh«, sagte eine ungemein sanfte und gänzlich farblose Stimme vor der Tür, »bin ich nicht mehr hier …«
Michael Fürbringer richtete sich auf, daß er zum Sitzen kam. Unwillkürlich sah er seinen Diener an.
Sekunden verstrichen.
»Lassen Sie ihn eintreten!« sagte Fürbringer halblaut.
Während der Diener sich zum Gehen wandte, beugte er sich vor und schlug mit einer raffenden Bewegung das Seidentuch der Lampe zurück, so daß der unbeirrte Lichtkeil der fünfzig Kerzen auf die Tür fiel, in deren Rahmen der Fremde erschien. Hinter seinem Rücken gleichsam schmaler werdend, verließ der Diener das Zimmer.
Der Fremde grüßte mit einer Verbeugung, die zu tief und zu feierlich war, um europäisch zu sein. Er sagte nichts.
Das erste Gefühl, das die Erscheinung des Fremden in Fürbringer auslöste, war eine leichte Enttäuschung. Er hatte einen Menschen erwartet, dessen Äußeres im richtigen Verhältnis zu der geheimnisvollen und dringlichen Art und Weise stand, mit der er sein Eintreten erzwungen hatte. Aber über dem schmalbrüstigen Mann mit den abfallenden Schultern, der an der Türe stehengeblieben war und mit zwinkernden Augen um Befreiung von der Grellheit des Lichts zu bitten schien, lag durchaus nichts Geheimnisvolles. Auch war seine Erscheinung zu nüchtern und unübertrieben, um den Gedanken an einen freundschaftlichen Scherz aufkommen zu lassen. Das einzig Auffallende an ihm war die Farbe seiner Haut, die den merkwürdigen Ton von altem Messing hatte.
»Sie wünschten mich zu sprechen«, begann Fürbringer das Gespräch, da der Fremde schwieg. »Sie müssen es der Dringlichkeit dieses Wunsches zuschreiben, daß ich Sie in dieser zwanglosen Verfassung empfange. Ich war krank.«
»Ich weiß es, Sahib«, antwortete der Fremde mit seiner sanften, gleichsam körperlosen Stimme. »Aber du bist es nicht mehr. Du wirst aufstehen und gesund sein.«
»Hoffentlich«, meinte Fürbringer mit einem flüchtigen Lächeln. »Immerhin wird es noch einige Tage dauern, bis ich daran denken kann.«
»Heute abend, Sahib«, sagte der Fremde.
Fürbringer verzog die Mundwinkel. »Auf Ihre Veranlassung?« fragte er.
»Du wirst heute abend aufstehen und gesund sein, Sahib«, wiederholte der Fremde.
Fürbringer stützte sich auf den Ellenbogen.
»Sie sind Inder, nicht wahr?« stellte er fest.
»Ja, Sahib.«
»Wollen Sie mir Ihren Namen nennen?«
»Hat das Staubkorn einen Namen? Ich bin ein Staubkorn unter der Sohle meines Herrn.«
»Und wer ist dein Herr?« fragte Fürbringer, die Knochenlosigkeit dieser völligen Unterwerfung unwillkürlich mit »Du« anredend.
»Er ist es, von dem ich dir diesen Brief zu bringen habe«, antwortete der Inder.
»Gib ihn mir«, sagte Fürbringer, die Hand ausstreckend.
Der Inder verbeugte sich; er zog aus dem linken Ärmel seines Rockes ein großes, auf besondere Art gefaltetes Schreiben, das er Fürbringer übergab.
Das Schreiben war versiegelt; das Siegel zeigte in einfachster, fast roher Ausführung ein großes lateinisches A.
»Bitte, setzen Sie sich!« sagte Fürbringer, während er den Brief öffnete. Der Inder blieb stehen.
Fürbringer las.
»Herrn Michael Fürbringer, dem Erbauer des Hauses auf dem Roten Hügel, durch meinen Diener, der schweigt.
Ich habe das Haus auf dem Roten Hügel gesehen, das Haus der Mater Immaculata und das Haus der schönen Frau, die zu jung gestorben ist. Ich habe die Frau verloren, die nahe an meinem Herzen gelegen hat, und ich will ihr ein Grabmal errichten, dessen Schönheit ihrer Schönheit gleichen soll. Ich will, daß dieses Grabmal von dem Manne gebaut wird, unter dessen Händen der weiße Marmor zu weißen Spitzen wird, von dem Gärtner der Blumen, die aus Edelsteinen gemacht sind. Ich bitte ihn, aufzustehen, wenn er liegt oder sitzt, fortzulegen, was er in Händen hält, und zu mir zu kommen. Die Jahre sind nichts, wenn das Werk gut ist. Ich biete ihm für Erfüllung meines Wunsches die Summe von einer Million Pfund in Gold.
Er möge sich meinem Diener anvertrauen. Seine Treue steht auf meinem Haupte. Nimm, wessen du bedarfst. Alles ist dein.«
Als Unterschrift ein unleserlicher Namenszug.
»Die Sache ist ein ausgezeichneter Scherz und hat außerdem den Vorzug der Neuartigkeit«, sagte Fürbringer, indem er den Brief zusammenfaltete. »Leider kann ich nicht so herzhaft auf ihn eingehen, wie ich gern täte, denn sein Urheber hat keine günstige Stunde gewählt. Sagen Sie ihm einen schönen Gruß, und in vierzehn Tagen stünde ich ihm zur Verfügung.«
»Sahib«, entgegnete der Inder, ohne die geringste Bewegung zu machen, um den Brief zurückzunehmen, »das Schreiben meines Herrn ist kein Scherz. Niemals scherzt mein Herr. Er ist jung. Er hat die Frau verloren, die seinem Blute Feuer war. Er trauert um sie und scherzt nicht. Er ist in der Welt gewesen, überall, wo Schiffe fahren und eiserne Bahnen; überall hat er die Bauten der Menschen erforscht und keinen gefunden, der der Schönheit seiner Freundin würdig gewesen wäre. Aber er sah die Werke deiner Hände und die Pläne deines Kopfes, und er dachte, du wärest der Mann, das Grabmal der Schönheit zu schaffen, wenn er dich hinführte in ein Tal, wo die Blöcke hundertfarbigen Marmors lagern und Marmor, reiner und weißer als das Gefieder der weißen Pfauen, Berge von Onyx, Achat und Lapislazuli, Silber in Barren und Platten aus Gold, und Becken, die ein Mann nicht zu heben vermag, angefüllt mit Edelsteinen und den großen Perlen des Meeres –, daß dich der Rausch des Schaffens ergreifen würde, wenn mein Herr zu dir spräche: Nimm und baue! … Sage nicht, Sahib, dies sei ein Scherz, denn mein Herr wartet auf dich …« Fürbringer wandte den Kopf. »Wo?« fragte er etwas schroff.
»In seiner Heimat«, antwortete der Inder einfach.
»Und du willst mich glauben machen, daß er dich eigens aus Indien nach Europa geschickt habe, um mir diesen Brief zu bringen?«
»Ich will es dich nicht glauben machen, Sahib – es ist die Wahrheit.«
Fürbringer drückte den Nacken in die Kissen und sah nach der Decke des Zimmers.
Wahrscheinlich, dachte er, habe ich wieder Fieber – oder ich träume … Natürlich träume ich … Aber die Gedanken seines Hirns arbeiteten mit außerordentlicher Kraft und Schnelligkeit und der untadelhaften Schärfe einer guten Maschine. Er sah die Gegenstände des Zimmers so deutlich, als wären sie von Scheinwerfern beleuchtet. Jedes Ding, das er ins Auge faßte, schien auf ihn zuzukommen wie ein Lebendiges, bei Namen Gerufenes.
Mit einem Ruck sah er sich um und sah dem Inder ins Gesicht. Es war vollkommen ernst, nicht ganz frei von irgendeinem fremden asiatischen Kummer und völlig beherrscht von der bedingungslosen Überzeugung, einem Willen zu gehorchen, der sich nicht irren konnte.
»Gesetzt den Fall, daß ich diesen Brief ernst nähme – was ich durchaus nicht tue –, wie hatte sich dein Herr die Entwicklung des Ganzen gedacht?« fragte Fürbringer mit einer Nachlässigkeit, die er nicht empfand.
»Nimm diesen Brief ernst, Sahib, denn er ist es«, antwortete der Inder.
»Gut, gut – wir wollen uns nicht streiten! Was also hätte ich dann zunächst zu tun?«
»Stehe auf, Sahib, und folge mir!«
»Was! – Jetzt, auf der Stelle?!«
»Das Auto steht vor der Tür, Sahib.«
Fürbringer lachte.
»Dein Herr scheint an prompte Erfüllung seiner Wünsche gewöhnt zu sein«, meinte er.
»Ja, Sahib!« sagte der Inder in unverkennbarer Ehrfurcht vor einem unsichtbaren Dritten.
»Immerhin hätte er bedenken müssen, daß er seinem Diener einem nüchternen Mitteleuropäer gegenüber einen glaubhafteren Ausweis hätte mitgeben müssen als einen Brief mit einer unentzifferbaren Unterschrift.«
Über das Gesicht des Inders ging ein Lächeln. Er griff mit einer kleinen, höflichen Bewegung nach seiner Brusttasche.
»Mein Herr kennt die Menschen Europas, Sahib«, sagte er sanftmütig. »Er hat mich beauftragt, falls du es wünschtest, dir dies zu geben.«
Fürbringer griff nach dem, was der Inder ihm reichte. Es war ein Scheckbuch der Deutschen Bank, lautend auf den Namen: Arada, Fürst von Eschnapur.
Fürbringer biß sich auf die Lippen. Er fühlte, daß ihm das Blut ins Gesicht stieg; er sagte nichts.
»Mein Herr«, fuhr der Inder nach einer Pause fort, »bittet dich, falls du seinem Briefe nicht glaubst, auf eines dieser Blätter die Zahl zu schreiben, die dir beliebt, und einen Menschen, dem du vertraust, dorthin zu schicken, wo er das Blatt einlösen kann. Ich werde ihn begleiten, und er wird dir das Geld bringen.«
Fürbringer schwieg noch immer. Er blickte vor sich hin. Nach einer Weile hob er die Augen und suchte, fast ohne zu wissen, daß er’s tat, die Radierung von der Tadsch Mahal, die seinem Bette gegenüber hing.
Der Inder folgte der Richtung seinen Schauens; er lächelte.
»Dies ist nichts gegen das, was du schaffen wirst, Sahib«, sagte er mit einem vorsichtigen Rufen.
Fürbringer gab ihm keine Antwort. Seine Hände, die auf der Bettdecke lagen, zogen sich leicht zusammen, wie die Fänge der Vögel es tun, ehe sie eine Beute packen.
»Es ist gut«, sagte er mit etwas heiserer Stimme. »Ich werde der Aufforderung des Fürsten Folge leisten und das Grabmal bauen. Ich hoffe in spätestens vier Wochen die Reise nach Indien antreten zu können.«
»Wenn du reisen willst, Sahib, dann muß du es noch in dieser Nacht tun«, sagte der Diener.
»Das ist gänzlich ausgeschlossen. Ganz abgesehen davon, daß ich für eine Reise von so langer Dauer die umfassendsten Vorbereitungen treffen muß; abgesehen auch davon, daß ich nicht weiß, wieviel ich mir jetzt schon wieder zumuten kann, ohne einen Rückfall heraufzubeschwören, muß ich unbedingt meine Frau verständigen und alles mit ihr besprechen …«
»Verzeihung, Sahib«, sagte der Inder mit großer Höflichkeit, »falls du die Absicht hast, den Wunsch meines Herrn zu erfüllen, so müßtest du in dieser Nacht abreisen, ohne deine Gattin noch einmal gesprochen zu haben. Morgen früh steht es dir frei, ihr ausführlich zu depeschieren, heute nacht jedoch dürfte niemand um deine Abreise wissen. Da mein Fürst gezwungen war, diese Bedingung an seinen Auftrag zu knüpfen, bittet er dich, den Preis ihrer Erfüllung selbst zu bestimmen. Seine Unterschrift ist in deiner Hand.«
»Da haben Sie das Scheckbuch, und da haben Sie den Brief«, sagte Fürbringer, beides dem Inder reichend. »Die Angelegenheit ist für mich erledigt; ich will nichts mehr davon hören. Sagen Sie dem Fürsten, wenn Sie nach Indien zurückkommen, daß ein Guthaben bei der Deutschen Bank zwar ein vorzüglicher Ausweis sei, aber doch nicht hinreichend, die einfachsten Rücksichten eines anständigen Mitteleuropäers aufzukaufen wie Grundbesitz. Gute Nacht.«
»Dies ist nicht dein letztes Wort, Sahib«, sagte der Inder.
»Kann ich meine Frau benachrichtigen oder nicht?«
»Es ist leider nicht möglich, Sahib.«
»Gute Nacht«, wiederholte Michael Fürbringer.
Der Inder verbeugte sich langsam und ging aus dem Zimmer. Den Brief hatte er zurückgelassen. Er lag auf der Bettdecke. Fürbringer rührte ihn nicht an.
Er hatte sich zurückgelehnt und sah unverwandt geradeaus, ohne zu wissen, was er sah. Erst allmählich lösten sich die Formen der Tadsch Mahal aus dem blicklosen Schauen, dieses schöne Grabmal einer großen Liebe. Fürbringer dachte an seine Frau. Warum warst du nicht bei mir? dachte er. Ich hätte zu dir gesagt: Ich soll etwas schaffen, schöner als alles, was ist – etwas, das zum Ewigen werden sollte, ein Triumphgesang des Marmors, ein goldenes Fanal, etwas, vor dessen Schönheit die Menschen heilig werden sollten. Warum warst du nicht bei mir? Du hättest mich gehen heißen – Ja, du hättest mich fortgetrieben, du mit deiner Liebe, die immer weiß, was das Rechte ist …
Er dachte: Vielleicht habe ich den Sinn meines Lebens aus der Hand gegeben …
Und mit einem Male überkam ihn der große Rausch des ersten Entwurfes einer neuen Schöpfung. Aus dem völlig Formlosen, das den Wolken glich, bildeten sich Formen, die sich bannen und fesseln ließen – ein Hintergrund von unerhörter Klarheit, in den hinein die Umrisse eines Form gewordenen Gedankens wuchsen, nicht mühsam aufgebaut noch entstehend – fertig, in sich vollendet, unmittelbar und vollkommen …
Mit einem Ruck setzte sich Michael Fürbringer auf. Er hatte die Klingel neben sich, aber das hatte er vergessen. Er schrie nach dem Diener.
»Franz …!!«
Der Diener kam mit offenem Mund ins Zimmer gestürzt. »Gnädiger Herr …?«
»Laufen Sie dem … laufen Sie dem Menschen nach, der eben hier war … dem Inder …! Suchen Sie ihn einzuholen! Bringen Sie ihn zurück! Sagen Sie ihm, er solle unter allen Umständen zurückkommen! Ich hätte mit ihm zu reden!«
Der Diener glotzte seinen Herrn an, verstand nicht …
Fürbringer zerbiß einen Fluch zwischen den Zähnen. Er warf die Decke zurück und sprang aus dem Bett. Er taumelte vor Schwäche.
»Der Inder …!« schrie er und hielt sich an Tisch und Stuhl. »Verstehen Sie kein Deutsch, Mensch …? Sie sollen den Inder zurückholen!«
Der Diener lief aus dem Zimmer; er ließ die Türe offen …
Fürbringer stand wie auf durchgeschnittenen Gelenken. Er sank auf den Bettrand zurück und stand wieder auf.
Ich bin schwach, weil ich Fieber hatte, dachte er. Vielleicht habe ich auch jetzt noch Fieber. Das macht nichts. Das geht vorüber. Ich will – ja, ich will das indische Grabmal bauen …!
Er ging ins Badezimmer und ließ das Wasser in die Wanne brausen. Der Druck des Wassers schlug ihm die Hände nach unten. Er lachte. Warte nur, dachte er. In fünf Minuten halte ich dir stand. Er tauchte den Kopf in das schneekalte Strömen. Eine ungeheure Kraft kam über ihn wie eine Trunkenheit. Er spürte das Federn seiner Gelenke wieder und die geschmeidige Bereitschaft seiner Muskeln. Nur daß er den Boden unter seinen Füßen als etwas Fremdes fühlte, wie Menschen, die nach einer langen Segelfahrt ans Ufer springen.
Der Diener klopfte an.
»Gnädiger Herr, bitte …«
»Haben Sie ihn getroffen?«
»Der Herr wartete vor der Gartentür …«
Fürbringer stand einen Augenblick bewegungslos.
»Führen Sie ihn in mein Arbeitszimmer; ich komme sofort!«
Zehn Minuten später standen sich die beiden Männer gegenüber.
»Wie kommt es«, fragte Fürbringer, ohne dem Inder Zeit zum Grüßen zu lassen, »daß mein Diener Sie noch vor der Gartentür antraf?«
»Ich wartete auf ihn«, antwortete der Inder mit einer Geste der Selbstverständlichkeit.
»Waren Sie so überzeugt davon, daß ich Sie zurückrufen würde?« fragte Fürbringer fast etwas verbittert.
»Ja, Sahib. Davon war ich überzeugt.«
»Warum, bitte …?«
Der Inder hob den Kopf. Die Sanftheit seines Lächelns machte jede Bitterkeit sinnlos.
»Sahib, niemand kann die neugeborenen Kinder seiner Seele töten …«
Fürbringer entgegnete nichts. Er fühlte in seiner Tasche nach dem Brief des Fürsten. Sein Blick fiel auf den Schreibtisch.
»Sie wünschen also, daß ich auf der Stelle abreise?« fragte er, ohne den Inder anzusehen.
»Es ist der letzte Tag und die letzte Stunde. Du warst sehr lange krank«, antwortete der Inder.
»Kommt es in diesem Fall auf Tag und Stunde an?«
»Es gibt keine Zwillinge unter den Stunden, Sahib«, sagte der Inder mit einer gewissen Schwermut.
»Und soll ich fortgehen, ohne meine Frau zu benachrichtigen, wohin ich fahre?«
»Morgen früh steht es dir frei, Sahib. Du magst dem Diener sagen, was du willst, um die Herrin zu beruhigen. Aber das Ziel deiner Reise darf sie erst morgen erfahren.«
»Und wenn sie wiederkommt, bevor ich fort bin?«
»Beeile dich, Herr«, war die einfache Antwort.
»Ich werde nur soviel Zeit brauchen, als notwendig ist, einen Koffer zu packen.«
»Du bedarfst keines Koffers, Sahib. Du bist der Gast meines Herrn und hast zu gebieten. Wünsche, und du besitzt.«
»Ich würde es vorziehen, in gewissen Dingen für mich selber zu sorgen«, meinte Fürbringer.
»Tue dies dann, Sahib, wenn du mit dem, was wir dir geben können, nicht zufrieden bist.«
Fürbringer zuckte die Achseln. Dem Inder den Rücken zukehrend, nahm er ein Blatt Papier vom Schreibtisch und steckte es in die Tasche.
»Verzeihen Sie einen Augenblick«, sagte er und ging in sein Schlafzimmer zurück, dessen Tür er offen ließ.
Durch den Spiegel über dem Diwan sah er den Inder mit dem Hut in der Hand unbeweglich auf seinem Platze stehen.
Er nahm das Blatt Papier und den Brief des indischen Fürsten aus der Tasche, zog den Bleistift aus dem Notizbuch und schrieb in Kurzschrift auf den Zettel:
»Geliebtes Geschöpf!
Lies den Brief und sorge Dich nicht. Die Angelegenheit scheint durchaus ernsthaft zu sein. Ich habe die Reise antreten müssen, benachrichtige Dich gegen den Willen meines geheimnisvollen Auftraggebers. Nochmals, sorge Dich nicht. Morgen depeschiere ich Dir ausführlich. Sobald ich selbst das Nähere weiß, bitte ich Dich, mir nachzukommen. Ich hielt mich nicht für berechtigt, das große Los als Mensch und Baumeister zurückzu weisen. Ich küsse Dich auf Deine beiden geliebten Augen!
Michael.«
Er steckte den Zettel in den Briefumschlag des Fürsten und legte ihn auf sein Kopfkissen. Dann schaltete er das Licht aus und verließ das Zimmer, die Tür hinter sich ins Schloß ziehend.
»Gehen wir!« sagte er.
Der Inder verbeugte sich. Er sah mit einem unbeweglichen Gesicht zu Boden.
Fürbringer ging im voraus auf den Flur und rief nach dem Diener.
»Ich will ausgehen«, sagte er.
Während der Diener ihm in den Mantel half, sagte er laut genug, um auch von dem Inder verstanden zu werden: »Wenn meine Frau nach Hause kommt, dann melden Sie ihr, daß ich den Besuch eines Herrn empfangen hätte, der mich veranlaßt habe, in einer außerordentlichen Berufsangelegenheit sofort zu verreisen. Ich ließe sie bitten, sich ja keine Sorge zu machen – ich fühlte mich vollkommen gesund und würde ihr morgen früh auf telegraphischem Wege ausführliche Nachricht zukommen lassen.«
»Jawohl, gnädiger Herr«, antwortete der Diener mit einem Blick über die Schulter seines Herrn.
Unwillkürlich drehte Fürbringer sich um.
Hinter ihm stand der Inder.
Fürbringer nickte dem Diener zu, setzte den Hut auf und schritt nach der Haustür.
Als er den Garten betrat, empfand er die warme und feuchte Süßigkeit der Märzluft fast lähmend. Er sog sie tief in sich hinein, um ihrer Herr zu werden. Die große Verheißung des Werdenden begann ihn zu erfüllen.
Vor der Gartentür stand das Auto, von dem der Inder gesprochen hatte. Der Lenker sprang vom Führersitz und warf den Motor an. Das beizende Licht der Scheinwerfer fiel auf seine asiatischen Züge. Er grüßte und schwang sich auf seinen Platz zurück, die Hände ans Steuerrad legend.
Fürbringer stieg in den Wagen. Das weiche Licht der elektrischen Lampen glühte auf. Der Inder legte ihm die Pelzdecke über die Knie, schloß die Tür und setzte sich neben den Fahrer. Leise wie ein Gespenst glitt der Wagen über den regenfeuchten Asphalt. Nach kürzester Fahrt hielt er am Bahnhof; der Inder sprang ab und riß den Schlag auf; Fürbringer stieg aus.
»Wem gehört der Wagen?« fragte er.
»Dir«, antwortete der Inder.
Fürbringer entgegnete nichts. Er stieg die Treppe zum Bahnhof hinauf und sah den Schatten des Inders, vom Spiel der Bogenlampen verdreifacht, neben sich die Stufen erklimmen.
»Mit welchem Zuge fahren wir?« erkundigte er sich, über die Schulter sprechend.
»Der Sonderzug des Fürsten wartet auf dich, Sahib«, sagte der Inder.
»Und wohin fahren wir?«
»Nach Genua.«
»Von Genua aus mit dem Schiff?«
»Ja, Sahib. Mit der Jacht des Fürsten.«
Fürbringer fragte nicht weiter.
Als er, eine Zigarette rauchend, im Klubsessel an einem Fenster des Wohnwagens saß und das unendlich behutsame Rollen der Räder unter seinen Füßen spürte, trat der Inder ein und auf ihn zu …
»Du hattest dies vergessen, Sahib«, sagte er halblaut und legte einen Brief auf den bronzenen Rauchtisch.
Fürbringer griff danach. Es war das Schreiben des Fürsten; in ihm lag der Zettel, den er an seine Frau geschrieben hatte.
»Gute Nacht, Sahib«, sagte der Inder.
»Gute Nacht …«
II
An Bord der »Eschnapur«, im März
Geliebte Frau!
Meine beiden Depeschen und den Brief, den ich in Genua zur Post gab, hast Du hoffentlich bekommen und sorgst Dich nicht mehr, wenn Du auch gewiß noch immer ebensowenig wie ich begreifen wirst, was dies alles zu bedeuten hat. Wissen möchte ich eins: Ob Du verstehen kannst, warum ich es auf mich nahm, Deine liebevolle Seele einer langen Unruhe preiszugeben, um die Laune eines Unbekannten zu erfüllen. Es war nicht Ehrgeiz oder Ruhmsucht in der nackten Bedeutung ihres Namens, es war weit mehr die plötzliche Erkenntnis, vor der Möglichkeit einer Selbsterfüllung zu stehen, wie sie das Leben unter tausend Menschen nur einem bietet – und auch diesem nur in einer einzigen Stunde. Du, die meine Pläne und geträumten Entwürfe liebte, mehr als ich selbst sie lieben konnte, die den Rausch des Entwerfens und Schaffens mit mir teilte wie einen Kuß, Du wärest der letzte Mensch gewesen, der sich zwischen mich und ein Ziel von so unerhörter Größe gestellt hätte – darauf habe ich vertraut, und darum bin ich gegangen.
Es scheint nun doch, als ob das Unausdenkbare zu Wirklichem werden sollte; ich bin an Bord der Jacht, die mich nach Indien bringt – nach dem Lande, über dessen Bildern, Sagen und Ungeheuerlichkeiten wir am liebsten träumten, wenn uns der Vorfrühling im Blute saß und wir Wanderpläne machten, denen die Welt zu klein war. Und Du warst so kühn wie ein junger Adler im Fernflug Deiner lieben Seele …
Daß Du jetzt nicht bei mir bist, Irene …
Ich sitze an Deck unter dem Sonnensegel und atme die frische Luft des Mittelmeeres, die wir beide kennen – die ganz gesättigt ist von jenem Duft, den kein anderes Meer der Erde hat, dem Duft nach Edelfäule, nach der verruchten Schönheit der Levante. Die vollkommene Stille der Fahrt wird nur gebrochen vom Geräusch der Schiffsmaschinen, deren Kraft das feine Fahrzeug zittern macht. Diesel-Motoren gehören auf den Ozean. Auf den homerischen Wassern aber dürften nur braune Segel über schöngeschnäbelten Schiffen sich wölben, oder weiter gen Osten die prunkenden Barken der Kleopatra. Es liegt über diesen Wellen, die sich so völlig dem Schiffskörper hinbreiten, eine zugleich heitere und lässige Sinnlichkeit, die Klang werden will; niemals habe ich so gut wie jetzt verstanden, woher dem blinden Götterseher das holde Märchen der Sirenen kam.
In einem Märchen scheine auch ich zu leben; der dienstwillige Geist aus der Wunderlampe Aladins steht mir zu Befehl. Nur, daß er indische Züge trägt. Wahrhaftig, ich bin neugierig darauf, den Mann kennenzulernen, der mit Millionen spielt wie ein Knabe mit Murmeln. Vielleicht ist er ein halber Narr, vielleicht auch ein ganzer. Seine Diener scheinen ihn für einen Gott zu halten. Die Art, mit der sie seinen Namen nennen, kommt einem Kniefall außerordentlich nahe. Ihr Gehorsam in seinen Willen ist vollkommen und von der Unfehlbarkeit seines Willens überzeugt. Dennoch weiß ich schon heute, daß sie ihn nicht lieben.
Was kümmert das mich? Ich will das Grabmal seiner Geliebten bauen. Weiter nichts. Und das soll schön werden, Du … Es steht vor mir, als wäre es mir in die Augen geätzt. Halbe Nächte hindurch habe ich daran gezeichnet. Ich habe es nicht entworfen – es war da. Ich brauche es nur in Steine zu setzen, wie die Begnadeten ein Lied in Töne setzen, und es soll sich selber singen.
Irene, ich schreibe an Dich, als nähme meine Seele ein Bad. Das Fieber der Erwartung hat mich gepackt. Das Land der großen Wunder wird sich vor mir auftun, das Land, dessen Namen niemand kennt; tausend Heiligtümer, unseren Sinnen ebenso fremd wie unseren Gehirnen, werden sich mir offenbaren. Sie dürfen es getrost, sie bleiben uns dennoch verschlossen. Darum lächeln sie auch, die indischen Götter.
Vielleicht hat auch der Mann, der mich rief, damit ich seiner Geliebten ein Grabmal baue, das ihrer Schönheit würdig sei, das gleiche Lächeln um seine asiatischen Lippen, dieses Lächeln der maßlos Herrschenden, denen ein Menschenleben nicht mehr ist als die Rauchwolke eines Opferfeuers. Denn wenn auch sein Reichtum sich an den Spielereien europäischer Technik ergötzt und die Großbanken der Welt sich vor seinem Namenszug verbeugen – wo finden wir, Kinder der gemäßigten Zone, den Eingang zu einer Menschenseele, die ihre Trauer um eine schöne Frau nicht anders zu sättigen weiß als in Orgien des Marmors, in Strömen von Silber und den Flammenausbrüchen reinen Goldes? …«
An diesen Brief, den er seiner Frau an Bord der »Eschnapur« geschrieben hatte, mußte Michael Fürbringer denken, als er nach einer Fahrt von nahezu zehn Tagen, in denen er das Auto kaum verlassen hatte, in Eschnapur angekommen, bei Nacht die Hauptstadt und den Palast des Fürsten erreichte, und, aus halbem Schlafe aufgerüttelt, von dem Inder, der den Schlag des Autos öffnete, die Meldung empfing, daß Seine Hoheit der Radschah von Eschnapur gekommen sei, den fremden Sahib zu begrüßen.
Der erste Eindruck, den Fürbringer gewann, als er den Wagen verlassen hatte und sich umsah, war ein überwältigendes Chaos von Rot und Schwarz.