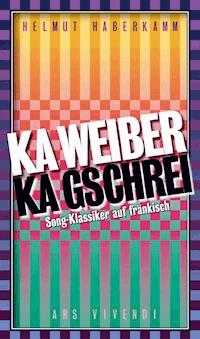Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Auf der Suche nach einem besseren Leben wandert Bauernsohn Michael Wegmann nach Amerika aus. 1867 kehrt er als gereifter Mann in seinen fränkischen Geburtsort zurück. Mit im Gepäck: ein Sack Kaffeebohnen, ein Klumpen Gold – und der Traum, in der Provinz ein außergewöhnliches Kaffeehaus zu eröffnen. Von den Einheimischen zuerst teils beneidet, teils belächelt, entwickelt sich Wegmanns Lokal bald zu einem Anziehungspunkt. Die unterschiedlichsten Menschen können hier ihre Erfahrungen miteinander teilen und sich ihren kargen Alltag mit Köstlichkeiten versüßen. Gesellschaftliche Umbrüche wie persönliche Tragödien werfen jedoch immer wieder ihre Schatten auf den Ort, an dem Geschichte und Geschichten sich treffen. Kann das Kaffeehaus die Wirren der Zeit überstehen und Wegmann sich seinen Lebenstraum bewahren? Der historische Roman für Franken – opulent, poetisch, episodenreich und dramatisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Haberkamm
Das Kaffeehaus im Aischgrund
Roman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage August 2016)
© 2016 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Elmar Tannert
Umschlaggestaltung: Armin Stingl unter Verwendung einer Zeichnung von Anton Atzenhofer
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-745-2
Für Petra,
die den Keim des Ganzen kennt,
ebenso Blüte, Frucht und Kern
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Glossar
Der Autor
Manchmal die Vorstellung, ein Schriftsteller
hätte vor allem die eine Pflicht:
eine Landschaft zu verewigen. – Aber wie? –
Mit den Geschichten von Menschen.
Peter Handke
1
Der Mann in den besten Jahren, der das Deck des Überseeseglers »Dorada« verließ, machte auf die Umstehenden den Eindruck eines aufgeräumten Menschen, eines Mannes mit Tatkraft und Schaffensgeist, der, nachdem er gerade den einen Kontinent hinter sich gelassen hat, nur darauf brennt, einen anderen Erdteil beherzt unter seine Füße zu nehmen.
Der mächtige Dreimaster war gerade mit viel Geschäftigkeit und Geschrei in den Hafen von Bremen eingelaufen, und dem Mann war die Mischung aus Herzklopfen und Handfreude anzumerken, mit der er seinen Lauf zielbewußt Richtung Innenstadt lenkte. Sein Blick verfolgte dabei aufmerksam die Kutschen, Fuhrwerke und Schiffsladungen, die wieselnden Passagiere, Kaufmänner, Seeleute und Hafenarbeiter – alles wurde gewissenhaft registriert und abgeschätzt. Der tabakbraune Vollbart verlieh seinem Auftreten Ernst und Bestimmtheit. Seine wachen Augen verrieten eine freundliche Aufgeschlossenheit für die vielfältigsten Erscheinungen dieser Welt. Fast pfiffig wirkte er in seiner Art, beim Tragen den lattengestützten Lederkoffer noch zu schwenken, als wäre es ein Kinderspiel, alle Habseligkeiten seines Lebens durch die Welt zu schleppen, um an einem ganz anderen Ort ein vollkommen neues Kapitel aufzuschlagen.
Unweit des Marktplatzes, beim stolzen Haus Schütting, nahe beim Roland mit Schild und Schwert, beim Rathaus und Dom, schien der Mann am Ziel seines Weges angelangt zu sein. Vor der Ladenfront einer Kolonialwarenhandlung hob er den Kopf und verschwand in dem hochgiebeligen Geschäftshaus mit den altehrwürdigen Fenstern. Als seine mittelgroße Gestalt wieder im Türrahmen auftauchte, folgte ihm ein älterer Kaufmann mit Vollbart und Glatze. Dann schüttelte man sich lange die Hände, bevor der Reisende seinen Koffer ergriff und sich einen zugebundenen Halbzentnersack über die Schulter warf. Dermaßen bepackt schlug er ohne Säumen seinen Weg zum Bahnhof ein, wo er vor dem Fahrkartenschalter seine Tragstücke absetzte, die Schultern einige Male hochzog und wieder herunterfallen ließ, in die geröteten, erhitzten Hände klatschte und dem knebelbärtigen Schalterbeamten hinter dem Schiebefenster sein Begehr zurief.
»Eine Fahrkarte für die Eisenbahn nach Nürnberg.«
»Bayern, wie?«
»Neustadt an der Aisch.«
»Wo soll denn das sein?«
»Auf halbem Weg zwischen Nürnberg und Würzburg.«
»Da müssen Sie sich in Nürnberg aber einen andern Zug suchen, für die Würzburger Linie.«
»Hauptsach, ich komm heim.«
»Die Würzburger Strecke ist funkelnagelneu. Da riecht man bestimmt noch den Lack und das Schmieröl überall. So etwa zwei Tage sind Sie da schon noch auf Achse.«
»Ein Kinderspiel, wenn man das große Wasser hinter sich hat.«
»Sie waren drüben, in Amerika?«
»Fünfzehn Jahre.«
»Was? Is ja ulkig. Scharenweise wandern hier die Leute Tag für Tag dorthin aus, als wär’s das gelobte Land, und Sie kommen wieder zurück – warum das denn?«
»Das ist eine lange Geschichte, werter Mann. Die wenn ich Ihnen erzähl, dann können S’ Ihren Schalter dicht machen, dann hocken wir zwei morgen früh noch da.«
»Was führen Sie denn da in dem Sack mit sich?«
»Kaffeebohnen. Fünfzig Pfund, köstlich geröstet. Soeben geholt im ersten Haus am Platz hier.«
»Warum schleppen Sie einen ganzen Sack Kaffeebohnen durch die halbe Welt? In Bayern gibt’s wohl noch keine?«
»Das hier sind ganz besondere Bohnen, erlesenste Qualität, mit denen will ich was ganz Bestimmtes anfangen.«
»Was denn, wo denn?«
»In Peppenhöchstädt.«
»Ach du liebes bißchen, wo ist das denn?«
»Ein kleines Seelennest, im Aischgrund.«
»In Bayern, was?«
»In Franken.«
»Na schön, von mir aus. Dort gibt’s nur Bier und noch keinen Bohnenkaffee, was? Dort brühen sie sich noch ihren Kraut- und Rübensud, nicht wahr?«
»Aus Gerste, Rüben und Zichorie.«
»Grundgütiger! Und deshalb tragen Sie also den Kaffee höchstpersönlich von Bremen in Ihr Kuhkaff dort?«
»Der halbe Zentner da ist ein Geschenk. Der Sohn des Kolonialwarenhändlers Böttcher ist ein guter Freund von mir gewesen, drüben überm Wasser, in Amerika.«
»Ja, wenn das so ist. Hier Ihr Billet.«
»Dankschön. Leben Sie wohl, guter Mann. Jetzt geht’s heim!«
»Alles Gute, Sie Heimkehrer. Eines kann ich Ihnen gleich sagen: Sie werden Ihre Rückkehr bestimmt noch bereuen!«
2
Am Bahnhof in Neustadt an der Aisch gab der Ankömmling seinen Koffer und den Halbzentnersack am Postschalter auf, nun hatte er die Hände und den Rücken frei. Er schnaufte tief ein und sah sich mit hungrigen Augen um. Die im Mittagslicht schimmernden Gleise hatten den Hutsberg mit seiner brandroten Tonerde aufgerissen wie ein Stück rohes Fleisch. Als er hinüberschaute zum Eichelberg, zum Schnappenstein, zu den Herrenbergen und zur Stübacher Steige, da erkannte er die Pforte zu seinem Aischgrund, der von hier aus breiter wurde, mit mehr Wald, mit leichteren Ackerböden. Die Häuser von Neustadt lagen vor ihm hingestreut in der Flußsenke wie Plätzchen in einer grasgrünen Porzellanschale. Seine Augen suchten die Stadtkirche, das Rathaus, das alte Schloß und die Stadttore. Fast kam es ihm vor, als könnte er die Rufe der Gerber und Wollweber, die Schläge der Zeugmacher und Nagelschmiede, das Geklapper der Pferdehufe und das Bellen der Hunde von drunten heraufhören in der frischen, klaren Herbstluft.
Der Horizont ganz weit unten bei Uehlfeld und Höchstadt flimmerte, als würden dort Schwärme von Dunstfischen durch die Lüfte fliegen. Alles wirkte so farbenfroh und nah, so greifbar, so verheißungsvoll. Wegmann spürte keine Müdigkeit mehr, nur ein elektrisches Pulsieren im Herzen, das ausströmte bis in Bauch und Haut. Ihm war es, als müßte er Türen aufreißen, Fenster öffnen, um einzutauchen ins Freie. Am liebsten hätte er den Wiesengrund mit ausgespannten Armen durchlaufen, hätte die in gewundenen Schleifen dahinschleichende Aisch überholen, sie antreiben und mit hineingeschleuderten Kieselsteinen weiterscheuchen mögen, daß die Karpfen, Barsche und Waller nur so auseinanderschießen würden. Von Herzen gern wäre er hinuntergerannt, hätte atemlos und mit stechenden Seiten verschnauft an einer schiefen Weide am Fluß, so sehr freute er sich mit einem Mal darauf, wieder heimzukehren in diesen so lieblich vor ihm liegenden Landstrich. Fünf Stunden Fußmarsch lagen noch zwischen ihm und seinem Kindheitsdorf. Nur noch fünf Stunden, bis er alle wiedersehen sollte, nach denen er sich jetzt so sehnte! Die Mutter, den Onkel, die Schwester. Nach den Abertausenden von Meilen in seinen Knochen und in seinem Kopf. Er setzte sich seinen hellen Hut wieder auf und machte sich auf den Weg, die staubige Landstraße den Aischgrund hinunter Richtung Dachsbach.
Durch die Bahnhofsstraße und durch das Windsheimer Tor gelangte er in die Stadt. Dort schaute er auf die gediegenen Geschäftshäuser, die gaffenden Bauern und Hausfrauen, die neugierigen Händler, Fuhrleute und Dienstboten auf der Straße, die plärrenden Mütter und Kinder vorm Diespecker Tor. Der Septembertag hatte noch einmal einen sommerblauen Himmel aufgespannt und überzog die Äcker und Wälder mit einem leuchtenden Schimmer. Die Farben von Reife und Ernte. Das satte Braun der Ackerböden, das Honiggelb und Weinrot im Laubwerk, das Feldgrau um die Krautbeete und Stauden, die fließenden Grüntöne der Wiesen und Kleefelder, der Rübenblätter und Hopfenreben. Versonnen im bunten Gewande, so hält der Weinmond seine Feier. Dieser Satz aus einem alten Hausbuch fiel Wegmann wieder ein.
Das Licht der späten Sonne spiegelte sich in den Scherben, die von einer Vogelscheuche herabhingen. Sonnenblumen streckten ihre strahlenden Gesichter zum Himmel. Als wären sie mit Schmalz eingerieben, so speckig glänzten die Erdschollen in den frisch gepflügten Feldern, wie Wellen im Ackermeer. Seine Sinne wollten alles sehen und aufsaugen, alles wahrnehmen und wertschätzen. So lange hatte sich Wegmann die Heimat im Geiste vorgestellt und ausgemalt – und nun sprang sie ihm beim Laufen und Schauen in Hülle und Fülle in die Augen, daß sie naß wurden und brannten.
In einem Wirtshaus in Diespeck hielt der Wanderer kurze Einkehr zum Vespern und Durstlöschen. Eine Brotzeit konnte man ihm servieren, Schwarzbrot und Preßsack, dazu eine geräucherte Bratwurst mit Gurken und Kren. Die drei Tage ohne richtigen Schlaf spürte er nun im Kreuz und in den Knochen, eine steinschwere Müdigkeit machte sich in ihm breit. Der Schankknecht musterte ihn mit unverhohlenem Argwohn. Ihm schien dieser Fremde im schlichten Werktagsanzug ein komischer Vogel zu sein, vielleicht ein Handeltreiber oder ein Stadtkrämer, aber solche redeten viel mehr. Der hier jedoch schaute nur als Kiebitz den vier kartelnden Zechkumpanen beim Schafkopfen zu, genoß schmunzelnd die derben Sprüche der Fuhrleute und blieb zugeknöpft und kurz angebunden über seinem Krug Bier.
»Trumpf! Hosen runter und raus mit deinem schlamperten Wenz!«
»An Trumpf kriegst, aber ohne die Schmier verreckst!«
»Raus mit der Hur aus’m Pfarrhof!«
»Wenns saudumm läfft, dann bricht dir die blanke Sau das Kreuz!«
»Ein Scheißblatt, von jedem Kaff ein krummer Hund.«
»Hauptsach am End ein Aug mehr, dann paßt der Arsch auf’n Eimer!«
Wie lange hatte er solche Brocken nicht mehr vernommen! Der Heimkehrer mußte an seinen Vater denken, der auch so herzhaft daherreden konnte in der Mundart dieses Landstrichs, in der jedes Gewächs seinen ganz besonderen Namen besaß, wo sich hinter dem wüstesten Spruch eine Lebensweisheit verbergen konnte und wo jedes Wetterzeichen Anlaß bot für ein bedeutungsvolles Sprichwort. Er spürte wieder den alten Schrecken im Leibe, als der Vater damals in aller Früh wachsgelb, kalt und starr im Bett gelegen war und ihn zurückgelassen hatte, mutterseelenallein, angewurzelt und herausgerissen zugleich, als neunjährigen Bub! So alt wie die Kinder dort drüben, die Mädchen mit den flachsblonden Zöpfen, die um den Hohlkreisel im Kreidefeld hüpften, die Jungen, die mit Steinschleudern auf Stare und Spatzen im strotzvoll hängenden Birnbaum schossen. Ach, diese Jahre als Lauser und Streuner! Wie oft hatte er sich nach der Hand des Vaters gesehnt, die einen halten konnte, anspornen, aufmuntern, mitreißen! Den Schmerz darüber, daß ihm dieser Vater über Nacht geraubt worden war, spürte er immer noch als Stachel in seinem Innern.
Er leerte seinen Bierkrug, spritzte sich am Brunnentrog Wasser über Gesicht und Hände und machte sich wieder auf den Weg. Vor dem Dorf besah er sich den schweren, rotbraunen Boden der Rübenäcker, die hellkrustigen Flurstücke oben am Buckel, die Felder mit Tabakstöcken und Krautköpfen, mit Pfefferminz und Meerrettich. Bauern in den Hopfengärten waren dabei, mit Messern und Haken an den armstarken Fichtenstangen die würzgrünen Reben und Ranken abzuschneiden, daß sie rauschend zur Erde sanken. Auf der linken Seite war eine schnatternde Menschenherde beim Rausgraben und Einsammeln von Kartoffeln zugange, die bodenfeuchten Früchte glänzten in der Sonne. Die Bäuerin klaubte die schönsten Klößerdäpfel flott vorne weg, und hinter ihr dann, Jahr auf Jahr abgestuft wie die Orgelpfeifen, hantierte ein halbes Dutzend barfüßige Kinder, die die mittleren und kleinen Erdäpfel in Flechtkörben zusammensuchten für die Keller und Futtertröge. Die rupfengroben Säcke, die Haufen mit Kartoffelkraut, der aufgerissene Ackerboden mit dem staubigen Geruch und den hellen Früchten, die sich erst so kühl anfühlten in der Hand und dann doch die Wärme annahmen, so klobig und rund, so fest und weich zugleich: Erinnerungen an die Kartoffeltage der Kindheit kamen Wegmann in den Sinn, das Gebuckel und Gekrieche, die zerfurchten Hände am Abend, wie rissig und aufgesprungen sie sich anfühlten, so trocken und spröde wie Werg waren sie. Der würzige Rauchgeschmack der heiß dampfenden Erdäpfel aus dem knackenden Krautfeuer, die sie mit Gabeln oder Stecken herausholten, stieg ihm wieder in die Nase. Wie schön das war, gemeinsam zu arbeiten und miteinander Ernte, Ende und Ertrag zu feiern!
Der Altweibersommer schien den Heimkehrer warmherzig zu begrüßen. Die Obstbäume am Rand der Landstraße waren behangen mit rauhschaligen Eierbirnen, weichen Zwetschgen und gefleckten Mostäpfeln, deren hartes, säuerliches Fleisch einem beim Reinbeißen eine Gänsehaut über den Leib jagte. Von ferne heulte eine Holzschneidesäge an Wegmanns Ohr. Auf einem Stupfelacker dampften etliche Haufen mit noch warmem Stallmist, der dort von zwei hemdsärmeligen Männern mühevoll abgeladen und mit Gabeln ausgebreitet wurde. Kreischend hüpften und flatterten Vögel um die braunen Batzen. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen ließ den Heimkehrer anhalten und kurz verschnaufen, damit die Müdigkeit in ihm etwas verfliegen konnte.
Oben am Ziegenhöfer Berg schaute er einem Bauern beim Ackern zu, blickte beim Einwenden in das mißtrauische Gesicht des Landmanns, sah seine furchige, schweißglänzende Haut, die gebeugte Gestalt hinter dem Wendepflug und hinter den Ochsen, die sich schnaubend abplagten unter dem drückenden Stirnblatt. Wegmann sah alte Leute auf den Feldern beim Steinklauben und junge Frauen und Mädchen, die mit grobleinigen Grastüchern auf dem Rücken Quecken, Disteln und Schmellen aus dem Boden rupften. Ein Mann mit einer Schürze aus blauem Tuch säte Korn, ein brav trottender Gaul zog eine Saategge hinter sich her über einen Acker. Kinder hüteten Gänse, trieben mit Ruten Kühe aus Krautbeeten hinaus und riefen den Spielkameraden Spottverse und Schimpfworte zu beim Verstecken und Fangen. Diese engen, kleinen Verhältnisse hier! Kein Vergleich zur Weite und Größe in Amerika. Warum nur hing sein Herz mit solcher Heftigkeit an diesem Erdflecken?
Wegmanns Augen folgten den Krümmungen der Aisch, die sich gemächlich hinunterschlängelte in den von Heuböcken bestückten, von Kopfweiden, Hopfengärten und Waldsäumen eingefaßten Wiesengrund. Am Dorfrand von Gerhardshofen leuchtete ihm Streuobst entgegen, ockergelbe Birnen und rotbackige Äpfel. In einem Bauerngarten sah er Kürbisse, Sellerie und Lauch, Wirsing und Mangold, die braunen Kapseln des Mohns bei den Gelben Rüben, und vorm stachelbeerstrotzenden Strauchwerk am Holzzaun blühten blaue Herbstastern, Dahlien und Chrysanthemen. Die Zwiebeln und Gurken waren schon geerntet, auch die Haselnüsse und Himbeeren. Der Blumenkohl reckte dem Betrachter seinen hellen Kopf entgegen, die sommersatten Trauben am Spalier drückte es zur Erde, die Holunderbeeren färbten sich hinein ins Dunkle, bald würde es Walnüsse hageln für die knakkende Wohligkeit des Winters. Die Fülle der Natur machte den Heimkehrer wehmütig. Ach, die verflossenen Jahre in der Fremde, die abgerissenen Verbindungen zu seinen Leuten daheim, hatte sich das alles gelohnt? Was würde ihn jetzt wohl erwarten? Vielleicht hätte er vorher doch einmal schreiben sollen?
Die Nachmittagssonne strebte schon dem Abend entgegen, als Wegmann in Dachsbach anlangte. Am Ortseingang hörte er das Gebrüll einer rindernden Kuh, die stiersüchtig am Aufreiten war. Buben schlugen mit langen Bohnenstangen nach Kastanien in den Bäumen. Die feuchtglänzenden Früchte sammelten sie in Säcken und brachten sie zum Jäger, der ihnen das Futter für das Wild im Winter mit ein paar Kreuzern entlohnte. Eine alte Frau mit Kopftuch und verschossener Schürze zermantschte in einem Trog vor einem Hofhaus Rübenschnitz und Hafersied zum Verfüttern an die Schweine. Am Schuppentor standen Körbe mit gekochten Kartoffeln und Kleie, daneben lagen Rübenblätter und Brennesseln. Tauben gurrten und flatterten oben am Schlagbrett, und die letzten Schwalben ziepten in der Luft über der Scheune. Sie genossen diese langen Spätsommertage mit den tänzelnden Mückenschwärmen im goldenen Licht. Bald würden sie sich zum Abflug rüsten, fort von den Nachtfrösten und Herbstnebeln und hinein in wärmere Gefilde. Eine alte Frau schaffte mit einem Rückenkorb Grünfutter heim für ihre Geißen und Stallhasen. Hinter ihr schob ein alter Mann einen rumpeligen Schubkarren mit frisch gesenstem Gras. Von einer Hofsäule aus stierte ein Knecht mit einer kalten Tabakspfeife dem Vorüberziehenden neugierig und einfältig ins Gesicht, ohne Gruß und Geste.
Ein barfüßiges kleines Mädchen in Dreck und Speck stand vor einem verzogenen, schadhaften Hoftor und schaute scheu herüber. Sein Kleid war abgewetzt und fleckenbesetzt, auf dem kahlrasierten Kopf prangte ein zerkratztes Grind. Eine Rotzglocke hing ihm vom Nasenloch herunter bis zum verschmierten Mund, in dem ein nasses Schnullersäckchen steckte, an dem es mit stiller Hingabe lutschte. Seine trüben Augen schauten Wegmann unverwandt an, bis das Kind plötzlich von einem heftigen Husten geschüttelt wurde. Aus dem Haus dröhnte eine Frauenstimme heraus. Eine untersetzte Bäuerin fuhrwerkte in einer dampfigen Kesselküche herum, wo sie Bettzeug kochte und blaue Wäsche bürstete und fleihte. Der Geruch von Wäsche, die tagelang im Schaff eingeweicht gewesen war, lag dick und stickig in der Luft. Da tauchte die gedrungene Frau auch schon mit einem tropfenden Waschkorb auf der Hausstaffel auf und erblickte den bärtigen Wanderer, dessen Anzug zu keiner Bauernarbeit paßte. Trotz ihres rotgelaufenen Gesichtes und der schweißverklebten Haarsträhnen hatte er seine alte Schulkameradin erkannt, die Hartmanns Gunda, die mit ihm einst konfirmiert worden war und ihm jetzt unvermittelt vors Auge trat, verblüht und stark in die Breite gegangen. Sie schien keine Ahnung zu haben, um wen es sich bei dem grüßenden Mann mit dem gelupften Hut wohl handelte. Geschwind zog er weiter, verfolgt von ihrer Stimme, die plärrte und einbelferte auf das greinende, hustende Kind.
Aus einem niedrigen Stallhaus hörte Wegmann die Herdringe klappern, das Rutschen von Tiegeln und Töpfen. Durch das niedrige Fenster sah er Feuer aufflammen, er roch das Dunstgemisch aus Dörrfleisch, gestöckelter Milch und ranzigem Rüböl, das schwer in der rußigen Küche hing. Im Hof neben der Mistgrube arbeiteten zwei Männer an einer Hobelbank, wo sie Sprossen und Streben fertigten. Sie hatten Holzstücke eingeklemmt zwischen Klotz und Keil und hantierten mit Bogensägen und Schabhobeln bei den zwei Holzböcken herum. Das konnte nur der Seidlers Veit sein, der auch schon arg gebückt ging. Die grobkantigen Züge erlaubten keinen Zweifel, wem sein Sohn sein Gesicht zu verdanken hatte. Die zwei in ihren blauen Kitteln und Schürzen erkannten den Grüßenden ebensowenig wie die Hartmanns Gunda vorher und ließen sich von ihrem beharrlichen Schaffen nicht weiter ablenken. Von nichts kommt nichts, dachten sie bestimmt, die Arbeit fordert ihr Recht, das Leben hat seinen Preis, wer nicht spurt und sich nicht sputet, der muß am Ende die Zeche zahlen und in sein hartes, karges Brot beißen.
Weiß Gott, Wegmann mußte wirklich ein anderer Mensch geworden sein, ein Unbekannter, ein Fremdling. Würde ihn die Mutter überhaupt erkennen? Und die Geschwister, die Nachbarn? Da tauchte der Stiefvater in ihm auf mit seinem Groll und seinem Geiz, und da wußte er, warum ihm jahrelang kein Brief von der Hand gehen wollte. Die blutige Wut stieg wieder hoch in ihm, die ihn damals gepackt hatte, als der ihm eine mit der Ochsenrute drübergezunden hatte, wie bei einem störrischen Rindvieh, damals, als ihm der Heuwagen umgefallen war im Schleifweg. Und wie der Stiefvater da getobt und gezetert hatte! Daß er sich gar nicht einzubilden braucht, daß es auf dem Hof noch was zu erben gibt für ihn, daß die ganze Sach sowieso einmal sein eigener Bub kriegt, daß er sein Graffel packen kann und sich gefälligst aus dem Staub machen soll, das Alter hätte er, daß er bei den Zigeunern und Scherenschleifern hausen kann, weil das eh keinen wundern wird, wenn er sich zum Gesindel schlägt und von den Federn aufs Stroh kommt!
War es trotzdem richtig gewesen, einfach wegzugehen von zu Hause? Die Mutter zurückzulassen bei diesem klobigen Mannsbild und so viele Jahre fortzubleiben, ohne Brief und Lebenszeichen? Er sah wieder das verhärmte Gesicht seiner Mutter nach dem allzu frühen Tod des Vaters. Ihr Schweigen und Starren und Schlucken unter den hartherzigen Reden des Stiefvaters. Wie sie dem Kerl verpflichtet blieb, so unterwürfig und ergeben! Das gehört sich so, hatte sie nur gesagt, wer heiratet, der hat seine Ordnung und seine Schuldigkeit, so ist es eben, so hat man es zu tragen. Für sie als verwitwete Mutter mit fünf Kindern unter dem Beichtalter und lauter geizigen Mausbalgschindern in der Verwandtschaft gab es damals nichts zu wählen und nichts zu mäkeln.
»Michel, bleib net daheim, das tut doch deiner Lebtag net gut!«, hatte sie zu ihm gesagt. »Schau, du bist ein heller Bursch, hast einen rechten Sinn und zwei tüchtige Händ. Du findst doch leicht dein Fortkommen anderswo, in der Stadt. Wennst hierbleibst, des gibt noch Mord und Totschlag mit dir und dem Wilhelm. Das Fortgehn bereut einer wie du bestimmt net.«
Recht behalten hat sie, seine Mutter. Aber wie weh hatte es getan! Schäbig kam er sich vor damals, weil er nichts tun konnte, um ihr zu helfen. Geschämt hatte er sich, weil sie ohne den Vater plötzlich zu Bittstellern geworden waren, ausgeliefert wie Menschen zweiter Klasse.
Doch jetzt würde er ihr den Lebensabend versüßen, so wie sie es sich im Traum nicht vorstellen konnte! Er mußte an den Onkel Lugg denken, seinen Taufpaten, der sich damals für ihn verwendet und verbürgt hatte beim Landgericht, an die Jahre auf Wanderschaft, wochenlang durchgeschlagen über Land, dann monatelang als Hauer, als Lader und Schieber unter Tage geschuftet im Bergwerk im Ruhrgebiet, danach die Überfahrt nach Amerika, die Schufterei, das Heimweh, und schließlich am End das schiere Glück. Wie sich seine Leute freuen würden mit ihm, über seine Heimkehr und seinen Erfolg!
Dachsbach lag nun in seinem Rücken und der Galgenberg vor seinen Augen. Es gab nur noch den Teschenberg zwischen ihm und dem Ort seiner Kindheit. Jetzt kannte er jeden Fuhrweg und jeden Maulwurfshaufen. Oben auf der Höhe blieb er schnaufend stehen, Tränen schossen ihm in die Augen, daß er sich über die Backen wischen mußte. Gewissenhaft besah er sich sein kleines Dorf und holte sich jeden einzelnen Hof und Hausnamen für einige Augenblicke im Geiste zurück. Dann drehte er sich um und blickte noch einmal zurück in die Grundwiesen. Rund und rotgelb wie ein Eidotter verschwand die Sonne hinter dem Wipfelkamm des Steigerwalds. Müde fühlte er sich nun, bleischwer waren seine Beine, doch die heiße, pochende Vorfreude schoß ihm durch alle Adern und Fasern. Gänsehaut und Herzklopfen! Jetzt kann er es dem Stiefvater heimzahlen! Jetzt kann er allen zeigen, was er aus sich gemacht hat! Die werden alle aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, mein lieber Spitz!
Da suchte seine Hand im Futter der Anzugjacke nach etwas, fand einen Gegenstand und befühlte ihn voller Genugtuung. Immer lauter und hungriger rumpelte nun sein Magen, immer schwerfälliger bewegten sich seine Füße, immer fester preßten sich die Lippen und Zähne aufeinander. Eine brennende, bange Erwartung ließ sein Herz gegen die Rippen klopfen, so wie ein keuchender Gast gegen eine Tür trommelt in der stockdunklen Nacht.
3
Der erste Mensch, den Michael Wegmann in Peppenhöchstädt traf, war der »Ballgoor«. Der stand auf der Straße herum und scheuchte eine flatternde Henne unter wildem Gejohle und Gefuchtel zurück in den Hof. Merkwürdig, der Kerl hatte sich über all die Jahre kaum verändert. Von kleiner Statur und leicht verwachsen war er schon damals gewesen. Als Kind hatte er die Englische Krankheit gehabt und dann das Hirnfieber, deshalb war das ganze Männlein verkümmert und sein Geist zurückgeblieben. Bei seiner Familie im Hirtenhaus gab es mehr Kinder als gute Worte, da horchte man nicht so genau hin und hat die Sache verschlampt. Danach hieß es, sein Hirnkästlein habe einen Hieb abgekriegt, und er sei darum halt nicht ganz gescheit im Kopf.
»Der hat so viel Verstand wie seinem Vater sein Spotzkasten mit die Sägespän drin«, spotteten die Bauern, die ihn als Handlanger und Botengänger aber recht gut brauchen konnten. Er half bei den einfachen Arbeiten, hockte sonntags im Wirtshaus, rauchte ein scheußlich stinkendes Tabakkraut aus dem eigenen Grasgarten und wurde von den jungen Burschen gern geleimt und angeschmiert. Sein wirklicher Name war den wenigsten bekannt, denn von jeher hieß er bloß der Ballgoor, weil er in seinem schwerverständlichen, schleimfeucht rumpelnden Redefluß immer wieder das Wort »ballgoor« im Sinne von »beinahe« aus dem Mund herausfallen ließ wie einen zu heißen Brocken. »Ballgoor hätt’s gscheppert, ballgoor jetzt aber, ballgoor fei! Ballgoor hin g’hutzt, ballgoor derwischt, ballgoor rumkugelt!« So quollerte und bollerte es in einer Tour aus ihm heraus.
»Grüß dich Gott, Ballgoor! Sag, kennst mich noch?«
Unsicher schaute Ballgoor mit verzerrtem Gesicht zu Wegmann auf. Sein Unterkiefer mit der vorgewölbten Unterlippe schien die Zunge im Mund zu zermahlen. Doch mit einem Mal strahlte ein Grinsen auf und zog sich quer unter seiner Nase von einem Ohr zum anderen.
»Ballgoor net. Etz aber scho.«
»Und meinen Namen, kennst den auch noch?«
»Der Michel, der wo fort is.«
»Schön, daß du mich noch kennen tust!«
»Ich kenn ballgoor jeden.«
»Horch, wie geht’s denn meine Leut?«
»Ballgoor alle fort.«
»Meine Mutter und der Onkel Lugg?«
»Alle fort.«
»Was redst denn du für Zeug daher?«
»Ballgoor alle fort.«
»Und mei Schwester? Wo ist denn die Sophie?«
»Beim Ratt.«
»Was für ein Ratt?«
»Beim Ratt auf’m Hof.«
»Beim Schusters-Ratt?«
»Dort droben halt, schau!«
»Beim Konrad, ihrem Vetter?«
Da nahm der Ballgoor Wegmann beim Ärmel und führte ihn weg wie eine Geiß zum Melken. Als sie zum Anwesen der Reutlein kamen, zeigte Ballgoor hinein und ging grußlos seiner Wege, wohl irgendwelchem Vieh oder Geziefer nach. Das alte Gehöft vom Onkel. Ein hingeducktes, niedriges Haus aus Sandstein, dessen Kalkputz an etlichen Stellen brüchig und löchrig geworden war. Unten und oben herum schauten teilweise schon arg abgesandete Quader heraus. Man sah die mit Zwickelsteinen gefüllten und mit Kalkmörtel zusammengebundenen Zwischenräume. Das graue Wetterbrett aus Holz an der Giebelseite schaute rissig und krumm herunter. Ein verwaister Eisenring in der Wand deutete darauf hin, daß hier einmal eine Hundehütte gestanden hatte. Wind und Wetter und schweres Schuhwerk hatten die Sandsteinplatten des Gehwegs und der Hausstaffel längst ausgeschliffen. Die Trittschwelle neben dem bockelnden Holzabstreifer war geschwungen wie eine Stirnplatte, der Türstock verzogen.
Durch den dunklen Hausflur hindurch sah Wegmann im rauchigen Zwielicht der gedrungenen Küche eine Frau herumwerken am Herd. Es roch dampfig und muffig, nach gekochten Erdäpfeln und gequollenem Weizen. Vorsichtig ging er hinein, klopfte an den Türstock und meldete sich mit einem unverblümten »Grüß Gott«. Ruckartig drehte sich die Frau herum.
»Meine Güte! Jetzt bin ich aber derschrocken!«
»Vor mir muß sich aber weiß Gott keiner fürchten! Und du schon gleich gar net, Sophie.«
Die Frau starrte den Mann im Türrahmen stumm an wie ein Gespenst.
»Sag bloß, du kennst deinen eigenen Bruder nimmer, Sophie? Hab ich mich denn gar so arg verändert in all den Jahren?«
»Allmächt! Des darf doch net wahr sein! Michel? Bist des du?«
»Na, lang genug hast dich jetzt aber besinnen müssen, mein ich!«
»Um Gottes willen, ich glaub, ich träum! Ich hätt dich etz fei nimmer kennt mit deinem Bart da! Aber die Stimm, die kenntmer gleich! Menschenskind, daß du noch leben tust!«
»Ja, und wie! Was denn sonst?«
»Wir habn denkt, du bist vielleicht schon gstorben und verdorben da drüben.«
»Ja, weiter nix mehr! Wo denkst denn hin?«
»Weilst dich in all die Jahr halt gar nimmer gmeldet hast, kein Lebenszeichen, gar nix. Warum hast dich denn net einmal grührt?«
Verlegen streckte sie ihrem Bruder die Hand entgegen. Er drückte sie fest und lang.
»Ach, Sophie, wie soll ich des erklärn? Des geht net so zwischen Tür und Angel.«
»Hast schon was gessen? Hast an Hunger? Magst a Brotzeit, sag? Komm, hock dich her da! Mensch, ich kanns noch gar net glauben, des is ja wie ein Wunder!«
Sophie räumte Tiegel und Gläser vom Tisch, holte einen angeschnittenen Brotlaib und ein Stück Butter, legte kaltes Bauchfleisch dazu und stellte eine Schüssel mit Zieberleskäs vor ihm hin. Der Herd knisterte kaum mehr, und Sophie schürte Wellenreisig und Holzscheite nach. Es roch nach Rauch und Ruß und altem Fett.
Michael griff hungrig und dankbar zu. Sophie war fülliger geworden, dachte er, sie sah viel älter aus, als sie war. Eine Frau, die ihm ausgesprochen bekannt vorkam, und ihm doch wie eine Fremde erschien, die man schwer einzuschätzen weiß. Sophie schien verwirrt zu sein, angespannt, unschlüssig, sie fragte nichts, trotz all der Fragen in ihrem Kopf, und ihr Bruder wollte ihrer Zurückhaltung und Verlegenheit nicht mit drängender Unduldsamkeit begegnen. Nur zögerlich kam ein Gespräch in Gang.
»Sophie, ich hab den Ballgoor getroffen auf der Dorfstraß. Wo ist denn unsre Mutter?«
»Sag bloß, des hast du gar net erfahrn damals?«
»Was denn?«
»Daß sie gstorben ist.«
»Die Mutter? Is nimmer … da?«
»Ach Gott, des is alles scho so viel Jahr etz her.«
»Gar nix hab ich davon …«
»Und wir hab’n alle denkt, daß d’ vielleicht deswegen nix mehr von dir hören läßt.«
»Wie hätt ich des denn …? Ich war doch so weit …«
Wegmann blickte wie entgeistert vor sich hin, ließ sich auf einen Holzstuhl sinken und drückte die Hände gegen sein Gesicht.
»Der Mutter war’s halt was Args, daß keiner mehr was g’hört hat von dir. Keine Menschenseele. Und du weißt ja, wie der Stiefvater ihr des Leben manchmal verhagelt hat.«
»Lebt der noch?«
»Naa, den Wilhelm hat der Schlag troffen. Der hat am End nimmer reden können und nimmer laufen. Ein Jahr lang hat er uns viel Plag gmacht im Bett, und bis zuletzt hat er mit seinem Stecken rumgetobt wie ein Wilder. Der ist arg hart naus aus der Welt. Dem Kerl hat seine Bosheit noch einmal gscheit den Leib traktiert! Naja, und sein David, der hat na die Rackelmanns Babett g’heiert aus Retzelsdorf, der ist heut der Bauer auf unserm alten Hof.«
»Des hat der Stiefvater alles sauber dreht und deichselt für seinen David …«
»Naja, glücklich ist der aa net, wirst schon sehn! Dort liegt ka Segen drauf. Wenn der eine Hü sagt und der andre Hott, dann geht’s schnell mehr rückwärts wie vorwärts.«
»Und der Onkel Lugg? Und des Rettla, die Käthi, die Anna?«
»Allmächt, du weißt des alles gar net?«
»Ja, was denn?«
»Ach Gott, des is alles so lang schon her. Bald schon zehn Jahr. Ach, du liebe Zeit! Der Onkel Lugg hat doch immer so hart gschnauft. Dem ist dann die Lunge sauer gworden, die hat’s dann wie zerfressen. Und die kleinen Schwesterle, die sind ganz schnell hinternander weg gwesen. Die haben Fieber kriegt g’habt über Nacht, und in vier Tagen warn die gstorben. Fort wie der Tau in der Sonne. Des hat der Mutter dann des Leben gar graubt, des kannst dir ja denken.«
Wegmann schwirrten Splitter und Scherben aller möglichen Gedanken durch den Kopf. Er fühlte sich zerlöchert, kraftlos, erstarrt. Die Hände hielt er fest an die Tischplatte gekrallt. Sophies Worte waren wie ein Baumstamm auf sein Herz und sein Gewissen gestürzt. Daß einem der Tod immer so schlagartig das Liebste auf der Welt aus dem Leben reißen mußte! Ein bitterer, schneidender Schmerz packte Wegmann im Nacken und in der Brust, er drückte ihm das Gesicht in die Asche seiner Freude. Die Tränen stauten sich in seinen Augen, und er rang um Fassung und Stimme.
»Später hab ich dann den Konrad g’heiratet, jetzt bin ich versorgt«, sagte Sophie in die Stille hinein.
»Du hast den Konrad …?«
»Ach Michel, des hat sich halt alles so ergeben. Was soll man da viel sagen? Der Konrad war einschichtig und hat den Hof da übernehmen wolln. Und für so ein Vorhaben braucht man halt eine Bäuerin. Und da hat er mich drum angangen. Schau, was hätt ich denn machen solln? Mein Lebtag für andre die billige Magd machen und für jede Drecksarbeit grad gut genug? Und überhaupt war ich dann auf einmal in andre Umständ, und da hat keiner mehr auskönnen.«
»Ihr habt ein Kind?«
»Des is gstorben. In der ersten Woche gleich.«
Sophie schwieg eine Weile und hantierte lange in einer Schublade herum.
»Ach, die Zeit damals möcht ich net noch einmal durchmachen müssen. Die Schulden beim Juden, die schlechte Ernt, das Unglück im Stall, und dann das tote Mädla.«
»Und wie sieht des heut aus mit euch zwei da auf’m Hof?«
»Der Konrad ist im Grund ein tüchtiger, anständiger Kerl. Der kann zupacken, auf den ist schon Verlaß, wenn’s drauf ankommt. Manchmal mault er halt und raunzt an allem rum, aber er meint’s eigentlich net so. Der kann heut grüblerisch sein und rumlaufen wie des verriegelte Elend, und morgen ist er wieder sierisch und sumsert wie eine Kleehummel.«
»Und der Hof, wirft er genug ab?«
»Wir haben ein paar schöne Tagwerk, es is net viel, aber es langt. Eine gute Schmalzwiesen, Äcker am Schleifweg und in der Schwärz, dann noch ein Hopfengärtla und einen Wald hinten am Vogelherd. Der Konrad tut für die Juden Vieh treiben und als Schmuser mit aushandeln, da springen schon mal Krautbeete raus oder so ein Spitzäckerla.«
»Der Ratt und ein Handeltreiber, ich sag’s ja! Wo ist er denn überhaupt, sag mal?«
»Der is noch auf’m Acker mit die Ochsen. Sei mir net bös, Michel, aber ich muß jetzt in den Stall und die Küh melken. Der Konrad wird sonst fuchsteufelswild, wenn man mit dem Vieh so lang braucht und net fertig ist, wenn er vom Acker heimkommt.«
»Ist schon recht, Sophie. Ich kann dir doch helfen beim Füttern!«
»Des wär ja noch schöner! Du bist unser Gast und net unser Knecht! Die paar Schwänz sind gschwind versorgt. Eß in aller Ruh und stell des Zeug hinter in die Speis, wennst fertig bist.«
»Gut, dann werd ich mir mal das Dorf anschaun und die Flur drum herum. Wahrscheinlich kenn ich mich gar nimmer aus.«
»Und nach dem Füttern und dem Melken erzählst uns, wo du dich rumtrieben hast, du alter Rumzug und Zigeuner!«
Ihr Bruder nickte lächelnd. Sophie zog ihre Holzschuhe an und klapperte mit einem Eimer hinaus in den Stall.
Wegmann machte Brotzeit und stand später wieder in der Dorfstraße und betrachtete Sophies eingadiges Haus. Es hatte keinen Keller und keinen Kniestock. An der Giebelseite befanden sich kleine Fenster mit Oberlichtern. Der Leinölkitt war schon bröckelig, und bei den zwei Flügeln wäre ein Anstrich kein Luxus gewesen, bevor man wieder die Herbst- und Winterfenster einhängen und alles mit Moos, Holzwolle und Lumpen verlegen würde wie alle Jahre. Die matten Scheiben erinnerten Wegmann an die Spinnweben, Eisblumen und Wasserflecken im Haus seiner Kindheit. Auf dem Dach ragte ein rauh gemauerter Schlot mit aufgestellten Ziegeln in die Höh, fränkische Biberschwänz lagen auf den Sparren und Latten. Da kam ihm ein langvergessener Spruch seines Vaters wieder in den Sinn: ›Die Ziegel haben Nasen, die Backsteine Zähn und eine gscheite Suppen hat tausend Augen.‹ Das Haus hier sah nicht gerade nach fetten Suppen und reichlich Fleisch aus. Daß die Sophie und ihr Konrad kein blühendes Hauswesen hatten, das lag auf der Hand.
Wegmann machte sich auf zu einem Gang ums Dorf. Das Alleinsein tat ihm jetzt gut. Er spürte die Erschöpfung und Traurigkeit, die ihn festhalten und erdrücken wollten. Die nachtkühle Herbstluft ließ seine Lunge aufatmen und verschnaufen. Beim Gehen und Schauen drängten sich Erinnerungen herein, das lächelnde Gesicht der Mutter beim Garbenbinden, beim Krauthobeln, beim Gugelhupfbacken, die glucksenden Geschwister beim Auskratzen der Teigschüsseln, die Gestalt des Vaters beim Ausspannen des Viehs. Tränen liefen ihm über die Wangen. Das frostige Gefühl, im Stich gelassen zu sein, stieg wieder in ihm hoch. Allein auf weiter Flur.
Er spazierte zur Säuschwemm, zum Löschweiher, dann die Fuhr hinaus zur Hirtenleite und zum Hühnergraben, zu den Schmalzwiesen, hinauf zur Laber Stange, dann hinüber zum Hirtenberg, zum Schneidersholz und an den Streitäckern vorbei wieder zum Haus der Schwester. In den Vorgärten sah er rankende Weinstöcke, Sonnenblumen und Sträucher mit den letzten Beeren. Aus den Ställen roch es warm nach Grünfutter, Mist und Kühen, die urkäuend schnaubten und beruhigend mit den Ketten rasselten. Kinder und Hunde waren zu hören in den hingeduckten Häusern. Ewig jung gebliebene Geräusche und Gerüche.
Ja, das war die Stätte seiner Kindheit. Nun war sie ihm wieder gegenwärtig mit ihrem Geschmack und Klang. Die Nacht mit ihrer nebelfeuchten Kühle und Finsternis hielt Einzug im ganzen Grund und schluckte allmählich die Stimmen, Farben und Umrisse. Viel hatte sich nicht verändert; die Wege, die Höfe, die Felder, alles trug noch das gleiche Gesicht, es war das armselige, beschauliche Bauernnest, das er zurückgelassen hatte, nur die Bäume waren größer, etliche Häuser neu gedeckt, und ein paar Handvoll Menschen waren weggestorben und dafür neue auf die Welt gekommen und dahergewachsen.
Hineingeboren. Von hier stammte sein eigenes Gesicht und Gemüt. Wo man herkommt. Wie man sich schreibt. Wie man heißt. Nach wem man gerät. Hier hatte er die Grundformen der Welt erfahren und sich eingeprägt. Kindheitsland. Löwenzahn, Sauerampfer und Bucheckern, Purzelküh und Hutzeldocken. Zeit der Steinschleudern und Wünschelruten, die ersten selbstgebrauten Räusche im Bierkeller. Hier hat er die Kühe gehütet, die Hühner verscheucht von der Saat, Eidechsen verfolgt im Brombeerschlag, Kornäpfel eingesackt, Steinkrebse gefangen und Nester ausgenommen, die handwarmen Kiebitzeier aufgeklaubt unterm taunassen Sensenblatt. Die Verheißungen der Palmkätzchen, im Mai die Schreie des Kuckucks nach Gulden und Talern, der Trauermantel auf der Gartenmauer, die wetzenden Grillen und flitzenden Fledermäuse hinten im Weihergrund, dort, wo der alte Schäfer den lieben langen Tag auf seinem wackeligen Stuhl hockte und für die Kinder wundervolle Geschichten aus dem Ärmel zauberte, vom Grimmerlein von Gickelhausen und seinem Wunderweiher in Gottesgab, vom Hörners Kasper und den drei Jägern, vom Häckelmann im Waldweiher mit seinen giftgrünen Augen, dem schleimigen Haar und seinen kalten, glitschigen Krautfingern.
Und die Sprüche erst von dem alten Schäfers-Jackl! »Du hast doch Wespen im Arsch und Hornissen im Hirn! Was du anlangst, des wird schimmlig! Sei stad etz, mit deinem Spektakel verrecken mir sonst noch die Fisch!« – »Jackl, alter Schlackl, haatscht rum wie a kranker Dackl!«, haben sie ihm nachgerufen. »Ihr seid ja frech wie Gassendreck, ihr Hundsdonnerwetter! Schaut bloß, gell! Ich hab fei den dicken Markgraf zum Vetter! Der verkauft euch unter die Soldaten, na schaut ihr wie die gstochnen Kälber, wenn ihr da in die Stiefel drinsteht wie der Gockel im Eimer!« All das schien so klaftertief versunken zu sein, so verblaßt wie nie gewesen. Der Jackl war längst verstaubt und vermodert.
Als Wegmann durch die knarzende Holztür wieder ins düstere Haus trat, hörte er Sophie in der Wohnstube hantieren. Vom Gang aus sah er, daß sie gerade dabei war, an den Fenstern die Vorhänge abzunehmen. Sein Blick schweifte kurz durch den Raum, er sah den gußeisernen Ofen im Eck, mit dem langen Abzugsrohr als Stubenheizung, das dunkle Büffet, das alte Kanapee, den Holztisch mit den vier Stühlen unter der Petroleumlampe, an den gekalkten Wänden die staubigen Strohkränze und gerahmten Häkelbilder. Die Decke war kalkverputzt, und auf der einen Seite, wo die Nässe ins Mauerwerk drückte, war zwischen den Balken und Brettern der Putz abgeblättert, daß die verdrahteten Rohrmatten herausschauten. Sobald ihn die Schwester bemerkte, erschrak sie, errötete und ließ alles stehen und liegen.
»Kannst du dir noch den Herd bei uns daheim denken, Sophie? Wie an den Haken überm Wasserschiff die nassen Halbstiefel und Fäustling getrocknet worden sind? Dort, wo wir uns als Kinder in der Höll hinterm Kachelofen versteckt haben, beim Stiefelknecht und beim Holzkorb, oder im Verschlag vom Schlafkabinett? Die Mutter hat einen Tee aufgebrüht, und der Großvater hat beim Körbflechten und Besenbinden die alten Geschichten erzählt vom Grünhütel, vom Federfuchs und von der Pfifferfee.«
»Hör mir auf mit die alten Gschichten da! Des is doch schon eine Ewigkeit her. Laß das Vergangene begraben sein, des hat doch keinen Wert net.«
»Nein, Sophie. Des Vergangene ist in uns immer lebendig.«
»Ich hab mit der Gegenwart weiß Gott schon gnug am Hals.«
Bevor Wegmann irgendetwas sagen konnte, kam Konrad mit festen Schritten und einer kuhwarmen Dunstfahne aus dem Stall ins Haus.
»So, hat der Ballgoor also doch recht g’habt. Jetzt ist der Am’rikanische tatsächlich wieder reingschneit kommen!«, rief er zu Michael hinüber, streckte ihm zögerlich die rindenrauhe Hand entgegen und musterte ihn mit einem abschätzenden Blick. Sein Gesicht wirkte kantig und verschmitzt, es war unrasiert, die schütter gewordenen Haare schienen wie hingeklebt an den schweißigen, wettergegerbten Schädel.
»Hat sich wohl der Freiheitsschwindel und Reichtumsrausch verblasen dort drüben, was?«
Er ging zum Guß, schüttete Wasser hinein und begann sich mit lautem Gespotze, Gerotze und Gespritze Kopf, Arme und Hände zu waschen. Sophie schaute verstohlen ihren Bruder an, doch der verkniff sich jeglichen Kommentar. Ohne eine Erwiderung abzuwarten, legte Konrad nach mit seiner Sicht der Dinge.
»Gell, ich mein halt, in dem Amerika da drüben ist auch net alles Gold, was glänzt! Dort werden einem halt auch net in einer Tour bloß die gebratnen Täuble ins Maul fliegen. Überall werden einem halt die Hörner gstutzt.«
Sophie schielte immer wieder hinüber zum Bruder, als müßte sie stumm um Verständnis oder Verzeihung bitten. Michael wußte nicht recht, wie er am gescheitesten auf die zwei so unterschiedlichen Menschen reagieren sollte. War man denn an seinen Ansichten, Schilderungen und Empfindungen überhaupt interessiert? Wo sollte er beginnen? Was erzählen? Wie erklären? Kaum zurück, glotzte ihm schon aus jedem Blickwinkel die Fremdheit an. Sollte alles wieder anfangen mit Falschheit und Fehlern, Verschweigen und Verschulden?
»Warum hat man denn vom gnädigen Herrn seit einer Ewigkeit keinen Muckser mehr g’hört, wenn man fragen darf?«, wandte sich Konrad wieder an ihn, wobei er sich mit einem Handtuch den Kopf und die haarigen Arme abtrocknete. »Erst die eignen Leut hocken lassen und dann kein Sterbenswort mehr herüberschicken in die alte Heimat, mein lieber Herr Gesangverein! G’hört sich sowas? Damit hast fei deine Mutter ins Grab bracht, daß du’s bloß weißt!«
Sophie sah, wie die Augen ihres Bruders feucht wurden und die Kiefer aufeinander drückten.
»Michel, weißt«, warf sie beschwichtigend ein, »du warst halt der Mutter ihr Augapfel. Und wie so lang nix mehr kommen ist von dir, wie’s g’heißen hat, es kommt zu einem Bürgerkrieg in Amerika, da ist sie immer einsilbiger und einhauchiger gworden und ganz zammgangen mit der Zeit. Da ist ihr das Schnaufen immer härter gfallen, und am End ist ihr Herz im Wasser erstickt.«
»Ja, so geht’s, erst der Augapfel und dann der Herzfresser«, pflichtete Konrad spitz bei. »Horch, für mich brauchst fei gar kein Brettla hintun, ich hab noch was zu erledigen im Dorf und dann trink ich noch ein Seidla beim Zapfer.«
»Was, du gehst heut noch ins Wirtshaus? Heut, wo der Michel heimkommen ist?«
»Grad deswegen. Wenn sich Brüderlein und Schwesterlein die alten Brotrinden einbrocken, dann will ich net stören beim Auslöffeln von der ganzen Familiensuppe da. Was der Red wert ist, erfährt man noch bald genug.«
»Aber du hast doch noch gar nix gessen!«
»Beim Wirt gibt’s heut a Schlachtschüssel.«
»Aber Konrad, des kost doch alles a Geld!«
»Ein wenig Freud braucht a Mann fei schon noch, hast g’hört! Und morgen früh sehn mir uns noch bald gnug, also gut Nacht mitnander!«
Damit war Konrad aus der Küche verschwunden. Sophie schwieg ein trockenes, bitteres Schweigen und drückte ihre Fäuste gegen den Leib. Michael hätte ihr jetzt gern einen tröstenden Spruch gesagt, ein befreiendes Scherzwort, aber seine Zunge war wie gelähmt.
»Nimm’s ihm net übel, Michel, so ist er manchmal halt, du kennst ihn ja, und seinen Vater hast du auch kennt. Die muß man rumhutzen lassen wie die narrischen Hummel, dann kommen’s wieder heimkrochen und sind die besten Kerl.«
Michael nickte. Er wollte seine Schwester nicht bedrücken und ging nicht weiter darauf ein, zudem steckten ihm die schweren Tage in den Knochen, und er sehnte sich nach einem langen, tiefen Schlaf.
»Laß gut sein, Sophie. Ich bin heut zu müd zum Erklärn und Verstehn. Morgen wieder, in alter Frische.«
»Is schon recht. Komm, ich zeig dir die kleine Kammer droben, die ist zwar arg einfach, aber fürs erste langt’s.«
Über eine knarzige Bodenstiege, an der man sich beim Runterwischen gewiß leicht Spreißel einreißen konnte im Fleisch, ging es hinauf und unter einem Kantholz als Türsturz hinein ins Dachzimmer mit den roh gekalkten Balken und den Föhrenbrettern ohne Nut und Federn. Dort stand ein altes Bett, ein mit Krempel und muffigen Kleidern vollgestopfter Schrank sowie ein verstaubter Holzofen ohne Rohr. Im Eck lagen alte Butten und Tragkörbe. »Schau dich net weiter um. Ich war net eingestellt auf Besuch. Morgen kriegst alles grichtet, was d’ brauchst.«
»Schon recht. Solang’s net verwanzt ist und verlaust.«
»Des fehlert grad noch!«
»Ich dank dir, Sophie.«
»Schlaf gut in der alten Heimat, Michel. Und morgen mußt dann alles erzähln, wies dir ergangen ist, wo du warst und was d’ alles erlebt hast!«
»Ja, freilich, gut Nacht, Sophie. Glaub mir, ab jetzt wird alles besser.«
»Sollst recht hab’n. Schön, daß d’ wieder da bist, Michel, gut’ Nacht!«
Als er auf dem Rücken lag und in die Höhe schaute zu den blanken Ziegeln über ihm, da sah er durch einen Sprung im Dach ein Stück vom Sternenhimmel. Das Bett fühlte sich kalt und klamm an. Es fröstelte ihn, er biß Zähne und Lippen zusammen, rieb die Füße aneinander warm und ballte die Fäuste unterm schweren, muffigen Federbett. Wie oft hatte er sich das im Geiste vorgestellt: heimzukehren. Allem Vertrauten ganz nah sein, das kleine, enge Dorf umarmen wie einen lieben Verwandten, die Familie ans Herz drücken und schier zerfließen vor Wiedersehensfreude. In Wirklichkeit war es so nüchtern und kühl wie ein lieblos hergestellter Notbehelf.
So mein Lieber, jetzt bist daheim und in einem Verschlag, grad so wie im Zwischendeck vom Atlantikschiff, dachte er und zog seine Anzugjacke ganz nah an seinen Leib, in deren Futter seine Faust etwas umfaßt hielt. Aber jetzt zeigst es allen, daß sie die Glotzer aufreißen und mit den Ohren schlackern! Jetzt heißt’s tüchtig draufhaun, daß die Sach einen gscheiten Anfang nimmt!
Der Schlaf holte ihn rasch zu sich in sein riesiges, unerforschliches Reich, wo das Vergessen herrscht und die Träume regieren.
4
Der Morgen war schon ein reifer Geselle, als Wegmann aus seinem Bärenschlaf erwachte. Er streckte und dehnte seine Arme und Beine und spürte die vielen Reisetage, die in seinem Leib noch drückten und zwickten. Er mockelte noch etwas nach, dösig und mit halbem Ohr. Die Ketten des Viehs in den Ställen rasselten, Kühe muhten, Kälber schrien, Hunde kläfften, Hühner gackerten, Hähne krähten, Enten und Gänse schnatterten, Kinder plärrten, Männer riefen den Gäulen und Ochsen Befehle zu beim Einspannen oder Anfahren mit den Bauernwagen: »Brrr« und »Hüha«, »Wista« und »Hott«. Lange konnte er sich nicht losreißen von diesem Dorfmorgenkonzert.
An einer Waschschüssel spritzte sich Wegmann das kühle Wasser ins Gesicht und ging nach unten in die Küche. Sophie hatte Milch, Brot und Butter für ihn auf den Tisch gelegt, dazu Honig und Zieberleskäs. Alles schmeckte nach Land, Dorf, Bauernhof, nach Handarbeit und Schweiß, nach Kuhstall und Erde. Es war der Geruch, dem er als junger Bursche einst entflohen war, der Geruch von Enge, Mühsal und Härte. Aber auch der Geruch von Nähe, Wärme und Herzhaftigkeit.
Als Sophie aus dem Stall ins Haus kam, schlüpfte ein Lächeln in ihr Gesicht.
»Gut’ Morgen, Michel. Ich hoff, du hast gut schlafen können da droben. Ein Palast ist das ja net. Ich war arg aufgregt die ganz Nacht vor lauter Herzklopfen und Freud, daß du lebst und wieder da bist. Ich kann’s noch gar net glauben, mir kommt’s so vor wie a einziges Wunder.«
Wegmann kaute an seinem Brot und aß hungrig den Zieberleskäs.
»Den darfst ruhig ganz aufessen, Michel. Da mach ich gleich wieder einen. Den hast früher auch schon so gern gessen, des weiß ich noch. Genauso wie den Backsteinkäs. Bist heut immer noch so ein Käswurm?«
Wegmann nickte und schaute kauend seine Schwester lange an. Er suchte das quicklebendige, heitere Mädchen hinter der breitbeckigen Frau mit den Strähnen und Falten, dem grauen Schimmer der Haare und dem matten Schleier der Augen.
»Was hast denn heut vor, sag mal?«
»Ich schau auf’m Bahnhof in Demantsfürth nach meine Koffer und Kisten, ob alles schon angekommen ist. Und der Sack Bohnen.«
»Was für Bohnen denn?«
»Kaffeebohnen, frisch geröstet, aus Bremen.«
»Was willst denn mit denen?«
»Na, mahlen, überbrühen und dann trinken.«
»Paß bloß auf, daß dir die net die Mäus wegfressen!«
»Nein, nein, da geb ich schon Obacht. Des wird mein Grundstock. Mein Fundus.«
»Was für ein Fundus denn? Was willst denn jetzt eigentlich da machen, Michel?«
»Ich werd mich erst einmal genau umschaun im Dorf, und dann wird was ganz Neues angfangt.«
»Machst an Bauern? Da brauchst fei erst a tüchtige Bäuerin.«
»Einen Hof brauch ich freilich. Äcker, Vieh, Wald, und ein großes Haus.«
»Gell, du willst a Gschäft aufmachen?«
»Sowas Ähnliches, eine Mischung, einen Hof mit einer Stube zum Ausschenken.«
»Einen Wirt willst machen?«
»Kein Wirtshaus. In Amerika hab ich schon gsehn, was ich will. Sowas gibt’s hier in der Gegend noch net.«
»Ja, was denn, sag bloß?«
»Ein Kaffeehaus.«
»Allmächt! Du bist doch net ganz gscheit! Des is doch bloß was für die Stadt. Wer soll sich denn da reinhocken?«
»Die Leut natürlich, für die Ochsen und Gäns is des nix.«
»Die Bauern hocken doch höchstens bloß beim Bier. Und von den andern Hungerleidern kann sich doch keiner einen Kaffee leisten! Da lachen dich doch die Gassenbuben aus, und die Gänshirten noch dazu!«
»Wirst schon sehn, Sophie, net alles, was die Leut zuerst verspotten als närrisches Zeug, is a Spinnerei.«
»Mensch, Michel, mach bloß keine dummen Sachen! Zum Gespött hab ich schon genug am Hals.«
»Keine Sorg, Sophie, ich weiß, was ich tu, des schaff ich schon. Und dann helf ich dir auch in die Höh mit deinem Hof da. Wirst schon sehn. Verlaß dich drauf.«
»Ein Kaffeehaus in dem Kuhkaff da?«
»Ganz genau, in dem Bauernnest hinterm Mond.«
»Des is ja wie Safran auf’m Kuhfladen!«
»Grad deswegen muß man’s probieren. Die kleinsten Vögel singen die schönsten Lieder.«
Sophie schaute ihn lange ungläubig an und schwieg. Ihre Gedanken drehten sich um dieses magnetische Wort: Kaffeehaus. Sie hatte keine Vorstellung davon und spürte nur voller Angst und Sorge das Scheitern ihres Bruders herannahen. Graue Wolken am Horizont, die ihr wieder einmal die Hoffnung und die Zukunft verhageln würden.
Wegmann riß sie aus ihrer Versunkenheit.
»Ich geh dann zu unserer Mutter auf den Kirchhof, und zum Onkel Lugg, zur Margaret, zur Käthi und zur Anna. Spätestens am Abend bin ich wieder da.«
»Wir sind heut auf’m Acker und tun die Erdäpfel raus. Heut abend ist der Konrad auch daheim, da mußt uns endlich von deinen Jahren draußen in der Welt erzähln. Von den ganzen Wilden in Amerika, von den Schiffen auf’m Meer und den riesigen Städten dort drüben.«
Wegmann nickte wortlos und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof in Demantsfürth. Sein Tragkoffer und sein Sack Bohnen waren bereits angekommen, er ließ sie von einem Bauern zum Haus seiner Schwester fahren. Seine verplombten Kisten und Überseekoffer waren noch unterwegs. Er traf Vorkehrungen, sie ebenfalls umgehend nach Peppenhöchstädt schaffen zu lassen, sobald sie eintreffen sollten. Der Bahnhofsvorsteher kannte ihn nicht und versah pflichtbewußt seinen Dienst, ohne ihn neugierig auszufragen.
Eine Dreiviertelstunde später betrat Wegmann den Friedhof in Dachsbach. Es war ihm wohl gewesen, von niemandem angesprochen zu werden, unbehelligt seinen Gedanken und Schritten nachhängen zu können. Das quietschende Metalltor zog ihm eine Gänsehaut über den Leib. Dohlen flatterten und krähten am Dach des Wasserschlosses umher. Gott sei Dank war kein Mensch im Kirchhof, der Werktag forderte allen Einsatz und Fleiß. Es roch nach Fichtenwedeln und feuchter Erde. Die Aisch schickte ihren moosig-modrigen Flußgeruch herüber. Karpfenzeit, Kartoffelzeit, Fruchternte und Wintersaaten. Die Luft war voll davon. Vertraute Namen kamen ihm unter die Augen. Wilhelm Seybold, der Stiefvater, der für ihn immer ein Gegner blieb, kein Vater. Ludwig Reutlein, sein Taufpate, die kleinen Schwestern: Margarethe, Katharina, Anna, alle drei so blutjung verstorben. Gesichter blitzten auf, verschwanden wieder, überdeckt von anderen. Ein kurzes Gedenken und Gebet. Sein Fuß fand das Grab wie von selbst. Wegmann spürte sein Herz heftiger klopfen, für einen Moment scheute er den Anblick, die Gewißheit, daß seine jahrelange Hoffnung endgültig zerbrochen war.
Todernst starrte ihn das geschmiedete Eisenkreuz an, kalt und fremd der Name seiner Mutter auf dem Porzellanmedaillon in der Mitte: Kunigunde Seybold, verw. Wegmann, geb. Reutlein. So viele verschnörkelte Buchstaben für ein viel zu kurzes Leben. Schlagartig schoß ihm das armselige Dasein seiner Mutter ins Bewußtsein: die harte Arbeit von Kindesbeinen an, die Geburten der Kinder, der Tod ihres ersten Mannes Adam Wegmann, den sie auf einer Familienfeier im Steigerwald kennengelernt hatte. Sie hatten miteinander getanzt, sich verstanden und einander versprochen, ihre Eltern wurden handelseinig, und damit hatte alles seine Ordnung und sein Bewenden. Es gab nichts zu klagen oder zu wünschen, das Leben war hart genug, so oder so. Angekettet an Haus und Hof, an Familie und Feldarbeit. Dann ihr zweiter Mann, der sie als Witwe mit fünf Kindern zur Frau nahm, weil ihm seine gestorben war und ihn kinderlos und ohne Erben zurückließ. Mit dem Seybolds Wilhelm hatte sie noch einen Sohn gehabt, den David. Damit waren die fünf Kinder aus der ersten Ehe überflüssig geworden und freigegeben zum Verdingen, mutterseelenallein.