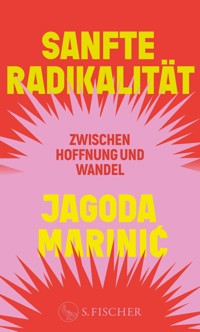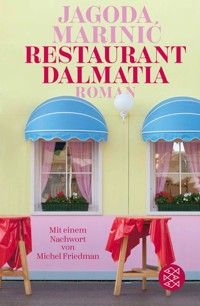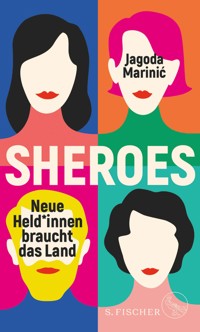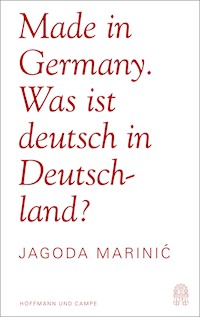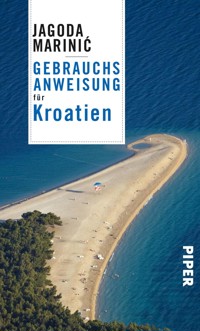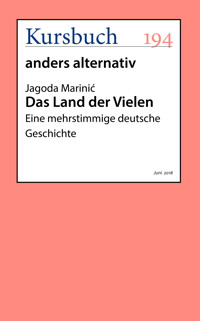
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Schriftstellerin Jagoda Marinić führt im Kursbuch 194 auf anschauliche Weise vor, wie sich der Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik ändert, wenn man sie aus einer ausgeschlossenen dritten Perspektive erzählt, nämlich der der Einwanderer. Es fehlen Narrative, sagt sie, die von anderen Aspekten als nur denen des vermeintlichen Misslingens der Einwanderungsgesellschaft erzählen. Eine in ihrem Sinne erzeugte Vielstimmigkeit im öffentlichen Diskurs könnte dafür sorgen, dass nicht weiterhin nur die eine Sicht, die eine Realität als dominante nachgezeichnet wird. Denn eine Folge dieses eklatanten Missverhältnisses sei auch die Normalisierung rechter Diskurse in der Mitte der Gesellschaft quasi als Reaktion auf diese eine Realität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Jagoda MarinićDas Land der Vielen Eine mehrstimmige deutsche Geschichte
Die Autorin
Impressum
Jagoda MarinićDas Land der Vielen Eine mehrstimmige deutsche Geschichte
Ich sitze in einem Berliner Café. Bei kaum einem der Tischgespräche um mich herum wird Deutsch gesprochen. Deutschland 2018. Hautstadtflair mit Weltstadtelementen. Heutzutage ist für viele so ein Sprachenmix Normalität, auch jenseits der Hauptstadt. Um das betriebsame Leben einer deutschen Großstadt aufrechtzuerhalten, muss die Arbeit vieler Menschen, die aus der ganzen Welt kommen und hier ihren Lebensmittelpunkt haben, ineinandergreifen: Flughäfen, Bahnhöfe, Krankenhäuser, Pflegeheime – Menschen, auch eingewanderte, bringen all die urbanen Strukturen zum Funktionieren. Doch der Diskurs über das Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft beschäftigt sich hierzulande zunehmend mit dem Scheitern. Ein Narrativ voller Bedrohungsszenarien droht das erfolgreiche Zusammenspiel zu überschatten. Und es fehlen Narrative, die parallel von anderen Aspekten der Einwanderungsgesellschaft erzählen. Nicht so, dass Probleme geleugnet würden, wohl aber so, dass Vielstimmigkeit dafür sorgen könnte, ein Missverhältnis in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht erst entstehen und das Misslingen nicht als alles überschattendes Narrativ der Einwanderungsgesellschaft bestehen zu lassen. Eine Folge des derzeitigen Missverhältnisses ist die Normalisierung rechter Diskurse in der Mitte der Gesellschaft – sie scheinen dann nur eine Reaktion auf »die Realität« zu sein, dabei erzeugt diese Verengung der Narrative eine allumfassende Pseudoumwelt.
»Die Realität« erzählt sich aus einer anderen Perspektive naturgemäß sehr anders. Im Bundestag, in den Führungsetagen zahlreicher – auch öffentlich finanzierter – Institutionen, auf staatlich geförderten Tagungen oder Konferenzen usw. erscheint die deutsche Gesellschaft plötzlich nicht mehr so divers. Hier ist die Vielfalt noch nicht im selben Maß wie im öffentlichen Leben angekommen, weil der Zugang nach wie vor privilegiert ist – was sich auch daran zeigt, dass bestimmte soziale und ethnische Milieus unterrepräsentiert sind. Man zerbricht sich den Kopf darüber, wie Publikum, Programm und Personal diverser werden könnte, »zukunftsfähig« heißt das. Die Institutionen von morgen werden ohne die Menschen von heute nicht überleben können. Verantwortliche, die jahrzehntelang Offenheit gepredigt haben, müssen jetzt erkennen, dass sie diese Offenheit zwar gefordert, aber selbst nicht konsequent in den Strukturen, für die sie zuständig sind, umgesetzt haben. Noch bevor die Welt feiern konnte, dass der Deutsche Bundestag so divers ist wie die Fußballnationalmannschaft, geht die Meldung um die Welt, dass erstmals seit 60 Jahren wieder eine rechte politische Kraft im deutschen Parlament sitzt. Im Parlament gerade jenes Landes, in dem man meinte, durch Erinnerungskultur solchen Tendenzen stärker entgegengewirkt zu haben als andere Länder. Ein Argument, das im Ausland angeführt wird, um Deutschland zu verteidigen: Der Rechtsruck sei einem historischen Jahr gefolgt, in dem die Mehrheit der deutschen Gesellschaft sich solidarisch mit dem Schicksal von Menschen auf der Flucht gezeigt hatte. Dafür, heißt es dann oft mit einem Augenzwinkern, sei der Prozentsatz eher gering.
Doch dieser geringe Prozentsatz erzeugt eine schwer zu befriedigende Schaulust, die das Narrativ weiter verschiebt: In deutschen Medien erscheinen aufwendig bebilderte Langstrecken über die »neuen rechten Intellektuellen«, die New York Times war nach der letzten Bundestagswahl wie trunken von den neuen Rechten, wochenlang erschien ein Leitartikel nach dem anderen dazu. Diese Relevanz resultiert nicht zuletzt aus dem besonderen Unbehagen, das deutscher Nationalismus auslösen kann – bei US-Autoren jüdischer Herkunft, deren Familiengeschichten von den Gräueln der Nazi-Zeit für immer geprägt sind und die durch transatlantischen Austausch gelernt hatten, an ein anderes Deutschland zu glauben. Sie möchten nicht wahrhaben, dass gerade Deutschland, von dem man in moralischer Hinsicht ein anderes Bewusstsein erwartet, die Weltgemeinschaft nun wieder mit rechten Kräften und nationalistischen Parolen konfrontiert.
Rechte Strömungen werden auch deshalb so stark wahrgenommen, weil ihre Narrative um Deutschland altbekannt und leicht abrufbar sind im kollektiven Bewusstsein. Das andere Deutschland, das weltoffene, ist dagegen jung. Es blitzt immer wieder auf, doch es hat bislang weder ausreichend Strahlkraft noch ist es vielstimmig genug, um für die Wiedergabe eines realistischen Bildes vom gegenwärtigen Zustand in diesem Land die nötige Durchschlagskraft zu erzielen. Noch immer scheint es eine Mehrheitsgesellschaft zu geben, die weitgehend funktioniert, einen rechten Rand sowie Ausländer, die sich noch nicht so integriert haben, wie das von der Mehrheitsgesellschaft erwartet wird. Die Vielzahl der Geschichten und Lebenswelten bleibt neben diesen schrillen, ausgetrampelten Diskursen oft unbemerkt. Die Protagonisten einer funktionierenden Vielfalt wünschen sich eine Normalisierung im Umgang mit der Diversität in diesem Land. Doch wie sind die alten Erzählstränge zu durchbrechen? Und wenn der Economist das Brandenburger Tor auf seine Titelseite setzt und darüber »Cool Germany« schreibt, scheinen viele diesen positiven Blick auf das eigene Tun, auf die Entwicklung Deutschlands als erfolgreiches Einwanderungsland, nicht auszuhalten.
Ganz normal gelebte Vielfalt. Warum hält Deutschland sich selbst so schwer aus?
Dabei hätten die, die nicht in Deutschland leben, leicht den Eindruck bekommen können, in diesem Land seien die Rechten überall. Und das, obwohl die Menschen – wie der Economist zu Recht feststellte – in den letzten Jahren Erstaunliches geleistet haben. Denn nicht erst seit 2015 ist Deutschland mit großen Migrationsbewegungen konfrontiert. In Zeiten der Gastarbeiteranwerbeabkommen waren die Zahlen im zweistelligen Bereich. Damals flohen Menschen aus diktatorischen Regimen, wie beispielsweise dem Iran, nach Deutschland. Über Jahrzehnte hinweg sind Einwanderer und ihre Familien in dieses Land gekommen.
Die meisten Menschen in deutschen Städten leben ihre Vielfalt mit großer Selbstverständlichkeit. Diversity is normality. Eine Normalität allerdings, die derzeit immer wieder Debatten-Erdbeben erleiden muss. Generalisierungen nach terroristischen und kriminellen Vorfällen sind die Regel und stellen eine vielfältige Gesellschaft vor Herausforderungen. Diese Debatten und die Art, wie sie geführt werden, polarisieren. Es scheint derzeit zwei mögliche Reaktionen auf diese aufgeheizten Kontroversen zu geben: mehr rechtes Denken in der Mitte salonfähig machen – oder mehr Selbstbewusstsein behaupten im Umgang mit der eigenen Diversität. Dabei geht es nicht mehr um die Unterteilung in rechte und linke Lager. Alle Seiten bemühen sich inzwischen um die sozial schwächer Gestellten. Die Verteilungsfrage ist ein Problem, das alle erkannt zu haben scheinen.
Die große Konfliktstelle ist die Frage: Wie schafft man ein Narrativ, das aus der Vielheit einer Bevölkerung ein Wir-Gefühl entstehen lassen kann? Wer ist dieses Wir? Woraus besteht es? Die Aufmerksamkeit richtet sich immer stärker auf die Frage nach der kulturellen Identität. Während die eine Seite das homogene, nationale Narrativ bemüht, versucht die andere Seite von den nationalen Erzählungen, die immer auch exklusiv sind, hin zu einer großen Erzählung zu gelangen, die gesellschaftliche Inklusion ermöglicht.