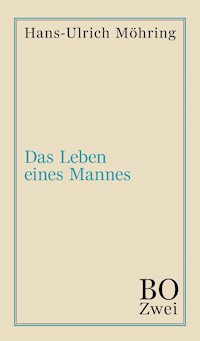
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Bildungsroman, eine Liebesgeschichte, ein Gedicht über Mann und Frau. Über Singen und Sagen. Über das Herz einer Generation. »Für die weibliche Lebensbewegung, meinte er, hätten sie in ihrer Jugend keinen Sinn gehabt. Sie hätten die Frauen letztlich nur als Schattenwurf ihrer eigenen, im Licht stehenden Heldengestalten wahrnehmen können. Wenn überhaupt. Was sie gelebt hatten, sei die männliche Erfahrung in ihrer reinsten, stärksten, schwärmerischsten Form gewesen. Wenn heute offenbar die Frauenbefreiung das Gebot der Stunde war, dann hätten sie, sofern man das vergleichen konnte, die Männerbefreiung gelebt. In rauschhafter Ausschließlichkeit.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 659
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Bo
Romantrilogie
1 Traum von Frau
2 Das Leben eines Mannes
3 Das Fest der Männer und der Frauen
Hans-Ulrich Möhring
Das Leben eines Mannes
Roman
Bo
Zweites Buch
Umschlaggestaltung: Notburga Reisener
© 2020 Hans-Ulrich Möhring
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback: 978-3-347-02305-5
Hardcover: 978-3-347-02306-2
e-Book: 978-3-347-02307-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
»… und geschikt einem …«
… trockene Seele…
»Wie blöd kann der Mann sein?«
Die Tür zum Hof fliegt auf, und als Bo sich erschrocken umdreht, sieht er Anna mit dem schweren Holzkorb durch die Küche ins Gemeinschaftszimmer wanken. Scheiße, an den hat er gar nicht mehr gedacht. Er springt auf, um ihr zu helfen, aber da hat sie ihn schon zum Kamin geschleppt und krachend abgestellt. »Heidenei, wo bist du bloß immer mit deinen Gedanken?« Sie schießt einen fiesen Blick auf ihn ab, wedelt mit der Hand vor der Stirn, dann macht sie abrupt kehrt, knallt die Tür hinter sich zu und lässt ihn betreten stehen. Er hört sie im Hof weiterschimpfen, während er schuldbewusst zum Kamin tappt und den Schnee von den obersten Scheiten klopft. Er nimmt zwei von weiter unten, die trocken geblieben sind, legt sie aufs Feuer. Auch schon ziemlich weit heruntergebrannt. Einfach zu dämlich, dass er das Holz vergessen hat. Er ist zurückgegangen, um die Schuppentür zuzumachen, und auf einmal hat es zu schneien begonnen, und er hat zu dem Flockengeriesel aufgeschaut und vor sich hingeträumt, wie so oft, und dann an nichts anderes mehr gedacht als weiterzulesen. Missmutig brummend schlurft er zum Sessel zurück, nimmt wieder das schmale Bändchen zur Hand. Selten genug, dass er am Wochenende mal zum Lesen kommt.
Unbemerkt von ihm ist draußen der Schneefall stärker geworden. In der trüben Fensterscheibe blickt ihn schemenhaft sein Spiegelbild an. Er sieht sich den Kopf schütteln. Wie blöd kann der Mann sein? Ja, das hat er sich in letzter Zeit auch schon mal gefragt.
Auf jeden Fall blöd genug, um sich freiwillig in solche Lebensumstände zu begeben.
An Silvester hatte es unmenschlich früh, noch vor elf, hartnäckig bei ihm geklingelt, und als er sich schließlich aus den Federn wälzte und schlaftrunken und verkatert die Tür aufmachte, starrte er Egon ins Gesicht. Das war noch nie dagewesen. In den ganzen fünf Jahren das erste Mal, dass der bei ihm in Frankfurt aufkreuzte. Bo war so verdattert, dass er kein Wort herausbrachte, und auch Egon sagte nichts, als er eintrat und die Tür hinter sich zuzog.
Sie setzten sich in die Sessel. »Es ging nicht«, sagte Bo, während er sich mit zitternden Fingern eine Zigarette drehte. »Es ging einfach nicht.« Er spürte schon wieder das Würgen im Hals, schluckte.
Egon schwieg lange. Dann begann er, von Freds Beerdigung und dem anschließenden Gedächtniskonzert zu erzählen. Alle waren gekommen; alle außer Herrn Bodo Bodmer. Sogar Ruud war da. Den hatte er ewig nicht mehr gesehen. Sah völlig abartig aus. Mit Sofie habe Ruud zwar nicht so richtig gut harmoniert, aber es sei gegangen. Sofie habe nach ihm gefragt. Andere auch. Sie sei über sein Ausbleiben echt betroffen gewesen. Sie hätte sich gewünscht, mit ihm reden zu können, habe sie gesagt. Wieder schwieg Egon. »Ich hätte dich ermorden können, als mir klarwurde, dass du nicht kommst«, sagte er schließlich in einem für seine Verhältnisse fast bissigen Ton. »Dass du es nicht mal in so einem Fall schaffst, deine eigenen Scheißbefindlichkeiten zurückzustellen, und einem toten Freund – ja, verdammt! – die letzte Ehre erweist! Was zum Teufel ist los mit dir?«
Es dauerte, bis Bos Tränenstrom so weit versiegte, dass er sich halbwegs verständlich artikulieren konnte. Er wusste selbst, wie erbärmlich sein Verhalten war. Aber woher die Ehre nehmen, die er Fred hätte erweisen sollen? Irgendwie hatte dieser Tod seine ganze hohle Existenz platzen lassen wie eine Seifenblase. Es war alles wieder hochgekommen in ihm: die gemeinsamen Jahre in der Band, das Politgekasper vorher, das Hin und Her mit Petra, die ungelebte Spannung zu Sofie, dann die Versuche, Boden unter die Füße zu bekommen, mit Schreiben, mit irgendwas. Alles für die Katz. Er war nichts und niemand. Eine Null. Die Vorstellung, Sofie wiederzusehen, in dem Zustand, im Duett mit ihr zu singen!, das war da einfach zu viel gewesen. »Mit mir reden, pff!« Er stieß scharf die Luft aus. Er hatte Egon nie von der Begegnung mit Sofie vor zweieinhalb Jahren erzählt, nicht wahr? Das holte er jetzt nach, zwischendurch immer wieder von Weinkrämpfen geschüttelt. Egon schloss einen Moment die Augen. Sie war über Nacht geblieben? Sie hatten zusammen … geschlafen?
»Ja. Es war wirklich … Ich dachte …« Bo machte eine hilflose Geste, dann legte er die Hand auf die Augen, wartete eine Weile. »Egal, was ich dachte. Im Morgengrauen, um fünf ungefähr, wache ich plötzlich auf, weil das Türschloss geschnappt hat oder so, und da ist das Bett neben mir leer.« Er beschrieb, wie er barfuß durch die Straßen gerannt war und ihren Namen gebrüllt hatte. Er wischte sich mit dem Taschentuch die Tränen ab, schneuzte sich heftig. Wie er verschiedene Möglichkeiten durchgespielt hatte, sie zu erreichen, sie zur Rede zu stellen, bis er auf dem Fußboden den Zettel von ihr fand: »Lass mich. Verzeih.« Er hatte gedacht, er wird wahnsinnig, hatte sich die wildesten Sachen ausgemalt, was er machen würde. Am Ende aber hatte er sie … gelassen.
So unerschöpflich sein Vorrat an Tränen im Augenblick zu sein schien, damals hatte er keine gehabt. Keine einzige. Eine wahnsinnige Wut hatte in ihm gebrannt, und so ein idiotischer Trotz, als ob er’s ihr irgendwie zeigen könnte, wenn er weiß Gott was machte, irgendwas Großartiges schrieb oder so. Aber dann war nach dem elenden deutschen Herbst diese innere Leere gekommen, und als er in dem Winter zufällig Carlo wiedergetroffen hatte und sich von dem als Dealer anheuern ließ … Na, den Teil der Geschichte kannte Egon ja schon. Er hatte halt gedacht, er müsste auf einen völlig anderen Trip gehen, hatte sich toll gefühlt, auf dem Vulkan zu tanzen … Und eine Zeit lang war das auch gar nicht so schlecht gewesen … Aber irgendwann … Und nach der Nachricht von Freds Tod … Bo schüttelte den Kopf, sah seinen Freund durch einen Tränenschleier an. »Egon, ich muss hier weg, ich muss hier raus! Ich muss was vollkommen anderes machen, vollkommen neu anfangen! Diese Trips, die ich hier abziehe in diesem Frankfurter Sumpf, das ist doch immer das selbe, immer die selbe Schleife. Ich strampele mich ab wie der Hamster im Rad und drehe und winde mich, und dabei komme ich keinen Zentimeter voran. Und diese Frau … ich hab versucht, das abzuschütteln, zu vergessen, mich nicht runterziehen zu lassen, aber sie steckt einfach so tief in mir drin, immer noch … Ich muss sie mir aus dem Fleisch schneiden, hörst du, ein für allemal, sonst gehe ich vor die Hunde. Ich muss irgendwie … Ich weiß nicht.« Er griff sich mit beiden Händen in die Haare. »Wenn sie oben im Norden in Hamburg wohnt, sollte ich wahrscheinlich ans südlichste Ende der Welt ziehen, oder wenigstens der Brrd. Irgendwohin, wo ich nicht ständig denke, hoffe, sie könnte mir über den Weg laufen, wenn sie ihre Eltern besucht, oder sich vielleicht doch noch bei mir melden und … Ich weiß nicht.«
»Hm«, machte Egon und betrachtete die Wand. »Hm.« Er legte den Kopf schief. »Ist das jetzt der nächste Trip, oder ist es dir wirklich ernst?« Bo sah ihn an. Ihm war, als wäre der Boden unter ihm von Nebel verschleiert, als säße er auf grauem Wolkengrund. Ja, es war ihm ernst, sagte er. Egon strich sich mit der Hand über die Stirn. »Ich glaube, ich habe eine Idee«, sagte er. Der erste Drummer der Rout 66, Volker, war Ende 1966 mit seinen Eltern nach Ravensburg gegangen. Bo hatte ihn nie kennen gelernt. Später hatte er in Freiburg Forstwirtschaft studiert, war aber Mitte der Siebziger ausgestiegen und mit Freunden in eine Landkommune in der Bodenseegegend gezogen, die irgendwas mit Wald und Holz und so machte. Egon hatte jahrelang nichts von ihm gehört gehabt, ihn dann aber wegen Freds Beerdigung kontaktiert, wie viele andere auch, und Volker war tatsächlich gekommen und sie hatten sich lange und intensiv unterhalten. Der Mann hatte eine richtig gute Entwicklung gemacht. Diese Kommune, in der er lebte, na ja, nach den Bemerkungen, die er darüber fallengelassen hatte, war das ein relativ tougher Haufen, aber in Bos Situation als Kur vielleicht gar nicht verkehrt.
Bo zuckte die Achseln. Schon möglich. Und wenn, wie würde man die Sache angehen? Sie dachten gemeinsam nach. Egon ging aus dem Wagen einen Autoatlas holen. »Viel südlicher geht’s nicht«, sagte Bo, als sie Urnau gefunden hatten, die Ortschaft, in deren Nähe der Waldhof lag. Eine Landkommune. Er wusste nicht, ob das für ihn das richtige war. Aber in seiner Situation – was war da schon das richtige? Unter Umständen war es einen Versuch wert. Ja, vielleicht. Doch. Ja. Egon zückte sein Adressbuch, griff zum Telefon. »Ja?« Ja. Er erreichte Volker auf Anhieb. Der besprach die Sache mit den anderen und rief dann zurück. Sie verabredeten sich für den nächsten Samstag. So gegen drei? Das erste Wochenende der achtziger Jahre.
Unglaublich, dass keine zwei Schneekristalle gleich sein sollen – das hat jedenfalls Egon auf jener Wochenendfahrt zum Waldhof behauptet, als es so heftig schneite, dass sie hinter Pfullingen nur noch kriechen konnten und erst mit mehrstündiger Verspätung am Abend ankamen. Irgendwann fing Egon an, von harmonikalen Gesetzmäßigkeiten zu reden und über Schneekristalle zu philosophieren und andere Sachen, wo die Sechszahl formbestimmend sei, Bienenwaben zum Beispiel, über den Gegensatz zur Fünf, die mit der Tendenz zum Fortzeugen und Fruchtbringen verbunden sei, während die Sechs die vollkommene natürliche Bauform hervorbringe und das Bild der harmonisch ausgewogenen objektiven Schönheit. Das meiste hat Bo vergessen oder es ist gleich bei ihm durchgerauscht. Aber dass alle Schneekristalle trotz ihrer unendlichen Formenvielfalt sechs gefiederte Strahlen haben, hat er sich gemerkt. Alle sind Sechssterne. Und wie die Schneekristalle aus der Begegnung der Wärme des aufsteigenden Wasserdampfs mit der Kälte der Luftschichten darüber entstehen, so wird laut Egon im Sechsstern ganz allgemein die Durchdringung und Vereinigung der Gegensätze anschaulich, bestehe er doch aus zwei Dreiecken, von denen eines, mit der Spitze nach oben zeigend, das Feuer und eines, mit der Spitze nach unten, das Wasser symbolisiere. Die elementare Gegensatzspannung schlechthin.
Immer dichter draußen der Flockenfall. Bo beugt sich näher an die Scheibe. Die elementare Gegensatzspannung. Wärme und Kälte. Fließendes und Festes. Wieder wenden sich seine Gedanken dorthin, wohin sie sich meistens wenden, wenn er sie nicht mit Gewalt daran hindert. Der warme, der heiße Strom der Liebe, den Sofie in ihm entfesselt hat, ist als Dampf der Sehnsucht zu ihrem blauen Himmel aufgestiegen, dort aber an ihrer Kälte erstarrt und zerbrochen, und jetzt fällt er in einem Splitterregen auf ihn nieder. Die fließende Liebe verfestigt zu eisiger Schönheit. Aus blauem Feuer weißer Tod.
Zu ihrer geplanten Ankunftszeit »so gegen drei« hatten sie gerade mal die Donau überquert und hielten in Riedlingen an einer Telefonzelle, um ihr verspätetes Eintreffen durchzusagen. Kein Problem, erklärte eine Feli, die Bo an den Apparat bekam. Dann würden sie sich halt den Hof und die Umgebung erst am Sonntag anschauen können. Als sie Richtung Saulgau weiterkrochen, merkte er beinahe staunend, wie das Ziel, auf das sie sich seit Stunden zubewegten, durch den selbstverständlichen Ton der Frauenstimme in der Leitung zum ersten Mal einen schwachen Anschein von Wirklichkeit gewann. Bis jetzt war zwischen Egon und ihm noch kein Wort darüber gefallen und dieser »Waldhof« nur ein Name, mit dem sich keinerlei konkrete Vorstellung verband. Ein paar Leute, die irgendwie auf dem Land lebten. Die ihm unter Umständen Asyl geben würden. Bilder von Waldspaziergängen zogen ihm durch den Kopf. Von Bergurlaub mit der Familie. Von Tramptouren durch das ländliche Anatolien. Von der Tripmühle in Rommersheim, wo er damals mit den Shiva Shillum gewohnt hatte – auf dem Land gelegen, aber im Alltag nicht furchtbar ländlich. Wie mochte es sein, so ein richtiges Landleben? ein mögliches Asyl?
Viel konnte Egon ihm nicht dazu sagen. Entstanden war die Hofgemeinschaft vor ein paar Jahren aus irgendeinem linken Projekt in Ravensburg, Genaueres wusste er auch nicht. Als er nach der Beerdigung mit Volker geredet hatte, war es weniger um das Leben in der Kommune gegangen als grundsätzlich um das Verhältnis von Drinnen- und Draußensein. Konnte Volker als gelernter Forstwirt wirklich auf Dauer so radikal aussteigen und trotzdem mit Aufträgen von Förstern und Waldbesitzern am Ball bleiben, wie er es gerne würde? Konnte Egon ein stinknormales Angestelltendasein als IBM-Informatiker und Familienvater führen und trotzdem auf irgendeiner Ebene das freiheitliche Leben verwirklichen, das sie sich einst auf die Fahnen geschrieben hatten? Das Schöne und Fruchtbare an der Diskussion war gewesen, dass keiner eindeutige Antworten hatte, dass die Fragen wirklich offen waren, die Möglichkeit des Scheiterns real, jenseits aller prinzipiellen Überzeugungen, aller Hoffnungen an die Zukunft. Was den Waldhof anbelangte, hatte er eigentlich nicht viel mehr erfahren, als dass alle auf ihre Art einen Bezug zu Landarbeit, Waldbau oder Handwerk hatten und selbstorganisiert arbeiten wollten. Volker hatte kurz was von den verschiedenen Tätigkeitsbereichen erzählt, aber das hatte sich Egon nicht gemerkt. Irgendwas mit einem Sägewerk? mit Pferden? Keine Ahnung. Jedenfalls richtig handfeste Arbeit. Bo sank das Herz, als er sich vorzustellen versuchte, wie er im Märzen die Rösslein anspannte. Er fragte nicht weiter nach.
Zuletzt hatten Egon und er auf ihrer nicht enden wollenden Fahrt durch das Winterwunderland des einschneienden Oberschwaben einen Zustand des Immerweiterrollens erreicht, der etwas Tranceartiges hatte. Sie schwebten in einer Raumkapsel durch das unergründliche All, in dem die Lichter entlegener Dörfer und Weiler wie ferne Sternbilder funkelten. Als der Strahl des Scheinwerfers irgendwann tatsächlich auf das Ortsschild »Urnau, Gde. Deggenhausertal, Bodenseekreis« fiel, schüttelten beide wie auf Kommando den Kopf und stießen leise Töne des Verwunderns aus: unvorstellbar, angekommen zu sein. So übersahen sie zunächst die Abbiegung zum Waldhof, ein Sträßchen nach links in einer Rechtskurve, zwischen zwei Häusern und schmal wie eine Hofeinfahrt, das Schild an einer Hauswand versteckt. Sie mussten wenden. Hinter dem Ortsausgang war die Feldstraße nur noch eine schmale, auch schon wieder überschneite Schneise zwischen hohen Schneehaufen. Vor ihnen tauchte ein Bildstock auf, unter dessen Dächlein ein schattenhafter gekreuzigter Christus im Licht der vorbeistreichenden Scheinwerfer aus hohlen Augen leidend in die Winternacht starrte. »Uh!«, machte Bo überrascht, und Egon, der in Gedanken schon beim Ankommen war, trat vor Schreck auf die Bremse. Die Zeit dehnte sich wie ein Kaugummifaden, als der alte Opel Rekord unaufhaltsam auf eine scharfe Rechtskurve zurutschte, ein paar Meter über unebenen Untergrund abwärts holperte und sich schräg mit der Schnauze fast liebevoll in einen besonders hohen Schneeberg grub. Im Moment des Steckenbleibens und Vorprallens an die Scheibe zuckte vor Bos innerem Auge das Bild von Fred auf, wie er mit hundertachtzig Sachen in der Kurve über die Leitplanke raste. Sie dagegen schlidderten gemütlich mit Tempo fünfzehn über den Acker: der Unterschied sprach Bände. Nachdem sie sich von dem Schreck erholt und sich gegenseitig bestätigt hatten, dass ihnen nichts passiert war, vielleicht ein blauer Fleck an der Stirn, kam die unangenehme Entdeckung, dass die Reifen im Rückwärtsgang durchdrehten. Alle Versuche, zurückzustoßen und aus eigener Kraft auf die Straße zurückzukommen, scheiterten kläglich. So blieb ihnen nichts anderes übrig, als zur nicht blockierten Fahrertür auszusteigen und, als auch Bos Schieben nichts half, die letzten dreihundert Meter bergan zu dem weiter oben am Waldrand gelegenen Hof zu stapfen, wo sie, vom eisigen Wind auf dem kurzen Marsch kräftig durchgepustet, sofort an den Kamin verfrachtet und mit heißem Tee und restlichen Weihnachtsplätzchen versorgt wurden. Zwei langhaarige bärtige Gestalten nahmen Egon den Autoschlüssel ab und verbaten sich jegliche Einmischung bei der Bergungsaktion, die sie mit einem alten Unimog in zwanzig Minuten erledigt hatten. Derweil schwamm Bo wie ein Öltropfen auf dem weiten Wasser der Solidarität, das ihn trug und ihn sich selbst abnahm, während er sich gleichzeitig von den Wellen der Wärme umhüllen ließ, die von dem offenen Feuer ausgingen. In Not zu sein und geholfen zu bekommen, prompt und ohne Gedöns, das hatte er, wollte ihm scheinen, zu selten gehabt im Leben. Ausnahme Egon natürlich. Er nickte öfter, während dieser sich mit Volker unterhielt, und steuerte hin und wieder eine Bemerkung bei, doch im großen und ganzen war er zufrieden, schweigend dazusitzen und in die Flammen zu schauen, während Leute kamen und gingen, ihn begrüßten oder auch nicht, mit eigenen Dingen beschäftigt. Der Geruch in der großen, niedrigen Bauernstube nach verbrennendem Holz, nach kochendem Essen, nach trocknendem Schuhleder, nach anderen undefinierbaren Dingen (er dachte an Arbeit gewohnte menschliche Körper, auch weibliche darunter), diese warme Wolke erzeugte in ihm ein Gefühl der Geborgenheit, des Aufgehobenseins, in das er sich tief einschmiegte. Ein Ort im dunklen Nirgendwo. Fremde Menschen, die einen bewirteten und dabei doch in Ruhe ließen, anders etwa als in Gastsituationen in der Türkei. Ah, angenommen werden, namenlos. Nichts erklären müssen. Zu essen bekommen. Später ein Bett. Eine Frau, eines Tages. Ein einfaches Tagwerk, ja, warum nicht?
Umso beklemmender das Gefühl, als es nach dem Abendessen zur Sache gehen sollte. Das Geschirr war abgeräumt und die Runde von aktuell sechzehn Leuten am wuchtigen Ecktisch eng zusammengerückt. Die Sache war er, der potentielle Neue. Ein Suchscheinwerfer zerschnitt das namenlose Dunkel und richtete sich auf ihn, auch wenn – wie hieß er? – Hubert, der hier der Wortführer zu sein schien, erst einmal in breitem Schwäbisch allgemein etwas zu ihrem Selbstverständnis sagen wollte. Die nuschelige, halb verschluckte Sprache, die Bo eben noch als angenehm zurückhaltend und unaufdringlich empfunden hatte, bekam etwas Reserviertes, Argwöhnisches, Abweisendes. »Woisch, mit so Programma und grauße Theoria hämmer’s ett so«, erklärte Hubert, als hätte Bo irgendwelche Theoriedefizite eingeklagt. »Heut noch weniger als früher. Das hört sich alles pfundig an und man redt sich die Köpf heiß und kommt sich furchtbar wichtig und weltrevolutionär vor, und was wirklich abgeht, das stehet auf ganz einem anderen Blatt.« Er zwirbelte seinen blonden Schnurrbart und fixierte Bo mit einem Blick aus schmalen Augen. »Am Anfang, da haben wir uns ewig und drei Täg gestritten, Politfraktion gegen Landfraktion, welchen politischen Stellenwert kann so eine selbstorganisierte Arbeit haben, ist das jetzt das reine kleinbürgerliche Aussteigertum, das bloß die gesellschaftlichen Widersprüche verschleiert? Tun wir den antikapitalistischen Kampf verraten und werden selber kleine Kapitalisten, wenn wir ein eigenes Unternehmen gründen, und wär’s noch so alternativ und ohne Chef, und gehen damit auf den Markt und konkurrieren mit andern Kleinkapitalisten?« Er winkte ab. »Nix wie Heckmeck. Was wichtig ist, worauf’s uns ankommt, das ist ganz einfach. Wir wollen so frei und selbstbestimmt leben wie möglich, hier und jetzt, nicht erst am Sankt-Nimmerleins-Tag nach der Revolution. Ohne Lohnsklaverei und Konsumidiotie.«
»Und dafür«, ergänzte eine ihm gegenüber sitzende Frau mit rundem, von braunen Locken umrahmtem Gesicht, »braucht’s halt neue kollektive Lebenszusammenhänge, solidarische Lebenszusammenhänge mit offenen Beziehungen zwischen den Leut, wo die sich gegenseitig in der persönlichen Entwicklung unterstützen und wo der ganze alte Kram abgeschafft ist: dass die einen oben sind und die andern unten und die Frauen für Küche und Kinder zuständig und so. Wie wir leben und arbeiten ist wichtiger, als was wir genau machen: dass wir lernen, anders umzugehen miteinand, und uns helfen, Konkurrenz und Mackertum und das alles abzubauen. Und dass man was macht gegen die Isolation und Einsamkeit heutzutag, das Singledasein, das immer mehr Leute führen und wo sie dann ihr Glück bloß noch darin finden, immer mehr und mehr zu konsumieren, immer neues Zeug. Wenn wir die Gruppe stärken, stärken wir auch die Einzelnen.«
»Das Gruppenleben muss einer schon wollen, wenn er hier einsteigen will«, bestätigte Hubert. »Aber ob’s funktioniert, hängt nicht an theoretischen Einsichten, sondern das ist immer eine praktische Sach. Wer bei uns mitmachen will, muss sich einbringen mögen, muss mit uns arbeiten mögen und mit uns leben mögen – und wir mit ihm.«
Bo erwiderte Huberts Blick, nickte.
»Wie is euer Grupp eischentlich entstande?«, fragte Egon, der durch das Schwäbisch der anderen unwillkürlich ins Mainzerische verfiel. »Was der Volker mir letztens erzählt hat, hab ich, ehrlich gesagt, mehrstenteils vergesse.«
Hubert lehnte sich zurück und sah die braungelockte Frau an. »Komm, erzähl du, Feli.«
Und Feli erzählte. Von einem Schüler- und Lehrlingsprojekt in Ravensburg. Von einem selbstverwalteten Jugendzentrum. Von der korrekten proletarischen Linie, die studentische ML-Missionare aus Konstanz ihnen Anfang der siebziger Jahre beibiegen wollten, und den tapferen Anstrengungen, die sie mit revolutionärer Betriebsarbeit und Arbeiteragitation unternommen hatten. »Raus aus der Schule!«, sei die Devise gewesen, aber am zweiten Teil der Parole, »Rein in die Betriebe!«, hätten sie nach einiger Zeit die Lust verloren. Die Blödheit, Bürgerlichkeit und Bierseligkeit des Proletariats war durch keine Agitation zu erschüttern. Sie mieteten einen heruntergewirtschafteten Hof am Stadtrand von Ravensburg, gründeten eine Kommune, schmiedeten Pläne für ein alternatives Landleben, erwogen die Auswanderung nach Neuseeland, experimentierten kurzfristig mit freier Liebe. Sehr kurzfristig. Sie fuhren nach Südfrankreich zu einer linken landwirtschaftlichen Kooperative, aber mit den hierarchischen Strukturen von denen kamen sie nicht zurecht. Sie diskutierten die verschiedensten Projekte, Gemüseanbau, Schafzucht, Geflügelhof, Biogroßhandel, Weinimport, bis sich die Lösung auf einmal wie von selbst ergab. Irgendwie kamen sie immer auf das Thema Holz zurück. Der Basti und der Andreas, Feli deutete auf die zwei bärigen Unimogfahrer, hatten vor dem Fachabi Zimmerer gelernt, sie selbst war gelernte Holzbildhauerin und interessierte sich auch wie der Schorch und die Bylle für das alte, aussterbende Holzhandwerk, der Hubert war sowieso ein Waldbauernsohn, der Volker war Forstwirt, und er und die Anna waren Zugpferdenarren, und alle, auch die mit anderen Interessen wie Gärtnern, Heilkräuter, Hexenwissen, natürliche Ernährung und so weiter, wollten am liebsten auf dem Land leben, mit Tieren, und draußen im Freien schaffen, nicht in stickigen Büros und lauten Fabriken. Als dann vor ein paar Jahren der Waldhof zum Verkauf stand, mit einem ewig nicht mehr benutzten alten Sägegatter in der Holzscheune, hatten sie zugeschlagen. Er war zwar in einem schlimmen Zustand, aber bauen, das konnten sie, und auch wenn manche Traumblase an der harten Realität zerplatzt war, was sie in den drei Jahren auf die Beine gestellt hatten, konnte sich sehen lassen, fand sie.
Die drei Leute, die in der Zwischenzeit die Küche gemacht hatten, waren mit ihrer Arbeit fertig und setzten sich dazu, schenkten sich Wein oder Wasser ein. Bo wusste nicht, ob er mehr Respekt empfand vor der Unerschrockenheit, mit der dieser Haufen geradenwegs seine Ideen in die Tat umzusetzen versuchte, oder mehr Unbehagen bei dem politischen Anspruch, der immer den Grundton gab, wenn Leute, die irgendwo auf seiner Wellenlänge lagen, etwas unternahmen, egal was es war. Klar war er auch für ein freies und selbstbestimmtes Leben in solidarischen Zusammenhängen, ohne Karrierismus und alte Rollenmuster, aber … In dem eingetretenen Schweigen holte er Luft, räusperte sich und sagte: »Wahrscheinlich sollte ich was zu mir sagen. Da sieht’s so aus: ich hab vor fast genau zehn Jahren die Schule geschmissen, von wegen ›Raus aus der Schule!‹. Ich hab ein paar Jahre Musik gemacht, das hat der Egon ja schon erwähnt, in der Band, in der auch der Volker ganz am Anfang war, und hab mich ansonsten mit Jobs und Straßenmusik und Dealen und so über Wasser gehalten. Eine Zeit lang dachte ich, ich will schreiben, aber daraus ist nichts geworden. So ein Projekt, wie ihr es habt, mit andern Leuten, hab ich für mich nicht gefunden, damit habe ich also keine Erfahrungen … außer halt allgemein WG-Erfahrungen und dann eben die Jahre in der Band. Und in letzter Zeit… na ja, da ist es nicht so besonders gut gelaufen für mich. Vor allem so eine Geschichte mit einer Frau vor einiger Zeit hat mir mehr ausgemacht, als ich dachte.« Bo schluckte. Seine Stimme hatte sich belegt. Wenn er nicht aufpasste, saß er auf einmal da und heulte diesen fremden Leuten was vor. Wieder räusperte er sich. »Ich hab jetzt … ähem, in den letzten Tagen hab ich darüber nachgedacht, was ich ursprünglich mal wollte vor zehn Jahren, was mich damals getrieben hat. Und vielleicht ist das, was ich wollte … und was dann im Lauf der Zeit immer mehr in den Hintergrund getreten ist … vielleicht gibt’s da sogar Ähnlichkeiten zu euch. Ich wollte … na ja, damals hab ich gesagt: Mensch werden. Mir den Kopf mit irgendwelchem zusammenhanglosen Bildungsscheiß vollzustopfen, um später mal Karriere zu machen oder so, das ist mir immer total schwachsinnig vorgekommen. Ich hab schon viel gelesen und hab auch nichts dagegen, mir Gedanken zu machen, aber was mich daran interessiert, an Gedanken und Theorien, ist, was das konkret fürs Leben bedeutet, für mein eigenes Leben und überhaupt. Ähem.« Bo fühlte, wie der Wasserdruck hinter den Augen stieg. Was sollte er machen? Er zuckte hilflos die Achseln. »Wie gesagt, weit bin ich nicht gekommen mit meiner Menschwerdung. Und jetzt bin ich an dem Punkt, glaube ich«, seine Kehle zog sich immer fester zu, die Stimme war heiser, zitterte, »wo ich noch mal ganz von vorn anfangen will, ganz unten.« Die Dämme brachen. »Unverkopft«, stieß er noch hervor, bevor er mit zuckenden Schultern das Gesicht in den Händen vergrub.
»Für Seelen ist es Tod, Wasser zu werden.«
Wie kann es sein, dass dieser Mann vor so langer Zeit eigens für ihn geschrieben hat? Bo blickt wieder aus dem Fenster. Ans Fenster. Große schwere Schneeflocken klatschen mittlerweile im rotgrauen Dämmerschein des Märzabends an die Scheibe und glitschen daran hinab, unten angekommen schon geschmolzen. Draußen scheint es milder zu werden.
In den letzten Monaten hat Bo nur zu oft das Gefühl gehabt, zu Wasser zu zerfließen, sich in Nässe aufzulösen, in der eigenen Seelenfeuchtigkeit zu ertrinken. Gleich spürt er wieder den Druck hinter den Augen, mit dem die Drüsen ihre Bereitschaft anzeigen, beim geringsten Anlass in Aktion zu treten. Er atmet dagegen an. Konzentriert sich auf das Buch. Unglaublich, dass sich hier ins Gemeinschaftsregal, wo sonst nur schmale Politkost neben irgendwelchen Naturbüchern und zerlesenen Dutzendromanen steht, ein Bändchen mit Fragmenten der Vorsokratiker verirrt hat. Sätze wie Nüsse, hart und verschlossen, und gerade dadurch verlockend, Nahrung anderer Art verheißend. Wie ausgehungert sein Kopf ist, seit längerem schon, ist ihm erst bewusst geworden, als er sich vorhin damit in den Fenstersessel verzogen und gierig an den herben, fremden Gedanken genagt hat. Bei Heraklit hat er sich festgebissen.
Dass das mit dem Wasser noch eine andere Seite hat, ist ihm natürlich ebenso klar wie dem alten Griechen, einerlei was der nun genau darunter versteht. »Für die Seelen ist es Lust oder Tod, feucht zu werden«, heißt es einige Sprüche weiter. Allerdings, erst einmal ist es alles andere als Tod, sich von den Lebenssäften durchtränken und überfluten und mitreißen zu lassen, und auf seine Art ist es auch noch Lust, wenn dann das Versumpfen einsetzt, dieses innere Schwammigwerden, das er jahrelang getrieben hat, dieses Suhlen im Matsch, das ja zeitweise auch etwas Genüssliches haben kann, bis man immer öfter und immer schärfer erkennt, wie man jede Kontur verliert, wie man sich quasi im eigenen Erbrochenen suhlt, und den wachsenden Ekel vor sich selbst nur noch dünn und dünner mit Geschwätz zu bemänteln vermag. Mit Nagellack und Glitterklamotten. Dabei hat am Anfang des feuchten Begehrens eigentlich das Feuer gestanden, ein brennender Trieb, der sich lodernd und leuchtend ins Andere versenken will, aber auf dieser Bahn irgendwann buchstäblich versinkt und »des Feuers Tod« erlebt. Für Heraklit gibt es anscheinend ein ätherisches Feuer, im Weltall wie im menschlichen Körper, das alles beseelt und lenkt, auch »der Blitz« genannt, aber das sich in sein Gegenteil verwandelt, wenn es ins Stocken gerät und zu brennen aufhört. Mit seiner Hitze hat es das Wasser zum Kochen gebracht, in Liebeswallungen versetzt, aber je schwächer es wird und herunterbrennt, umso lauer wird das Wasser. Die stolze Feuersäule sinkt in sich zusammen, zerfließt in einen Abwassertümpel, in Jämmerlichkeit und Selbstmitleid. Tod.
Die Waldhöfler waren bereit, es mit Bo zu versuchen. Unverkopft, das war gut angekommen. Den Frauen gefiel es, dass ein Mann Gefühle zeigen konnte. Da Bo in sich keine Waage für Gründe und Gegengründe fand, war die Entscheidung damit gefallen. Jetzt galt es, den Umzug zu organisieren. Von der Frankfurter Hausverwaltung erhielt er den Bescheid, wenn es bei der Übergabe nichts zu beanstanden gebe, betrage die Forderung an ihn, aufgelaufene Mietschulden mit Zinsen gegen die beim Einzug hinterlegte Kaution gerechnet, 1542 Mark 27. Egon knurrte ein wenig herum, war dann aber doch bereit, ihm das Geld vorzustrecken. Mit frischer Energie kümmerte sich Bo um die Weitervermietung seiner Wohnung und die Auflösung seines überschaubaren Hausstands. Die Bücher reduzierte er auf eine Kiste, die Plattensammlung verkaufte und verschenkte er komplett. Keine Roxy Music auf dem Plattenteller, wenn er starb. Als er den Hyperion in die Bücherkiste warf, guckte ein Zettel heraus: die Adresse von Sofies Eltern. Er sank zu Boden. Wenn doch das Ding in den Gedichten gesteckt hätte, aus denen er ihr vorgelesen hatte in jener Nacht der Nächte! Er hätte sofort hinfahren, sie umstimmen, festhalten, für sich gewinnen können! Mit brennenden Augen starrte er auf die Stelle, Jahre vorher angestrichen und eingemerkt, als er sie mit der Auflösung der Shiva Shillum zum ersten Mal verloren hatte. Schon damals bloß ein frommer Wunsch: »Ich bin erwacht aus dem Tode des Abschieds, meine Diotima! gestärkt, wie aus dem Schlafe, richtet mein Geist sich auf.«
Stöhnend knüllte er den Zettel zusammen und warf ihn fort.
Voll aufgerichtet hatte sich sein Geist auch nach drei Wochen Waldhof noch nicht, aber er musste sich nicht mehr mit der Frage herumschlagen, wie er sich durch den Tag schleppte oder ob er nicht lieber gleich im Bett blieb, weil es eh egal war, ob er aufstand oder durchsumpfte. Zu tun gab es auf dem Hof jederzeit mehr als genug, auch wenn Bo als beschränkt tauglicher Neuer ohne besondere praktische Fähigkeiten und ausgeprägte Neigungen erst einmal keinen festen Arbeitsbereich zugewiesen bekam und sich dort anstellen ließ, wo gerade etwas anlag, am liebsten im Haus, auch wegen der klirrenden Kälte in der ersten Zeit. Er schob öfter Küchendienst, und ein paar Tage half er auch Basti und Andreas beim Ausbau des alten Geräteschuppens zum zusätzlichen Wohntrakt, solange es dort Trennwände einzureißen und Zeug wegzuschaffen gab, wofür man vom Mauern und Zimmern nichts verstehen musste. Im Augenblick war der Wohnraum knapp, weil mit ihm im letzten halben Jahr drei neue Leute dazugestoßen waren, es pressierte also mit der Erweiterung. Unter den beengten Verhältnissen bezog Bo, fürs erste, einen kleinen Wohnwagen mit Gasofen, der hinter dem Stall auf der Obstwiese stand, von wo aus er einen Blick über das weite Tal und den Hügelrücken im Norden hatte.
Mit ihrem Holzhammercharme versuchte Anna, ihn für die Pferde zu begeistern: Wie wär’s, wenn er seinen beschränkten Horizont erweiterte und mal ein bisschen Stallluft schnupperte? Anna war eine kleine, drahtige Frau mit langen, meistens wild hochgesteckten aschblonden Haaren und einer scharfen Zunge, die nicht zu ihrer Beliebtheit beitrug. Mit Bo, sagte sie, hatte sie in dem maulfaulen Haufen endlich einen schlagfertigen Sparringspartner gefunden, und sie genoss die kleinen Wortgefechte, in die sie ihn hin und wieder verstrickte. Sie war eine der wenigen »Unverbandelten«. Ohnehin, sagte sie, gehörte ihre ganze Liebe den Rössern, und obwohl Bo die Tiere dem Namen nach natürlich schon kannte, stellte sie ihm vor der Einweisung in die Stallarbeit noch einmal jedes einzeln vor beziehungsweise eigentlich eher ihn den Pferden. »Guck her, Flori, das ist der Bo, der wohnt jetzt auch hier. Er stellt sich noch dappig an, aber ganz nett ist er schon.« Sie nahm die Hände aus den Taschen ihrer weiten blauen Latzhose und zog den Kopf des vor sich hin malmenden grauen Riesen sanft herum, damit er den Vorgestellten in Augenschein nehmen konnte, doch als der sich mit ausladender Gebärde tief verbeugte, trat sie rasch auf ihn zu und schob ihn zurück. Er dürfe sich nie nie nie! dicht hinter eines der Pferde stellen und dort schon gar keine wilden Hampeleien veranstalten, die sie erschrecken könnten, wenn er nicht plötzlich einen Huf in der Gosch haben wolle. Wollte Bo nicht. Er merkte es sich.
Derzeit gab es vier Pferde auf dem Hof, drei Wallache und eine Stute, Molli, die trächtig war. Sie und Flori gehörten der französischen Percheron-Rasse an, die anderen beiden waren Schwarzwälder Kaltblüter, und während Anna Bo darin anlernte, die Pferde zu füttern und zu striegeln, die Boxen auszumisten und mit Stroh auszustreuen, und mit ihm das Projekt einer Generalentrümpelung des hinteren Stallteils in Angriff nahm, erzählte sie ihm von ihren Lieblingen, besonders den Percherons. Angefangen hatten sie mit den kleineren Wälderpferden, beide Füchse, aber dann ließen sie sich im vorigen Jahr von einem französischen Freund zu einer Fahrt in die Normandie verlocken und schafften sich dort in einem echten finanziellen Kraftakt die beiden Apfelschimmel Flori und Molli an, fünf Jahre alt der Wallach und schon zur Arbeit ausgebildet, zweieinhalb Jahre die Stute und von ihnen selbst angelernt. Annas Traum war eine eigene Percheronzucht eines Tages, eine größere, freischweifende Herde, was allerdings riesige Weideflächen verlange und deshalb vermutlich unrealistisch sei. Leider. Sie seufzte, während sie mit der Mistgabel über den Betonboden des alten, für Pferde umgerüsteten Kuhstalls kratzte. Auch ein Zuchthengst überstieg bis auf weiteres die vorhandenen Möglichkeiten. Auf absehbare Zeit mussten Molli und etwaige andere Stuten, die sie einmal zur Welt brachte, über hundert Kilometer weit nach Bayern zum Decken gefahren werden – was aber immer noch besser sei als die widerliche künstliche Besamung, wo statt des begehrten Hengstes ein Herr im weißen Kittel zu der rossigen Stute kam und ihr eine Lust abtötende kühle Pipette mit dem abgemolkenen Samen in die Gebärmutter einführte. Anna schüttelte sich bei dem Gedanken. So ähnlich würden die katholischen Pfaffen am liebsten auch die menschliche Fortpflanzung geregelt sehen. Aber irgendwann einmal ein Zentrum für Waldpferde aufzuziehen und die angelernten und eingearbeiteten Tiere weiterzuverkaufen, ach Mann, das müsste doch drin sein.
Wenn Anna bei ihrem Lieblingsthema war, geriet sie ins Schwärmen, und Bo konnte ihre Begeisterung verstehen. Trotz ihrer Größe und starken Bemuskelung wirkten die Percherons eleganter und temperamentvoller als die auch nicht schwachen und unansehnlichen Schwarzwälder. Wach und lebendig die großen Augen in dem fein geformten Kopf, Schweif und Mähne dicht und lang, die Schultern irgendwie schnittiger, schräger als bei den anderen Pferden, der Gang schwingender, bei aller Schwere und Kraft beinahe tänzerisch. Sie ließen sich auch hervorragend reiten, versicherte Anna und führte es ihm bei nächster Gelegenheit auf dem ungesattelten Flori vor, aber, nein danke, das musste Bo nicht unbedingt ausprobieren. Der Sturz vom Pferd als Zehnjähriger im Pfadfinderlager war zwar nur eine blasse Erinnerung, die keinen bleibenden Schaden hinterlassen hatte, aber er hatte in seinem Leben nie etwas mit Tieren zu tun gehabt, nicht einmal mit Hunden oder Katzen, und wollte die Distanz, die er zu diesen anderen Wesen empfand, nicht mit plumper Vertraulichkeit überspielen. Lieber näherte er sich den Tieren vorsichtig an, spürte die Fremdheit, das Unbekannte. Aber er konnte sich vorstellen, dass mit der Zeit eine Sympathie wuchs, vielleicht gegenseitig. Er mochte die warme Ausdünstung der massigen Körper, den herben Geruch, das gleichmäßige Malmen der Kiefer beim Fressen, das Schlabbern der weichen Mäuler, wenn er ihnen ein Zuckerstück hinhielt, die ruhigen Blicke der feuchten Augen. Ihre ganze Gegenwart, dachte er sich, während er den Gang zwischen den Boxen ausfegte, war irgendwie anheimelnd. Er ertappte sich dabei, wie er, auf den Besen gestützt, andächtig die wohlgeformte kräftige Hinterhand der fressenden Molli betrachtete. Ganz ansprechende weibliche Formen, jedenfalls ansprechender als Annas, die zwar ein guter Kumpel war, aber ihm einen Schauer über den Rücken jagte, wenn sie ihn mit diesem Blick streifte, als taxierte sie seine Eignung zum Deckhengst.
Leises Knistern hinter ihm lenkt seinen Blick zum Kamin. Ruhig verzehren die Flammen das Holz. »Trockene Seele weiseste und beste«, schreibt Heraklit. Seine Seele, denkt Bo, ist gewiss noch nicht trocken, noch lange nicht, aber sie ist auch nicht mehr ganz so feucht wie am Anfang. Die einfache Handarbeit tut ihm wohl – dabei hat ihm davor am meisten gegraut. Geregelter Tagesablauf. Feste Pflichten. Konnte er wirklich so schwachsinnig sein, sich freiwillig für etwas zu entscheiden, wovor er sich ein Leben lang konsequent gedrückt hatte? Ja, kann er, weiß er inzwischen, und sogar ganz zufrieden sein kann er mit diesem Schwachsinn. Selbst an das frühe Aufstehen beginnt er sich zu gewöhnen. Auch wenn dieses Leben kein loderndes Feuer in ihm entfacht, so verbreitet es doch eine wohlige Wärme. Ja, langsam die Seele durchwärmen, durchtrocknen. Gesunden. Klar und nüchtern werden. Er zündet sich eine Zigarette an und steht auf, um Schorsch und Concha zu helfen, die sich schon in der Küche mit dem Abendessen zu schaffen machen. Das Streichholzflämmchen versengt ihm fast die Fingerkuppen, bevor er den Blick davon löst und es ausbläst. Tief zieht er den Rauch ein, als spürte er schon die gesundende Wirkung.
Bo musste sich zwingen, um nach dem Abräumen des Geschirrs an den Tisch zurückzukehren. Nein, was ihm schwerfiel auf dem Waldhof, war nicht das Mitarbeiten und Pflichtenübernehmen, ihm graute nicht einmal mehr davor, demnächst tatsächlich die Rösslein anzuspannen, die Aussicht erregte ihn eher, nachdem Volker ihm kürzlich die Möglichkeit vorgestellt hatte: richtig mit den Pferden im Wald arbeiten, er, der Bo mit den zwei linken Händen, als den er sich kannte und bisher immer kennen wollte, wie um das vor Jahren gesprochene Urteil des Stiefvaters trotzig zu bestätigen und sich mit dessen Heimwerkergewurstel ja nicht gemein zu machen.
Was ihm schwerfiel, war das Reden.
Ihm! In der Gruppe jedenfalls. Vor dem Plenum, das zweimal die Woche in der Gemeinschaftsstube stattfand, hätte er sich jedes Mal am liebsten gedrückt. Dem Kollektivanspruch nach hätten sie eigentlich jeden Abend nach der Arbeit zusammensitzen und gemeinsam etwas unternehmen müssen, aber nicht nur Bo, auch etliche andere zogen sich nach dem Abendessen lieber in die Ein- oder Zweisamkeit zurück. Im Sommer sei das anders, hatte Anna ihm erklärt, aber im Winter seien die meisten Leute die meiste Zeit grädig und maßleidig. Aha. Bei einem der ersten Plenen, an dem Bo nach seinem Umzug teilnahm, war die Frage aufgekommen, ob es nicht sinnvoll sei, ihn nach seinen realen Fähigkeiten einzusetzen, nicht nach allgemeinen abstrakten Prinzipien. Es wäre eh schön, wenn kulturell mehr laufen würde auf dem Hof, hatte Feli gemeint, wenn sie etwa am Abend Musik machen würden, zusammen singen, Geschichten erzählen, Theater spielen. Volker und Basti spielten zwar in einer Band in Ravensburg, »The Swinging Hinterwäldlers«, aber in der Gruppe ließen sie so gut wie nie was davon hören. Überhaupt, vielleicht konnte Bo ja bei ihnen einsteigen, schließlich hatte er bei den legendären Shiva Shillum gesungen, und sie konnten richtig professionell werden und Konzerte geben und auf der Schiene ein bisschen was dazuverdienen, oder? Bo dämpfte die aufkeimenden Hoffnungen vor allem der Frauen, aber ließ sich immerhin erweichen, am Ende der Sitzung auf Bastis Gitarre ein paar seiner alten Lieder zum besten zu geben. Seine Stimme, merkte er, war dünn geworden, er war aus der Übung, kam nicht in Schwung. Das dritte Lied, »How Can I Touch You«, war ein Fehler. Nach wenigen Takten hatte er feuchte Augen, legte die Gitarre weg und floh kommentarlos in das Refugium seines Wohnwagens, von mitfühlenden weiblichen Blicken begleitet.
Auf der Tagesordnung stand heute die Frage, wie realistisch es sein konnte, das im Wald gemachte Holz selbst zu vermarkten. Andreas hatte sich zusammen mit Basti überlegt, dass man das Sägegatter kommerziell in Betrieb nehmen konnte, wenn man es mit neuen Sägeblättern bestückte und die eine defekte Walze am Vorschub reparierte. Die Investition hätte man schnell wieder raus, und für die Zimmerei würde das bedeuten, dass man das eigene Holz verbauen konnte. Volker war skeptisch. Damit würden sie quasi ein Sägewerk aufmachen und sich den Druck anlachen, Holzmengen ranschaffen zu müssen, die allein mit den Pferden nicht zu packen waren. Nach der fortgeführten Profitlogik müssten sie sich dann für den Waldeinsatz schwere Maschinen zulegen, genau das, was sie auf gar keinen Fall wollten. Hubert stimmte ihm zu und sah das weitergehende grundsätzliche Problem, dass man die Kohle nicht zum obersten Kriterium machen durfte. Selbstverwaltet arbeiten sei das eine, aber die Arbeit dürfe nicht den Bezug zu den emanzipatorischen politischen Inhalten verlieren und auch nicht zum Gemeinschaftsleben, aus dem sich in letzter Zeit manche, auch die beiden Zimmerer, häufig ausklinkten. Aber sie lebten nun mal immer noch im Kapitalismus, wandte Andreas ein, und solange der nicht beseitigt war, brauchte man Kohle, um zu überleben, sonst konnte man sich seine emanzipatorischen Inhalte sonst wohin stecken. Und nach einem langen harten Arbeitstag, ergänzte Basti, konnte es schon mal sein, dass man keinen Bock mehr auf langwierige Diskussionen und gemeinschaftliche Aktivitäten hatte. »Kohle, Kohle!«, platzte es aus Anna heraus. »Wenn wir nur wegen der Kohle zusammen sind, ist auf die Gruppe echt geschissen.«
Bo musste über Annas temperamentvolle Art grinsen, doch er merkte, wie seine Aufmerksamkeit nachließ. Sachlich konnte er nicht mitreden, ideologisch … eigentlich auch nicht. Er blickte ins Feuer. Wild züngelnd arbeiteten sich die Flammen an den wuchtigen Klötzen ab. Wenn sie zu schwach waren, weil noch zu viel Lebenssaft im Holz steckte, brachten sie bloß ein qualmiges schwarzes Schwelen zustande, aber diese Scheite hier waren gut durchgetrocknet und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie dem wütenden Angriff erlagen. Eine Zeit lang behielten sie ihre ursprüngliche Form bei, wenn das Fleisch schon völlig aufgezehrt und in glühenden Feinstoff verwandelt war. Noch aber hatte das Feuer heftig zu kämpfen. Am Fuß der flackernden gelben Zungen fraß sich das heiße dunkle Blau still in den Stoff. Blue flame. Das Bild Sofies tauchte vor ihm auf, die tanzende blaue Flamme, als der er sie einst gesehen hatte bei ihrem gemeinsamen Singen. Blue hatte er sie damals im stillen genannt. Ah, brenne, brenne, Flamme!
Währenddessen hielt Hubert seine übliche Predigt: Klar brauche man zur Reproduktion ein tragfähiges ökonomisches Projekt, um sich unter den herrschenden Bedingungen zu behaupten, aber was zähle, seien die Qualitäten, die man dabei verwirklichte: Freiheit, Selbstbestimmung, Kollektivität, Kooperation, Herrschaftslosigkeit, wobei ganz obenan die Überwindung des seuchenartig grassierenden bürgerlichen Individualismus stehe. Für einen, der sich bei jeder Gelegenheit von den »Theoretikern« abgrenzte, hatte der Mann eine ausgesprochene Schwäche für Grundsatzerklärungen. Bo hatte inzwischen begriffen, dass die freischweifende Herde, von der Anna schwärmte, hier nicht allein in züchterischer Hinsicht ein Ideal war. »Nur Stämme werden überleben« war die von Hubert und anderen häufig gebrauchte Formel für die Strategie, mit der man heutzutage der spätkapitalistischen Industriegesellschaft zu begegnen habe, die in erschreckendem Umfang und Tempo die Lebensgrundlagen der Menschheit vernichte, die Erde selbst. Gerade weil, realistisch gesehen, gesamtgesellschaftlich keine revolutionäre Situation herrschte und keine Massenmobilisierung zu erwarten war, hing alles von der Umsetzung der emanzipatorischen Inhalte im eigenen Leben und Arbeiten ab, der Veränderung des Möglichen hier und heute, mit der Perspektive zukünftiger größerer Umwälzungen, wenn es eines Tages zum unweigerlichen Zusammenbruch des maroden Systems kam.
Marode wie der Spätkapitalismus brach im Kamin ein durchgeglühtes Holzscheit zusammen und zerkrümelte nach und nach im roten Glutbett. Dunkelrot leuchtend nahm das Feuer Abschied, nachdem es vom irdischen Gastmahl gezehrt hatte, ein Fremdling in dieser Welt der Asche. Je länger er hinschaute, umso mehr Gestalten erkannte Bo in der Glut, langsam verblühende Pflanzen mit ohrmuschelartigen Blättern, Tiergesichter, eine spitze, spaltbreit geöffnete Schnauze, ein großes Auge, das einem Menschen gehören konnte, einem Riesen. Es schaute ihn flimmernd an. Berge und Seen in der Glut, Länder, Wolken, Himmelslandschaften, etwas wie eine Hand mit drei Fingern, die sich im Lichtspiel nach ihm ausstreckte, zögernd winkte …
Hubert wurde lauter. Was sollte das heißen: die Gruppe könne den Einzelnen in seiner Freiheit zu sehr beschneiden? Was Andreas da sagte, sei entweder banal und selbstverständlich, denn natürlich dürfe niemand von den andern plattgemacht werden, oder es sei eine defätistische Tendenz, die das ganze Projekt gefährde. Man müsse sich immer wieder klarmachen, dass die Art Stamm, an dessen Schaffung sie arbeiteten, historisch etwas Neuartiges war. Alle Beteiligten hätten die Erziehung zum isolierten westlichen Individuum durchgemacht und könnten sich selbstverständlich nicht auf natürliche Weise ins Kollektiv eingliedern. Das ändere nichts daran – und eben das lernten sie hier durch allmähliche praktische Erfahrung begreifen – gar nichts ändere das daran, dass sich der Einzelne erst durch das kollektive Leben in seinen persönlichen Anlagen allseitig entfalten konnte. Sie dürften nicht der modernen Scheinbefreiung durch die hunderttausend Spielarten individuellen Konsums im Single-Apartment aufsitzen. Woran sie hier arbeiteten, seien neue Formen, in denen die Jäger- und Sammlerkollektive des Urkommunismus wiedererstehen konnten, die keine vereinsamten passiven Konsumenten kannten, keine priesterlichen und sonstigen gesellschaftlichen Schmarotzer. Die Frauen hätten den Männern damals an Körperkraft nicht nachgestanden. Als Bo den Kopf hob und dem Blick Inges begegnete, einer der Neuen, mussten beide grinsen. Natürlich habe es Konflikte und Rangeleien gegeben, fuhr Hubert fort, wie in jeder Wildpferdeherde auch, aber keine konkurrenzhafte Durchsetzung individueller Interessen, und wenn das natürliche Kräfteverhältnis ausgependelt war, habe sich jeder mit seinen Fähigkeiten dem Ganzen eingefügt. Was nichts mit Unter- und Überordnung in hierarchischen Strukturen zu tun habe. Im Prinzip sei der Stamm eine Gruppe von Gleichstarken. Untätige und Schwache würden nicht mitgeschleift.
»Die Schwachen und Missratenen sollen zugrunde gehen«, murmelte Bo, bevor er sich bremsen konnte. Er hatte sich im Plenum bisher noch nie ungefragt zu Wort gemeldet.
»Hn?« Hubert sah ihn mit einem unwilligen Stirnrunzeln an.
»Ach, nichts.« Bo winkte ab. »Nur so ein Spruch vom Genossen Nietzsche zum Thema Wildpferdeherde.« Dass das kurze Auflachen von Inge kam, wusste er, ohne hinzuschauen.
… brüderlich wie ein Wald…
Die tags zuvor eingeführte Sommerzeit hatte Bo völlig verdrängt, unterbewusst vielleicht auch gehofft, Volker werde diese willkürliche Uhrenverstellerei genauso boykottieren wie Hubert und ein paar andere, die lauthals verkündeten, sie dächten gar nicht daran, sich von irgendwelchen Bürokratenärschen manipulieren zu lassen, denen es nur darum ging, die Ausbeutung der Arbeitskraft zu maximieren. Pech gehabt. Volker stand um sechs auf der Matte – um fünf, hieß das in Wirklichkeit! Morgenstund hat Gold im Mund – ja, scheiß die Wand an. Knurrend und fluchend quälte sich Bo aus dem Schlafsack. Da hatte er sich gerade halbwegs ans frühe Aufstehen gewöhnt, und schon mussten sich diese Staatsterroristen neue Schikanen einfallen lassen. Eine hundsgemeine Sauerei und völlig unbegreiflich, warum Volker mit denen kollaborierte. Wäre wirklich zu schön, die Revolution käme und es würden menschenwürdige Verhältnisse eingeführt.
Als Bo gefrühstückt und ausgegrummelt hatte, luden sie Top und Harry, die beiden Wälderwallache, auf den Pferdeanhänger und fuhren im blassroten milchigen Frühlicht zu Bos erstem Waldeinsatz in ein zwanzig Minuten entferntes Tal, wo die Durchforstung, erklärte Volker, bereits im frühen Winter passiert war, sie aber wegen dringender anderer Arbeiten nicht dazu gekommen waren, das geschlagene Holz zu »rücken«, sprich, an Lagerplätze zu befördern, »Polter« genannt, von wo es abgefahren werden konnte. »Fichten, Fichten, Fichten«, sagte er mit einem Blick in die Runde, als sie aus dem alten Unimog stiegen. »Altersklassenwald in Monokultur. So sieht’s hier fast überall aus, jedenfalls im Staatswald und im Bauernwald. Ein Grauen. Das mitmachen zu müssen ist für mich die einzige echte Härte bei der Arbeit.«
Nachdem die Pferde am Halfter aus dem Anhänger geführt waren, zeigte er Bo, wie man ihnen das Arbeitsgeschirr anlegte, vor allem das »Kummet«, einen oben spitz zulaufenden massiven Kragen aus Holz, Leder und Füllmaterial, an den neben anderen Riemen und Gurten die Verbindungsstränge zur Zuglast eingehakt wurden. Geduldig ließ Top es über sich ergehen, dass Bo ihm mit Schieben und Zerren das schwere Geschirrteil über den Kopf streifte. Dann machten sie die Pferde an einem Baum fest und gingen ein Stück in den Wald, ausgerüstet mit einer Forstaxt, einem »Fällheber« und einem Werkzeug mit langem Holzstiel und flachem Metallblatt mit leicht konkaver Schneide, von Volker als »Rebbeleisen« bezeichnet. »So heißt das bei uns hier, anderswo sagen die Leute Schäleisen dazu. Früher wurden damit Fichten und Tannen entrindet, heute wird es fast nur noch von alten Holzrückern benutzt. Aber richtig geführt ist es ein erstklassiges Arbeitsgerät.« Er trat an einen im Schnee liegenden Stamm, entfernte mit wenigen Stößen die unteren Äste und schälte dann in langen Streifen einen Teil der Rinde ab. »Die Schneide ist nicht zu stumpf, dass man gut unter die Rinde kommt, und nicht zu scharf, dass man nicht ins Holz hackt.« Er drückte Bo das Eisen in die Hand. »Aber Entrinden muss gar nicht sein. Du sollst die Stämme nur entasten, und dafür nimmst du entweder die Axt, vor allem für die dicken Dinger, oder, wenn du damit gut klarkommst, das Rebbeleisen, wie ich’s dir gezeigt hab. Versuch’s mal.«
Bo stellte sich hin, wie er es bei Volker gesehen hatte, linkes Bein vor, und stieß mit dem Eisen nach dem nächsten Ast, aber traf ihn zu hoch, so dass er etwa zehn Zentimeter über dem Stamm absplitterte. »Noch mal«, sagte Volker. Bo stieß tiefer, zu tief diesmal, so dass sich die Schneide ins Holz fraß. Er riss sie heraus, und mit zwei weiteren Stößen hatte er den Aststumpf ab. »Das braucht Übung, wie alles«, meinte Volker. Zudem sei das Holz durch das wochenlange Liegen zäh geworden. Bei der Arbeit mit der Axt müsse Bo vom Stammfuß in Richtung Spitze schlagen, »Zopf« genannt, und darauf achten, die Hiebe vom Körper weg zu führen und möglichst den Stamm zwischen sich und der Axt zu haben. Er machte es vor, dann reichte er Bo die Axt, nahm sich seinerseits das Rebbeleisen und begann einen anderen Stamm zu entasteten, »damit es für mich was zu tun gibt, wenn ich mit den Pferden komme«. Als er mit der Oberseite des ersten fertig war, setzte er den hebelartigen Fällheber mit dem Wendehaken an, drehte den Stamm und bearbeitete die Unterseite. So entasteten und »zopften« sie zehn Stämme, ehe Volker das Eisen ablegte und auf den sanft ansteigenden Hang deutete, an dem die gefällten Bäume lagen, alle mit der Spitze hangaufwärts. Von seinem Lehrmeister habe er zwar gelernt, die Bäume mit der Krone bergab zu legen, weil die als Überlebensreflex alles Wasser im Stamm noch einmal nach oben schickten und das Holz auf die Weise schneller und natürlicher trockne, aber ihnen war in dem Fall das leichtere Entasten und Abtransportieren wichtiger gewesen. Bo solle Stamm für Stamm weitermachen. Er werde jetzt Top und Harry holen und mit ihnen die fertigen Stämme an die Rückegasse vorliefern. Von dort könne Hubert sie später mit Schlepper und Rückezange an den Weg ziehen und am Rand »aufbeugen«.
Von den ersten zehn Stämmen waren drei Bos Werk gewesen. Allein gelassen machte er eine Zeit lang mit der Axt weiter, dann griff er wieder zum Eisen. Die Axtschläge trafen zwar sicherer, doch wenn er es richtig führte, ging es mit dem Eisen deutlich schneller. Langsam kam er in einen gewissen Rhythmus. Zisch, zisch, zisch. Die dünneren Äste weiter oben flogen. Ha, kommt nur, wenn ihr euch traut! Hart stieß er in den herandrängenden Heerhaufen, trieb die Trojaner zurück, selbst Hektor konnte nichts gegen die Kampfgewalt des lanzenschwingenden Ajax ausrichten, wenn er so den scharfen Stahl – zack. Die Klinge steckte im Holz. Knurrend kehrte Bo aus Ilion ins Deggenhausertal zurück, wo Volker gerade mit den beiden zusammengespannten Wallachen erschien, sie festband und noch eine Weile beim Entasten half. Dann hängte er vier Stämme an ihre Zugketten und lenkte sie sicher und fast ohne Berührung stehender Bäume an den Rand der etwa drei Meter breiten Schneise, die er als Rückegasse bezeichnet hatte. Die Pferde schienen die Arbeit zu genießen. Es sah nicht besonders schwierig aus.
Die Schwerarbeit hatte er geleistet, fand Bo, als Volker ihn schließlich zur Mittagspause rief. Er konnte kaum noch die Arme bewegen, so zogen und schmerzten sie vom stundenlangen Stoßen. »Wirst dich schon noch entkrampfen«, sagte Volker lächelnd, als er sah, wie Bo sich die Arme rieb und ausschüttelte. »Am Anfang ist das ganz normal.«
»Hoffentlich«, ächzte Bo. »Im Moment ist es eine ziemliche Schinderei.«
»Mir macht’s Spaß«, sagte Volker, während er Harry einen Futtersack mit Hafer umhängte und mit einem Wink Bo aufforderte, das gleiche bei Top zu machen. Er hatte, warmgeworden, schon vor einiger Zeit die dicke Pudelmütze abgezogen und sah jetzt mit seiner abstehenden schwarzen Lockenmähne und dem dichten Vollbart aus wie Phineas von den Fabulous Furry Freak Brothers. Selbst wenn Bo mehr als eine schattenhafte Erinnerung an den brav rasierten und frisierten ersten Drummer der Rout 66 gehabt hätte, mit seiner heutigen Haartracht hätte er ihn niemals wiedererkannt. »Es gibt für mich kaum was Schöneres, als mit den Pferden durch den Winterwald zu stapfen, einerseits schwere Holzmassen zu bewegen und das andererseits ganz ruhig zu tun, ganz präzise, ohne Hauruck und Maschinengedröhn. Die Tiere wissen genau, worauf’s ankommt, sie machen das gern, und ihre Freude an der Arbeit überträgt sich auf einen, wenn man mit ihnen zusammen ist.«
»Und weil dir die Waldarbeit so Spaß macht, hast du die Forstwirtschaft an den Nagel gehängt und bist Holzrücker geworden?«, fragte Bo, während sie einen verwitterten alten Stamm auf einer Lichtung vom Schnee befreiten und sich mit ihren Vesperpaketen in die Sonne setzten. »Nicht gerade das, was man einen Karrieresprung nennt.«
»Ach, das hat viele Gründe.« Volker biss in sein dickes Wurstbrot und sah Bo kauend mit blitzenden Augen an, zu denen man sich wohl unter dem Bartgestrüpp ein Grinsen denken musste. »Ob du’s glaubst oder nicht, entstanden ist der Wunsch, eines Tages beruflich mal was im Wald zu machen, noch in meiner Mainzer Zeit. Wir haben draußen in Gonsenheim gewohnt, und als Bub war ich mit meinen Freunden viel im Wald unterwegs. Wir waren der Schinderhannes und seine Bande und haben gespielt, dass wir die Reichen überfallen und den Armen geben und in unserer Waldhöhle ein fröhliches Räuberleben führen.« Später, in den Stürmen der Pubertät, sei er auch oft allein im Wald unterwegs gewesen. Im Sand dort unter den Kiefern habe er sein erstes Liebesabenteuer gehabt. Und kurz vor dem Umzug nach Ravensburg habe Fred ihn mit einem geheimnisvollen »Abschiedsgeschenk« besucht, und dann hätten sie hinten beim Mombacher Waldfriedhof zusammen einen Joint geraucht, seinen allerersten. »Kannte damals kein Schwein, so was. Ich weiß noch genau, wie es mir gleich beim ersten Zug die Schädeldecke gehoben hat, als würde mir das Gehirn durchgepustet. Ich hatte das Gefühl, zum ersten Mal im Leben zu sehen, wo ich war. Auf der Erde, für eine Zeit, unter den wachsenden Dingen. Na ja«, er wischte sich die Nase, »ich muss dir nicht erzählen, wie solche Erfahrungen reinhauen, grad in dem Alter. Irgendwie war damit klar, dass ich in der Umgebung, mit der Wahrnehmung, dem Gefühl mein Leben verbringen wollte.«
Die naive Übersetzung nach der Schule war gewesen, Forstwissenschaft zu studieren. Wobei ihm die Vielseitigkeit des Studiums anfangs ganz gut gefiel, das breite Spektrum, mit dem man es zu tun hatte, von Kultur- und Naturgeschichte über Wirtschaft und Waldbau bis zu Biologie und Genetik. Aber der Geist, der in der Freiburger Fakultät wehte, war der bekannte »Muff von tausend Jahren«, den hier keine Studentenbewegung jemals gelüftet, geschweige ausgetrieben hatte, und was die Forstwissenschaft im engeren Sinne betraf, so hatten sich ihre Vertreter bis auf wenige belächelte oder befehdete Ausnahmen seit Jahrzehnten einem Effizienzdenken verschrieben, das in Volkers Augen für den Wald eine Katastrophe war. Sein Waldbauprofessor, den er nach naturnahen Konzepten befragte, tat etwa den in den zwanziger Jahren viel diskutierten Gedanken des »Dauerwalds« als ideologische und wirklichkeitsferne Schwärmerei ab. Wirklichkeitsnah war offenbar eine »arbeitssparende« Kahlschlagpolitik, waren Fichten- und Douglasienpflanzungen mit profitablen kurzen »Umtriebszeiten«, war flächendeckender Einsatz von hochgiftigen Spritzmitteln, die Boden und Grundwasser belasteten, war die Holzernte mit immer schwereren »Rückeaggregaten«, die den Boden verdichteten, Staunässe förderten und Wurzel- und Rindenschäden im großen Stil verursachten, war die Zerschneidung des Waldes mit immer mehr Wirtschaftswegen und Rückegassen. Dass damit nicht zuletzt die Anfälligkeit der Bestände für Sturm, Schnee und Schädlinge zunahm, kam in den smarten Nutzenrechnungen nicht vor.
Volkers tiefe Stimme, mainzerisch grundiert mit schwäbischem Firnis an einigen Stellen, hatte einen ungewohnt schneidenden Ton bekommen. Am Ende des Studiums, sagte er, habe er kaum mehr gewusst, was ihn einmal zu seiner Fachwahl bewegt hatte. Er trat zwar noch die Ausbildung im Staatsdienst an, aber das Handtuch hing gewissermaßen schon zum Werfen bereit. Er ließ keinen Zweifel daran, was er von der absurden Uniformpflicht hielt. Er weigerte sich, Vorgesetzte militärisch zu grüßen. Er musste sich öffentlich rüffeln lassen, weil er seinen Chef nicht mit »Herr Oberforstmeister« angesprochen hatte. Irgendwann hatte er genug von dem Hickhack und den Schurigeleien der Beamtensäcke. Was hatte das alles mit dem lebendigen Wald zu tun! Er wollte nicht nur kein Holzbürokrat werden, er wollte auch keinen Guerillakampf gegen Holzbürokraten führen. Sollten sie doch versauern in ihren Forstdienststellen! Er musste diesen Impuls wiederfinden, der ihn einmal getrieben hatte. Als eine befreundete Ethnologin ihm auf einem Ausflug in den Hotzenwald halluzinogene Pilze gab, erlebte er seine zweite große Hirndurchpustung. Er las Sachen über schamanische Rituale bei Urwaldindianern in Lateinamerika und beschloss, auf große Fahrt zu gehen und in der Richtung Erfahrungen zu sammeln. Um die Zeit, ungefähr 1975, traf er zufällig auch seinen alten Schulfreund Hubert wieder, der ihm von seiner Ravensburger Kommune erzählte und voll war von der ursprünglichen naturverbundenen Lebensweise der urkommunistischen Jäger- und Sammlerstämme, und nach seiner Rückkehr aus Südamerika tat er sich mit der Gruppe zusammen … »Aber das ist eine lange Geschichte, da gäb’s viel zu erzählen. Jetzt wartet erst mal Arbeit auf uns.«
Diesen Moment hat Bo ein wenig gefürchtet. Volker spannt die Pferde um, denn Bo soll jetzt »einspännig« mit Top arbeiten, der für ihn genau richtig sei, »ein feiner alter Herr mit viel Erfahrung und noch mehr Geduld«. Er zeigt ihm, wie man am Kummet des Pferdes die Zugstränge einhängt, die mit dem Wagscheit verbunden sind, einem am Boden schleifenden Metallrohr mit einem Ring in der Mitte für eine oder mehrere Ketten. Bos erste Aufgabe ist, die Kette an einem in Zugrichtung liegenden Stammfuß zu befestigen, wie er es vorher bei Volker gesehen hat. »Halt! Beim Anhängen, und überhaupt, niemals vor die Last treten, immer daneben.« Bo tritt daneben. »Halt! Nie den Zügel aus der Hand legen.« Auch die einfachsten Handgriffe wollen bedacht sein. »Halt!« Der Abstand zum Wagscheit soll so kurz sein, dass der Stammfuß ein kleines Stück über dem Boden schwebt, was sowohl die Zuglast verringere als auch die Gefahr hängen zu bleiben. »Vorsicht beim Anziehen!«, mahnt Volker. »Wie gesagt, du darfst nie vor der Last stehen und schon gar nicht vor dem Wagscheit. Du stehst immer links vom Pferd, am besten kurz hinter dem Anhängepunkt. Da hast du den besten Überblick nach vorn und hinten, und die Unfallgefahr ist am geringsten.« Den Zügel soll Bo locker halten, denn das eigentliche Führen des Pferdes, schärft Volker ihm ein, erfolge über die Kommandos. »Hüa« heißt losgehen, »hooo« heißt langsam, »hott« ist rechts, »wist« links, und »ö-ha« heißt stehen bleiben. Zurück heißt »zurück«, am besten, man muss es nie gebrauchen. Das wichtigste Kommando sei »ö-ha«, das müsse unbedingt klappen. Mit dem Zügel soll Bo überhaupt nur arbeiten, wenn ein Kommando nicht befolgt wird. »Wenn du ziehst, gibt die Trense einen unangenehmen Druck, deshalb wird das Pferd beim nächsten Mal lieber gehorchen. Aber wenn du gleich ziehst, ignoriert es die Befehle und achtet nur darauf, und du bist ständig am Rumzerren, was für dich stressig ist und für das Pferd auch.«
So einfach die Arbeit aussieht, sie hat unendlich viele Tücken, wie Bo schnell erfährt. Beim Anziehen (»Hüa!«) geht Top schnurstracks in die Richtung los, in der er steht, und bevor die korrigiert ist (»Wist! Wist!«), ist schon ein ordentliches Stück Rinde von einem im Weg stehenden Baum abgeschrammt. Auf der dünnen Altschneedecke bekommen die Stämme tüchtig Fahrt. Ein andermal steht das Pferd richtig, aber beim Anziehen bleibt der Stamm liegen, weil die Kette nicht ordentlich eingehakt ist. Kommando »Zurück!«. Leider hat Bo nicht daran gedacht, die Zugstränge hochzuheben, so dass Top nach wenigen Schritten quer in den Seilen steht und erst umständlich von Volker wieder hinausmanövriert werden muss. Als es weitergeht, verfängt sich ein langer Ast im Wagscheit, schlägt aus und trifft Bo so heftig am Schienbein, dass er vor Schmerz fast in die Knie geht. Aber nach und nach arbeitet er sich ein. Er entastet einen Stamm, fährt ihn ab, macht sich an den nächsten. Ein ruhiger, gleichmäßiger Rhythmus. Top folgt aufs Wort, manchmal etwas zu wörtlich (»Wist! Nicht so weit, Mann! Hott! HOTT!«), und der zum Wegträumen neigende Fuhrmann ist mit einem Schlag wieder hellwach. Die Arbeitsleistung ist nicht gigantisch, aber sie müssen ja nicht im Akkord schaffen, wie Volker bemerkt, und bei einer Ersteinweisung schon gar nicht.





























