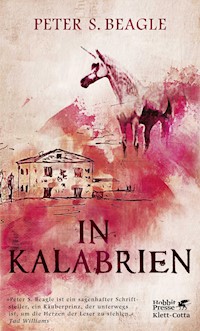17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Das letzte Einhorn ist das beste Buch, das ich je gelesen habe.« Patrick Rothfuss Längst gehört »Das letzte Einhorn« zum Kanon der Weltliteratur für Leserinnen und Leser jeder Altersklasse und es hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Unzählige Fans hat dieses Buch an die Fantasy herangeführt. Eine einzigartige Geschichte über Freiheit und ihre Bedrohung, am Beispiel eines aussterbenden Fabelwesens. Das Einhorn lebte in einem fliederfarbenen Wald, und es lebte ganz allein. Eines Tages wagte es sich aus der Sicherheit des verwunschenen Waldes hinaus auf die Suche nach anderen seiner Art. Zusammen mit dem wenig talentierten Zauberer Schmendrick und der unbeugsamen Molly Grue, lernt das Einhorn die Freuden und Leiden des Lebens und der Liebe kennen, bevor es im Schloss eines verzagten Monarchen seinem Schicksal begegnet - und dem Wesen, das seine Art in den Untergang treiben will... In kaum einem anderen Buch drückt sich so sehr die Sehnsucht nach Freiheit und die Sehnsucht nach einer immerwährenden Natur und Schönheit aus wie in "Das letzte Einhorn". »Das helle Funkeln der Hörner. Wie regenbogenschimmernde Masten auf silbernen Schiffen kamen die Hörner aus dem Meer geritten. Jede Woge trug Hunderte heran, sie bäumten sich auf und stampften und bogen ihre langen wolkigen Hälse weit zurück.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter S. Beagle
Das letzte Einhorn
Aus dem Amerikanischen von Jürgen Schweier
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Last Unicorn« im Verlag Ace Books, New York
© 2023 by Peter S. Beagle
Für die deutsche Ausgabe
© 2023 by J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Cover: Birgit Gitschier, Augsburg
unter Verwendung einer Illustration von © August Lamm, London
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-608-98716-4
E-Book ISBN 978-3-608-12153-7
Vorwort
Ich liebe dieses Buch.
Das ist das einzig wirklich Wichtige, was ich hier zu sagen habe. Alles, was ich sonst noch schreibe, ist sekundär. Beiwerk. Ausschmückung. Variation des Themas.
Also: Wenn Sie gerade in einer Buchhandlung stehen, dieses Vorwort lesen und sich fragen, ob Sie das Buch kaufen, ihm eine Chance geben sollen … Die Antwort lautet ja.
Wenn Ihnen jemand dieses Buch geschenkt hat und Sie gerade überlegen, was Sie als nächstes lesen sollen und ob das hier wohl Ihre Zeit wert sein könnte … Auch darauf lautet die Antwort ja.
Wenn Sie dieses Buch in jüngeren Jahren gelesen haben, es mochten und jetzt befürchten, dass es vielleicht nicht so gut ist, wie Sie es in Erinnerung haben, dass es irgendwie an Kraft verloren haben könnte: Keine Bange, das hat es nicht.
Wenn Sie Sorge haben, Sie hätten sich vielleicht zu sehr verändert, seien müde geworden, ihr Herz könnte durch die Welt verhärtet, ihr Geschmack durch weniger subtile Geschichten abgestumpft sein, seien Sie beruhigt. Diese Geschichte ist so vollkommen wie eine Perle. Sie ist so süß wie der Kuss, den sie in einem stillen Winkel ihres Herzens als den schönsten bewahrt haben.
Ich habe dieses Buch Menschen geschenkt, die ich gernhabe, habe es in Buchhandlungen Leuten aufgedrängt und es meinen Kindern vorgelesen. Ich habe immer mehrere Exemplare parat, damit ich jederzeit eins verschenken kann. Es ist ein Buch, das ich allen empfehle, egal, wie alt sie sind, welches Genre sie am liebsten mögen und ob sie sich für Einhörner interessieren oder nicht.
Und hier und jetzt empfehle ich es Ihnen. Tun Sie sich einen Gefallen. Bitte lesen Sie es. Bitte.
Dies ist nicht nur ein Buch, das ich mag. Es ist mein Lieblingsbuch und das nun schon fast dreißig Jahre. Es ist das Buch meines Herzens.
Für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben – keine Angst. Ich werde nicht die größte Sünde des Vorwortschreibens begehen und spoilern, indem ich mich über meine Lieblingsstellen auslasse oder all die guten Witze klaue und hier wiedergebe, um geistreich zu wirken, oder indem ich überraschende Wendungen verrate oder auf Details Bezug nehme, die Ihnen nichts sagen, weil Sie das Buch ja noch nicht gelesen haben.
Aber im übernächsten Absatz werde ich mich – für diejenigen, die das Buch bereits gelesen haben – auf ein paar Charaktere beziehen. Wenn Sie schon das umgehen möchten, springen Sie gleich zu dem Absatz nach der nächsten Leerzeile.
Als Junge habe ich Der König von Narnia gelesen. Und darum wollte ich in meiner Kindheit nichts sehnlicher, als in Narnia zu landen. Ich war groß genug, um zu wissen, dass es so etwas nicht wirklich gab, aber noch klein genug, um zu hoffen. Also hielt ich Ausschau nach verborgenen Türen und Geheimgängen. Jahrelang.
Jetzt sehe ich den Fünfzig ins Auge. Manche Leute werden sagen, das sei doch nicht alt, ist es aber. Zumindest ist es so alt, wie ich noch nie war. Ich brauche jetzt eine Brille. Ich lache nicht mehr so viel wie früher. Jeden Tag fühle ich, wie ich weniger Schmendrick und mehr Haggard werde. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass es Einhörner nicht wirklich gibt, aber immer noch jung genug, um zu hoffen, ich könnte einem begegnen. Und wenn ich doch noch einem begegne, dann werde ich mich dessen hoffentlich würdig erweisen und besser sein, als ich bin, was heißt, weniger König Haggard und mehr Molly Grue.
Ich hasse Vorworte.
Ja, mir ist klar, dass das ein seltsamer Ort für eine solche Aussage ist. Damit sie verständlich wird, sollte ich wohl etwas Hintergrund liefern.
Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Es war dort nicht sonderlich dörflich, und ich will damit nicht sagen, dass die Umstände hart waren, es war nur so, dass ich nicht in einem vorstädtischen Wohngebiet aufwuchs, mit lauter anderen Kindern zum Spielen und Freizeitangeboten. Stattdessen bin ich mit Büchern aufgewachsen.
Im Rückblick lässt sich kaum genau sagen, wie viel ich damals gelesen habe, aber es war eine Menge. Ich weiß noch, wie ich das Exemplar meiner Mutter von Der Herr der Ringe – die große rote Hardcover-Ausgabe – jeden Sommer, auf meinem Bett liegend, wiederlas.
Ich erinnere mich, wie ich meine Schulsachen packte, bevor ich mich in der Fünften auf die lange Busfahrt machte. Ich sorgte immer dafür, dass ich zwei Taschenbücher im Rucksack hatte. Keins davon war das Buch, das ich gerade las. Dieses Buch hatte ich immer in der Hand oder in der Jackentasche. Die Bücher im Rucksack waren für danach, wenn ich dieses ausgelesen hätte. So hatte ich immer ein Reservebuch … und dann sicherheitshalber noch eins. Ich vergaß vielleicht, meinen Lunch in die Schule mitzunehmen, aber Bücher mitzunehmen, vergaß ich nie.
Interessanterweise habe ich Das letzte Einhorn in jener ganzen Zeit nie gelesen. Das weiß ich, weil mir, als ich mit meiner Mutter und meiner Großmutter den Zeichentrickfilm ansah, die Geschichte völlig neu war.
So ging es im Grunde meine gesamte Highschool-Zeit hindurch. Ich las in der Mittagspause. Ich las, wenn meine Mom mit uns an den Strand fuhr. Wussten Sie, dass die Anzahl der Bücher, die man in der Bibliothek ausleihen kann, begrenzt ist? Ist sie. Mein Taschengeld ging hauptsächlich für Bücher drauf, und für den Familienurlaub packte ich eine Reisetasche mit Taschenbüchern voll.
Die meisten dieser Bücher waren Fantasyromane, und die meisten waren das, was meine Mutter »Popcorn-Bücher« genannt hätte, was hieß, nett zu konsumieren, aber nicht wirklich nahrhaft. Wunderbare, köstliche »Schundbücher« voller Elfen und Zauberschwerter. Grob geschätzt, dürfte ich mindestens zwei- bis dreitausend Romane gelesen haben, bevor ich aufs College ging.
(Ich erwähne das hier, damit Sie wissen, worauf ich hinauswill: Ich kann mich nicht erinnern, dass je eins dieser Bücher ein Vorwort gehabt hätte.)
Auf dem College entdeckte ich das Küssen und die Geisteswissenschaften. Das Ergebnis war, dass ich am Ende meines ersten Collegejahrs mein Studienziel, Chemieingenieur zu werden, ebenso aufgegeben hatte wie die Gewohnheit, täglich ein bis zwei Bücher zu lesen. Zu dieser Zeit stolperte ich zufällig über eine Ausgabe von Der Herr der Ringe, die ein Vorwort von einem gewissen Peter S. Beagle enthielt. Es ist in meiner Erinnerung das erste Vorwort, dem ich je begegnet bin, und erst recht das erste, das ich je gelesen habe.
Ich war empört. »Was glaubt dieser Typ, wer er ist?«, fragte ich mich mit der ganzen Arroganz eines Zwanzigjährigen. »Wie kann man auf die Idee kommen, ein Vorwort für das beste Fantasy-Buch aller Zeiten zu schreiben?«
Trotzdem las ich das Vorwort, und es erwies sich als überraschend tröstlich. Man hatte mir beigebracht, dass Fantasy minderwertig sei, Zeitverschwendung. Aber Peter sprach in glühenden Worten über Tolkien und Mittelerde und sagte: »Wir sind dazu erzogen worden, all die falschen Forscher und Entdecker zu ehren – Diebe, die Fahnen aufpflanzten, Mörder, die das Kreuz trugen. Lasst uns endlich die Kolonisatoren der Träume preisen.«
(Verzeihen Sie, wenn ich hier so leichthin über das Wort »Kolonisatoren« hinweggehe, das damals nicht wie heute die ganz und gar berechtigten negativen Konnotationen hatte.) Ich erinnere mich daran so klar, weil es so ziemlich das erste Mal war, dass ich jemanden Fantasy als etwas Schönes und Wertvolles verteidigen sah. Dadurch setzte bei mir die Erkenntnis ein, dass ich vielleicht kein schlechtes Gewissen zu haben brauchte, weil ich Fantasy mochte. Dass das vielleicht keine peinliche Vorliebe war.
Ich stöberte das Einhorn-Buch von diesem Beagle auf und war beeindruckt von der Sprache und der Andersartigkeit gegenüber all den vielen Büchern, die ich zuvor gelesen hatte. Es ging darin nicht die ganze Zeit um kämpfende Heere und magische Schwerter und Heldenreisen. Wie seltsam. Wie erstaunlich und wunderbar.
Obwohl ich nicht mehr ein Buch pro Tag las, las ich immer noch kontinuierlich. Es gab kaum ein Semester, in dem ich nicht mindestens eine Lehrveranstaltung hatte, wo der Schwerpunkt darauf lag, etwas zu lesen, irgendwas. (Romane, Theaterstücke, Gedichte, philosophische und religiöse Texte). Hinterher diskutierte ich mit Lehrenden, Mitstudierenden und Freundinnen über das, was ich gelesen hatte. So ging es etwa zehn Jahre. Es war ein großartiger Bildungsprozess und eine sehr glückliche Zeit meines Lebens.
Dann beging ich einen schrecklichen Fehler: Ich hatte meinen ersten Studienabschluss und wollte den Master in Englischer Literatur machen. Im Graduiertenstudium verlagerte sich der Schwerpunkt: Wir besprachen Bücher, bevor wir sie gelesen hatten. Oder statt sie zu lesen.
Es dauerte quälend lange, bis ich erkannte, warum ich mich so unwohl fühlte, so unglücklich, so unbefriedigt. Doch irgendwann ging es mir schließlich auf. Die Struktur dieser Lehrveranstaltungen, die Art von Sekundärtexten, die ich lesen musste, machten eins mehr als klar: Was andere über ein Buch denken und fühlen, ist wichtiger, als was man selbst denkt und fühlt.
Ich persönlich glaube das nicht.
Das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass ich stur und eigensinnig bin. Unsere ersten Lieben sind die stärksten, und ich bin damit aufgewachsen, Bücher selbst zu lesen und meine eigenen Gedanken zu denken. Später auf dem College habe ich gelernt, wie toll es ist zu lesen, zu denken und dann diese Gedanken anderen mitzuteilen und zur Diskussion zu stellen. Aber man beachte die Reihenfolge: Zuerst zu lesen und die eigenen Gedanken zu denken.
Ich habe viel zu viele Vorworte gelesen, die vergessen, dass ihre Aufgabe nur ein Vorstellen ist, das Stiften einer Bekanntschaft. Möchte ich, dass Sie das Buch lesen, das Sie gerade in Händen halten? Natürlich. Es ist so, als wollte ich, dass Sie eine Person kennenlernen, die ich sehr mag. Eine Person, die interessant und amüsant ist. Eine Person, von der ich glaube, dass Sie beide gute Freunde werden könnten. Deshalb das Vorstellen. Darf ich bekannt machen? Leserin, Buch. Buch, Leser.
Aber meiner Erfahrung nach bescheiden sich Vorworte kaum je damit. Häufiger will die Person, die das Vorwort geschrieben hat, unbedingt sicherstellen, dass man das Buch richtig liest. Was heißt, so wie sie es gelesen hat. Und eh man sich’s versieht, posaunt sie einem schon ihre aufregende Meinung um die Ohren, dass das Ganze doch offensichtlich der Versuch ist, Heideggers Phänomenologie durch die marxistische Brille zu rekontextualisieren. Oder so etwas in der Art.
Ich persönlich finde das so reizvoll wie die Vorstellung, dass mir jemand mein Mittagessen vorkaut.
Aber nicht nur das. Es ist noch schlimmer.
Ein Buch für sich ist nichts. Es ist unbelebter Lehm. Jemand hat mal gesagt, ein Buch sei wie ein Blitz in einer Flasche, es brauche Leserinnen und Leser, um die Flasche zu entkorken. Aber so stark das Bild auch ist – es ist völlig falsch. Es impliziert nämlich, dass die Magie einer Geschichte ganz und gar im Buch selbst steckt. Aber das stimmt einfach nicht.
Denn: Ein Buch ist keine Packung Instant-Nudelsuppe.
Oh Gott, hoffentlich kommt niemand auf die Idee, das aufs Cover zu schreiben. Klingt ziemlich durchgeknallt. Aber hören Sie mir einfach noch ein bisschen zu. Ich versuche, etwas zu sagen, das zu formulieren ich mir noch nie richtig Zeit genommen habe.
Ein Buch ist nicht wie Instant-Nudelsuppe. Oder wie Instant-Trinkschokolade. Mit beiden interagiert man zwar, aber sie sind doch von einem getrennt. Außerhalb von einem selbst. Unabhängig von einem selbst. Jeder könnte das heiße Wasser daraufgießen, und heraus käme das Gleiche.
Bücher sind anders: Ein Buch ist ein Kuss. Ein Buch ist ein Tanz.
Eine Geschichte kommt zwar aus einem Buch, aber ihr Leben erlangt sie nicht dort. Sie erlangt es in uns selbst. Und diese Version der Geschichte ist anders als jede andere Version auf der Welt, und das liegt an dem, was man selbst einbringt. An dem, was man denkt und fühlt. Das ist einmalig. Es ist besonders und wunderbar.
Also. Ein Buch ist keine Instant-Nudelsuppe. Diese exklusive Einsicht verdanken Sie mir. Ein Buch ist ein Tanz. Oder vielmehr, man tanzt mit dem Buch. Es ist ein Zusammenspiel, und die Geschichte ist der Tanz. Das Zusammenspiel ist einmalig, weil man nicht nur Wasser beisteuert, sondern sich selbst.
Das gilt wahrscheinlich für alle Formen von Kunst, aber ich glaube, für Bücher gilt es ganz besonders. Und mehr noch, Bücher variieren sehr darin, wie stürmisch der gemeinsame Prozess sein kann. Manche Bücher überraschen uns dauernd mit neuen Schritten, die sie uns zeigen, sobald wir den Tanz wieder aufnehmen. Andere helfen uns, uns selbst zu überraschen.
Also. Darf ich bekanntmachen? Leserin, Buch. Buch, Leser.
So gern ich noch weiter dabei wäre und dafür sorgen würde, dass Sie beide sich gut verstehen – ich muss jetzt gehen. Natürlich habe ich jede Menge Gedanken und Gefühle zu der Geschichte, die Sie in Händen halten. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, wie toll ich die Sprache finde. Den Handlungsbogen. Schmendrick den Zauberer. Molly Grue …
Aber wenn Sie meine aufregende Meinung über Haggard und den roten Stier erfahren wollen, lesen Sie das auf meinem Blog nach. Das gehört nicht hierher. Für Sie heißt es jetzt: Tanzen.
Patrick Rothfuss
Februar 2022
1
Das Einhorn lebte in einem Fliederwald, und es lebte ganz allein. Es war sehr alt, ohne etwas davon zu wissen, und es hatte nicht mehr die flüchtige Farbe von Meerschaum, sondern eher die von Schnee in einer mondhellen Nacht. Seine Augen aber waren frisch und klar, und noch immer bewegte es sich wie ein Schatten über dem Meer.
Es hatte keine Ähnlichkeit mit einem gehörnten Pferd, wie Einhörner gewöhnlich dargestellt werden; es war kleiner und hatte gespaltene Hufe und besaß jene ungezähmte, uralte Anmut, die sich bei Rehen nur in schüchternscheuer Nachahmung findet und bei Ziegen in tanzendem Possenspiel. Sein Hals war lang und schlank, wodurch sein Kopf kleiner aussah, als er in Wirklichkeit war, und die Mähne, die fast bis zur Mitte seines Rückens floss, war so weich wie Löwenzahnflaum und so fein wie Federwolken. Das Einhorn hatte spitze Ohren und dünne Beine und an den Fesseln Gefieder aus weißem Haar. Das lange Horn über seinen Augen leuchtete selbst in tiefster Mitternacht muschelfarben und milchig. Es hatte Drachen mit diesem Horn getötet und einen König geheilt, dessen vergiftete Wunde sich nicht schließen wollte, und für Bärenjunge reife Kastanien heruntergeschüttelt.
Einhörner sind unsterblich. Es ist ihre Art, allein an einem Ort zu leben, gewöhnlich in einem Wald, in dem es einen klaren Teich gibt, worin sie sich spiegeln können; sie sind nämlich ein wenig eitel, wohl wissend, dass sie auf der ganzen Welt die schönsten Geschöpfe sind, und zauberische obendrein. Sie haben nur selten Junge, und keine Stelle ist so wundervoll wie die, an der ein Einhorn geboren ward. Viel Zeit war verflossen, seitdem es ein anderes Einhorn gesehen hatte; und damals hatten die jungen Einhörner, die hin und wieder zu Besuch kamen, eine Sprache gesprochen, die ihm fremd war. Doch eigentlich konnte es sich Monate, Jahre und Jahrhunderte gar nicht vorstellen, nicht einmal Jahreszeiten. In seinem Wald herrschte immer Frühling, weil es dort lebte. Den ganzen Tag wandelte es unter den großen Buchen umher und hütete die Tiere, die in Nestern und Höhlen, in Büschen und Bäumen hausten. Geschlecht auf Geschlecht jagten und liebten sie, hatten Kinder und starben, Wölfe wie Hasen; und weil das Einhorn nichts von all dem tat, ward es nie müde, ihnen dabei zuzuschauen.
Eines Tages ritten zwei Männer mit langen Bogen auf der Jagd nach Rehen durch seinen Wald. Das Einhorn folgte ihnen so behutsam, dass nicht einmal die Pferde es bemerkten. Der Anblick von Menschen erfüllte es mit einer uralten und ahnungsvollen Mischung aus Zorn und Zärtlichkeit. Wenn es irgendwie vermeidbar war, zeigte es sich den Menschen nicht, aber es bereitete ihm Freude, sie vorüberreiten zu sehen und sprechen zu hören.
»Dieser Wald gefällt mir überhaupt nicht«, brummte der ältere der beiden Jäger. »In einem Einhornwald lernen alle Tiere mit der Zeit ein wenig Zauberei – vor allem, was das Verschwinden angeht. Beute machen wir hier keine.«
»Einhörner gibt es schon längst nicht mehr«, sagte der andere Mann, »wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat. Das hier ist ein Wald wie jeder andere.«
»Und warum fällt hier weder Blatt noch Schnee? Ich sage dir, ein Einhorn gibt es noch auf der Welt – ich wünsch dem armen alten Ding viel Glück –, und solange es in diesem Wald lebt, wird kein Jäger auch nur mit einer Maus als Beute am Sattel nach Hause reiten. Reit nur zu, du wirst schon sehen. Ich kenne sie, diese Einhörner!«
»Aus Büchern«, erwiderte der andere. »Nur aus Büchern und Balladen und Märchen. Drei Könige haben geherrscht – und in dieser ganzen Zeit hat man weder in unserem noch in irgendeinem anderen Land auch nur den Schatten eines Einhorns gesehen. Du weißt über Einhörner nicht mehr als ich, denn ich habe die gleichen Bücher gelesen und die gleichen Geschichten gehört, und gesehen habe ich auch noch keines.«
Der erste Jäger schwieg eine Weile, und der andere pfiff griesgrämig vor sich hin. »Meine Urgroßmutter hat mal ein Einhorn gesehen«, sagte der vordere Reiter. »Als ich ein Kind war, hat sie mir oft davon erzählt.«
»Wirklich? Und hat sie es mit einem goldenen Zaum gefangen?«
»Nein. Sie hatte keinen zur Hand. Um ein Einhorn zu fangen, braucht man nur im Märchen einen goldenen Zaum. In Wirklichkeit muss man bloß ein reines Herz haben.«
»Das glaub ich auch«, lachte der jüngere Mann. »Und ist sie dann auf ihrem Einhorn geritten? Ohne Sattel, wie eine Waldnymphe in grauer Vorzeit?«
»Meine Urgroßmutter fürchtete sich vor großen Tieren«, sagte sein Kamerad. »Sie ritt nicht auf ihm, sondern blieb sitzen, ohne sich zu rühren, und das Einhorn legte seinen Kopf in ihren Schoß und schlief ein. Meine Urgroßmutter hat sich nicht bewegt, bis es wieder aufgewacht ist.«
»Wie hat es ausgesehen? Plinius beschreibt das Einhorn als ein äußerst wildes Tier, mit dem Kopf eines Rehs, den Füßen eines Elefanten und dem Schwanz eines Bären; im Übrigen soll es einem Pferd ähneln. Es heißt, es habe eine tiefe, bellende Stimme und ein schwarzes Horn, zwei Ellen lang. Und die Chinesen …«
»Meine Urgroßmutter sagte nur, das Einhorn habe gut gerochen. Sie konnte den Geruch von Tieren auf den Tod nicht ausstehen, nicht einmal den einer Katze oder einer Kuh, ganz zu schweigen von dem eines wilden Tieres, aber den Geruch des Einhorns, den hat sie geliebt. Einmal hat sie sogar geweint, als sie mir davon erzählte; sie war schon eine sehr alte Frau und weinte über alles, was sie an ihre Jugend erinnerte.«
»Lass uns umkehren und woanders jagen«, sagte plötzlich der jüngere Jäger. Das Einhorn schlüpfte lautlos in ein dichtes Gebüsch, als die Männer ihre Pferde wendeten; es folgte ihnen erst wieder, als sie schon ein gutes Stück voraus waren. Die beiden Männer ritten wortlos dahin, bis sie sich dem Waldrand näherten. Da fragte der zweite Jäger nachdenklich: »Warum sind sie bloß fortgegangen, was meinst du? Wenn es sie überhaupt je gegeben hat?«
»Was weiß ich! Die Zeiten ändern sich. Glaubst du, das heute sei eine gute Zeit für Einhörner?«
»Nein, aber ich weiß nicht, ob es überhaupt schon einmal einen Menschen gegeben hat, der dachte, seine Zeit sei für Einhörner die richtige. Und gerade kommt es mir so vor, als hätte ich darüber Geschichten gehört – aber da war ich müde vom Wein oder hab an etwas anderes gedacht. Ach, lassen wir’s. Wenn wir uns beeilen, dann reicht das Licht noch zur Jagd. Komm!«
Sie brachen aus dem Wald, spornten ihre Pferde zum Galopp und preschten davon. Als sie gerade noch zu sehen waren, schaute der ältere Jäger zurück und rief – grad so, als könne er das Einhorn sehen, das sich im Schatten barg: »Bleib, wo du bist, armes Geschöpf! Diese Welt ist nichts für dich. Bleib in deinem Wald und halte deine Bäume grün und deine Freunde lang am Leben. Hör nicht auf junge Mädchen, denn aus ihnen werden höchstens törichte alte Weiber. Viel Glück!«
Das Einhorn stand reglos am Waldrand und sagte laut: »Ich bin das letzte Einhorn auf der Welt.« Das waren die ersten Worte, die es seit mehr als hundert Jahren gesprochen hatte.
›Wie kann das sein?‹ dachte es. Allein zu leben, ohne je ein anderes Einhorn zu sehen, das hatte ihm nie etwas ausgemacht, denn es war immer überzeugt gewesen, dass es noch mehr von seiner Art gebe, und mehr Gesellschaft braucht ein Einhorn nicht. »Aber wenn alle von uns verschwunden wären, dann könnte ich doch auch nicht mehr da sein: Mir widerfährt, was ihnen widerfährt.«
Die eigene Stimme erschreckte es, und es wollte laufen, nichts als laufen. Leichtfüßig und leuchtend jagte es die düstren Waldwege entlang, überquerte jäh auftauchende Lichtungen, blendend helle oder schattensanfte, und es war eins mit allem ringsumher, mit den Kräutern, die seine Fesseln streiften, und mit dem blauen und silbrigen Flirren, wenn der Wind die Blätter hob. ›Nie könnte ich das hier verlassen, nie; und wenn ich das allerletzte Einhorn wäre. Hier bin ich zu Hause, weiß, wie jedes Ding ist, wie es riecht und schmeckt. Was könnte ich in der Welt suchen, wenn nicht das, was ich hier schon habe?‹
Als es die wilde Jagd beendete, stillstand und den Krähen und einem Hähergezeter über sich lauschte, da dachte es: ›Und wenn sie irgendwo in der Ferne alle zusammen umherschweifen und auf mich warten?‹
Von diesem ersten Augenblick des Zweifels an fand es keine Ruhe mehr. Seitdem es sich zum ersten Mal vorgestellt hatte, seinen Wald zu verlassen, konnte es an keinem Ort sein, ohne sich an einen anderen zu wünschen. Ruhelos und unglücklich trabte es an seinem Teich auf und ab. Entscheidungen fallen Einhörnern schwer. Es sagte ja und es sagte nein, Tag und Nacht, und zum ersten Male fühlte es die Minuten wie Würmer über sich kriechen. ›Ich bleibe hier. Wenn die Menschen eine Zeitlang keine Einhörner gesehen haben, dann bedeutet das noch lange nicht, dass alle Gefährten verschwunden sind. Und selbst wenn es so wäre, würde ich nicht gehen. Ich lebe hier.‹
Doch dann erwachte es inmitten einer warmen Nacht und sagte: »Jetzt aber los!« Es lief durch seinen Wald und gab sich große Mühe, nichts anzusehen und nichts zu riechen, versuchte, die Erde unter den gespaltenen Hufen nicht zu spüren. Die nächtlichen Tiere, Eulen, Füchse und Rehe, hoben die Köpfe, als es vorüberkam, doch das Einhorn schenkte ihnen keinen Blick. ›Ich muss mich beeilen, damit ich bald wieder zurück bin. Vielleicht ist es nicht sehr weit. Aber ob ich die anderen finde oder nicht: Ich werde schnell zurückkommen, so schnell ich nur kann.‹
Die Straße, die am Wald vorüberführte, glänzte im Mondlicht wie Wasser, doch als es sie betrat, spürte es, wie hart sie war und wie lang. Fast wäre es umgekehrt, dann aber sog es die Waldluft tief ein und behielt sie im Mund wie eine Blume, so lang es nur ging.
Die Straße führte nirgendwohin und hatte kein Ende; sie lief durch Dörfer und kleine Städte, über Berg und Tal, durch steiniges Brachland und Wiesen, die sich hinter Felsen ausbreiteten. Die Straße aber gehörte nirgendwohin und rastete nie; sie zog das Einhorn mit sich, zupfte und zerrte an seinen Füßen wie die einsetzende Flut, ließ ihm weder Zeit noch Ruhe, wie gewohnt dem Winde zu lauschen. Seine Augen waren jetzt voller Staub, und seine schmutzige Mähne war steif und schwer.
In seinem Wald war die Zeit an ihm vorübergegangen, ohne es zu berühren, aber jetzt musste es durch die Zeit hindurchgehen. Die Farben der Bäume wechselten, und den Tieren wuchsen dicke Pelze und dann wieder dünnere. Die Wolken krochen oder jagten dahin vor den wechselnden Winden, waren rosa und golden in der Sonne, oder bleifarben vor dem Sturm. Überall suchte das Einhorn nach seinen Gefährten, aber nirgends fand es auch nur eine Spur von ihnen, und in all den Sprachen, die es unterwegs hörte, gab es nicht einmal ein Wort für sie.
Eines frühen Morgens, als es gerade die Straße verlassen wollte, um sich zur Ruhe zu legen, sah es einen Mann, der in seinem Garten Unkraut jätete. Anstatt sich zu verbergen, blieb das Einhorn stehen und schaute ihm bei der Arbeit zu, bis er sich aufrichtete und es erblickte. Er war fett, und seine Wangen hüpften bei jedem Schritt. »Oh!« rief er. »Oh, bist du schön!«
Als er hastig seinen Gürtel abnahm, eine Schlinge hineinmachte und schwerfällig herankam, da machte das dem Einhorn mehr Spaß als Angst. Der Mann wusste, was er da vor sich hatte, und er wusste auch, was er selbst war: jemand, der Rüben hackte und hinter etwas herjagte, das glänzte und schneller laufen konnte als er. Das Einhorn entzog sich seinem ersten Angriff so federleicht, als hätte der Luftzug es davongeweht. »Man hat mich schon mit Gerten und Geißeln gejagt«, sagte es zu ihm. »Und die Jäger wussten, dass sie mich nur dann fangen würden, wenn sie die Jagd so erregend und wunderlich führten, dass ich aus Neugier in ihre Nähe käme. Und selbst so bin ich kein einziges Mal gefangen worden.«
»Ich muss ausgerutscht sein«, sagte der Mann. »Ruhig, ganz ruhig, hübsches Ding.«
›Ich habe nie verstanden‹, grübelte das Einhorn, während der Mann sich mühsam aufraffte, ›was ihr mit mir tun wollt, wenn ihr mich gefangen habt.‹ Der Mann sprang wieder vor, und es entglitt ihm wie Wasser zwischen den Händen. ›Ich glaube, ihr wisst es selber nicht.‹
»Brrr, bleib doch stehen!« Der Mann hatte ein schwitzendes, verschmiertes Gesicht und war außer Atem. »Hübsche«, keuchte er, »hübsche kleine Stute!«
»Stute?« Das Einhorn stieß das Wort so schrill hervor, dass der Mann seine Verfolgung aufgab und sich die Ohren zuhielt. »Stute!« rief das Einhorn. »Ein Pferd soll ich sein? Seh ich so aus? Glaubst du das wirklich?«
»Gutes Pferd«, schnaufte der dicke Mann. Er lehnte sich an den Zaun und wischte sich das Gesicht ab. »Ich werde dich striegeln und rausputzen, wirst weit und breit das schönste Pferdchen sein.« Er holte wieder mit dem Gürtel aus. »Und dann verkauf ich dich. Komm nur her, Pferd.«
»Ein Pferd wolltest du also fangen, ein Pferd!«, sagte das Einhorn. »Eine weiße Stute mit einer Mähne voller Kletten!« Als der Mann heranschlich, stieß es sein Horn durch den Gürtel, riss ihn aus seinen Händen und schleuderte ihn über die Straße hinweg in ein Büschel Gänseblümchen. »Ein Pferd bin ich?«, schnaubte es. »Ein Pferd!«
Einen Augenblick lang war der Mann dem Einhorn sehr nahe, und dessen große Augen starrten in die seinen, die klein und müde waren und voll Erstaunen. Dann machte es kehrt und jagte die Straße hinauf und davon; und so schnell war sein Lauf, dass alle, die es sahen, ausriefen: »Seht! Dort läuft ein wahres Pferd!« Und ein alter Mann sagte zu seiner Frau: »Das ist ein Araber. Ich bin einmal mit einem Araber auf einem Schiff gewesen.«
Von da an mied das Einhorn selbst bei Nacht alle Ortschaften; dennoch wurde es immer wieder von Menschen gejagt, aber diese Jagd galt immer einem streunenden weißen Pferd, und niemals war sie heiter und huldigend, wie es sich geziemt. Sie versuchten es mit Seilen und Netzen und Zuckerstückchen, sie pfiffen ihm und riefen es Nellie oder Bess. Manchmal rannte das Einhorn nicht gar so schnell, damit die Pferde es wittern konnten, und sah dann zu, wie sie sich aufbäumten und ausschlugen und mitsamt ihren entsetzten Reitern davonstoben. Die Pferde erkannten es immer.
›Wie kann das sein?‹, fragte es sich. ›Ich könnte ja noch verstehen, dass die Menschen uns Einhörner vergessen haben, oder dass sie sich geändert haben und uns jetzt hassen und jedes Einhorn töten wollen, das sie sehen. Aber sie erkennen mich ja nicht einmal, sie sehen mich an und sehen etwas ganz anderes! Wie mögen sie da erst für einander aussehen? Wie sehen da wohl Bäume in ihren Augen aus, oder Häuser, oder wirkliche Pferde, und wie ihre Kinder?‹
Und manchmal dachte es: ›Wenn die Menschen nicht mehr erkennen, was sie erblicken, dann kann es ja auch noch andere Einhörner auf der Welt geben – unerkannt und froh darüber.‹ Doch es wusste, mit schmerzlicher Gewissheit, dass sich die Menschen verändert hatten, und mit ihnen die Welt. Und dann zog es wieder weiter auf seiner beschwerlichen Straße, obgleich es jeden Tag ein wenig mehr wünschte, seinen Wald nie verlassen zu haben.
Eines Nachmittags flatterte der Schmetterling aus einer Brise und ließ sich auf der Spitze seines Hornes nieder. Er war sammetschwarz, mit goldenen Tupfen auf den Flügeln, und er war so zart wie ein Blütenblatt. Er grüßte mit seinen bebenden Fühlern und tanzte auf dem Horn. »Ich bin ein fahrender Sänger. Wie geht es dir?«
Das Einhorn lachte zum ersten Mal auf seiner Wanderung. »Schmetterling, was machst du an so einem windigen Tag im Freien?«, fragte es ihn. »Du wirst dich erkälten und lange vor der Zeit sterben.«
»Der Tod nimmt dem Menschen, was er gern behielte, und lässt ihm, was er gern verlöre«, erwiderte der Falter. »Blas, Wind, bis dir die Backen platzen! Ich wärme mir die Hände am Feuer des Lebens und schaff mir vierfache Erleichterung.« Auf dem Horn sah er aus wie ein samtener Schatten.
»Weißt du, wer ich bin, Schmetterling?«, fragte das Einhorn voller Hoffnung, und er antwortete: »Bestens! Du handelst mit Fischen. Puppchen, du bist mein Augenstern, ich hab dich zum Fressen gern, du bist alt und grau und voller Schlaf, schwindsüchtige Mary Jane.« Er flatterte heftig, um nicht vom Wind davongeweht zu werden; dann sagte er leichthin: »Dein Name ist eine goldene Glocke, die in meinem Herzen hängt. Ich würde mich in Stücke reißen, wenn ich dich ein einziges Mal bei deinem Namen nennen dürfte!«
»Dann sag meinen Namen!«, bat das Einhorn. »Wenn du meinen Namen weißt, dann sprich ihn aus!«
»Rumpelstilzchen!«, rief der Schmetterling fröhlich. »Einen Orden kriegst du nicht!« Er tanzte und torkelte und sang aus Leibeskräften: »Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht, wenn an der nächsten Ecke schon Schneewittchen steht. In der Nacht, wenn meine Frau erwacht! Jüngelchen, mach Feuer an, dass ich meine Federn wärmen kann!« Seine Augen glühten im milchigen Glanz des Hornes.
Das Einhorn seufzte und trottete weiter; es war enttäuscht und zugleich belustigt. »Geschieht dir recht«, sagte es, »wie kannst du von einem Schmetterling erwarten, dass er deinen Namen kennt! Sie kennen sich mit Liedern und Gedichten aus und mit allem, was sie so hören. Sie meinen es gut, aber sie bringen alles durcheinander. Und warum auch nicht? Sie sterben ja so bald.«
Der Falter gaukelte vor seinen Augen und sang: »Lirumlarum Löffelstiel, schöne Frauen kosten viel! Frohsinn, führ mir ein Heer von grimmigen Grillen her. Der Kuckuck und der Kolibri, das sind die Herren Musici! Ich liebe, liebe, liebe dich, aber nach dem Schlussverkauf hört auch unsre Liebe auf! Und aus ihrem Hexenhaus, schaut heut Frau von Holle raus! Ich liebeliebeliebedich!« Seine Worte klimperten in des Einhorns Kopf wie fallende Silbermünzen.
Er begleitete es, bis es Abend wurde; als die Sonne unterging und der Himmel voll rosiger Fische stand, flog er vom Horn ab und schwebte und schwankte über ihm. »Ich muss den D-Zug noch erwischen«, sagte er höflich. Seine samtigen Flügel waren von einem Netzwerk zarter dunkler Adern durchzogen.
»Leb wohl«, sagte das Einhorn. »Ich hoffe, du wirst viele neue Lieder hören.« Das dünkte ihm das Beste, was man einem Schmetterling zum Abschied sagen kann. Doch anstatt davonzufliegen, flatterte er weiterhin über ihm, in der bläulichen Abendluft wirkte er plötzlich weniger kühn und etwas nervös. »Flieg fort!«, drängte das Einhorn. »Es ist schon viel zu kalt für dich.« Der Falter blieb, wo er war, und summte vor sich hin.
»Auf seinem Pferde ritt Mazeppa«, stimmte er zerstreut an; und dann sagte er laut und klar: »Einhorn. Lateinisch unicornis, Altfranzösisch Licorne. Wörtlich: einhörnig, unus für eins und cornu das Horn. Ein Fabeltier, das einem Pferd mit einem Horn ähnlich sieht. John Maynard war unser Steuermann, dem keine Frau vertrauen kann. Heinrich, der Wagen bricht!« Er schoss ausgelassen hin und her, und die ersten Leuchtkäfer blinkten erstaunt und entrüstet.
Das Einhorn war so überrascht und glücklich, endlich seinen Namen zu hören, dass es die Erwähnung des Pferdes gerne verzieh. »Oh, du kennst mich also!«, rief es und sein entzücktes Schnauben blies den Falter zwanzig Schritte davon. Als er zurückgeflattert kam, flehte das Einhorn: »Schmetterling, wenn du wirklich weißt, wer ich bin, dann sag mir, ob du irgendwo meinesgleichen gesehen hast; sag, wo ich meine Gefährten finden kann. Wo sind sie geblieben?«
»Glühwürmchen, Glühwürmchen, glimm’re«, sang er in der Dämmerung. »Wir lagen vor Madagaskar und hatten Rapunzeln an Bord, versoffen unser Oma klein Häusel, und wollten nicht mehr fort!« Er setzte sich wieder auf das Horn, und das Einhorn spürte, wie er zitterte.
»Bitte«, sagte es, »ich will doch nur wissen, ob es irgendwo auf der Welt noch andere Einhörner gibt. Sag mir, dass es noch meinesgleichen gibt, und ich glaub dir und geh zurück in meinen Wald. Ich bin schon so lange in der Fremde und wollte doch so bald wieder daheim sein.«
»Mit fünfundsiebzig die Fahrt begann, zurück kam nur ein einziger Mann, ja, ja, der Alkohol! Der Mond, der scheint so helle, die Toten reiten so schnelle!« Plötzlich hielt er inne und sagte mit fremder Stimme: »Nein, nein, hör zu, hör nicht auf mich, hörst du! Du kannst deine Gefährten finden, wenn du tapfer bist. Sie sind vor langer Zeit vom Roten Stier davongetrieben worden, er rannte dicht hinter ihnen her und verwischte mit seinen Hufen ihre Spuren. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern!« Seine Flügel streiften das Einhorn.
»Der Rote Stier?«, fragte es. »Wer ist der Rote Stier?«
Der Falter fing wieder zu singen an: »Folge mir! Der Rote Stier? Folge mir! Folge mir! Das böse Tier!« Aber dann schüttelte er heftig den Kopf und deklamierte: »Als Kalb war er schon ein riesiges Tier, und seine Hörner sind so gewaltig wie die des Auerochsen. Und mit diesen Hörnern wird er alle Sünder in den Pfuhl des Verderbens stoßen. Hör, hör zu, hör gut zu!«
»Ich hör doch zu!«, schrie das Einhorn. »Wo sind meine Gefährten, und wer ist der Rote Stier?«
Der Schmetterling schoss lachend an seinem Ohr vorüber. »Ich hab Albträume, wenn ich an die Erde denke«, sang er. »Hunde bellen und bellen mich an, die Schlangen fauchen und schleichen heran, die Bettler verlassen die Stadt!«
Noch einen Augenblick lang tanzte er in der Dämmerung vor ihm her, dann verlor er sich in den violetten Schatten am Wegesrand. »Du oder ich, Motte!«, sang er herausfordernd, »Arm in Arm in Arm …« Das Letzte, was das Einhorn von ihm sah, war ein schwaches Flattern zwischen den Bäumen, und das konnte eine Täuschung sein, denn die Nacht war jetzt voller Flügel.
›Wenigstens hat er mich erkannt‹, dachte es traurig. ›Immerhin etwas.‹ Aber dann gab es sich selbst die Antwort: ›Nein, das hat gar nichts zu bedeuten, oder höchstens, dass irgendjemand einmal ein Lied oder ein Gedicht über Einhörner gemacht hat. Aber der Rote Stier? Was hat er damit gemeint? Wahrscheinlich auch nur ein Lied.‹
Es zog langsam weiter, und die Nacht brach über ihm herein. Der Himmel hing tief und war beinahe pechschwarz, bis auf einen Fleck gilbenden Silbers, dort, wo der Mond hinter den Wolken dahinzog. Das Einhorn sang leise ein Lied, das ein junges Mädchen vor vielen Jahren in seinem Wald gesungen hatte:
Katzen und Spatzen in meinem Schuh
leben eher zusammen als ich und du;
die Fische kommen zu Fuß aus dem Meer,
bevor ich erleb deine Wiederkehr.
Es verstand die Worte nicht, musste aber voller Sehnsucht an seine Heimat denken; es war ihm, als hätte der Herbst die Buchen in seinem Walde zum ersten Mal geschüttelt, als es diese Straße betrat.
Endlich legte es sich ins kalte Gras und schlief ein. Einhörner sind die scheuesten aller Geschöpfe, ihr Schlaf aber ist tief und fest. Es träumte, daheim zu sein, und aus diesem Traum konnten es nicht einmal das näherkommende Rasseln von Rädern und das Geklingel von Glöckchen reißen, umso weniger, als die Räder mit Lumpen gedämpft und die Glöckchen mit Wolle umwickelt waren. Es war weit fort, weiter, als die leisen Glockentöne reichten; es erwachte nicht.
Jeder der neun schwarz verhüllten Wagen wurde von einem mageren schwarzen Pferd gezogen, und jeder von ihnen bleckte vergitterte Seiten, wenn der Wind die Vorhänge verschob. Der Wagen an der Spitze wurde von einem vierschrötigen alten Weib gelenkt; auf beiden Seiten trug er in großen Buchstaben die Aufschrift:
MAMMY FORTUNAS MIT TERNACHTSMENAGER IE und darunter stand in kleinerer Schrift: Kreaturen der Nacht, ans Licht gebracht!
Als der Wagen sich der Stelle näherte, wo das Einhorn lag und schlief, brachte die alte Frau das schwarze Pferd zum Stehen. Auch die anderen Wagen hielten und standen geräuschlos da, während das alte Weib mit einer verblüffend anmutigen Bewegung vom Kutschbock sprang. Sie ging behutsam zu dem Einhorn hinüber und blickte lange zu ihm hinab. Dann sagte sie: »Der Teufel soll mein altes Lederherz holen! Und ich hab gedacht, die gäb’s schon längst nicht mehr!« Ihre Stimme hinterließ in der Luft einen Geschmack von Honig und Schießpulver.
»Wenn der das wüsste!«, sagte sie, und entblößte kieselige Zähne. »Ich werd’s ihm kaum sagen.« Sie blickte zu den schwarzen Wagen hinüber und schnalzte zweimal mit den Fingern. Die Fahrer des zweiten und des dritten Wagens stiegen ab und kamen herüber. Der eine sah so finster und vierschrötig aus wie sie, der andere war ein großer, hagerer Mann, der eine Miene voll wirrer Entschlossenheit zur Schau trug. Er hatte einen alten schwarzen Mantel an, und seine Augen waren grün.
»Was siehst du?«, fragte das alte Weib den kleineren Mann. »Rukh, was liegt dort?«
»Toter Gaul«, antwortete er. »Nein, lebt noch. Der Drache wird sich freuen.« Sein Lachen klang wie das Anreiben von Zündhölzern.
»Narr!«, sagte Mammy Fortuna. Dann fragte sie den anderen Mann: »Und du, Zauberer, Magier, Wundertäter, was siehst du mit deinem Seherauge?« Sie brach, wie auch der Mann namens Rukh, in ein kreischendes Gelächter aus, das erst aufhörte, als sie sah, dass der hagere Mann immer noch auf das starrte, was vor ihm lag. »Antworte mir, du Scharlatan!«, knurrte sie, doch er drehte nicht einmal den Kopf nach ihr. Das besorgte die Alte für ihn, indem sie sein Kinn mit ihrer krabbenartigen Hand herumzerrte. Vor ihrem bernsteingelben Blick senkte er die Augen.
»Ein Pferd«, murmelte er. »Eine weiße Stute.«
Mammy Fortuna sah ihn lange an. »Du bist auch ein Narr, Zauberer«, kicherte sie endlich, »aber ein größerer als Rukh, und gefährlicher. Er lügt aus Habgier, du aber lügst aus Angst. Oder sollte es Freundlichkeit sein?« Der Hagere gab keine Antwort, und Mammy Fortuna lachte vor sich hin.
»Auch gut«, sagte sie dann. »Es ist also eine weiße Stute. Ich will sie für die Menagerie haben. Der neunte Käfig steht leer.«
»Ich hol ein Seil«, sagte Rukh und wollte zu den Wagen hinübergehen; die Alte packte ihn am Ärmel und hielt ihn zurück.
»Das einzige Seil, das sie binden könnte, wäre die Fessel, mit denen die Götter den Fenriswolf gebunden haben. Die bestand aus Bärensehnen, Frauenbart, Katzenmiauen, Vogelspeichel, Fischatem und noch etwas. Jetzt fällt mir’s ein: Gebirgswurzeln. Da wir keins von diesen Dingen haben und auch keine Zwerge, die daraus ein Seil flechten, müssen wir uns mit Eisenstangen behelfen, und mit meinem Bann.« Sie murmelte ein paar krächzende, unheimliche Worte, und ihre Hände webten die Nacht. Als sie ihren Bann gesprochen hatte, lag über dem Einhorn ein Geruch von Schwefel und Blitz.
»Holt den Käfig!« sagte sie zu den beiden Männern. »Sie wird bis zum Sonnenaufgang schlafen, und wenn ihr noch so viel Lärm macht – es sei denn, ihr stellt euch so blöd wie sonst an und berührt sie. Zerlegt den neuen Käfig und baut ihn um sie herum wieder auf, aber Vorsicht! Die Hand, die auch nur ihre Mähne streift, verwandelt sich augenblicklich in den Eselshuf, den zu sein sie verdient.« Sie sah den hageren Mann spöttisch an und krächzte: »Dein Hokuspokus fiele dir dann noch schwerer, Magier. An die Arbeit, es bleibt nicht mehr lange dunkel!«
Als sie ein gutes Stück außer Hörweite war und schon in ihrem Wagen verschwand, als wäre sie nur herausgekommen, um die Stunde auszurufen, da spuckte Rukh aus und fragte aufgeregt: »Ich möcht nur wissen, wovor der alte Tintenfisch solche Angst hat? Warum sollen wir das Vieh nicht anfassen?«
Die Antwort des Zauberers war beinahe unhörbar: »Die Berührung von Menschenhand würde es sogar aus dem Schlaf erwecken, in den es der Teufel persönlich versenkt hat – und Mammy Fortuna ist kein Teufel!«
»Es wär ihr recht, wenn wir sie für einen hielten«, schnaubte der dunkle Mann. »Eselshufe, bah!« Er streckte beide Hände tief in die Taschen. »Was für ein Bann soll denn da brechen? Das ist doch nur ein alter weißer Gaul.«
Doch der Zauberer ging schon zu dem letzten Wagen hinüber. »Beeil dich!«, rief er über die Schulter. »Es wird bald Tag!«
Sie brauchten den Rest der Nacht, um den neunten Käfig zu zerlegen, Dach, Gitter und Boden, und ihn dann um das schlafende Einhorn herum wieder zusammenzubauen. Rukh rüttelte an der Tür, um sich zu vergewissern, dass sie fest verschlossen war. In diesem Augenblick flutete die Sonne über die graue Wipfelwirrnis herein, und das Einhorn schlug die Augen auf. Die beiden Männer machten sich aus dem Staub; aus sicherer Entfernung blickte der Zauberer zurück und sah, wie sich das Einhorn aufrichtete und die Eisenstangen anstarrte. Sein gesenkter Kopf schlenkerte hin und her wie der Kopf einer alten weißen Mähre.
2
Die neun schwarzen Wagen der Mitternachtsmenagerie sahen am Tage kleiner aus und hatten ihr unheimliches Aussehen verloren; aus der Nähe wirkten sie recht morsch und brüchig. Die Vorhänge waren verschwunden, statt dessen waren sie jetzt mit groben schwarzen Fähnchen und ausgefransten schwarzen Bändern geschmückt, die bei jedem Luftzug flatterten. Die Wagen standen in seltsamer Formation auf einem Stoppelfeld: Ein Fünfeck von Käfigen umschloss ein Dreieck, in dessen Mitte wiederum Mammy Fortunas Wagen hockte. Dieser Käfig war als einziger noch mit einem Vorhang verhängt; Mammy Fortuna war nirgends zu sehen.