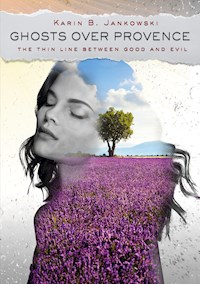Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Das letzte Geheimnis
- Sprache: Deutsch
Eine fast wahre Geschichte, in der es um Liebe und den Umgang damit geht. "Vertrau mir doch", sagte der Vater zu Alice und später auch ihr Mann... Aber da war es schon zu spät. Die Liebe war missbraucht... und erst Steven schafft es, Alice wieder an die wahre Liebe glauben zu lassen. Aber - kann sie ihm wirklich vertrauen? Ein spannender Roman mit tiefen Einblicken in die menschliche Seele und eine Welt, vor der viele Menschen Angst haben - die in Wirklichkeit aber keine andere ist als die, in der wir leben. Erst wenn wir das erkennen, können wir sie ändern. "Ich lese viel. Aber das ist ein ganz anderes Buch. Man spürt, dass hier nichts erfunden wurde. Was für ein Leseerlebnis." -eine begeisterte Leserin-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Widmen möchte ich dieses Buch all den Frauen und Männern, die sich „ermutigt fühlen, der Geschichte ihrer eigenen Kindheit zu begegnen, sie ernst zu nehmen, und von ihr zu berichten. Damit werden sie wiederum weitere Kreise der Menschheit darüber informieren, was ein Mensch am Ursprung seines Lebens in den meisten Fällen ertragen musste, ohne dass er es später selber weiß, auch ohne dass irgend jemand anderer es weiß – einfach, weil es bisher nicht möglich war, es zu merken, und es auch kaum Berichte von Betroffenen zu lesen gab, die nicht idealisierend waren. Doch jetzt gibt es sie, und sie werden weiter erscheinen, in steigender Zahl.“
Aus „Alice Miller, Du sollst nicht merken“, 1983
Inhalt
Vorwort
Buch 1 Glaube
Prolog
Kapitel 1.1 Mutprobe
Kapitel 1.2 Alles war anders
Kapitel 1.3 Nachbesprechung mit Überraschungen
Kapitel 1.4 Charme und Macht
Kapitel 1.5 Träume sind (keine) Schäume
Kapitel 1.6 Katz und Maus
Kapitel 1.7 Glück im Unglück
Buch 2 Hoffnung
Kapitel 2.1 Spielereien?
Kapitel 2.2 Müll
Kapitel 2.3 Geister der Vergangenheit
Kapitel 2.4 Der Weg zur Wahrheit
Kapitel 2.5 Zu neuen Ufern
Kapitel 2.6 Manchmal kommt es anders…
Kapitel 2.7 Das Tier in uns
Kapitel 2.8 Allmacht statt Ohnmacht
Buch 3 Liebe
Kapitel 3.1 Nur aus Liebe zu Dir…
Kapitel 3.2 Gut gemeint ist nicht immer…
Kapitel 3.3 Haggis und Trüffel
Kapitel 3.4 Lizbeths Tagebuch
Kapitel 3.5 Hoffnung auf Liebe
Kapitel 3.6 Am Abgrund
Kapitel 3.7 Kurz vor Sonnenuntergang
Kapitel 3.8 Ritzenkinder
Kapitel 3.9 Mord verjährt nicht
Kapitel 3.10 …doch am größten ist die Hoffnung
Nachwort
Personenverzeichnis
Weitere Literatur zum Thema Missbrauch
Vorwort
Der Missbrauch, vor allem von Kindern, ist endlich kein Tabuthema mehr. Die sexuellen, physischen und psychischen Übergriffe Erwachsener an ihren Schutzbefohlenen skandalisieren uns mit Recht: den Campingplatz Lügde, die Odenwaldschule, die Regensburger Domspatzen, Fußballvereine in England, Sportclubs in Australien – es gibt so viele Beispiele, und wir wissen alle, dass jeden Tag noch mehr zum Vorschein kommen kann.
Dieses Buch geht weiter. Es handelt davon, dass Missbrauch in seinen vielen hässlichen Gesichtern auch in der sogenannten heilen Familienwelt vorkommt, täglich und immer wieder. Das bringt vielleicht nicht die großen Schlagzeilen, ist aber nicht minder verwerflich.
Mittlerweile haben auch Therapeuten und Juristen den Missbrauch als mögliche Ursache von Krankheiten und Fehlverhalten erkannt, z. B. wenn sie in der Familiengeschichte der Betroffenen eine Verwirrung der Rollen und eine Verwischung der Grenzen zwischen den Generationen feststellen; oder sich wiederholende Depressionen, für die man bisher keine Ursachen hatte feststellen können.
Denn der Missbrauch an einem Kind wirkt auch im Erwachsenen fort und kann sich wiederholen, besonders in dessen Liebesbeziehungen. Deshalb ist es für den Therapeuten wichtig, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten. Diese Gefahr hat Prof. Irvin Yalom, der vielleicht bedeutendste lebende Vertreter der existenziellen Psychotherapie, in seinem Roman „Die rote Couch“ angesprochen: „Sollten fürsorgliche Therapeuten ihre Patienten je berühren oder in den Arm nehmen? Welche sexuellen, sozialen, geschäftlichen, finanziellen Grenzen einer therapeutischen Beziehung sind angemessen? Diese heutigen Sorgen sind nicht nur komplex und von entscheidender Bedeutung: Sie sind auch hochbrisant.“
Meine Romanfigur, der Psychotherapeut Dr. Felix Janus, ist auch nur ein Mensch. Einer mit mehreren Gesichtern. Er schafft es nicht, Grenzen zu respektieren und die Beziehung mit seinen Patienten nicht mit Erotik zu besetzen.
Aber es gibt Therapeuten wie Dr. Noël in meinem Roman, und Alice Miller und Renate Magnier in der Realität, die Opfer und Täter nicht mehr durcheinanderbringen. Und uns helfen, die Geister der Vergangenheit herauszufordern und schließlich zu besiegen.
Karin Bohr- Jankowski
Burgund, im September 2020
Reden ist Gold – Schweigen war gestern!Goran Mijuk, 2013
Buch 1 Glaube
Prolog
Als er an dem Nachmittag des elften Juli 1991 Henry aus dem Schlafzimmer seiner Schwester hatte kommen sehen, muss er gewusst haben, was los war.
Cathy weinte. Und Henry grinste.
Cathy hat es mir wieder und immer wieder erzählt.
Wie Steven ihn gepackt und gegen die Wand gedrückt hatte. Keiner von beiden sagte ein Wort. Sie waren gleich groß. Der eine sechzehn, der andere Ende achtzig. Henry hatte keine Chance. Sein Kopf schlug auf wie eine reife Melone. Aber er schüttelte sich nur und lachte. Immer lauter.
Als Cathy die zwei trennen wollte, sagte er: „Das traust du dich nie, Stevie!“
Und dann schlug Steven zu. Mit dem ersten, was ihm in die Hand kam: dem kleinen Silberpokal. Seinem ersten. Immer und immer wieder.
Wir haben Henry dann zusammen weggeschafft. Schade, dass es keine Schweine mehr gab.
Wir mussten ihn vergraben.
Kapitel 1.1
Mutprobe
„Warum aufstehen?“
Es gab Tage, an denen Alice das nicht konnte. Geschweige denn, bis zum Fenster gehen, die Läden aufmachen und das gleißende Sonnenlicht der Provence zu sich hereinlassen. An solchen Tagen gingen ihr immer dieselben Fragen durch den Kopf, und wenn ihr keine Antwort einfiel, konnte die Lawine sie ganz schnell überrollen: „Warum sich bewegen? Warum atmen?“
Heute aber war alles gut; sie hatte ihren Grund aufzustehen. Nicht so wie die meisten Menschen um sie rum, die jeden Morgen aus den Federn kriechen, um ihr täglich Brot zu verdienen und vielleicht sogar noch mehr.
„Nicht jedem geht es so gut wie dir, und er kann von den Reserven leben“, bekam sie oft zu hören.
Wenn damit Geld gemeint war, musste sie den Leuten recht geben. Dank der großzügigen Unterstützung ihres Freundes Claude Fuentes hätte sie die Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen. Aber sonst – nein, sonst hatte sie keine Reserven. Nicht mehr!
„Soll ich zuerst aufstehen und den Laden aufmachen – die erste Mutprobe des Tages – oder mir überlegen, was ich anziehen soll? Anziehen, auch so eine Herausforderung; obwohl – im Sommer ist alles einfacher. Dann aber das Duschen, Zähneputzen, Frühstücken – nein, besser umgekehrt: Zuerst frühstücken, dann die Zähne putzen, oder? Verdammt – es ist wirklich nicht einfach, einen Tag anzufangen.“
Alice hielt gerne Selbstgespräche, und Dr. Noël meinte, das sei okay. Sogar, dass sie im Spiegel manchmal das kleine Kind sehen würde oder den Teenager. Und auch, dass die mit ihr sprächen ... Angeblich kein Problem! Aber warum fiel ihr der Beginn des Tages immer noch so schwer? Warum ließ sie sich von leidigen Kleinigkeiten einschüchtern? Das alles würde sie ihn heute fragen.
Sie strich sich gedankenverloren mit der Hand durch die kastanienbraunen Locken. Gut, dass sie wieder die Haare so kurz trug. Sonst wäre auch das Bürsten der verknoteten Nachthaare noch zu bewältigen. Genauso hatte sie ihre Haare auch als Kind getragen. Aber daran wollte sie jetzt auf keinen Fall denken. Viel wichtiger war doch die Entscheidung, was sie heute anziehen sollte.
Wenn sie zu Hause bleiben würde, könnte sie wie gestern rumlaufen – mit quasi nichts an. Bei über 30°C im Schatten lief sie am liebsten in den alten Leinennachthemden rum, die sie im Trödel kaufte. Aber heute musste sie nach Aix. Heute war Gruppentherapie bei Dr. Noël. Und da konnte sie nicht auftauchen, wie sie wollte, sondern so, wie man es von ihr erwartete.
Schon überschlugen sich wieder die Gefühle ... aber dann fiel ihr ein, was sie anziehen könnte: das rote Kleid. Das kam am nächsten an „nichts anhaben“ ran und sah trotzdem nicht zu ausgezogen aus für die Gruppensitzung. Oder doch?
„Weißt du eigentlich, dass man deine Brustspitzen sieht – in dem roten Wickelkleid?“, hatte eine Freundin sie vor vielen Jahren gefragt. Sie hatte es nicht gewusst und war fürchterlich erschrocken: Wieder was falsch gemacht! Und dann kam die Scham. Das war damals. Da hatte sie noch mehr Angst als heute. Warum musste sie ausgerechnet jetzt an diese Geschichte denken? Vielleicht wegen des BHs? Sie durfte heute auf keinen Fall vergessen, einen anzuziehen ... Was für ein Aufwand!
Und dann die Strecke – 45 Minuten Autobahn. Obwohl ..., die Landschaft war doch wirklich schön: der Fluss, die Berge, die Weinfelder. Aber dann das anstrengende Hin- und Hergerede mit den anderen. Obwohl ..., die brachten einen auch schon mal zum Lachen. Und ohne die Therapie käme sie ja gar nicht mehr aus dem Haus; hätte auch nie so viele Leute kennengelernt. Auch wenn die alle ziemlich schräg waren.
„Obwohl ..., was denken die erst über mich?“
Beim Anziehen kamen ihr Erinnerungen an die ersten Therapiestunden. Damals waren es noch Einzelgespräche. Nur sie und Dr. Noël. Trotzdem hatte sie immer Angst davor gehabt. Angst, irgendwas falsch zu machen, etwas von dem zu vergessen, was der Doktor ihr Relevantes gesagt oder was sie im Gespräch Wichtiges entdeckt hatte. Nach ihren 45 Minuten in der Rue du Temple wollte sie immer schnellstmöglich wegkommen; einfach nur um die nächste Straßenecke, sich dort hinhocken und alles notieren, bevor es wieder weg war: in denselben Nebel zurück wie die anderen Erinnerungen.
Irgendwann entdeckte sie ein paar Meter weiter das Bistro Chez Bruno, und nach einem Jahr hatte sie sogar den Mut, sich an den äußersten Tisch der Terrasse zu setzen, einen Espresso zu bestellen und dann erst alles aufzuschreiben. Das war bequemer als auf einer Gartenmauer, und bei Bruno wurde sie auch nicht so blöd angeschaut.
An guten Tagen wusste sie, dass man ihr die Unsicherheit nicht ansah. Sie war groß und schien auf den ersten Blick viel sportlicher, als sie eigentlich war. Auf einige wirkte sie arrogant, auf andere unnahbar. Das war okay für sie. Hauptsache, die Leute ließen sie in Ruhe.
* * *
Der Termin in Aix war einfach zu behalten: Jeden ersten Mittwoch im Monat, von 14 bis 16 Uhr.
Im Rausgehen warf sie wie immer noch einen Blick in den riesigen Spiegel in der Diele und hätte fast selbst die Frau aus dem Bett nicht wiedererkannt.
Das tiefausgeschnittene Kleid umspielte ihre Figur wie eine zweite Haut und betonte die nahtlose Sonnenbräune ohne Scham. Das sinnliche Rot ihres Lippenstifts passte zu allem, sogar dem Nagellack an Fingerspitzen und Füßen. Und die weißen Sandaletten zum weißen Strohhut, den sie noch in der Hand hielt. Sogar die Ohrringe, zwei weiß-rote Spiralen – alles passte. Sie versank in ihrem Spiegelbild und dachte an das kleine Mädchen mit den kurzen Haaren. Fast hätte sie sie vergessen. Dabei wollte sie doch heute den anderen in der Gruppe etwas aus ihrer Kindheit erzählen. Wenn sie Mut genug hätte.
Vielleicht – warum sie sich dann doch die Haare hatte wachsen lassen. Damals!
Das schrille Klingeln des Haustelefons riss Alice aus ihren Gedanken. Ein hastiger Blick auf die alte Standuhr verriet ihr, dass sie gut in der Zeit lag. Sonst hätte sie den Anrufbeantworter die Arbeit machen lassen. Aber als sie sah, wessen Nummer da aufleuchtete, freute sie sich sogar. Nicht ganz so wie früher, aber genug, um dranzugehen.
„Claude, du hast Glück, ich bin eigentlich schon weg. Heute hab ich doch Sitzung. Hast du das vergessen?“
„Pardon, Liebling. Klar, wie konnte ich den Termin vergessen? So ein Monat ist aber auch in null Komma nichts vorbei. Prima. Wenn du eh auf dem Weg nach Aix bist, können wir uns später bei mir treffen. Komm zum Kaffee in die Kanzlei. Dann kann ich dir die Sache besser erklären als jetzt am Telefon. Du bist doch bestimmt in Gedanken schon unterwegs. Küsschen.“
Noch ehe sie antworten konnte, hatte Claude schon aufgelegt. Alice stand wie benommen in ihrer schönen Diele und fühlte sich – abgehängt. Nein, viel schlimmer – bevormundet.
Er hatte ihr noch nicht mal die Chance gegeben, ihre Meinung zu sagen, vielleicht sogar zu widersprechen. Er wusste doch genau, dass sie normalerweise nach ihrer Sitzung zurück nach Hause wollte. So schnell wie möglich. Seit ein paar Monaten kehrte sie noch nicht mal mehr bei Chez Bruno ein, um sich Notizen zu machen.
Dr. Noël hatte sie nämlich davon überzeugen können, dass Therapie nicht so funktionierte.
„Lassen Sie einfach Ihr Inneres arbeiten. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie sich an alles erinnern. Es wird kommen. Haben Sie Vertrauen zu sich selbst. Hören Sie auf, alles aufzuschreiben. Das setzt Sie zusätzlich unter Druck. Glauben Sie mir.“
Und Alice hatte ihm geglaubt, und die Erinnerung war gekommen. Seitdem ließ sie ihr Unterbewusstsein arbeiten und ruhte sich öfter mal aus. Das funktionierte nicht immer, aber immer häufiger.
„Merde, warum hat Claude nicht gesagt, warum er angerufen hat? Warum soll ich im Büro vorbei? Was lässt sich besser in der Kanzlei erklären? Sonst ruft er nie um diese Uhrzeit an. Er weiß genau, dass ich diese Geheimnistuerei nicht ausstehen kann.“
Und plötzlich war sie da; sie kam wie immer aus dem Spiegel geklettert: das kleine Mädchen mit den kurzen Haaren, in ihren schmutzigen weißen Shorts und der zerknitterten roten Bluse.
Sie nahm Alice ganz selbstverständlich bei der Hand und zog sie langsam Richtung Auto.
* * *
Als er das Klingeln hörte, zuckte er schuldbewusst zusammen. Er hatte schon wieder an den Nägeln gekaut. So langsam sollte er sich zusammenreißen und sich an den Klingelton und so vieles andere gewöhnen. Vielleicht könnte er aber auch eine andere Melodie finden. Und ein Sekretariat wäre auch nicht schlecht. „Praxis Dr. Noël, Dr. Janus am Apparat, was kann ich für Sie tun?“
„Ich möchte mit Dr. Noël verbunden werden. Ich rufe aus der Jugendvollzugsanstalt an. Sagen Sie bitte Dr. Noël, es gehe um Patrice Dufee.“
Dr. Janus holte tief Luft; irgendwann musste das erste Mal sein. Warum also nicht jetzt? Er räusperte sich und sprach in die Muschel des alten Telefons: „Hören Sie? Mein Name ist Dr. Janus; ich bin die Vertretung von Dr. Noël, voraussichtlich für die nächsten sechs Monate. Dr. Noël hatte einen Schlaganfall.“
Für kurze Zeit war die Leitung tot, und Dr. Janus, der mit solchen Reaktionen durchaus gerechnet hatte, wollte schon wieder auflegen.
„Hallo, sind Sie noch dran?“, fragte die Stimme.
„Schon, aber Sie wohl nicht.“
Geduld gehörte nicht zu den Stärken von Dr. Janus. Und überhaupt, diese Vertretungskiste ging ihm jetzt schon auf die Nerven. Er war schließlich eine international anerkannte Kapazität. Nur, weil er ein Sabbatical in seiner Heimat angetreten hatte, mussten die ihn doch nicht gleich dienstverpflichten. Aber „Nein“ sagen war ihm immer schon schwer gefallen. Er wusste bis heute nicht, wer ihn vorgeschlagen hatte. Alles musste wohl mal wieder schnell-schnell gehen. Und das französische Gesundheitssystem hatte sich in den letzten zehn Jahren, in denen er in England praktiziert hatte, nicht unbedingt verbessert.
„Entschuldigen Sie. Vielleicht können wir das Gespräch einfach neu anfangen. Sie müssen verstehen ... das mit dem Schlaganfall von Dr. Noël... das ist ja schrecklich. Wie geht es ihm? Wird er es überstehen?“
„Meinem Kollegen geht es den Umständen entsprechend gut. Er hatte Glück, dass er sofort ins Krankenhaus kam. Die Ärzte hoffen sogar, dass die Lähmungen teilweise zurückgehen. Aber vielleicht könnten Sie mir jetzt sagen, wer Sie sind und was Sie wollen?“
„Pardon, ja klar. Mercier, ich bin der Leiter der Jugendvollzugsanstalt Aix, in der Dr. Noël einmal die Woche praktiziert. Sowohl Einzelals auch Gruppentherapien. Einige wenige unserer ...“ Mercier suchte offensichtlich nach der korrektesten Bezeichnung.
„Klienten, wir sprechen von Klienten.“
„Ja, danke. Einige wenige Ihrer Klienten ...“
Dr. Janus konnte ein Lachen nicht mehr zurückhalten: „Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, Monsieur Mercier, aber noch sprechen wir von Ihren Klienten, oder?“
Janus liebte es, Menschen aus der Reserve zu locken. Und er wollte Mercier gleich zu verstehen geben, dass er, Dr. Felix Janus, ein anderes Kaliber war als der alte Noël.
Aber der Typ aus der JVA redete unbeeindruckt weiter: „Nach ihrer Entlassung haben einige wenige die Therapie noch weitergeführt. Bei Dr. Noël. Der hat einen besonderen Zugang zu den jungen Leuten; der ist echt gut, der versteht sein Handwerk.“
Janus entschied sich, nicht darauf einzugehen und abzuwarten, wie Mercier sich verhalten würde. Aber der schien nichts zu merken.
„Da ist nun der Fall von Patrice Dufee. Der soll heute um 14.00 Uhr zum ersten Mal zu ... einer Ihrer Gruppensitzungen kommen.“
Janus ließ Mercier gerne noch weiter zappeln. Jetzt hatte er ihn, wo er ihn haben wollte, denn der fragte nun vorsichtig: „Hallo? Sind Sie noch dran? Ich glaube, wir sind unterbrochen worden ...“
Was für ein Dilettant! Es wurde Zeit, dem Gespräch ein Ende zu setzen. Also donnerte Janus los: „Auf gar keinen Fall. Wie stellen Sie sich das vor? Ich weiß überhaupt nicht, ob er in die Gruppe reinpasst. Wenn überhaupt, kann er in vier Wochen dazukommen. Wissen Sie was, wir kürzen das jetzt alles an dieser Stelle mal etwas ab, und Sie sagen Monsieur Dufee, er soll sich bei mir melden – telefonisch – und einen Termin zum Kennenlernen ausmachen. Danach werde ich entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und wenn ich das richtig sehe, ist Monsieur Dufee ja auch aus Ihrer Kompetenz raus – sobald er heute entlassen wird.“
* * *
Mercier hätte am liebsten den Hörer aufgelegt. Sein Anfangsverdacht verstärkte sich zunehmend: Die Vertretung von Dr. Noël hatte doch wohl selbst ein dickes Problem – oder auch zwei; auf jeden Fall, eins davon mit ihm. Er versuchte, sich zu beruhigen und einen letzten Versuch zu starten, diesen Janus zu überzeugen, dass Dufee heute fest mit einem Termin rechnete, und wie wichtig der für ihn wäre. Vielleicht, dass er bis in einem Monat, zur nächsten Sitzung, sogar abspringen würde und ein Einzelgespräch mit dem neuen Doc erst gar nicht führen wollte.
Aber Dr. Janus gab ihm keine Gelegenheit für weitere Erklärungen. Das letzte, was Mercier von ihm hörte, war ein ziemlich kaltschnäuziges: „Entschuldigen Sie, ich habe ein Gespräch auf der anderen Leitung. Geben Sie einfach Monsieur Dufee meine Nummer; ich erwarte seinen Anruf. Au revoir.“
Mercier war sich sicher, dass das „auf Wiedersehen“ nicht wörtlich gemeint war. Und da niemand außer ihm in seinem Büro war, beendete er das Gespräch in aller Form mit dem leeren Besucherstuhl vor seinem Schreibtisch: „Ich hätte Ihnen gerne noch etwas mehr über Ihren zukünftigen Klienten gesagt. Aber ich verstehe, dass ein guter Therapeut sich lieber selbst ein Bild macht. Ich wünsche Ihnen ebenfalls alles Gute. Und bitte, bleiben Sie nicht in Verbindung.“
* * *
So kam es, dass Dr. Janus weder von der Tatsache erfuhr, dass Patrice Dufee wegen schwerer Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung eingesessen hatte, noch davon, dass er unter multipler Persönlichkeitsstörung litt und daher nicht alleine zur Therapie kommen würde!
* * *
Dr. Janus wusste ganz genau, dass das Gespräch mit diesem JVA-Typen schlecht gelaufen war. Er hatte sich nicht im Griff gehabt. Mal wieder nicht diese für ihn so schwierige Balance geschafft zwischen genügend Distanz und ein wenig Empathie. Manchmal fragte er sich, ob er den richtigen Beruf gewählt hatte. Für sich auf jeden Fall, aber nicht unbedingt für seine Klienten. Zu denen fehlte ihm doch so manches Mal der Bezug. Einige stießen ihn schon rein körperlich ab. Allein der Gedanke an den einen oder anderen ... er bekam schon Gänsehaut. Er sah sie genau vor sich: Den 140 Kilo Typ in London; die alte Frau, die aussah und roch, als käme sie von der Müllkippe.
Wie geschickt hatte er es immer angestellt, sie während der Therapiestunden nicht direkt anzuschauen; das ließ sich leicht arrangieren. Da war er gut drin. Und nicht nur darin. Er wusste sogar, wo SEINE Phobie herkam.
„Du sollst nicht so viel in dich reinstopfen, Felix. Zwei éclairs sind nun wirklich genug – oder willst du etwa so dick werden wie papa?“
Er liebte die Stimme von maman – egal, was sie sagte.
Die größten Beschimpfungen aus ihrem Munde waren leckerer als die dicksten Küsse von papa. Und wie gut sie roch. Von oben bis unten nach ... Das änderte sich in der Phantasie von Dr. Janus je nach Stimmung. Manchmal sah und roch er sie umrankt von tausend kleinen weißen Jasminblüten. Oder weißen Lilien. Oder dem schweren Parfum überreifer Orchideen. Er suchte ihren Geruch sehr oft, und manchmal fand er ihn. Nicht immer an den feinsten Orten.
Warum hatte sie ihn auch alleine gelassen? Dann müsste er nicht in solche Etablissements gehen. Aber das Leben ist voller Ungerechtigkeiten; und das hatte der kleine Felix schon früh gelernt. Was wäre seine Mutter stolz auf ihn: Er hatte ein tolles Studium geschafft. Anerkannter Psychologe, Dissertation und zahlreiche Veröffentlichungen. Und er achtete immer noch brav auf seine Figur. Nur nicht so werden wie papa!
Sobald er etwas zu viel um die Mitte ansetzte, ekelte er sich vor sich selbst und unterwarf sich drakonischsten Diäten. Mit dem Resultat, dass er sich mit seinen fünfundvierzig Jahren sehr gut sehen lassen konnte. Dazu die halblangen, fast schwarzen Haare, in denen erste graue Fäden aufblitzten; aber Mutter hätte sicherlich nicht die Strähne gefallen, die er sich gerne mal über die Augen fallen ließ: Egal – er hatte, was er bei anderen de la classe nannte und pflegte sie akribisch.
Schon wieder klingelte das Telefon; aber dieses Mal erschrak er nicht. Den Klingelton kannte er nur zu gut. Das war sein privater: Frank Sinatras Strangers in the Night.
Felix liebte die USA – überhaupt alles Anglophone. Er hatte einige Semester in Oxford studiert und danach ein Praktikum in den Staaten absolviert. Seitdem träumte er davon, in New York zu praktizieren. Von den paar Euros, die er in Aix für die Vertretung von Dr. Noël bekam, konnte er kaum seine Klamotten bezahlen, geschweige denn, seine Lieblingsrestaurants so regelmäßig besuchen, wie er es gerne getan hätte. Aber von ein paar hundert Dollar, die EINE Therapiestunde in New York kostete – irgendwann schon!
Sichtlich besserer Laune, nahm er das Telefonat entgegen und fragte mit allem Charme, den er von maman geerbt hatte:
„Hello, Janus hier – wer spricht?“
„Hey, Felix, altes Haus. Wie ich gerade von einem mürrischen Kollegen von dir gehört hab, bist du gar nicht mehr in Oxford. Was treibst du Buntes?“
Dr. Janus brauchte nicht lange, um DIE Stimme zu erkennen. Ein guter Freund aus England. Am Anfang war die Beziehung nicht ganz unproblematisch, weil Steven sein Patient war. Aber mit der alten Schule, von wegen kein Verhältnis, egal welcher Art, mit einem Klienten anfangen, hatte Dr. Janus nie was am Hut gehabt. Warum hätte er Regeln respektieren sollen, an die sich noch nicht mal Freud und Jung halten konnten. Auf jeden Fall nicht immer.
„Mensch, Steven, schön, von dir zu hören. Das muss ein Jahr her sein, wenn nicht länger. Du hörst dich verdammt nah an. Von wo rufst du an?“
„Du wirst es nicht glauben. Ich bin gerade in Marseille gelandet und stolpere, wie gesagt, über diesen Typen, mit dem du mal die Praxis geteilt hast. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Du weißt schon, der mit dem kahlrasierten Schädel und dem Schnurrbart.“
„Oh Gott, Steven, du meinst doch nicht etwa Sir James. Ist er gerade angekommen, oder war er Richtung England unterwegs?“
„Keine Sorge, Sweetheart. Er war auf dem Rückweg nach good old England. Und hatte wohl nach zwei Wochen Frankreichurlaub die Schnauze gestrichen voll von den froggies. Er ist doch immer noch derselbe alte Chauvi. Klar; jetzt kann ich mich an den Spitznamen erinnern. Sir James. Egal, vergiss ihn. Wichtig war nur, dass er mir von deinem Sabbatjahr erzählte, und dass du mal wieder in der Provence seist. Eine Tatsache, die ihm so was von abzugehen scheint. Wie hat er so schön gesagt?
Dazu muss man wohl in Frankreich geboren sein, um über den ganzen Dreck hinwegsehen zu können. Ich sag nur: die Toiletten! Die Bürgersteige!“
Steven konnte die Stimme so gut imitieren, dass Janus sich vor Lachen verschluckte.
„Steven, hör auf, ich kann nicht mehr. Und das im doppelten Sinn. Ich hab um 14 Uhr meine erste Therapiesitzung für die Woche und hab noch keinen Fatz vorbereitet. Wie lange bleibst du in der Gegend? Wir müssen uns unbedingt sehen.“
„Ich muss übermorgen wieder weg. Morgen hab ich einen Notartermin in Aix. Wie wärs mit heute Abend?“
„Mensch, das tut mir leid. Aber um sieben hab ich Tango und du weißt, dass ich den nie ausfallen lasse. Wie wärs mit einem frühen Apéro gegen fünf? Bei mir um die Ecke gibts ein kleines Bistro, Chez Bruno, das ist ganz okay.“
„Dann musst du mir nur noch erklären, wo bei dir um die Ecke ist.“
„Meine Praxis ist in einer kleinen Nebenstraße hinter dem Bahnhof. Nicht gerade die erste Adresse von Aix, aber ich mach hier ja nur Vertretung. Die Bar liegt an der Ecke Rue de la Masse direkt am Cours Mirabeau; ganz einfach zu finden. Wenn es Probleme gibt, ruf an.“
„Okidoki! Bleib sauber, Felix, und denk dran: Finger weg von den Klienten!“
* * *
Alice parkte, wie immer, wenn sie zu Dr. Noël fuhr, am liebsten an der Uni. Das gab ihr Sicherheit. Nicht wie am Bahnhof, da wurde sie schon ein paar Mal angequatscht. Und das brachte sie zur Raserei. Der Stellplatz an der Uni lag ideal für sie. Direkt hinter dem Haupteingang, fast neben der Pförtnerloge, die sogar am Mittwochnachmittag besetzt war.
Den Platz hatte ihr Marie besorgt; eine Frau, die mit ihr in derselben Gruppentherapie und Lehrbeauftragte an der Faculté de droit war. Meist wartete Marie schon am Parkplatz auf sie, und dann gingen sie gemeinsam in die Rue du Temple. So auch heute.
„Salut, Alice. Geht es dir heute so gut wie du aussiehst, oder ist das eine ganz besonders ausgefeilte Art der Tarnung?“, rief Marie ihr mit ihrer schrillen Stimme zu, an die sich Alice nach all den Jahren noch nicht gewöhnt hatte. Sie schätzte die direkte offene Art von Marie sehr.
„Irgendwann werde ich es schaffen, genauso cool und taff zu sein wie Marie und nicht so angepasst und brav wie ... MAN es von mir erwartet.“
Das sagte sie sich oft. Und wenn Alice mal wieder von irgendjemandem oder irgendwas getriggert wurde, konnte ihre Stimme sich genauso überschlagen wie die von Marie. Sonst gab es eigentlich wenig Ähnlichkeiten.
„Und du, Marie? Ein echter Hingucker. Grün ist die Schminke der Roten, was? Das Kleid passt echt toll zu deinem Haar. Aber meinst du nicht auch, dass wir es mit den Décolletés heute etwas zu gut meinen für den armen Dr. Noël? In seinem Alter – nicht, dass er uns einen Herzkasper kriegt. Man könnte meinen, wir wollten ihn verführen. Hoffentlich hat sich wenigstens Isa heute etwas dezenter angezogen.“
„Isa und dezent? Der Sommer ist doch die einzige Jahreszeit, in der sie endlich alle ihre Tattoos zeigen kann.“
Alice verdrehte die Augen, und Marie schnitt ihr eine Grimasse: „Okay – fast alle!“
Die beiden liefen lachend Richtung Bahnhof. Ein lustiges unbeschwertes Duo für jeden Außenstehenden. Zwei Frauen, denen man die pure Lebensfreude ansah – eine perfekte Fassade.
Sie trafen Isa an der Eingangstür zur Praxis. Marie hatte recht behalten. Der kurze Short ließ nach unten die Beine etwas länger erscheinen, und nach oben war Platz genug zwischen Top und Oberkante, das kleine glitzernde Kunstwerk um den Nabel voll zur Geltung zu bringen. Sie hatte eine jungenhafte Figur und fast keinen Busen. Das alles sah man heute ganz genau. Und noch viel mehr!
„Salut, ihr zwei. Was für ein Tag! Viel zu schade, um zwei Stunden eingesperrt zu verbringen. Vielleicht könnten wir Noël überreden, mit uns in den Park zu gehen. Irgendein ruhiges Eckchen wird sich doch bestimmt finden lassen, was meint ihr?“
Alice zögerte. Sie traute sich ja schon kaum, in einem geschlossenen Zimmer zu reden. Draußen in freier Natur, wusste sie, würde sie kein Wort rauskriegen. Aber sie wollte Isa nicht die Laune verderben.
„Ist Michel auch schon da? Dann wären wir komplett und könnten abstimmen. Noël hat bestimmt nichts dagegen.“
Isa war begeistert von ihrer Idee und stürzte als Erste in das Sitzungszimmer.
Aber dort erwartete sie nicht wie üblich Dr. Noël in seinem Sessel, sondern ein äußerst unzufrieden dreinblickender Michel – und ein Neuer.
In seinen weißen Lacoste Bermudas mit passendem Hemd sah der auf den ersten Blick ganz attraktiv aus: ziemlich groß und eher schlank. Die glatten dunklen Haare, die er mittellang und schick geschnitten trug, strich er sich alle paar Minuten nervös aus den Augen. An ihm war irgendwas Weibliches. Sie versuchte herauszufinden was. Bestimmt nicht die zusammengewachsenen Augenbrauen; die passten so gar nicht zu dem sonst so gepflegten Äußeren. Es war vielmehr seine Art, sich zu bewegen. Geschmeidig. Flüssig. Als würde er tanzen und dabei versuchen, so wenig wie möglich den Boden zu berühren.
Mal ganz was anderes, dachte sich Isa. Irgendeine Macke haben wir schließlich alle hier, sonst bräuchten wir ja keine Therapie.
Kapitel 1.2
Alles war anders ...
... und trotzdem wie zuvor. Das konnte eigentlich nicht sein. Dieselben hohen, nicht mehr ganz sauberen Wände, die nach ungefähr vier Metern in eine etwas bröckelige Stuckdecke übergingen. In der Mitte die Rosette mit den kleinen Engelchen, wie in einer Barockkirche. Auch die Farbe stimmte: das warme provençalische Gelb. Dazu die schweren Vorhänge mit den verblassten Sonnenblumen. Ab dann aber war alles verkehrt: Das Zimmer bot keinen Schutz mehr. Die grellen Strahlen der Sonne überfluteten es mit Licht und Hitze. Sogar der alte Parkettboden knarrte anders – nicht mehr an denselben Stellen.
Wieso standen die Stühle an der Wand und nicht im Kreis? Zwei üppige Palmen versperrten den sonst freien Weg zum Fenster. Und links davon, die kleine Kaffee-Ecke, war doch auch neu, oder? Die ganze Atmosphäre war anders. Alice wurde immer unruhiger und teilte die Neugierde von Isa und Marie an dem neuen Mann in ihrer Runde überhaupt nicht.
Wenn nicht gerade in diesem Moment Michel losgepoltert hätte, wäre sie sofort aus dem Zimmer gerannt. Das war nicht mehr ihr Zimmer. Irgendetwas ganz Schlimmes musste geschehen sein; da war sie sich nun sicher.
„Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Uns alle kommen zu lassen, als sei nichts passiert. Wir sind hier ja nicht irgendwo ...“
Michel suchte nach Worten, kniff die Augen zusammen und drückte sich plötzlich den Zeigefinger an seine linke Schläfe.
„Jetzt krieg ich auch noch ‘ne Migräne. Kann denn nicht endlich mal jemand die Vorhänge zuziehen? Das ist doch nicht zum Aushalten!“ Michel sah sich verzweifelt im Raum nach Hilfe um, aber alle schienen wie festgefroren – trotz der drückenden Hitze.
Den Neuen schien die Situation nichts anzugehen; auf jeden Fall fühlte er sich von dem Typ mit dem lustigen Akzent nicht angesprochen. Im Gegenteil; mit gesenktem Blick und beiden Händen fest in den Hosentaschen, schlenderte er zu den weißen Rattanstühlen. Blieb kurz davor stehen, als wolle er sie zählen oder sich überlegen, ob er sich setzen sollte oder nicht. Dann drehte er sich langsam um und ließ sich auf den mittleren Stuhl fallen. Erst dann schaute er in die Runde und lächelte einen nach dem anderen an.
Niemand sagte ein Wort – noch nicht einmal Michel. Marie war die Erste, die sich aus ihrer Starrheit befreite, langsam zu den Fenstern schritt und einen Vorhang nach dem anderen zuzog. Isa bewegte sich als Nächste, indem sie Anstalten machte, auf Michel zuzugehen, der immer noch in der Mitte des Zimmers stand. Sie entschied sich dann aber anders: Mit höchster Konzentration ließ sie sich auf den Boden gleiten, faltete ihren kleinen Körper in einen perfekten Lotussitz und – verschwand in sich selbst.
Für Alice, die bis dahin die Inszenierung beobachtet hatte, wie eine Ballettstudie, die ihr aber überhaupt nicht gefallen wollte, wurde es Zeit, sich zu entscheiden. Sie holte tief Luft, drehte sich auf ihrem Absatz Richtung Tür – und just in dem Moment stand der Neue wieder auf und eine weiche, fast feminine Stimme erklärte: „Mein Name ist Felix. Dr. Felix Janus. Bitte bleiben Sie doch hier.“ Mit diesen Worten ging er auf Alice zu und berührte sie leicht am Arm. „Ich soll Ihnen Grüße ausrichten, von Dr. Noël , allen von ihnen.“
Zuerst zuckte Alice zusammen. Wie konnte er es wagen, sie anzufassen? „Nimm deine dreckigen Pfoten weg oder ich ...“
Aber Alice ließ das Mädchen nicht ausreden. Niemand außer ihr konnte die Stimme hören. Und das war gut so. Sie spürte, wie die anderen sie beobachteten, die Luft anhielten und sich sicherlich fragten, wie sie heute reagieren würde. Keine Angst. Heute war immer noch ein guter Tag.
Also ließ sie die Berührung nicht nur geschehen, sondern folgte Dr. Janus wie ein braves kleines Kind, das seinen Mut verloren zu haben schien, zurück ins Zimmer. Der einzige, der nichts von der Gefahr merkte, in der er sekundenlang geschwebt hatte, war Dr. Janus selbst.
„Wollen Sie sich nicht alle setzen? Ich erkläre Ihnen gerne die neue Situation. Setzen Sie sich, wohin Sie wollen. Wie Sie wissen, sind die Stühle frei beweglich. Wenn Sie eine Erfrischung wünschen, bitte bedienen Sie sich.“
Er wartete, bis jeder seinen Platz gefunden hatte: Marie überlegte kurz, ... ging auf Dr. Janus zu, ohne ihn aus den Augen zu lassen, suchte sich genau den Stuhl neben ihm aus – und zog ihn unter eine der Palmen. Michel platzierte den seinen lautstark mit dem Rücken zur Fensterfront; Isa blieb da, wo sie war, und Alice zog ihren Stuhl zurück – in die Nähe der Tür.
Jetzt hatte Dr. Janus die Aufmerksamkeit der Vier. Alles funktionierte wie geplant. Die Neugierde ist ein hungriges Tier in jedem Menschen; das wusste er nur zu gut. Aber er wusste auch, dass es darauf ankommen würde, ihr Vertrauen zu gewinnen; wenn er es jetzt nicht schaffte, dann nie mehr – nicht mit dieser Gruppe.
„Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Das ist keine einfache Situation – für keinen von uns. Ich bekam selbst erst gestern die Nachricht, dass ich die Vertretung von Dr. Noël übernehmen sollte. Mein Kollege hat am Wochenende einen Schlaganfall erlitten.“
Von der Tür aus hörte er einen kurzen unterdrückten Aufschrei und eine Art Quieken von der Frau am Fenster. Der Mann mit Migräne fing an, mit seinem Kopf zu nicken – unaufhörlich, wie diese chinesischen Glücksbringer.
Niemand aus der Gruppe hielt Blickkontakt oder sagte etwas. Jeder analysierte die Information für sich. Schweigen ist Teil jeder Therapiestunde, das wussten sie alle, und Dr. Janus ließ ihnen Zeit.
Die Frau am Boden brach als Erste das Schweigen. Das hätte er nicht gedacht, so in sich versunken, wie sie schien. Auf den ersten Blick wirkte sie selbstsicher und gar nicht so labil, wie es in ihrer Akte stand. Und sehr sexy. Obwohl sie sich redlich Mühe gab, ihren Körper zu verunstalten: Tattoos in allen Farben und Größen verteilten sich über mehr als die Hälfte ihrer freizügig zur Schau gestellten Nacktheit. Die zahlreichen Piercings an Nase, Ohren, Kinn und Bauchnabel ließen vermuten, dass es auch noch welche an den wenigen bedeckten Stellen ihrer zierlichen Gestalt gab. Und die Krönung der Abschreckung sollte wohl die Cherokeefrisur sein. Schade für das schöne Haar, dachte sich Felix, aber Haare wachsen ja nach – die Haut nicht. Die Frau schreckte ihn ab und faszinierte ihn zugleich. Er hörte nur ihre Stimme. Die Worte passten gar nicht dazu. Wie konnte das sein? Das melancholische Timbre seiner Mutter in so einem entstellten Körper. Surreal!
„... Sie hätten uns informieren müssen. Unsere Nummern haben Sie in den Akten. Wir sind alle freiwillig hier und können jederzeit gehen – hast du gehört, Alice? Er kann dich nicht zwingen, hier zu bleiben.“
Um ihre Lässigkeit zu unterstreichen, blies sie ihren Kaugummi zu einem Ballon auf und ließ ihn lautstark platzen. Marie klatschte in die Hände, und Alice konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
„Also können wir jetzt gehen?“, fragte der immer noch nickende Michel; und trotzdem blieb er sitzen.
„Selbstverständlich ist jeder frei, über die Fortführung seiner Therapie unter meiner Leitung zu entscheiden. Aber sehen Sie: Genau deswegen habe ich Sie nicht angerufen. Sie hätten sich alle ihre Meinung gebildet, ohne mich persönlich und die Art von Zusammenarbeit kennenzulernen, die ich Ihnen gerne anbiete. Es geht um die nächsten sechs Monate. Mindestens. Wenn nicht mehr. Auf jeden Fall wäre es eine zu lange Zeit, wenn Sie unterbrechen würden. Ich weiß nicht, welchen Vergleich Dr. Noël benutzt hat; ich vergleiche eine Therapie gerne mit einem Gärtchen, das in der therapiefreien Zeit mit Unkraut zuwächst. Je mehr freie Zeit – umso mehr ist zu jäten.
Entscheiden Sie selbst, aber entscheiden Sie in Ruhe, und am besten NACH der heutigen Sitzung.“
Er machte eine kleine Pause, als erwarte er jetzt schon eine Antwort. Doch niemand schaute auch nur in seine Richtung.
„Wissen Sie, was mich wundert? Wenn Sie doch alle so an Dr. Noël und seiner Methode hängen, warum hat mich noch niemand nach seinem Befinden gefragt?“
„Was sind Sie nur für ein Scheiß-Therapeut, dass Sie uns jetzt ein schlechtes Gewissen machen wollen? Bullshit. Sie haben uns hierher gelockt und versuchen, uns nach Strich und Faden zu manipulieren“, ließ sich der Punk wieder hören; und dieses Mal gar nicht so entspannt und ganz ohne Kaugummi. Also hatte er sich doch nicht getäuscht. Alles nur aufgesetzt. Alles nur Fassade.
„Ich weiß ja nicht, wie es den anderen geht, aber ich fühle mich so langsam ganz schön verarscht; und wissen Sie, warum ich noch bleibe? Mein Stiefvater hat immer gesagt, man soll gehen, wenn es am Schönsten ist – und ich hab den Verdacht, dass das für heute noch nicht der Fall ist.“
„Lass doch gut sein, Isa, er hat schließlich nicht ganz Unrecht. Sagen Sie uns doch endlich, was passiert ist und wie es Dr. Noël geht. Wird er wieder gesund?“
„Mensch, Alice lass dich doch nicht gleich einwickeln; merkst du nicht, auf was der raus will?“
Auch Michel wusste jetzt, was er von dem Ganzen zu halten hatte und meinte lakonisch:
„Früher war alles besser!“
Und wieder war Dr. Janus der Einzige, der nicht verstehen konnte, dass für Michel in diesen vier Worten die ganze Welt lag. Und heute passten sie ganz besonders.
„Wenn Sie mir etwas mehr Redezeit geben würden, meine Damen, könnte ich Ihnen so viel mehr erklären. Wir sollten uns einfach besser kennenlernen. Ich erzähle Ihnen, wer ich bin und Sie vielleicht, wer Sie sind und was Sie hierher geführt hat. Sie werden schnell merken, dass ich anders arbeite als mein Vorgänger, aber dafür nicht schlechter.“
Wieder hörte er diesen komischen Quiekser aus der Fensternische, und die Frau schrie ihn an:
„Also doch Nachfolger. Dr. Noël wird tatsächlich nicht mehr kommen. Lebt er überhaupt noch?“
Dr. Janus merkte, dass seine Geduld sich ihrer Toleranzschwelle gefährlich näherte. Er musste sich unbedingt bewegen, und sei es nur bis in die Mitte des Zimmers. Dort fing er an, sich langsam um die eigene Achse zu drehen, ein tibetanisches Allheilmittel. Und praktisch dazu: Er kehrte niemandem aus der Gruppe länger als nötig den Rücken zu. Und er konnte jeden einzeln und intensiv ansprechen.
„Dr. Noël geht es den Umständen entsprechend gut; die Ärzte gehen davon aus, dass er in sechs Monaten wieder auf den Beinen sein wird. Zu mehr Auskünften bin ich nicht berechtigt, wie Sie sicherlich verstehen. Okay?“
Er versuchte, Blickkontakt mit den Vieren zu halten, und diesmal gelang es ihm.
„Wie wäre es, wenn ich Ihnen zuerst mal was von mir erzähle?“
Bisher war er nicht unzufrieden mit seinem Ansatz für die heutige Sitzung. Er hatte fest damit gerechnet, dass der eine oder andere aufgeben und sich davonmachen würde. Wenn er es schaffte, eine Mindestgröße zusammenzuhalten, könnten die Vier eine gute Gruppe für sein Projekt abgeben. Er forschte seit über zehn Jahren an einem neuen Ansatz zur wahren Identität: Was hat uns zu dem gemacht, was wir sind, und noch wichtiger, was wir tun. Kann man in einer Gruppe diese Erkenntnis fördern – eventuell durch Teilnehmer, die als Katalysator oder Trigger für die anderen dienen? Laut Aktenlage von Dr. Noël schienen hier ein paar interessante Fälle versammelt. Ein guter Grund, auch von seiner Seite nicht so schnell die Geduld zu verlieren.
„Meinen Namen kennen Sie bereits. Ich bin am 15.03.1970 hier in Aix geboren. Vater, Franzose; Mutter, Engländerin. Daher meine Ausbildung und Berufserfahrung in beiden Ländern. Dazu habe ich ein paar Jahre in den USA verbracht und mir auch dort die neuesten Therapieansätze angeschaut. Was kann ich noch sagen? Ach, ja – ich bin ledig. Koche gerne und gut. Gehe ab und zu Golf spielen und Tango tanzen. Und meine Lieblingsfarbe ist weiß. Voilà!“
„Leben ihre Eltern noch?“, wollte Marie wissen.
„Warum gerade weiß?“, fragte Isa.
Michel meinte, dass sich seine Vorstellung eher nach einem Bewerbungs- als nach einem Therapiegespräch anhörte.
Nur Alice meinte nichts, sondern fragte sich insgeheim, ob sie nicht doch einfach gehen sollte; die offene Tür neben ihr war sehr verführerisch.
Genau in diesem Moment sprach Dr. Janus sie an: „Wollen Sie vielleicht die Nächste sein und sich kurz vorstellen, Frau Weiß? Oder darf ich Alice sagen?“
Alice zuckte zusammen und wollte nur eines: Zurück in ihr Bett und sich die Decke über den Kopf ziehen. Also machte sie, was einer Flucht am nächsten kam – einfach die Augen zu; und sich taub stellen.
Es war Marie, die ihr zu Hilfe kam: „Alice hat hier einen Sonderstatus. Steht das nicht in den Unterlagen, oder haben Sie die noch nicht gelesen? Alice kann noch nicht über alles reden, aber dafür schreibt sie. Das liest sie uns dann vor, und wir sprechen darüber. Für uns ist das immer okay gewesen, und für Dr. Noël auch.“
Mit diesen Worten blitzten Dr. Janus ein Paar schilfgrüne Augen an, dass ihm ein leichter Schauer über den Rücken lief. Die Frau mit den rotbraunen Haaren hatte ihn nicht umsonst an eine Wildkatze erinnert, nur dass die nicht quieken; und statt Krallen hatte sie ja offensichtlich Haare auf den Zähnen.
Egal, er durfte sich auf keinen Fall mehr von Äußerlichkeiten ablenken lassen. Die Leute in der Gruppe schienen sich gut zu kennen und hatten interessante Verbindungen untereinander. Wie in einer richtigen kleinen Familie. Was ja kein Wunder war, sie arbeiteten schließlich schon einige Zeit zusammen. Das alles konnte nur gut für ihn sein. Und ja, diese Marie hatte ihn voll erwischt mit ihrer Bemerkung – mehr als der tätowierte Punk vorhin. Er hatte tatsächlich noch nicht alle Akten detailliert durchgearbeitet: nur überflogen.
Also richtete er sein Augenmerk auf sie: „Ja, wie schön, dann erzählen Sie doch mal von sich: Marie Ricks, wenn mich nicht alles täuscht. Und wenn uns am Ende noch Zeit bleibt, kann Alice uns ja vielleicht was vorlesen.“
Die erwartete Zustimmung blieb aus, und schon war seine Unsicherheit wieder da. Wie gern hätte er kurz an seinen Fingernägeln geknabbert, ... aber das konnte er sich hier und jetzt nicht leisten. Er steckte seine Hände in die Hosentaschen und konzentrierte sich auf die Frau mit dem Quiekser.
Und die schien sich ihrer Ausstrahlungskraft voll bewusst zu sein. Sie war betont langsam aufgestanden und in die Mitte des Zimmers gekommen, so wie er selbst kurz zuvor. Und da stand sie nun. Kein Blatt hätte noch zwischen sie und ihn gepasst. Er roch ihr Parfum, ihre Haare, ihren ganzen Körper. Und plötzlich, wie auf ein geheimes Zeichen, fing sie sich an zu drehen, zuerst beherrscht, dann immer wilder: um ihn rum, ganz nah. Nach ein paar Minuten blieb sie abrupt stehen und er wusste, dass er es nicht länger ausgehalten hätte.
„Jahrgang 1977; Größe 171; Gewicht zwischen 60 und 65 kg; Verhältnis Oberweite zu Unterbrustweite 1,07; Lieblingsfarbe grau und grün, ja, warum nicht auch grüngrau, graugrün? Hahaha; übrigens die Haarfarbe ist echt: rotbraun – nicht gefärbt. Hobby: Putzen – ich liebe es, wenn alles um mich rum sauber ist! Innen und außen. Was noch? Oh ja, ganz wichtig: Meine Eltern sind tot – Gott sei Dank.“
Marie bekam Applaus – von allen aus der Gruppe.
„Danke für die Vorstellung. Da steckt schon so einiges drin, aber ...“ Die anderen ließen ihn nicht ausreden, lachten sich in einen wahren Rausch.
„Das ist zu gut, können Sie das nochmal sagen? ... da steckt so einiges drin. Was für eine Melodie. Und so ganz was Neues. Wissen Sie, Dr. Janus, vor Marie müssen Sie sich in Acht nehmen. Marie hat nicht nur Augen wie eine Katze, sie spielt auch gern wie eine Katze. Vor allem mit Mäuserichen.“
„Isa, du Spielverderberin! So was macht man nicht unter Freunden. Und schon gar nicht in der Familie. Ich hasse dich!“
Dr. Janus war sich nicht sicher, ob die Gruppe ihm was vormachen wollte oder ob die Reaktionen von Marie und Isa echt waren. Er ging einfach drauf ein.
„Hass ist eine natürliche und wichtige Reaktion. Und lachen hilft zu entspannen. Es freut mich, dass es uns allen mittlerweile besser geht als am Anfang unserer Sitzung. Erzählen Sie mir trotzdem noch ein wenig mehr über sich selbst. Zum Beispiel, was Sie von ihrem Leben erwarten? Sie tun ja alle interessante Dinge außerhalb der Gruppe, wie ich durchaus gelesen habe. Trauen Sie sich an die Wahrheit – so nah wie möglich. Wollen Sie es mal versuchen, Monsieur Voss, oder darf ich Michel sagen?“
„Das ist mir egal, wie Sie mich nennen. Und was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, sag ich nur einmal und nicht, wie in der Therapie üblich, wieder und wieder und wieder: Ich bin vor genau drei Jahren in diese Gruppe gekommen; da waren noch andere, die sind schon wieder weg; ich bin heute quasi der Dienstälteste. Ich litt unter schweren Depressionen nach dem Tod meiner Frau und unter schweren Migräneanfällen: zwei, drei in der Woche. Dr. Noël hat es geschafft, meine Migränen auf zwei bis drei im Monat zu reduzieren. Und Sie? Sie haben es geschafft, bei mir nach fünf Minuten einen Anfall auszulösen, wie ich ihn schon ewig nicht mehr hatte.“
Dieses Mal lachte keiner, und es gab auch keinen Applaus. Man sah Michel die Krise an, er war so weiß wie die Bermudas von Dr. Janus. Aber auch der schien betroffen, zog seine Hände aus den Hosentaschen und ging auf Michel zu.
„Was nehmen Sie denn, wenn es ganz schlimm wird? Ich nehme Triptane. Die gibt es ja auch als Injektion. Haben Sie die schon mal probiert? Ich kann Ihnen eine verabreichen, wenn Sie wollen.“
Michel, der mit so einer Reaktion des Neuen nicht gerechnet hatte, lenkte ein: „Geht schon. Ich hab gerade was genommen und muss erst mal warten, ob es wirkt. Wenn nicht – gerne die Spritze. Danke für das Angebot.“
Das war nun wirklich nicht professionell. So viel wollte er doch gar nicht von sich rauslassen. Er wusste, dass die meisten seiner Kollegen diesen offenen persönlichen Ansatz mit den Klienten immer noch nicht schätzten. Es war ja auch nicht unproblematisch, manchmal sogar gefährlich. Aber er hatte diese Vertretung ja schließlich auch aus einem ganz bestimmten Grund angenommen: den, zu experimentieren. Also musste er folgerichtig auch bereit sein, sich selbst mit in dieses Experiment einzubringen; sich in die Gruppe integrieren und nicht draußen bleiben. Ganz einfach.
Mit sich und der Welt etwas zufriedener, schaute er auf die Uhr und meinte: „Wie ich sehe, haben wir trotz allem Hin und Her noch zwanzig Minuten. Wollen Sie uns vielleicht etwas vorlesen, Alice? Sie hatten doch bestimmt was für die Sitzung mit Dr. Noël vorbereitet.“
Mit einem Seitenblick auf Marie präzisierte er: „Wie ich durchaus schon im Protokoll der letzten Sitzung gelesen habe, ging es um LIEBE. Was ist Ihnen denn dazu eingefallen, Alice?“
Kaum hatte Dr. Janus sie angesprochen, verwandelte sich die Frau im roten Kleid und den immer noch festgeschlossenen Augen in das kleine Mädchen, das von Lehrer Herrmann vor die Klasse zitiert und lächerlich gemacht wurde: „Wieder alles vergessen? Sag uns doch wenigstens die erste Strophe ... Dann halt die erste Zeile ... Ach Alice, du bist so dumm wie Bohnenstroh.“
Alice wartete auf das Lachen.
Aber es kam nicht. Alle wollten sie eine neue Geschichte hören. Also lief sie auch nicht weg; öffnete behutsam die Augen und griff in die Seitentasche nach ihrem Manuskript.
* * *
Ich hab dich so geliebt. Und ich liebe dich immer noch. Nur anders. Aber schon damals wusste ich nicht so genau, wie ich dir meine übergroße Liebe zeigen sollte. Und du wusstest auch nicht so recht damit umzugehen. Wie so oft, wenn man für große Gefühle einfach noch zu klein ist, macht man Fehler. Ich wollte doch nur deine Aufmerksamkeit erhaschen, und da du dich nicht nach mir umschautest, hab ich den Kieselstein aufgehoben und in deine Richtung geworfen. Der erste Kiesel war zu klein. Er blieb genauso unbemerkt wie meine Blicke. Also hab ich größere Kiesel genommen und versucht, besser zu zielen.
Das ist alles nun schon so viele Jahre her, aber es ist nie zu spät, sich zu entschuldigen. Ja, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich dich am Kopf getroffen habe, und du geblutet hast wie Schwein. Hab ich dir eigentlich geholfen? Dich verbunden? Dich getröstet? Ich hab es vergessen.
Aber dass du meiner Lieblingspuppe zuerst die Zehe und danach die Locke abgeschnitten hattest, das war auch nicht gerade gute Kinderstube. Danach kam dann schon ziemlich bald mein Attentat auf deinen Contrabass, den du nach der Stunde im Musikverein in dem riesigen Kasten mit nach Hause schlepptest. War es eine Saite oder zwei? Oder noch mehr? Aber ich war halt eifersüchtig auf das Ding. Es sah schon fast wie ein Mensch aus, wenn der Kasten da so in der Ecke stand: kleiner Kopf, langer Hals, dicker Bauch ... man hätte dem Kasten ein Kleid überstülpen und das Ding für ein Mädchen halten können. Und ich tat das auch. Du verbrachtest damals immerhin mehr Zeit mit dem Kontrabass als mit mir.
Aber was hab ich geweint, als wir dachten, du seist tödlich verunglückt. Du hattest dieses kleine putzige Pelzmäntelchen an, und daher wurde der Aufprall von der Mauer abgefedert. Ich höre noch deinen Kumpel Stefan rufen: „Der Erich ist tot; der Erich ist tot.“ Und es klang gar nicht traurig. Eher freudig erregt. Wie jemand, der als Erster eine wichtige Neuigkeit verbreiten kann. Es war so schön, als du zwar schwer röchelnd und leichenblass, aber tapfer deine schönen Augen aufmachtest. Nein, damals bist du noch nicht gestorben. Und auch nicht mit dreißig, an der Lungenentzündung. Damals, an der Uni, wussten wir nicht, was für eine wunderbare Zeit wir durchlebten. Für ein paar Monate in einer Studentenbude zusammen. Gemeinsam lernen, lachen, kochen, ausgehen, Freunde treffen. Was haben wir diskutiert, und was hab ich dich abgehört für deine Prüfungen in französischer Literaturgeschichte, Spezialgebiet Existentialismus. Wir lebten „absurd“ und standen dazu. Bei unserem letzten Treffen hatte ich unseren Camus dabei; und heute wohne ich 10 km entfernt von dem Friedhof, auf dem Camus’ sterbliche Überreste nach seinem absurden Tod beigesetzt wurden.
In einem kleinen Dörfchen im Südluberon. Ich hatte immer gehofft, du kommst mich einmal besuchen: Wir gehen zusammen zum Grab, wie man zu einer Gedenkstätte pilgert. Und davor und danach trinken wir Wein und Pastis. Heute warte ich nicht mehr auf dich. Heute weiß ich, dass du in diesem Leben nicht mehr kommen wirst.
Es war schön, dass wir ganz am Schluss auf eine ganz andere Art, als sonst bei großen Liebesgeschichten üblich, unseren Frieden machen konnten. Es war nicht unter der Sonne Südfrankreichs, sondern im klaren Sonnenlicht unserer Alma Mater von damals. Wir haben uns angefasst: Ich hab dein Gesicht gestreichelt und deine Hände. Und ich musste an die Geschichte denken, die du immer gerne erzählt hattest: „Weißt du noch, Alice, als Mutti damals ein paar Jahre nach deiner Geburt am Blinddarm operiert werden musste und ich an der Tür des Krankenzimmers stehen blieb und Angst hatte einzutreten? Weißt du noch, was ich sie gefragt hatte?“
„Ja, Erich, ich weiß es noch.
Du hast gefragt: ,Ist es auch wirklich nicht noch ein Schwesterchen?‘
Und erst dann hattest du dich getraut, zu ihr zu gehen!
Trotzdem war unsere Geschichte auf eine wundersame Art und Weise eine ganz große Liebe!“
Kapitel 1.3
Nachbesprechung mit Überraschungen
Vieles war heute anders als sonst. Sogar das Ende der Sitzung. Niemand wollte sich nach der Geschichte von Alice noch länger in den Praxisräumen von Dr. Noël aufhalten. Und darüber reden, wie gewöhnlich, wollte auch niemand. Ohne Alice, die sofort nach dem letzten Satz ihre Tasche ergriffen hatte und aus dem Zimmer gelaufen war, hätte es auch keinen Sinn gemacht.
Die größte Veränderung war jedoch die in den Personen selbst. Alice, die sich grußlos davon machte und alle anderen mit der Frage zurückließ, ob sie je wieder zurückkommen würde.
Isa, die sonst eher schüchtern und zurückhaltend auftrat, musste sich heute gegen den Neuen wohl zur Wehr setzen und tat es gleich noch für die anderen mit. Sonst war eigentlich eher Marie die hilfsbereite, offene Seele der Familie. Aber nicht der verführerische Vamp, der seine Krallen ausstreckte und Blut gerochen hatte, wie heute. Und dann erst die Sprache: Wenn jemand ein loses Mundwerk hatte, war sie es, und nicht Isa.
Und last but not least der Ausbruch von Michel; der hatte die Gruppe wohl mehr erstaunt als den Neuen. Er kannte ihn ja überhaupt nicht und wusste auch nicht, wie selten, eigentlich nie, Michel heftig wurde. Nicht umsonst neckten sie ihn manchmal mit dem Spitznamen Ted – für Teddybär. Lieb, kuschelig – harmlos. Er hatte zwar nie gesagt, ob ihm das recht sei, aber auch nicht das Gegenteil. So war Michel. Halt ein Ted. In den letzten -zig Monaten Gruppentherapie hatte er so manches Mal rausgelassen, wie sehr er seit seiner Jugend darunter gelitten hatte, nicht mehr zu sein als Durchschnitt: mittelgroß, mittelschwer, mittelschön – selbst seine Haare waren mittelblond und mittellang. Vor sechs Monaten tauchte er plötzlich mit einer anderen Frisur auf. Isa hatte sie ihm geschnitten. Und seitdem veränderte er sein Image. Oder vielleicht sogar sich selbst?
„Hey, du Armer, gehts besser? Kannst du überhaupt mit zu Bruno?“