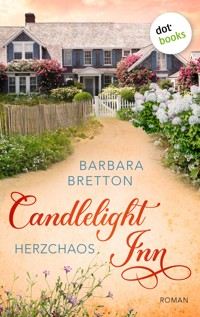Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jersey Love
- Sprache: Deutsch
Das Glück von neuen Anfängen: Das berührende Romantik-Highlight »Das Leuchten der Morgenröte« von Barbara Bretton jetzt als eBook bei dotbooks. Christine Cannon ist schön, erfolgreich, ein gefeierter Fernsehstar – doch statt Kraft und Zuversicht fühlt sie seit Monaten schon eine erdrückende Leere in sich. Sie beschließt, für eine Auszeit in ihr Haus in den grünen Hügeln von New Jersey zurückzukehren. Doch gleich an ihrem ersten Abend dort drängen die Erinnerungen auf sie ein: an Tage voller Licht und Hoffnung, an Schmerz und Traurigkeit – und an Joe, den Mann, den sie über alles liebte, und den sie dennoch gehen lassen musste. Nun steht er eines Morgens plötzlich wieder vor ihr, mit seinem unwiderstehlichen Lächeln, als wären die letzten Jahre nie geschehen – und mit einer Frage auf den Lippen, auf die Christine keine Antwort weiß: Können ihre Gefühle füreinander stärker sein als alles andere? »Keine schreibt so wunderbar über große Gefühle wie Barbara Bretton!« Bestsellerautorin Susan Elizabeth Philipps Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der romantische Schicksalsroman »Das Leuchten der Morgenröte« von Bestseller-Autorin Barbara Bretton – Band 3 ihrer großen Jersey-Love-Reihe, in der jeder Roman unabhängig gelesen werden kann. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Christine Cannon ist schön, erfolgreich, ein gefeierter Fernsehstar – doch statt Kraft und Zuversicht fühlt sie seit Monaten schon eine erdrückende Leere in sich. Sie beschließt, für eine Auszeit in ihr Haus in den grünen Hügeln von New Jersey zurückzukehren. Doch gleich an ihrem ersten Abend dort drängen die Erinnerungen auf sie ein: an Tage voller Licht und Hoffnung, an Schmerz und Traurigkeit – und an Joe, den Mann, den sie über alles liebte, und den sie dennoch gehen lassen musste. Nun steht er eines Morgens plötzlich wieder vor ihr, mit seinem unwiderstehlichen Lächeln, als wären die letzten Jahre nie geschehen – und mit einer Frage auf den Lippen, auf die Christine keine Antwort weiß: Können ihre Gefühle füreinander stärker sein als alles andere?
»Keine schreibt so wunderbar über große Gefühle wie Barbara Bretton!« Bestsellerautorin Susan Elizabeth Philipps
Über die Autorin:
Barbara Bretton wurde 1950 in New York City geboren. 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, dem bis heute 40 weitere folgten, die regelmäßig die Bestsellerlisten eroberten. Ihre Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Sie lebt mit ihrer Familie in Princeton, New Jersey.
Bei dotbooks veröffentlichte Barbara Bretton in ihrer »Jersey Love«-Reihe auch die Romane »Nächte aus Sternenlicht« und »Das Glitzern der Wellen«.
Auch bei dotbooks erschien ihre »Shelter Rock Cove«-Reihe mit den Romanen »Ein Traum für jeden Tag« und »Ein Sommer am Meer« sowie ihre »Candlelight Inn«-Reihe mit den Bänden »Liebeszauber« und »Herzchaos«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1995 unter dem Originaltitel »Maybe this Time« bei Berkley Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Tage der Rosen« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1995 by Barbara Bretton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München. Der Wilhelm Heyne Verlag ist ein Verlag der Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-955-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Leuchten der Morgenröte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Bretton
Das Leuchten der Morgenröte
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ingeborg Ebel
dotbooks.
Kapitel 1
»Es ist das letzte Haus in der Marlborough Street«, sagte Christine Cannon zu dem Chauffeur, als sie an einer Ampel am Ortsanfang von Hackettstown in New Jersey hielten. »Ungefähr eine halbe Meile von hier.«
Der Chauffeur deutete mit beiden Daumen auf die Seitenfenster der Limousine. »Rechts oder links?«
»Zweimal nach links, dann scharf nach rechts bei der weißen Kirche mit der roten Tür. Das Haus steht auf der Hügelkuppe.«
»Mann o Mann«, sagte der Chauffeur und schüttelte den Kopf. »Warum haben Sie denn ein Haus am Ende der Welt gekauft, Mrs. Cannon? Ich sehe Sie eher in den Hamptons oder einem ähnlichen Ort wohnen.«
»Aufgrund einer Hoffnung«, antwortete Christine leise. »Nichts anderes als Hoffnung.«
Damals hatten alle ihre Bekannten zu Joe und ihr gesagt, dass sie verrückt seien, ein Haus zu kaufen. Es sei nicht der richtige Zeitpunkt, der falsche Ort und der falsche Preis.
»Immobiliengeschäfte funktionieren genauso wie der Handel mit Aktien an der Börse«, hatte Christines Vater ihnen beiden erklärt. »Man muss billig kaufen und teuer verkaufen. Nicht anders rum. Wozu habt ihr studiert, wenn ihr nicht einmal das wisst?«
»Allein die Lage zählt«, hatte Joes Vater gemeint. »Und die stimmt bei eurem Haus nicht.«
Das Problem war nur, dass keines dieser Argumente zählte, wenn man auf ein Wunder hoffte. Und sie beide waren überzeugt gewesen, dass dieses Haus ein Wunder vollbringen würde. Es war das Letzte in der Straße, ein Monstrum aus Stein und Holz an einem sanften Abhang gelegen, das den darum wachsenden Eichen, Fichten und Kiefern den Platz streitig machte.
Die Fenster waren undicht und klapperten in den Rahmen. Die Böden mussten erneuert werden. Die Grundsteuer war unverschämt hoch und eine Gebäudeversicherung unbezahlbar.
»Wir kaufen es«, hatte Joe erklärt.
Sogar die Immobilienmaklerin war überrascht gewesen. »Ach, du meine Güte«, hatte sie gesagt und sich auf die Unterlippe gebissen. »Ist das nicht etwas überstürzt, Mr. McMurphy? Sie haben das Webster-Haus noch nicht gesehen.«
»Nein, das ist das richtige Haus«, hatte sich Christine eingemischt. »Dieses Haus wollen wir haben.«
Die Immobilienmaklerin hatte nervös in ihrer Liste mit den zum Verkauf stehenden Objekten geblättert. »Ein paar Meilen weiter unten in der Straße habe ich einen Neubau im Angebot. Große Panoramafenster, Fußböden aus Marmor ‒ damit können Sie nichts falsch machen.«
»Aber dieses haben wir sofort ins Herz geschlossen«, hatte Joe gesagt. »Und das ist das Entscheidende.«
Damals hatten sie beide noch einmal von vorne anfangen wollen, denn in ihrer Ehe war vieles schief gelaufen. Sie hatten einen Ort gebraucht, wo ihre Wunden heilen und sie einander neu entdecken konnten. Und das alles würde in diesem wundervollen Haus geschehen. Doch nüchtern betrachtet war das zu viel von einem Haus verlangt.
Die Limousine bog in die Marlborough Street ein und Christine wurde von Erinnerungen überwältigt. Als der Immobilienmarkt zusammenbrach, zerbrach auch ihre Ehe. Trotzdem kamen sie überein, das Haus als gemeinsamen Besitz zu behalten. Es zu vermieten, falls sich ein Mieter fände, oder es Freunden und Verwandten zur Verfügung zu stellen, wenn die Vermietung nicht klappte.
Joe hatte ein paar Mal während der Skisaison im Haus gewohnt ‒ jedenfalls vermutete sie das doch Christine war nie wieder hierher zurückgekehrt. Bis heute. Vielleicht hatte sie diesen Ort instinktiv gemieden, weil er seit ihrer Scheidung mit zu schmerzlichen Erinnerungen verbunden war, die sie bisher erfolgreich verdrängt hatte. Oder sie war nicht hergekommen, weil sie einfach die Vergangenheit hinter sich lassen wollte. Aus welchen Gründen auch immer, seit sechs Jahren hatte sie das Haus nicht mehr betreten und plötzlich fragte sie sich, ob sie es überhaupt sehen wollte.
Das ist keine gute Idee, Christine, sagte sie sich. Besser, du hättest eines dieser schicken Lofts in TriBeCa am Hudson River oder ein rotes Sandsteinhaus in der Nähe des Central Parks gemietet.
Eine Bleibe, so modern und nüchtern wie ihre Wohnung in Los Angeles mit viel Glas und ein paar teuren Kunst-Objekten, die ihrem Vermögensberater besser als ihr gefielen.
Aber sie hatte ein paar Wochen für sich haben wollen, etwas Zeit zum Ausspannen, ehe sie nach New York umzog und ihr neues Leben begann. Ihr Erfolg hatte sie harte Arbeit gekostet, doch dieser plötzliche Aufstieg von einer Journalistin zur berühmten Fernseh-Moderatorin hatte sie erschöpft, irgendwie atemlos gemacht. Zwar war der Ausblick ‒ stand man oben auf der Leiter ‒ großartig, doch die Luft dort wurde immer dünner.
Obwohl sie es niemals irgendjemandem ‒ und am wenigsten sich selbst ‒ eingestehen würde, hatte sie manchmal das Gefühl, das Beste in ihrem Leben aufgegeben zu haben, als sie sich von Joe und ihren gemeinsamen Träumen getrennt hatte.
Nämlich die Menschen, die sie beide liebten.
»Komm doch und besuch uns für ein paar Tage«, hatte ihr Vater, Sam, sie vor kurzem am Telefon eingeladen. »Deine Mutter und ich wissen ja, dass es zu unserer Goldenen Hochzeit nicht klappt, aber auf deinem Weg nach Osten könntest du doch einen Zwischenstopp einlegen.«
»Tut mir Leid, Pop«, hatte sie überstürzt abgelehnt. »Ich habe noch jede Menge Termine. Doch ich versuche, zu Thanksgiving zu kommen.« Sie bedauerte es, so schnell abgesagt zu haben, aber nicht die Absage als solche. Denn sie hatte gelernt, dass sie hart sein und die Menschen meiden musste, die sie am meisten liebte, wenn sie ihr seelisches Gleichgewicht behalten wollte.
»Wir sind da, Mrs. Cannon«, sagte der Chauffeur und hielt oben auf der Hügelkuppe. »Es sieht aus, als wäre das Haus lange nicht bewohnt gewesen. Wenn Sie wollen, öffne ich die Fensterläden und sehe nach, ob alles in Ordnung ist.«
»Nein, danke. Laden Sie nur das Gepäck aus«, meinte Christine und knipste automatisch ihr Lächeln an. Sie deutete auf den leise schnarchenden Mann neben ihr. »Ich wecke inzwischen den schlafenden Prinzen.«
Der Chauffeur kicherte und stieg aus.
»Wach auf«, sagte sie und schüttelte sanft die Schulter des jüngeren Mannes. »Willkommen in New Jersey.«
Slade murmelte Unverständliches und grub sich tiefer in den weichen Sitz ein.
Kein Wunder, dachte Christine mit Blick auf die leere Champagnerflasche neben ihm. Allein während des Flugs von Los Angeles nach New York hatte er so viel Schampus getrunken, dass ein Schiff darin hätte schwimmen können.
Sie knipste das Licht an und sah, wie er schützend seinen dünnen Arm über die Augen legte. Wenn er schlief, blieb nichts mehr von seinem weltgewandten und geistreichen Getue übrig, deshalb schlief er wohl auch so wenig. Slade so ungeniert zu betrachten, empfand Christine plötzlich als Eindringen in seine Privatsphäre, und sie knipste das Licht schnell aus. Joe hätte das Absurde dieser Situation gefallen, denn schließlich lebte sie davon, dass sie in das Privatleben anderer Leute eindrang.
»Ich weiß nicht, ob du mir dafür dankbar sein wirst«, hatte ihre Freundin Terri Lyons eines Morgens gesagt, »aber ich kenne einen jungen Fotografen, mit dem ich dich bekannt machen möchte.«
»Warum sollte ich dir dafür nicht dankbar sein?«, hatte Christine gefragt. »Versteht er sein Metier nicht?«
»Ganz im Gegenteil«, hatte Terri geantwortet, die damals für denselben Zeitungsverlag wie Christine in Los Angeles gearbeitet hatte. »Er ist ein phantastischer Fotograf, aber ein mieser Typ.«
»Wie mies?«
»Total opportunistisch.«
»Das ist doch jeder in unserem Beruf. Ist er wenigstens ein talentierter Opportunist?«
»Absolut. Er wird’s noch weit bringen, Chris. Und ich habe mir gedacht, dass er vielleicht der richtige Mann für die Fotos dieser Story ist, an der du gerade für dieses Klatsch-Magazin arbeitest.«
»Bring ihn her«, hatte Christine geantwortet. »Dann sage ich dir, was ich von ihm halte.«
Das war vor zwei Jahren gewesen und Christine wusste noch immer nicht, ob Slade ein Sünder oder ein Heiliger war. Aber das könnte auch mehr mit seinem Alter als mit seiner Moral zu tun haben ‒ oder mit dem Fehlen derselben.
Eigentlich war Slade ein großes Kind, was Christines mütterlichen Instinkt ihm gegenüber weckte. Sie beschützte ihn; er brauchte Ruhe und Hilfe, jemanden, der ihm den richtigen Weg wies. Er wartete auf ein Wunder und wenn der richtige Zeitpunkt gekommen war, würde er mit ihrer Unterstützung die Gelegenheit beim Schopf packen, das wusste Christine.
Im Moment hatte er so gut wie gar nichts ‒ er war nicht verheiratet, war kinderlos und besaß weder eine Wohnung noch ein Auto. Zigaretten schnorrte er von Models und fahren ließ er sich von Produktionsassistenten. Seine Garderobe bestand aus zwei Paar Jeans und einem Hemd und seine Fotoausrüstung fand Platz in einer Ledertasche, nicht viel größer als Christines Einkaufstasche. Er hatte nie Zeit oder genug Geld, aber sein Talent war größer als das von drei guten Fotografen.
Und sie liebte ihn. Nicht auf die Weise, wie er gern von ihr geliebt worden wäre, sondern sie liebte ihn, wie sie einen ihrer jüngeren Brüder liebte.
Oder auf die Weise, wie sie ihren Sohn geliebt hätte.
»Verdammt noch mal!«, flüsterte sie und presste den Kopf gegen die kühle Fensterscheibe, froh über die Dunkelheit. Mit eisernem Willen war es ihr gelungen, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, manchmal monatelang, so dass es aussah, als hätte sie überhaupt keine. Nie war sie auf Mütter eifersüchtig gewesen, die sich wie Glucken um ihre Kinder kümmerten.
Doch als sie es am wenigsten erwartet hatte, als sie erschöpft und wehrlos war, wurde sie von diesen lange unterdrückten Emotionen förmlich überwältigt. Und das tat weh.
Wie seltsam, dass dieses Mal ein redegewandter Brite mit wachem Blick der Auslöser dieses Gefühlssturms war. Alle ihre Freundinnen wären ihm an die Wäsche gegangen. Offenbar funktionierten ihre Hormone nicht richtig. Anstatt jüngere Männer in ihr Bett zu zerren, adoptierte sie sie.
Du gibst ein erbärmliches Weib ab, Christine, dachte sie, und würdest nicht einmal die Gelegenheit ausnützen, wenn der Typ nackt vor dir strippen würde.
Ein einziges Wort von ihr hätte genügt und Slade wäre zu allem bereit gewesen. Es war lange her, seit sie mit einem Mann geschlafen hatte. So lange, dass sie sich nicht einmal an wilde Sexphantasien mit einem Fremden erinnern konnte ‒ oder mittelmäßigen Sex mit einem Bekannten. Denn seit ihrer Scheidung hatte sie ihre ganze Energie und ihre ganze Zeit ihrer Karriere gewidmet. Sie war mit ihrer Arbeit verheiratet und ihre Arbeit ersetzte ihr ebenfalls das Kind. Wenn sie nicht glücklich war, so war sie doch wenigstens zufrieden. Und das war wahrscheinlich mehr als achtzig Prozent der Bevölkerung von sich sagen konnte.
Eigentlich sollte ihr das genügen. Man versucht die Götter, wenn man mehr verlangt. Das hätte sie schon vor Jahren begreifen müssen, als sie noch mit Joe verheiratet war und glaubte, ein Recht darauf zu haben, glücklich zu sein, anstatt das Glück als ein Geschenk zu betrachten.
»Komm jetzt«, sagte Christine, diesmal lauter. »Ich muss den Chauffeur bezahlen.«
»Kaffee«, murmelte Slade und unterdrückte ein Gähnen.
»Steig aus, dann koche ich dir Kaffee.«
Christine überließ Slade sich selbst, stieg aus und quittierte den Voucher für den Fahrer, während Slade, vor sich hin brummend, seine Siebensachen zusammenraffte.
»Es war schön, Sie wieder fahren zu dürfen, Mrs. Cannon«, sagte der Chauffeur und tippte an seine Mütze. »Sie haben uns hier gefehlt.«
Daran zweifelte sie nicht, denn sie gab immer zu viel Trinkgeld. Dann kam das Mädchen vom Land aus Nevada wieder zum Vorschein, das immer mit den Großstädtern Schritt halten wollte, was ihr nie gelang. Joe hänselte sie früher ständig, weil sie in diesem näselnden Tonfall sprach, sobald sie aufgeregt oder wütend war. Doch dass er stets breiten New Yorker Slang redete, hatte ihn nie im Geringsten gestört.
Aber Joe war jemand, der sich immer wohl in seiner Haut fühlte. Er wusste, was er im Leben wollte und wie er es bekommen konnte. Schon in der Schule hatte sie ihn dafür abwechselnd beneidet und gehasst und sich gewünscht, wenigstens einen Bruchteil seines Selbstvertrauens und seiner Begabung zu haben. Alles, was sie besaß, musste sie sich hart erarbeiten. Doppelt so lange gelernt, doppelt so lange gearbeitet und doppelt so gut ausgesehen.
Slade schwang seine Beine aus dem Wagen, atmete tief ein und fiel in den Sitz zurück.
»Soll ich ihn ins Haus bringen, Mrs. Cannon?«
»Wir schaffen das schon«, sagte sie mit ihrem strahlendsten TV-Lächeln. »Wenn erst etwas Koffein in seinen Adern zirkuliert, geht es ihm wieder gut.«
»Dann will ich ihm mal auf die Beine helfen. Das kann nicht schaden.«
Christine ging langsam den Weg zum Haus hoch und atmete den Geruch der Erde und den der Wildblumen ein. Die Rhododendren neben der Haustür waren so gewachsen, dass sie den Weg überwucherten. Jeden der fünfzehn Ziersträucher hatte sie eigenhändig gepflanzt sowie die Spindelsträucher und die beiden Hartriegelbäume vorm Küchenfenster.
»Heb dir noch ein paar Pflanzen für nächstes Jahr auf«, hatte Joe gesagt, »weil wir dieses Haus lange haben werden, Christie.«
Was stimmte.
Ihre Ehe war vorbei, aber das Haus besaßen sie immer noch.
Als Joe mit Marina in der West Side angekommen war, fing die zweite Mrs. McMurphy zu weinen an. Zwar zeigt sich New York an einem Donnerstagabend im Juli während der Rushhour nie von seiner besten Seite, doch außer ein paar Verlegern auf dem Weg zu den Hamptons hatte Joe noch nie jemanden gesehen, der sich deswegen aufregte.
Der Taxifahrer warf den beiden im Rückspiegel verstohlene Blicke zu und Joe ahnte, was der Typ dachte: Kindesentführer, Pädophiler, Möchtegern-Woody Allen.
»Sie hätten fast eine Nonne überfahren. Passen Sie lieber auf den Verkehr auf!«
Der Taxifahrer blieb stumm, was nicht verwunderte, denn wahrscheinlich sprach er kein Wort Amerikanisch.
»Warum weinst du?«, fragte Joe das neben ihm sitzende Mädchen. Es waren die ersten Laute, die Marina von sich gab, seit sie in London-Gatwick umgestiegen waren.
»Ich hasse dich«, antwortete sie zwischen zwei Schluchzern. »Das wollte ich nicht.«
»Ich wollte das ebenso wenig«, entgegnete Joe. »Aber dein alter Herr hat es so bestimmt. Jetzt sitzen wir beide in der Tinte.«
»Das müsste aber nicht sein«, entgegnete sie mit ihrem schönsten britischen Internats-Akzent und deutete auf die Straße. »Lass mich einfach hier aussteigen. Ich bin clever. Ich schaffe es auch allein nach Hause.«
»Wie denn?«, fragte Joe. »Du hast weder Geld noch Pass. Denn dein Pass steckt in meiner Brieftasche.«
»Es gibt immer Möglichkeiten«, entgegnete sie finster. »Du wärst erstaunt, wenn du wüsstest, wie einfach es ist, die Bürokratie zu umgehen.«
»Ach? Und ich dachte, ich müsste dich beschützen«, sagte Joe und musterte Marina eindringlich.
»Ha!«, schnaubte sie verächtlich. Der Zorn hatte ihre Tränen mit erstaunlicher Geschwindigkeit zum Versiegen gebracht. »Mein Vater ist ein machtgieriges Monster. Er hat nur eins im Sinn: dass ich mich seinem Willen beuge! Aber ich krieche nicht vor ihm, immer …« Sie schwieg abrupt.
»Warum redest du nicht weiter?«, sagte Joe. »Jetzt, wo es interessant wird.«
»Mehr kann ich nicht sagen«, erwiderte sie und warf ihm einen verstohlenen Blick zu.
»Das muss in der Familie liegen«, murmelte Joe, lehnte sich zurück und schloss die Augen, während das Taxi im Stau stand.
Vor vierundzwanzig Stunden war er in einer Stadt Osteuropas an Bord einer Maschine gegangen, die ihn wieder in den Westen brachte. Ein halbes Jahr hatte er das Land auf der Suche nach dem Mann ‒ einem alten Freund ‒ durchstreift, der dem Nachbarland des einstigen Jugoslawiens eventuell Frieden bringen könnte. Qualifiziertere Leute als Joseph McMurphy hatten bereits vor Wochen die Suche nach diesem Mann aufgegeben ‒ nicht aber Joe.
Denn Joe hatte immer für die Verlierer gekämpft: den Preisboxer mit Glasauge angefeuert, auf das älteste Pferd im Rennen gewettet. Und jedes Mal, wenn er verloren hatte, war er erstaunt gewesen, dass kein Wunder geschehen war. Hätte er während des amerikanischen Sezessionskriegs gelebt, er hätte für die Südstaaten gekämpft ‒ für die Konföderierten ‒, obwohl er ein Yankee war. So wie dieser Bürgerkrieg für den Süden zum Desaster geworden war, kämpfte Joe gern für aussichtslose Sachen. Das empfand er als nobel und ein solcher Kampf berührte ihn wie sonst nichts auf der Welt.
Doch sogar er musste Niederlagen akzeptieren und hatte einsehen müssen, dass es Zeit war heimzukehren.
Eben noch hatte er am Flughafen von den häuslichen Annehmlichkeiten geträumt ‒ einer heißen Dusche und einem kalten Bier ‒ und kurz darauf stand er in einem zerbombten Haus und wurde mit einer nicht sehr attraktiven Neunzehnjährigen verheiratet, die er nicht einmal kannte.
Joe war Auslandskorrespondent. Für ihn zählten nur Fakten. Doch selbst jetzt noch fiel es ihm schwer, die Kette der Ereignisse nachzuvollziehen, die zu dieser Heirat geführt hatte.
»Ich bin seit Dezember hier, Ric. Und habe dich nicht gefunden. Warum bist du erst jetzt aufgetaucht?«
»Aus Sicherheitsgründen.«
»Geht’s um deine Sicherheit?«, hatte Joe erstaunt gefragt.
»Nein«, hatte sein Freund ‒ der zukünftige König ‒ geantwortet. »Um deine.«
»Es muss doch eine andere Möglichkeit geben. Irgendeinen anderen Mann. Ich bin hier, weil ich Reportagen schreibe, nicht wegen deiner Tochter.«
»Marina ist in großer Gefahr. Nur dein Land kann ihr eine sichere Zuflucht bieten.«
»Dann kommt sie einfach mit mir mit«, hatte Joe geantwortet. »Ich besorge ihr ein Apartment und helfe ihr bei ihrem Studium an der New York University, wenn du das willst. Aber bitte mich nicht, sie zu heiraten.«
»Du bist meine letzte Hoffnung.«
»Ich bin für niemanden die letzte Hoffnung. Hast du’s schon vergessen? Ich trinke zu viel, ich rauche zu viel, ich bin ein arroganter Mistkerl, der …«
»… nicht verheiratet ist.«
»Geschieden ist.« Seit sechs Jahren. Und das sollte eigentlich nicht mehr weh tun. Tut es aber immer noch.
»Du hast Pech gehabt«, hatte Ric entgegnet. »Das verstehe ich nur zu gut. Aber Tatsache ist, dass ich dir einmal vor langer Zeit das Leben gerettet habe und jetzt bitte ich dich, das meiner Tochter zu retten. Das scheint mir nur fair.«
»Du erwartest doch nicht etwa, dass ich die Ehe vollziehe, oder?«
»Solltest du es auch nur versuchen, kriegst du es mit mir zu tun.«
Joe hatte seinen alten Freund bei den Schultern gepackt und eindringlich gesagt: »Komm mit. Nimm dein Kind, deine Krone und verabschiede dich von deiner Heimat. Das Land, das du geliebt hast, existiert nicht mehr. Und es wird nie wieder so sein wie früher. Denk nur einmal an dich selbst.«
»Das kann ich nicht. Ich bitte dich nur, Marina zu beschützen, bis sich die Situation hier entspannt hat. Ich habe bereits meine Frau in diesem Bürgerkrieg verloren und will nicht auch noch meine Tochter verlieren. Sicher kannst du am besten verstehen, was das bedeutet …«
Beide hatten geschwiegen. Die Worte schienen förmlich in der Luft gehangen zu haben und immer schwerer geworden zu sein. Joe hatte ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche genommen und seinem Freund eine angeboten.
»Diese Dinger sind tödlich.«
»Das Leben auch«, war Joes Antwort gewesen. Das hatte er schon vor vielen Jahren an einem Sommermorgen gelernt.
Als das Taxi rumpelnd durch ein Schlagloch fuhr, machte Joe die Augen wieder auf. Er sah seine Frau an.
»Schau mich nicht so an!«, blaffte Marina. »Ich mag das nicht.«
»Und mir gefällt nicht, was ich sehe!«, gab er zurück und fragte sich, wie es kam, dass zwei so gut aussehende Menschen wie Ric und seine verstorbene Frau eine so hässliche und aggressive Tochter bekommen konnten. Ihr Haar war glatt und stumpfbraun. Ihre Augen besaßen dieselbe braune Farbe. In ihren Gesichtszügen gab es nichts Bemerkenswertes. Ihre nur etwa ein Meter dreiundfünfzig große Gestalt steckte in grünen Kampfhosen, darüber trug sie einen ausgeleierten, unförmigen beigen Pullover. Zudem sah sie wie ein quengelndes Kind aus, das man mit Stubenarrest bestrafen muss.
Das sollte seine Frau sein? Du meine Güte!
»Wie viel hat dir mein Vater bezahlt, damit du mich heiratest?«, murmelte Marina.
»In ganz Fort Knox gibt’s nicht genug Geld dafür, Kid. Ich zahle nur eine alte Schuld zurück.«
»Pah!«, zischte sie wütend. »Schon wieder diese blöde Lawinengeschichte? Das ist doch eine Ewigkeit her.«
»Aber die Geschichte ist gut«, sagte Joe. »Vielleicht gefällt sie dir.«
»Sie ödet mich an.«
»Aber da ist doch alles drin: Action, Abenteuer und ein glückliches Ende. Der Königssohn rettet dem armen Jungen aus Brooklyn das Leben, als er beim Skilaufen in Colorado unter einer Lawine zu ersticken droht. Eine herzerwärmende und zu Tränen rührende Geschichte.«
»Mich rührt sie nicht zu Tränen.«
»Ja. Weil du sie schon seit langem kennst.«
»Ich will nicht mehr reden.«
»Schön. Dann eben nicht. Ist mir auch recht«, entgegnete Joe.
Zehn Minuten später hielt der Taxifahrer vor Joes Apartment in dem Mietshaus in der 72th Street West. Noch ehe Joe nach seiner Brieftasche greifen konnte, hatte Marina die Tür aufgestoßen und sich kopflos in den Verkehr gestürzt. Sie schrie auf, als ein Bus auf sie zukam, rappelte sich aber sofort wieder hoch, schleuderte ihre Schuhe von den Füßen und rannte. Joe zögerte keine Sekunde und lief hinter ihr her.
Joe litt unter Jetlag, das zeigte sich jetzt. Fast hilflos umrundete er zwei alte Damen und wäre fast mit einem Typen zusammengestoßen, der an einem Zeitungsstand in einem Magazin blätterte. Er verlor noch ein paar Sekunden, als er das Titelblatt der Time betrachtete. Kurz hatte er den Eindruck, dass ihm seine erste Frau darauf entgegen lächelte.
Reiß dich zusammen, McMurphy, schalt er sich. Du hast bereits Ehefrau Nummer eins verloren und wenn du deinen Arsch jetzt nicht bewegst, verlierst du auch Nummer zwei.
Marina hatte bereits die halbe Strecke zum Central Park zurückgelegt, ehe er sie endlich einholte.
»Lass mich los!«, schrie sie und trat ihn mit ihren kleinen, schmutzigen Füßen. »Monster! Biest!«
Er packte sie an der Taille und versuchte, ihren Tritten auszuweichen. »Wenn du nicht sofort den Mund hältst …«
Sie schrie noch lauter. »Hilfe! Hilfe! Ich werde gegen meinen Willen festgehalten!«
Die Arme hatte keine Ahnung, wie dieses Benehmen auf New Yorker wirkte.
Zwei tuschelnde Frauen machten einen großen Bogen um die beiden, während ein junger Mann in Jeans und T-Shirt interessiert zuschaute.
»Wir sind verheiratet«, erklärte Joe die Situation. »Frisch vermählt sozusagen.«
Der Typ nickte, als würde das alles begreiflich machen. Dann ging er weiter.
In Manhattan konnte er mit Marina nicht bleiben. Sie würde jedes Mal einen Fluchtversuch unternehmen, wenn er sie aus den Augen ließ.
»Du kannst mich nicht ewig festhalten«, sagte sie und boxte ihn mit Fäusten auf den Rücken.
»Wie wär’s dann mit Fußfesseln«, entgegnete er, als neben den beiden ein Bus hielt und Fahrgäste ausstiegen.
»Ich bin eine politische Gefangene und Folter ist gegen das internationale Recht.«
»Das ist keine Folter, Kid. Das sind die Freuden des Ehelebens.«
Der Bus reihte sich wieder in den Verkehr ein und fuhr an dem auf sie wartenden Taxi vorbei. An der Rückseite des Busses klebte ein großes Plakat. Strahlendes Lächeln mit vielen weißen Zähnen, honigblondes Haar und riesige türkisblaue Augen.
Die Frau sah ganz wie ein Filmplakat von Christine aus, wenn auch etwas unscharf, aber feurig und herzergreifend zugleich. In dicken Letter stand darüber: IM HERBST ZURÜCK. CHRISTINE CANNON!
»Du meine Güte!«, flüsterte Joe, als der Bus die Straße hinunterfuhr. Seine Christine? Zwar wusste er, dass sie in Kalifornien erfolgreich war. Aber das hier sah nach Erfolg in einer ganz anderen Größenordnung aus.
»Das Blut steigt mir in den Kopf«, sagte seine Ehefrau, die über seiner Schulter lag. »Lass mich sofort los.«
»Gleich. Noch etwas Geduld, Kid. Ich muss eine Zeitschrift kaufen.«
Er drehte um und marschierte zum Zeitungsstand zurück. »Die Time bitte.«
Der Mann gab ihm das Gewünschte. »Sieht so aus, als hätten Sie alle Hände voll.«
»Kann man wohl sagen.« Joe klemmte sich die Zeitschrift unters Kinn, änderte Marinas Position etwas und grub in seinen Taschen nach Kleingeld.
»Au!«, Marina bohrte ihr Knie in seine Brust. »Es ist einfach unverschämt, wie du mich behandelst.«
Joe gab dem Zeitungshändler zwei Dollar.
»Wer ist sie denn?«, fragte der Mann und deutete auf Marina. »Ihre Tochter?«
Joe wartete nicht aufs Wechselgeld. Mit seinem Pech würde er noch wegen Freiheitsberaubung einer schlecht gelaunten Minderjährigen festgenommen werden.
»Legen Sie das Gepäck wieder in den Kofferraum«, sagte er zu dem Taxifahrer, der mit ausdrucksloser Miene den ganzen Zirkus beobachtet hatte.
Dann ließ er Marina auf den Rücksitz plumpsen und stieg gerade noch rechtzeitig ein, ehe sie wieder fliehen konnte.
»Ich hasse das, Kid«, sagte er zu ihr. »Aber du lässt mir ja keine andere Wahl.«
Mit großen Augen sank sie in ihrem Sitz zusammen. Zweifellos sah sie sich schon mit Eisen an den Füßen. »Du hast meinem Vater geschworen, dass du mir nichts antust.«
»Was ich vorhabe, ist viel schlimmer«, sagte er, als sich der Fahrer wieder hinters Steuer klemmte. »Denn ich bringe dich nach New Jersey.«
»Traurig«, sagte Christine und fischte einen aufgeweichten Schokoriegel aus ihrer Handtasche. »Wirklich traurig.«
Mrs. TV-Shootingstar musste sich mit einem alten Milky Way und einem Päckchen Erdnüssen aus dem Flugzeug zum Abendessen begnügen. Zum Glück lag Slade in halb komatösem Zustand auf dem Sofa, denn sie war nicht gewillt, ihr karges Mahl mit jemandem zu teilen, nicht einmal mit einem mageren und heruntergekommenen Fotografen.
Wie konnte sie nur so wesentliche Dinge des Lebens wie Essen und eine Transportmöglichkeit vergessen? Sie hatte doch dafür gesorgt, dass im Haus nicht nur der Strom und das Telefon angestellt wurden, sondern auch ihr Büro funktionierte, samt Computer, Fax und Laser-Drucker. Morgen musste sie sofort ein Auto mieten und gleich zum Supermarkt fahren.
In den vergangenen sechs Jahren war sie so weit die Karriereleiter aufgestiegen, dass sie sich um alltägliche Dinge nicht mehr kümmern musste. Erst letzte Woche hatte sie zu einem Hollywood-Produzenten gesagt: »Meine Leute rufen dann Ihre Leute an«, und war in lautes Lachen ausgebrochen, während ihre Mitarbeiter nicht einmal gelächelt hatten. Joe hätte bei dieser Szene sicher auch losgeprustet. Er liebte das Absurde und ganz besonders mochte er es, wenn man einem aufgeblasenen Ego die Luft entzog.
Nachdem sie die letzten Nüsse gegessen hatte, ging sie in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken. Das war mindestens das sechste Mal, dass sie an ihren Ex-Mann dachte, seit sie vor ein paar Stunden ihr Haus betreten hatte. Nun, aber wie sollte sie hier nicht an Joe denken? In diesem Haus hatten sie schließlich ihr Leben geplant und wollten ihre Kinder großziehen.
Als sie ihr Glas füllte, gurgelte es in den Leitungsrohren.
»Das muss alles erneuert werden«, hatte ihnen der Klempner schon vor sechs Jahren geraten. »Eines Tages werden Sie den Hahn aufdrehen und es kommt nichts mehr raus.«
Aber sie hatten sich taub gestellt, genauso wie sie das Donnergrollen und die aufziehenden Gewitter in ihrer Ehe überhörten. Wenn sie nicht darüber redeten, würden die Unwetter schon vorbeiziehen. Und wenn sie so taten, als würden ihre Herzen nicht brechen, dann würden sie es auch nicht hören, wenn es wirklich zerbrach.
Sie nahm das Glas und ging ins Wohnzimmer zurück. Slade lag auf dem Rücken, ein Bein hing vom Sofa herunter. Das Gesicht hatte er in einem Kissen vergraben. Es war ein Wunder, dass er atmen konnte. Es sah entsetzlich unbequem aus, wie er dalag in seinen engen Jeans und seinem Pullover. Aber schließlich war noch niemand an unbequemer Kleidung gestorben.
Sie hockte sich auf die Sofaecke, trank einen Schluck Wasser und sagte zu dem Schlafenden: »Und was jetzt? Möchtest du vielleicht eine Runde durch die Nachtclubs machen?«
Nicht, dass es hier Nachtclubs gegeben hätte, nur zwei ganz gewöhnliche Kneipen.
Slade veränderte seine Lage und eine Haarsträhne fiel ihm in die Stirn. Christine beugte sich vor und strich sie ihm aus dem Gesicht. Sein Haar fühlte sich seidig an. Seine Haut war kühl. Sie wartete auf eine Reaktion, irgendetwas, ein Gefühl, das sich in ihr regte. Aber nichts geschah.
Es musste ja kein Feuerwerk sein. Ein sanftes Glühen hätte es auch getan. Eine kleine, flackernde Flamme. Nur so viel, damit sie wieder spürte, dass Christine Cannon mehr war als nur für Spitzen-Einschaltquoten verantwortlich.
Als im Licht der Scheinwerfer das Schild mit der Aufschrift Hackettstown sichtbar wurde, sagte Joe zum Taxifahrer, er solle die Ausfahrt nehmen.
Sofort erkannte er die Umgebung wieder. Die Bank vor der Kirche. Die Pizzeria an der Ecke. Die gewundene, mit Schlaglöchern übersäte Straße den Hügel hinauf zu ihrem Haus.
»Diese verdammte Straße wird unsere Stoßdämpfer ruinieren«, hatte er am Einzugstag gesagt.
»Was macht das schon? «, hatte Christine mit einem Schnippen ihrer schlanken Finger geantwortet. »Wenn wir reich und berühmt sind, lassen wir uns eine eigene Straße bauen.«
Fünf Minuten später stand er mit Marina oben auf der Einfahrt und sah, wie die Rücklichter des Taxis in der Dunkelheit verschwanden. Ihre Reisetasche aus Leinen lag auf seinem abgenutzten Lederkoffer neben der Treppe. Er rührte keinen Finger, um das Gepäck reinzutragen.
»Und das ist dein Haus?«, fragte Marina verdrießlich.
»Ja, das ist mein Haus«, antwortete Joe.
»Dann mach die Tür auf.«
»Geht nicht.«
»Natürlich geht das. Du schiebst einfach den Schlüssel ins Schloss und schon ist sie offen.«
»Wie klug du bist, Kid. Wenn du mir den Schlüssel gibst, tue ich es.«
»Wer braucht schon Schlüssel«, entgegnete sie leichthin. »Ich knacke das Schloss.«
Sie hielt Wort. Eine halbe Minute später stieß sie die Tür auf und winkte ihn ins Haus.
»Bist du sicher, dass du nicht ein paar Jahre in Brooklyn gelebt hast?«, fragte Joe.
Ric hatte ihm erzählt, seine geliebte Tochter habe Jahre in einem teuren Internat in England verbracht. Er fragte sich, ob der Vater stolz sein würde, wenn er wüsste, dass Marina ein Diplom als Einbrecherin besaß.
»Wo ist das Badezimmer?«, fragte sie.
»Ganz hinten, der Küche gegenüber.«
Sie nickte und verschwand. Joe tastete an der Wand nach dem Lichtschalter. Gleich darauf war der Flur hell erleuchtet.
»Verdammter Mist!«, schimpfte ein Mann. Die Stimme kam aus dem Wohnzimmer. »Mach das Scheißlicht aus!«
Sofort hatte sich Joe den Typen geschnappt, zerrte ihn hoch und schubste ihn dann gegen die Wand. Er hatte Haare wie ein Punk und uralte, schäbige Klamotten an.
»Ich gebe dir zehn Sekunden. Erklär mir, was du hier machst, sonst hole ich die Cops«, sagte er drohend.
Der Typ starrte ihn mit glasigen, haselnussbraunen Augen an. »Ich bin hier, weil ich betrunken bin.«
»Das reicht nicht.«
»Weil ich brillant bin.«
»Noch fünf Sekunden«, warnte Joe ihn, »oder du bist erledigt.«
»Meine Hände sind tödliche Waffen«, nuschelte der Typ und rülpste. »Hüte dich, mich anzurühren!«
Nach dem letzten Wort glitt er langsam an der Wand hinunter und blieb wie ein Häufchen Elend zu Joes Füßen liegen.
Dieser Säufer ließ sich seine Exzesse etwas kosten, dachte Joe, als er die leere Champagnerflasche auf dem Sofa sah. Dann überprüfte er die Seitenfenster und die Hintertür, konnte aber keine Spuren eines Einbruchs entdecken. Ein schrecklicher Gedanke kam ihm: Konnte der Typ ein Mieter sein, mit gültigem Vertrag und einem gierigen Anwalt, der ihn ‒ Joe ‒ nur zu gern bluten lassen würde?
»Scheißkerl!« Er rannte über den Flur zu den Schlafzimmern. Er brauchte nur eine zerbrochene Fensterscheibe. Fußabdrücke auf dem Sims. Irgendetwas als Beweis, dass der Typ in sein Haus eingebrochen war.
Joe überprüfte das erste Schlafzimmer. Nichts. Dasselbe beim zweiten Schlafzimmer.
Nun blieb nur noch das eheliche Schlafzimmer übrig, der Raum, den er früher einmal mit Christine geteilt hatte. Seit ihrer Scheidung hatte er ihn nicht mehr betreten, sogar dann nicht, als er ein paar Mal in seinem Haus gewohnt hatte. Zu viele Erinnerungen waren mit diesem Zimmer verbunden. Zu viele Träume. Doch jetzt war keine Zeit für Gefühlsduseleien.
Er drehte den Türknopf und trat ins Zimmer. Die Fenster standen offen und die Vorhänge bauschten sich in der nächtlichen Brise. Die Rollläden waren unten und intakt. Sekundenlang glaubte Joe, Christines Parfüm zu riechen. Eigentlich wollte er nicht hinschauen, aber sein Blick wanderte zu der Tapete mit dem Blumenmuster, dem Schminktisch in der Ecke und dann zu der Frau, die in dem Himmelbett schlief …
»So ein Mist«, murmelte er und wich zurück. Das Haus war vermietet. Er hatte den Typen im Wohnzimmer rumgeschubst und jetzt schnüffelte er fremden schlafenden Frauen nach. Sie würden ihm ihre Anwälte so schnell auf den Hals hetzen, dass ihm schwindelig werden würde. Er ging zur Tür und blieb dann stehen. Irgendetwas an der Schlafenden verwirrte ihn, zog ihn automatisch zu ihr zurück. Viel konnte er von ihr nicht erkennen, denn sie hatte die Decke bis über die Schultern hochgezogen. Es war verrückt, aber die Fremde erinnerte ihn an Christine.
Christine? Unmöglich. Seine Ex war in Los Angeles, wo sie mit den Filmstars auf du und du stand. Vorhin erst hatte er ihr Foto auf dem Titelblatt der Time gesehen. Was sollte sie wohl in ihrem Haus in Hackettstown, New Jersey?
Joe trat näher an das Bett heran. Die Fremde schlief auf der Seite, ganz so wie Christine zu schlafen pflegte. Ein Knie gebeugt, das andere Bein gestreckt umarmte sie das Kissen ‒ ganz wie sie ihn früher umarmt hatte, ehe alles in die Brüche ging. Er beugte sich über die Frau und atmete den Duft von Vent Vert ein … Und in diesem Moment war er wieder einundzwanzig und bis über beide Ohren in seine Traumfrau verliebt.
»Du lieber Himmel!«, murmelte er. Es war Christine. Ihr Haar war kürzer und blonder. Wie ein Schleier aus Seide fiel es über ihre Wange. Die Decke verrutschte etwas und entblößte ihre, von der kalifornischen Sonne leicht gebräunte Schulter. Er fragte sich, ob sie unter der Decke nackt war. Und dann sagte er sich, dass ihn das überhaupt nichts angehe.
Christine bewegte sich. Die Decke rutschte noch etwas tiefer.
Er machte eine Bewegung, doch dann wurde ihm schmerzlich bewusst, dass dies dieselbe Frau war, die ihn verlassen hatte; um zu sich selbst zu finden. Und deswegen hatte sie alles aufgegeben, wovon sie beide jemals geträumt, was sie jemals geteilt hatten. Den Mut, ihm das ins Gesicht zu sagen, besaß sie nicht, sondern sie ging, als er in Washington den Vizepräsidenten interviewte. Nichts war ihm geblieben als ein kümmerlicher Zettel mit dürren Worten als Erklärung ‒ und seine Erinnerungen, für die er am liebsten seine Seele verkauft hätte, um sie zu vergessen.
Christine nackt und bereit.
Christine voll glühender Begeisterung über einen neuen Auftrag.
Sie rollte sich auf den Rücken. Jetzt verrutschte die Decke und entblößte die sanfte Rundung ihrer Brüste.
Christine nackt …
Joe räusperte sich.
Sie murmelte etwas im Schlaf.
Er gab ihr einen kleinen Stups.
Sie legte sich wieder auf die Seite.
»Christine.«
»Geh weg«, murmelte sie und legte den Arm über ihre Augen. »Es ist schon spät.«
»Komm, Chris. Wach auf.«
Sie murmelte lauter, aber nichts Verständliches.
Früher hätte er ihr die Decke weggezogen und sich neben sie gelegt, den Duft und die Wärme ihres Körpers genossen, während er sie mit zärtlichem Streicheln geweckt hätte. Die Erinnerung an vergangene Tage war so stark, dass sie sich mit der Gegenwart gefährlich zu vermischen begann.
»Himmel noch mal, Slade!«, murmelte Christine. »Es ist mitten in der Nacht. Kannst du dich denn nicht allein amüsieren?«
»Wer, zum Teufel, ist Slade?«
Seit wann hatte Slade einen amerikanischen Akzent? Noch präziser, seit wann hatte er den Akzent ihres Ex-Mannes?
Gott sei Dank war das unmöglich. Joe war Tausende von Meilen entfernt in einem namenlosen Land, wo er für Gerechtigkeit und Demokratie focht, während sie für einen Oscar oder eine Emmy oder einen Grammy kämpfte.
Christine machte die Augen auf und betrachtete den Mann neben ihrem Bett, dann schloss sie die Augen wieder. Das war ein Traum in einem Traum, nichts anderes. So etwas passierte in ihrem sorgfältig geplanten ordentlichen Leben nicht.
»Zu spät«, sagte Joe. »Ich weiß, dass du wach bist.«
Da atmete sie seinen Geruch ein und ein Schauder durchlief ihren Körper. Ein sinnliches Begehren, das sie schon vergessen glaubte.
Trotzdem dachte sie: Geh weg, Joe. Ich will dich nicht hier haben. Verschwinde nach Europa, da gehörst du hin.
Wieder öffnete sie die Augen und setzte sich auf, die Bettdecke bis ans Kinn hochgezogen. »Um Himmels willen, was tust du hier?«
»Dasselbe könnte ich dich fragen.«
Er sah älter aus. Nach sechs Jahren war das nicht verwunderlich. In seinem Gesicht waren Falten, die sie nicht kannte. Und er hatte Schatten unter den Augen.
»Ich renne schließlich nicht in Europa rum.«
Joe schwieg, hob nur leicht die linke Braue.
»Du hast gute Artikel geschrieben. Ich habe sie gern gelesen.«
»Du hast sie also gelesen.«
»Ich habe sie gelesen.« Die Decke verrutschte und Christine zog sie schnell wieder hoch.
»Du bist gar nicht nackt«, sagte Joe. »Also brauchst du keine Angst zu haben.«
»Woher willst du das wissen?«
»Ich habe nachgeschaut.«
»Das glaube ich nicht. Hättest du das getan, wüsstest du, dass ich nackt bin.«
Sie sahen sich in die Augen. Christine war, als würde ihr Herzschlag kurz aussetzen. Dann beugte sich Joe vor und musterte ihr Gesicht.
»Seit wann hast du blaue Augen? Früher waren sie grau.«
»Ich hatte schon immer blaugraue Augen.«
»Aber nicht so blaue.«
Sie fing an zu lachen. Nicht einmal ihre engsten Mitarbeiter in L.A. hatten einen Kommentar zur Farbe ihrer Augen abgegeben. »Kontaktlinsen«, antwortete Christine. »Sie können Wunder vollbringen.«
»Das Grau hat mir besser gefallen.«
»Aber Blau sieht vor der Kamera besser aus.«
»Hast du deshalb auch dein Haar gebleicht?«
»Ich habe mein Haar nicht gebleicht«, sagte sie. Und fügte nach einer Pause hinzu: »Das sind Strähnen.«
»Es sieht blonder aus.«
»Das soll es auch.«
»Für die Kamera?«, fragte Joe lakonisch.
»Für mich.«
»Was hast du sonst noch geändert?«
»Nichts, was dich interessieren dürfte.« In dem Moment hörte Christine Stimmen im Flur und fragte: »Mit wem redet Slade da?«
»Ich hab dich schon mal gefragt: Wer ist Slade?«, sagte Joe mit zusammengepressten Zähnen.
»Hast du jemanden mitgebracht?«, fragte Christine.
Eigentlich ging es sie überhaupt nichts an, was Joe wo tat. Aber der Gedanke, dass er hier, in ihrem gemeinsamen Haus, mit einer anderen Frau zusammen war, wurmte sie.
»Wenn du meine Frage beantwortest, beantworte ich deine.«
»Ich war zuerst hier«, entgegnete Christine und klang dabei wie eine Fünfjährige.
»Ja«, gab Joe zu. Aber ich habe zuerst gefragt.«
»Ein Lächeln für die Kamera, Leute!« Ein Blitzlicht erhellte das Zimmer. »Ich hatte dich doch um ein Lächeln gebeten, Chris, Schätzchen.«
»Kannst du nicht klopfen?«, rügte sie Slade in scharfem Ton und kam sich plötzlich wehrlos und ausgenutzt vor. »Wir sind hier nicht auf einem Bahnhof.«
»Die Tür war offen«, entgegnete Slade und kam ins Zimmer, als wäre er hier zu Hause, keine geringe Leistung in Anbetracht seines Alkoholspiegels. »Übrigens, du brauchst uns nicht vorzustellen. Ich habe Rambo bereits kennen gelernt.«
»Wovon redet er?«, fragte Christine, an Joe gewandt.
»Ich habe ihn mir kurz vorgeknöpft«, sagte Joe obenhin. »Denn ich hielt ihn für einen Einbrecher.«
»Ja, Sie haben mich tätlich angegriffen«, sagte Slade und stürzte sich mit vor Wut funkelnden Augen auf Joe. »Ich verlor das Bewusstsein.«
Joe schob ihn beiseite, als hätte er eine lästige Fliege verscheucht. »Einen schönen Lügner hast du da an Land gezogen, Christine. Viel Spaß. Du zeigst wirklich ein unglaubliches Geschick in der Wahl deiner Freunde.«
»Verdammter Scheißkerl!«, brüllte Slade und hielt seine Hasselblad schützend vor die Brust.
Joe ballte die Hand zur Faust, trat einen Schritt zurück, bereit zuzuschlagen ‒ da erhob Christine ihre Stimme.
»Raus hier! Alle beide!«, befahl sie und versuchte, autoritär zu klingen. »Das ist mein Schlafzimmer und wenn ihr nicht gleich verschwindet, rufe ich die Polizei und lasse euch einsperren. Das ist mein voller Ernst.«
Nicht nur, dass die Männer nicht reagierten, in dem Augenblick tauchte eine dritte Person im Türrahmen von Christines Schlafzimmer auf.
»Joseph«, sagte das unscheinbare Mädchen in den Kampfhosen und dem verlotterten übergroßen Pullover. »Wie kannst du mich nur mit diesem betrunkenen Irren allein lassen?«
Die anderen schienen für sie nicht zu existieren.
Doch Slade drehte sich schnell um und machte zwei Aufnahmen von ihr. »Du hast vergessen zu lächeln, Schätzchen.«
Das Mädchen wollte nach seiner Kamera greifen und giftete: »Kein Mensch hat das Recht, mich ohne meine Erlaubnis zu fotografieren.«
Doch Slade hielt seine Hasselblad außerhalb ihrer Reichweite. »Wenn du diese Kamera anrührst, ist das das Letzte, was du tust.«
Aus den Augen der kleinen Person schossen wütende Blitze, sie stürzte sich wie eine Furie auf den Fotografen, während sie eine Reihe unflätiger Flüche ausstieß, was Christine veranlasste, die Kleine mit einer Mischung aus Entsetzen und Bewunderung anzustarren.
»Sag ihr, wer ich bin!«, flehte Slade Christine an.
»Sag ihm, wer ich bin!«, befahl das Mädchen Joe und trat Slade vors Schienbein.
»Du zuerst«, sagte Joe, an Christine gewandt.
»Das ist Slade«, gab Christine nach. Sie wünschte sich sehnlichst, sie hätte sich in einem ruhigen Hotel mit Zimmerservice und einem Schloss an der Tür eingemietet. »Er ist mein Fotograf.« Dann deutete sie auf das hässliche kleine Ding. »Und wer ist sie?«
»Ich bin Marina«, antwortete das Mädchen und schritt in den Raum, als wäre sie zur Königin geboren. »Und ich bin Josephs Frau.«
Kapitel 2
»Sehr lustig«, sagte Christine laut lachend. Und fügte, an Joe gewandt, hinzu: »Und wer ist sie wirklich?«
Joe lachte nicht. »Sie ist meine Frau, Chris.«
»Du machst Witze.« Das musste ein Witz sein. Das Mädchen hätte seine Tochter sein können.
»Ich mache keine Witze«, antwortete er, noch immer ohne ein Lächeln. »Willst du die Heiratsurkunde sehen?«
»Du schleppst dieses Dokument mit dir herum?« Christine warf Marina einen kurzen Blick zu. Die junge Frau starrte beide mit unverhüllter Neugier an. Wieder an Joe gewandt, fuhr sie fort: »Wenn ich es mir richtig überlege, ist das vielleicht keine schlechte Idee.«
»Was soll das denn heißen?«
Sie schüttelte ihr Kopfkissen zurecht und setzte sich kerzengerade hin. »Hast du schon mal das Wort ›minderjährig‹ gehört?«
»Minderjährig?«, echote Slade vom Türrahmen her.
»Verschwinde und koch Kaffee!«, befahl Christine ihm. »Und leg endlich diese Kamera weg.«
Joe sah seine Ex fragend an. »Behandelst du neuerdings deine Freunde so?«, sagte er mit einem ironischen Unterton.
»Slade ist nicht mein Freund.«
»Du schläfst doch mit ihm, oder nicht?«
»Das geht dich nichts an.«
»Ja«, entgegnete Joe finster. »Also schläfst du mit ihm.«
»Soll ich die Polizei rufen?«, fragte Slade und trat näher. »Die beiden sind hier eingebrochen. Das reicht doch für ein paar Tage Knast. Sogar in New Jersey.«
»Wir sind nicht eingebrochen«, sagte Marina. »An der Tür ist kein Schaden entstanden. Ich habe das Schloss einfach geknackt.«
»So jung und so praktisch veranlagt. Sie ist richtig lustig. Du musst ein glücklicher Mann sein, Joe.«
»Niemand kann eingesperrt werden, weil er in sein eigenes Haus eingebrochen ist«, entgegnete Joe.
»Ich dachte, es sei dein Haus«, sagte Slade zu Christine.
»Es ist mein Haus«, erwiderte Christine mit wachsender Verärgerung.
»Was soll das eigentlich?«, fragte Joe, nun ebenfalls verärgert.
»Verdammt noch mal!«, blaffte Christine. »Es ist unser Haus, okay?«
Slade musterte Joe mit übertriebener Geringschätzung und meinte dann zu Christine: »Mit dem da hast du ein Haus gekauft?«
»Wir waren damals verheiratet und das schien uns eine gute Idee zu sein«, antwortete sie.
»Du warst mit ihr verheiratet?«, fragte die Kindfrau Joe.
»Ich habe volles Verständnis für ihre Verwirrung. Schließlich bin ich schon seit längerer Zeit volljährig.«
»Lass sie in Ruhe, Christine«, warnte Joe seine Ex. »Das alles ist ganz anders als du denkst.«
»Wie kannst du wissen, was ich denke?«, sagte sie. Wie konnte er das wissen, wenn sie es selbst nicht einmal wusste?
»Worüber redet ihr überhaupt?«, mischte sich Slade ein. »Über Bigamie?«
»Leider muss ich Sie enttäuschen, mein Junge«, sagte Joe. »Denn wir sind geschieden.« Christine fragte er: »Wo hast du den denn aufgegabelt?«
»Slade fotografiert mich für einen Artikel in Vanity Fair.«
»Und?«
»Und nichts. Das ist alles.«
»Das tut weh«, sagte Slade. »Ich dachte, ich würde dir mehr als meine Stroboskoplampe und ein rosa Filter vor meinem Objektiv bedeuten.«
»Joseph.« Die Kindfrau trat ans Fußende des Betts. »Ich brauche ein Bad.«
Eine dunkle Vorahnung beschlich Christine. »Du und deine … Frau … ihr wollt doch nicht etwa hier bleiben?«
Joe schien diese Aussicht ebenso wenig zu begeistern wie Christine. »Hmm. Doch. Ja. Das hatte ich geplant«, sagte er zögernd.
»Unter den gegebenen Umständen scheint mit das keine sehr gute Idee zu sein.«
»Du und Glade …«
»Slade.«
»Wie auch immer er heißen mag. Ihr beide könnt euch doch anderswo etwas suchen.« Er machte eine Pause. »Natürlich komme ich für die Kosten auf.«
»Dein Geld brauche ich wirklich nicht«, sagte Christine lachend. »Ich verdiene inzwischen ganz gut, Joe.«
Grinsend verzog sie den linken Mundwinkel. Ach, wie er früher dieses Grinsen an ihr geliebt hatte. Aber jetzt tat es weh.
»Naja. Schließlich hast du’s bis aufs Titelblatt der Time gebracht, Christine. Also wirklich bis nach ganz oben.«
»Du hast die Time gesehen?«, fragte sie und dachte: Fast alle meine Träume sind wahr geworden, Joe. Kannst du mir sagen, warum ich dann nicht glücklich bin?
»Ja, ich habe die Time gesehen und ein Poster auf der Rückseite eines Busses. Du hast wohl die beste aller PR-Firmen für dich engagiert, oder sehe ich das falsch?«
Joe sah wirklich beeindruckt aus. Irgendwie freute Christine das mehr als jeder andere Erfolg der letzten Monate.
»Um diese Dinge kümmert sich der Sender, damit hab ich nichts zu tun«, antwortete sie und versuchte, lässig zu klingen. »Ich muss nur präsent sein.«
Beide wussten, dass das nicht stimmte. Christine hatte sich jeden Erfolg hart erarbeitet; und Joe hatte früher viel dazu beigetragen. Nichts war ihr in den Schoß gefallen. Das musste er wissen. Sie hatte doppelt so viel lernen müssen wie er und dreimal so viel Zeit investiert, um auf dem College mit ihm Schritt halten zu können. Selbst nachdem sie beide ihren Hochschulabschluss gemacht hatten, änderte sich daran nichts. Joe schrieb seriöse Artikel, die Menschen bewegten, während Christine ihre ersten Erfolge mit Storys über Filmstars bei irgendwelchen Eröffnungen hatte.
Als Marina plötzlich leicht schwankte, ging Joe schnell zu ihr und zog sie an seine Seite. Eine einfache Geste. Sie war so klein und mager. Er hielt sie wie man ein Kind hält und tröstet.
Wie kannst du nur, Joe, dachte Christine. Das sind Gesten, von denen ich glaubte, dass sie nur mir gehören. Was für ein idiotischer Gedanke, schalt sie sich gleich darauf. Was er auch immer und mit wem auch immer tat, ging sie überhaupt nichts an.
»Sie braucht Schlaf«, sagte Joe plötzlich. »In welches Zimmer darf ich sie bringen?«
Christine brauchte eine Sekunde, um ihre Fassung wiederzugewinnen. »Ins … ins hintere Schlafzimmer.« Sie räusperte sich. »Das mit dem Doppelbett.«
Ihre Blicke trafen sich. Christine konnte den Anblick der schon fast schlafenden Kindfrau in Joes Armen nicht mehr ertragen. Sie schaute weg.
»Morgen früh reden wir über alles«, sagte er über den Kopf seiner Frau hinweg.
»Ja. Morgen früh«, antwortete Christine und nickte.
Am liebsten hätte sie mit den Fingern geschnippt und die ganze Bande verschwinden lassen. Joe und seine kleine Frau. Slade mit seinen wissenden Augen. Und dieses Haus voller Erinnerungen, die sie längst vergessen glaubte. Sie hasste dieses Gefühl der Verletzbarkeit und Einsamkeit. Sie kam sich ärmlich vor und glaubte, ihr Herz würde gleich brechen.
»Das ist also dein Ex«, sagte Slade, als sich die Schlafzimmertür hinter Joe und seiner Frau geschlossen hatte.
»Darüber will ich nicht reden, Slade.«
»Ein unhöflicher Kerl, aber photogen ist er. Das muss man ihm lassen. Du hättest eine schlechtere Wahl treffen können.«
»Hör auf damit!«, warnte sie ihn. »Ich bin nicht in Stimmung.«
»Was ärgert dich denn, Schätzchen? Dass er verheiratet ist oder dass du es nicht bist?«
Eine Antwort hatte Slade nicht erwartet.
Feingefühl oder Takt waren für ihn Fremdworte und trotz seines Mangels an Sensibilität hatte er etwas in Christines Blick gesehen, das ihm sagte, er dürfe im Moment nicht weiterbohren. Innerhalb von Sekunden war ihm klar geworden, dass noch immer eine intensive Beziehung zwischen Christine und ihrem Ex-Mann existierte und mit ihrer Scheidung noch längst nicht alles zu Ende war. Es sei denn, sie gehörten zu jener Kategorie Menschen ‒ wie Slade ‒ die ihre Gefühle beliebig an- und ausknipsen konnten.
Leider war der Champagner alle. Die leere Flasche glitzerte zwischen den Sofakissen. Und leider verlor Christine auch nie die Kontrolle über sich. Doch er war überzeugt, dass sie ihm nach ein paar Gläsern Schampus ihre Geheimnisse anvertrauen würde.
Er ließ die Sektflasche auf den Boden fallen und sah, wie sie unter den Couchtisch rollte. Im Haus war es still. Ihm fehlte die Hektik des Großstadtlebens, der lärmende Verkehr, die Sirenen, die quietschenden Reifen, das laute Geschrei und Fluchen der Menschen. Denn er liebte die Anonymität, in der er untertauchen und in jede beliebige Person schlüpfen, sich ständig neu erfinden konnte, bis er mit dem Resultat zufrieden war.