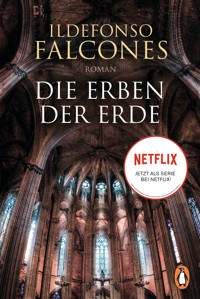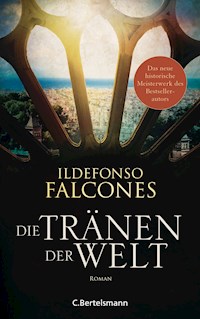9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sevilla 1748: Die freigelassene Sklavin Caridad findet Zuflucht bei der Zigeunerfamilie Vega. Hier freundet sie sich mit der schönen Sängerin Milagros an. Beide wissen, was es heißt, einem unterdrückten Volk anzugehören – noch dazu als Frau in einer von Männern beherrschten Welt. Ihre von Schicksalsschlägen gezeichneten Lebenswege führen sie von den sonnenverbrannten Ebenen Andalusiens in die prunkvollen Straßen und Theater der Königsresidenz Madrid.
Ildefonso Falcones’ opulenter Roman erzählt von Schmerz und Trauer, Liebe und Freundschaft, Hass und Verrat, Sehnsucht und Hoffnung – und von der Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1135
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Ildefonso Falcones
DAS LIED DER FREIHEIT
Roman
Deutsch von Stefanie Karg
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »La reina descalza« bei Grijalbo, Random House Mondadori, S.A., Barcelona.
Die Übersetzerin dankt Heike Peetz für ihre Unterstützung bei der Recherche und Korrektur.
Begriffe wie Negerin, Zigeuner usw. wurden aus Gründen der historischen Authentizität verwendet; sie entsprechen dem damaligen Sprachgebrauch.
»Elegie des Cantaor« zitiert nach Bernard Leblon (Hrsg.), Flamenco, übersetzt von Maximilien Vogel, mit freundlicher Genehmigung des Palmyra Verlags, Heidelberg.
Copyright © 2013 by Ildefonso Falcones de Sierra
Translated from the original edition of Random House Mondadori, Barcelona 2013
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: arcangel/Nik Keevil; Getty Images/Nick White und shutterstock/Tamara Kulikova
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12375-8V004
www.penguin.de
Zum Gedenken an meine Eltern
Flamenco bedeutet:
ein anderer Körper,
Seele, Leidenschaften, Gefühle, Triebe und Begierden;
ein anderer Blick auf die Welt,
mit großartigem Gespür;
das Los der Erkenntnis,
Musik in den Nerven,
wilde Unabhängigkeit,
Freude voller Tränen,
und Schmerz, Leben und
Liebe im Schatten;
Hass auf die Routine,
auf die Methode, die einen beschneidet;
sich versenken in Gesang,
in Wein und in Küsse;
in feine Kunst verwandeln das Leben,
voller Launen und Freiheit;
die Ketten der Mittelmäßigkeit nicht gelten lassen;
in allem eine Herausforderung sehen;
sich genießen, sich hingeben, sich spüren,
leben!
TOMÁS BORRÁS, »Elegie des Cantaor«
I Großartige Göttin
1
Hafen von Cádiz, 7. Januar 1748
Als sie den Kai schon fast mit dem Fuß berührte, zögerte Caridad. Sie verharrte auf der Laufplanke der Feluke, mit der die Passagiere der La Reina ausgebootet wurden, des Kriegsschiffs, das sechs Handelsschiffe mit wertvollen Waren über den Ozean begleitet hatte. Die Frau hob den Blick zu der Wintersonne, die das geschäftige Treiben im Hafen in helles Licht tauchte: Die Ladung eines der Handelsschiffe, das mit ihnen in Havanna aufgebrochen war, wurde gerade gelöscht. Die Sonne stahl sich durch die Ritzen ihres schäbigen Strohhutes und blendete sie. Der Lärm verstörte sie, und sie verkrampfte sich ängstlich, als gälte all das Schreien und Rufen ihrer Person.
»He, du da, weiter!«, schnauzte ein Seemann die dunkelhäutige Frau an und drängelte sich rücksichtslos an ihr vorbei.
Caridad stolperte und wäre beinahe ins Wasser gefallen. Schon wollte der Nächste sie überholen, doch da sprang sie ungelenk auf den Kai, trat zur Seite und blieb wieder stehen, während die Seeleute unter Lachen und Scherzen weiter entluden und gewagte Wetten über die Weiber abschlossen, bei denen sie sich für die lange Ozeanüberfahrt entschädigen würden.
»Genieß deine Freiheit!«, rief ein anderer Mann, als er an der Schwarzen vorbeiging und sich dazu hinreißen ließ, sie heftig in die Oberschenkel zu kneifen.
Seine Gefährten lachten. Caridad reagierte nicht, sie starrte auf den langen schmutzigen Pferdeschwanz, der auf dem Rücken des Matrosen hin und her tanzte und dessen Lumpenhemd streifte, bis der Mann sich mit schwankenden Schritten in Richtung der Puerta de Mar verlor.
Freiheit?, fragte sie sich. Welche Freiheit? Sie sah über den Kai hinweg zur Stadtmauer. Die meisten der mehr als fünfhundert Besatzungsmitglieder der La Reina drängten sich vor dem Stadttor, wo ein ganzes Heer von Amtspersonen – bestehend aus Vorstehern, Wachleuten und Prüfern – sie auf der Suche nach illegalen Waren filzte und über den Verlauf der Überfahrt befragte. Die Seeleute warteten ungeduldig darauf, die Prozedur hinter sich zu bringen, manche forderten lauthals, unverzüglich durchgelassen zu werden, doch die Inspektoren gaben nicht nach. La Reina, die nun majestätisch vor der Insel Trocadero vor Anker lag, hatte in ihrem Schiffsbauch mehr als zwei Millionen Pesos transportiert und fast ebenso viele Silberbarren, aber auch Caridad und ihren Besitzer Don José.
Dieser verdammte Don José! Caridad hatte ihn während der Überfahrt gepflegt. »Schiffspest«, hatten die Männer an Bord gesagt. »Er wird sterben«, waren sie sich einig gewesen. Und er starb tatsächlich, nach einer langen Agonie, während der sich sein Körper Tag um Tag in gewaltigen Schwellungen, Fieberschüben und Blutungen aufzehrte. Einen ganzen Monat lang waren Don José und seine Sklavin in einer kleinen stickigen Kabine eingesperrt, in der es nur eine Hängematte gab. Don José hatte tief in die Tasche gegriffen, damit der Kapitän von der Kajüte im Heck, die von den Schiffsoffizieren gemeinsam genutzt wurde, für ihn und seine Sklavin einen kleinen Raum abteilte.
»Eleggua, mach, dass seine Seele niemals Ruhe findet! Eleggua, mach, dass sie weiter umherirrt«, hatte Caridad gefleht, während sie in der engen Kabine die machtvolle Gegenwart des Höchsten Wesens gespürt hatte, des Gottes, der das Schicksal der Menschen bestimmte. Und als ob Don José ihre Stimme vernommen hätte, hatte er sie mit grausig finsteren Augen um Mitleid angefleht und Hilfe suchend die Hand nach ihr ausgestreckt. Aber Caridad hatte ihm jeden Trost verweigert. Hatte sie damals nicht auch verzweifelt die Hand ausgestreckt, als man ihr den kleinen Marcelo wegnahm? Und was hatte ihr Herr daraufhin getan? Er hatte dem Vorarbeiter der Tabakplantage befohlen, sie festzuhalten, und einen anderen schwarzen Sklaven angebrüllt, den Kleinen mitzunehmen.
»Sieh zu, dass er Ruhe gibt!«, hatte er drohend auf dem Vorplatz vor dem großen Haus verlangt, wo die Sklaven versammelt waren, um zu erfahren, wer ihr neuer Besitzer werden würde und welches Schicksal sie von nun an erwartete. »Das ist ja nicht auszuhalten …«
Dann hatte Don José plötzlich geschwiegen. Die Verwunderung war den Sklaven an den Gesichtern abzulesen gewesen. Caridad war es gelungen, sich dem Vorarbeiter zu entwinden, um zu ihrem kleinen Sohn zu laufen, doch sogleich war sie sich ihrer Unvorsichtigkeit bewusst geworden und stehen geblieben. Eine Weile waren nur die verzweifelten Schreie Marcelos zu vernehmen gewesen.
»Soll ich sie auspeitschen, Don José?«, hatte der Vorarbeiter gefragt, als er Caridad wieder am Arm packte.
»Nein«, hatte Don José nach kurzer Überlegung gesagt. »Ich habe keine Lust, sie verletzt mit nach Spanien zu nehmen.«
Cecilio, der große Sklave, hatte Caridad daraufhin losgelassen und den kleinen Marcelo unter dem strengen Blick des Vorarbeiters zur Hütte geschleift. Caridad war auf die Knie gefallen, und ihr Klagen hatte sich mit dem Weinen des Jungen vermischt. Damals hatte sie ihren Sohn zum letzten Mal gesehen. Sie durfte sich nicht einmal von ihm verabschieden, man gestattete ihr nicht …
»Caridad! Frau, was stehst du da herum?«
Als sie ihren Namen hörte, kehrte sie in die Gegenwart zurück. Es war die Stimme von Don Damián, dem alten Kaplan der La Reina, der ebenfalls an Land gegangen war. Sogleich ließ sie ihr Bündel fallen, zog den Hut, senkte den Blick und starrte auf ihre schäbige Kopfbedeckung, die ihre Hände jetzt zerdrückten.
»Du kannst hier nicht auf dem Kai stehen bleiben«, ermahnte der Priester sie und nahm sie am Arm. Die Berührung dauerte nur einen Augenblick, dann löste der Geistliche verwirrt die Hand. »Los«, trieb er sie an, »komm mit!«
Gemeinsam gingen sie zum Stadttor, Don Damián, mit einer kleinen Truhe beladen, und Caridad, das Bündel und den Hut in Händen, den Blick auf die Sandalen des Kaplans geheftet.
»Weg frei für einen Gottesmann!«, forderte der Priester die Seeleute auf, die sich vor dem Stadttor drängten.
Die Menschenmenge trat auseinander, um Platz zu machen. Caridad folgte ihm, schwarz wie Ebenholz, mit gesenktem Kopf, barfuß und mit schleppendem Schritt. Doch das lange graue Hemd aus grobem, rauem Stoff, das ihr als Gewand diente, konnte sie nicht richtig verhüllen: Sie war eine große, wohlgeformte Frau – viele Seeleute sahen auf, um ihr dichtes schwarzes Kraushaar zu betrachten, während andere ihre festen, üppigen Brüste und ihre ausladenden Hüften bewunderten. Der Kaplan ließ sich nicht aufhalten, hob jedoch mahnend die Hand, wenn er Pfiffe oder unverschämte Rufe oder eine allzu dreiste Bemerkung vernahm.
»Ich bin Pater Damián García«, stellte sich der Priester vor und breitete seine Papiere vor einem der Vorsteher aus, sobald sie die Seeleute hinter sich gelassen hatten. »Der Kaplan des Kriegsschiffes La Reina der Armada Seiner Majestät.«
Der Amtmann begutachtete die Dokumente.
»Gestatten Padre, dass ich Eure Truhe untersuche?«
»Persönliche Dinge …«, antwortete der Priester und öffnete die Truhe. »Die Waren sind ordnungsgemäß in den Dokumenten verzeichnet.«
Der Vorsteher nickte und fing an, den Inhalt zu durchwühlen.
»Irgendwelche Zwischenfälle während der Überfahrt?«, fragte er, ohne den Priester anzusehen, und wog einen kleinen Tabakriegel in der Hand. »Irgendwelche Begegnungen mit feindlichen Schiffen oder mit Schiffen, die nicht zur Flotte gehören?«
»Nichts dergleichen. Alles ist nach Plan verlaufen.«
Der Vorsteher nickte.
»Eure Sklavin?«, fragte er und deutete auf Caridad, nachdem er offensichtlich die Kontrolle beendet hatte. »Sie steht nicht in den Papieren.«
»Die Frau? Nein. Sie ist frei.«
»Sie sieht aber nicht so aus«, stellte der Vorsteher fest und baute sich vor Caridad auf, die ihr Bündel und ihren Strohhut fest umklammerte.
»Verdammte Negerin, sieh mich an!«, herrschte der Amtmann sie an. »Was versteckst du da?«
Einige der Männer, die mit der Kontrolle der Seeleute beschäftigt waren, unterbrachen ihr Tun und blickten zu der Schwarzen, die reglos, mit gesenktem Kopf vor dem Amtmann stand. Die Seeleute, die den Geistlichen und Caridad vorgelassen hatten, traten näher.
»Nichts. Sie versteckt nichts«, entfuhr es Don Damián.
»Schweigt, Padre! Wer einem Amtmann nicht in die Augen sehen kann, hat etwas zu verbergen.«
»Was soll die Arme schon zu verbergen haben?« Der Priester gab nicht nach. »Caridad, zeig ihm deine Papiere!«
Die Frau wühlte in dem Bündel nach den Dokumenten, die ihr der Schiffsschreiber überreicht hatte, und Don Damián sprach weiter:
»Sie ist in Havanna zusammen mit ihrem Besitzer Don José Hidalgo an Bord gegangen. Ihr Herr wollte in seine Heimat zurückkehren, doch er ist während der Überfahrt gestorben, Gott hab ihn selig.«
Caridad überreichte dem Vorsteher ihre zerknitterten Dokumente.
»Vor seinem Tod«, erklärte nun Don Damián, »hat Don José sein Testament gemacht und darin die Freilassung seiner Sklavin Caridad bestimmt. Hier haben Sie das Schriftstück über die Freilassung, das der Schreiber des Flaggschiffs ausgestellt hat.«
»Caridad Hidalgo«, las der Vorsteher in dem Dokument, in dem der Schreiber den Nachnamen des verstorbenen Besitzers eingesetzt hatte, »auch Cachita genannt, Sklavin von schwarzer Farbe wie das Ebenholz, gesund und von kräftigem Wuchs, mit schwarzem Kraushaar, im Alter von etwa fünfundzwanzig Jahren befindlich.«
»Was hast du da in dem Beutel?«, fragte der Vorsteher, nachdem er die Dokumente gelesen hatte, die Caridads Freiheit bestätigten.
Die Frau öffnete ihr Bündel und zeigte es ihm. Eine alte Decke und eine Jacke aus grobem Flanell. Das war ihr gesamter Besitz: Die Jacke hatte der Plantagenbesitzer ihr im letzten Winter gegeben, die Decke vor zwei Wintern. Zwischen den Stoffsachen verborgen, steckten noch ein paar Zigarren, die sie Don José auf dem Schiff stibitzt hatte. Was, wenn sie die entdecken?, fragte Caridad sich ängstlich. Der Amtmann wollte gerade das Bündel genauer untersuchen, doch als er die alten Kleider sah, verzog er nur angewidert das Gesicht.
»Sieh mich an!«, herrschte er die Schwarze an.
Caridad zitterte am ganzen Leib. Sie hatte noch nie einen weißen Mann angesehen, wenn dieser mit ihr sprach.
»Sie hat Angst«, griff Don Damián ein.
»Ich habe gesagt, dass sie mich ansehen soll!«
»Tu es«, bat der Kaplan.
Caridad hob den rundlichen Kopf mit den kräftigen Lippen, der kurzen Nase und den kleinen braunen Augen und blickte am Vorsteher vorbei in Richtung Stadt.
Der Amtmann runzelte die Stirn und versuchte vergeblich, den flüchtigen Blick der Frau zu erhaschen. »Der Nächste«, sagte er schließlich. Die Anspannung ließ nach, und ein ganzer Trupp Seeleute drängte sich auf ihn zu.
Don Damián, mit Caridad immer dicht auf den Fersen, durchquerte die Puerta de Mar mit den beiden zinnenbesetzten Türmen und betrat die Stadt. Die La Reina, mit der sie aus Havanna gekommen waren, ließen sie hinter sich zurück. Der Zweidecker mit mehr als siebzig Kanonen lag vor Trocadero auf Reede, zusammen mit den sechs Handelsschiffen, die er eskortiert hatte und deren Laderäume mit Waren aus Amerika angefüllt waren: Zucker, Tabak, Kakao, Ingwer, Sarsaparille, Indigo, Koschenille, Seide, Perlen, Schildpatt … und Silber. Cádiz hatte sie mit Glockengeläut empfangen. Spanien stand mit England im Krieg, deshalb hatte die Ankunft der Waren und der Schätze, die für die Kassen der spanischen Finanzbehörde dringend benötigt wurden, eine festliche Stimmung ausgelöst, die überall in der Stadt zu spüren war.
Das Stadttor und die Iglesia de Nuestra Señora del Pópulo lagen inzwischen hinter ihnen, und als sie die Calle del Juego de Pelota erreichten, scherte Don Damián aus dem Strom der Seeleute, Soldaten und Händler aus und blieb stehen.
»Möge Gott dich begleiten und behüten, Caridad«, sagte er, während er sich zu ihr umdrehte und die Truhe auf den Boden stellte.
Die Frau gab keine Antwort.
»Ich habe zu tun, verstehst du?«, versuchte er sich zu entschuldigen. »Such dir irgendeine Arbeit. Cádiz ist eine reiche Stadt.«
Don Damián unterstrich seine Worte mit einer Handbewegung. Dabei streifte er Caridads Unterarm. Er senkte den Kopf. Als er wieder aufsah, blickte er in Caridads braune Augen, die auf ihn geheftet waren, so wie während der Nächte der Überfahrt, als er sich der Sklavin nach dem Tod ihres Besitzers angenommen hatte und sie auf Anweisung des Kapitäns vor der Besatzung versteckt hielt. Ihm drehte sich der Magen um. Ich habe sie nicht angefasst, sagte er sich zum wiederholten Mal. Ja, er hatte sie nie berührt, doch Caridad hatte ihn mit ausdruckslosen Augen betrachtet, und er … er hatte nicht umhin gekonnt und sich beim Anblick des üppigen Weibes unter seiner Kleidung befriedigt.
Gleich nach Don Josés Ableben war das Begräbnisritual durchgeführt worden. Es wurden drei Responsorien gebetet, und dann wurde der Leichnam, mit zwei Wasserkrügen an den Füßen beschwert, in einem Sack über Bord geworfen. Danach ordnete der Kapitän an, dass die improvisierte Kabine wieder abgebaut wurde und der Schreiber das Hab und Gut des Verstorbenen sicherstellte. Don José und Caridad waren die einzigen Passagiere des Flaggschiffs gewesen, Caridad die einzige Frau an Bord.
»Padre«, hatte der Kapitän den Kaplan angewiesen, »Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Negerin nicht mit der Besatzung zusammentrifft.«
»Aber ich …«, hatte Don Damián versucht, sich zu wehren.
»Sie gehört Euch zwar nicht, doch Ihr könnt über den Proviant, den Señor Hidalgo mit an Bord genommen hat, verfügen und sie damit verpflegen«, hatte der Offizier festgestellt, ohne auf Don Damiáns Protest einzugehen.
Don Damían hatte Caridad in seiner winzigen Kabine versteckt gehalten, in der nur Platz für eine Hängematte war, die er tagsüber einholte und zusammenrollte. Die Schwarze schlief auf dem Boden, unter der Hängematte. In den ersten Nächten hatte der Kaplan in der Lektüre der Heiligen Schrift Zuflucht gesucht, doch immer wieder war sein Blick dem flackernden Licht der Kerze gefolgt, das sich wie von selbst von den Seiten des schweren Buches zu lösen schien, um die Frau zu bescheinen, die zusammengerollt ganz in seiner Nähe lag.
Er hatte gegen die Fantasien angekämpft, die ihn beim Anblick von Caridads Beinen überkamen, die unter der Decke hervorlugten, beim Anblick ihrer Brüste, die sich im Rhythmus ihres Atems hoben und senkten, beim Anblick ihrer Schenkel. Doch dann hatte er, wenn auch widerwillig, begonnen, sich zu berühren. Vielleicht weil die Holzwand, an der die Hängematte festgemacht war, knarrte, vielleicht wegen der Spannung, die in dem engen Raum entstand, jedenfalls hatte Caridad irgendwann die Augen aufgeschlagen. Don Damían hatte gespürt, wie er errötete, und einen Augenblick innegehalten, aber unter Caridads Blick, genau dem ausdruckslosen Blick, mit dem sie jetzt seine Worte vernahm, hatte sich seine Begierde nur vervielfacht.
»Hör auf mich, Caridad«, forderte er sie jetzt nachdrücklich auf. »Such dir Arbeit!«
Dann lud Don Damián seine Truhe auf, kehrte ihr den Rücken zu und machte sich wieder auf den Weg.
Warum nur fühle ich mich schuldig?, fragte er sich, als er kurz stehen blieb, um die Truhe auf die andere Schulter zu heben. Er hätte sie ja auch zwingen können, sagte er sich, wie immer, wenn ihn Schuldgefühle überkamen. Sie war doch nur eine Sklavin. Vielleicht … vielleicht hätte er ja nicht einmal Gewalt anwenden müssen. Diese schwarzen Sklavinnen waren doch alle hemmungslos! Don José, ihr Besitzer, hatte es doch bei der Beichte zugegeben: Er hatte mit allen Beischlaf gehabt.
»Mit Caridad hatte ich ein Kind«, hatte er gestanden, »vielleicht auch zwei. Aber nein, das wohl doch nicht. Ihr zweites Kind, dieser tölpelige und dumme Junge, war genauso schwarz wie sie.«
»Bereuen Sie?«, hatte der Priester gefragt.
»Weil ich Kinder mit den Negerinnen habe?«, hatte der Plantagenbesitzer entrüstet erwidert. »Padre, ich habe diese kleinen Kreolen immer der Zuckermühle in der Nähe verkauft, und die gehörte Priestern! Die haben sich niemals mit meiner sündigen Seele befasst, wenn sie mir die Kinder abgekauft haben.«
Don Damián ging weiter in Richtung der Kathedrale Santa Cruz. Bevor er in eine Seitenstraße einbog, blickte er zurück. Er konnte Caridad erkennen, an der die Leute vorbeigingen. Sie war zur Seite getreten und lehnte still und in sich versunken an einer Mauer.
Sie wird schon zurechtkommen, sagte er sich und ging rasch weiter. Cádiz war eine reiche Stadt, in der man Händler und Kaufleute aus ganz Europa antraf und in der das Geld säckeweise bewegt wurde. Die Schwarze war eine freie Frau, also musste sie lernen, mit ihrer Freiheit zu leben, und sich eine Arbeit suchen. Als Don Damián eine Stelle erreicht hatte, von der aus man die Bauarbeiten an der neuen Kathedrale, ganz in der Nähe der alten Kathedrale Santa Cruz, deutlich sehen konnte, blieb er stehen. Aber was für eine Arbeit sollte die arme Frau verrichten? Die Unglückliche hatte doch nie woanders als auf einer Tabakpflanzung gearbeitet! Dort hatte sie gelebt, seit englische Sklavenhändler die Zehnjährige aus einem Königreich am Golf von Guinea für fünf lächerliche Stoffballen gekauft hatten, um sie auf dem stets nach frischer Ware gierenden kubanischen Markt weiter zu verschachern. Das hatte Don José Hidalgo dem Kaplan selbst erzählt, als er wissen wollte, warum er ausgerechnet Caridad für diese Reise ausgewählt hatte.
»Sie ist kräftig und ansehnlich«, hatte der Plantagenbesitzer augenzwinkernd erklärt. »Und dazu ist sie offenkundig nicht mehr fruchtbar, was außerhalb der Plantage nur von Vorteil ist. Denn nachdem sie diesen blöden Balg auf die Welt gebracht hat …«
Don José hatte ihm auch berichtet, dass er Witwer sei und einen Sohn habe, der nach der Universität in Madrid Karriere gemacht hatte. Nun war er nach Madrid unterwegs, um dort seinen Lebensabend zu verbringen. Auf Kuba hatte er in der Nähe von Havanna eine einträgliche Tabakplantage besessen, die er selbst mithilfe von etwa zwanzig Sklaven bewirtschaftete. Die Einsamkeit, das Alter und die zunehmende Konkurrenz der Zuckerfabrikanten, die immer mehr Land für ihre blühende Industrie erwarben, hatten ihn veranlasst, seinen Besitz zu verkaufen und in die Heimat zurückzukehren. Doch nach zwanzig Tagen auf See hatte ihn die Pest befallen und sich wütend in seinen altersschwachen Körper gefressen. Fieber, Ödeme, Flecken auf der Haut, blutendes Zahnfleisch – der Arzt hatte den Patienten bald aufgegeben.
Wie auf den königlichen Schiffen vorgeschrieben, hatte der Kapitän der La Reina daraufhin den Schreiber in die Kabine von Don José beordert, um dessen Letzten Willen aufzuzeichnen.
»Ich schenke meiner Sklavin Caridad die Freiheit«, hatte der Kranke geflüstert, bevor er seinen gesamten Besitz seinem Sohn vermachte, den er nicht mehr wiedersehen sollte.
Die Frau hatte nicht einmal ansatzweise den Mund zu einem Lächeln verzogen, als sie von ihrer Freilassung erfuhr, erinnerte sich der Priester, als er jetzt auf der Straße stand.
Sie hatte nie etwas gesagt! Don Damián dachte an seine Bemühungen, Caridad unter den vielen Stimmen herauszuhören, die sonntags bei den Gottesdiensten an Deck beteten, oder auch an ihr verhaltenes Flüstern abends, vor dem Schlafengehen, wenn er sie zum Beten zwang. Was für eine Arbeit sollte diese Frau also hier finden? Der Kaplan wusste, dass fast alle Sklaven, die die Freiheit erhielten, letztlich für ihre ehemaligen Besitzer weiterarbeiteten, für einen erbärmlichen Lohn, mit dem sie kaum das Notwendigste bezahlen konnten, das ihnen zuvor, als Sklaven, sicher zugestanden hatte. Oder aber die Schwarzen waren dazu verdammt, in den Straßen um Almosen zu betteln, immer im Wettstreit mit Unmengen anderer Bettler. Und die waren wenigstens in Spanien geboren, kannten Land und Leute und waren, zumindest manche von ihnen, aufgeweckt und listig. Wie aber sollte Caridad in einer fremden großen Stadt wie Cádiz zurechtkommen?
Don Damián seufzte und strich sich mehrere Male über das Kinn und das wenige Haar, das ihm verblieben war. Dann drehte er sich um, stöhnte, als er sich erneut die Truhe auf die Schulter hob, und schickte sich an, den Weg zurückzugehen. Was soll ich nur tun?, fragte er sich. Er könnte … Ja, er könnte Caridad Arbeit in der Tabakfabrik vermitteln, denn darauf verstand sie sich.
»Mit den Tabakblättern ist sie sehr geschickt. Sie geht liebevoll und sanft damit um, so wie es sein muss, sie kann die besten Blätter unterscheiden, und sie ist sehr geübt im Zigarrenrollen«, hatte Don José ihm berichtet. Aber das würde bedeuten, dass er um einen Gefallen bitten müsste und dass man womöglich erfuhr, dass er … Das Risiko, dass Caridad über den Vorfall vom Schiff sprach, konnte er nicht eingehen. In den Fabrikhallen waren an die zweihundert Arbeiterinnen beschäftigt, die ohne Unterlass tuschelten und lästerten, während sie die kleinen Cádiz-Zigarren fertigten.
Caridad lehnte nach wie vor ruhig und schutzlos an der Mauer. Eine Bande Rotzlöffel machte sich über sie lustig, ohne dass die übrigen Passanten eingriffen. Don Damián kam genau in dem Moment bei ihr an, als einer der jungen Burschen einen Stein auf sie werfen wollte.
»Aufhören!«, schrie er.
Der Kerl hielt inne. Die Frau nahm den Hut ab und blickte zu Boden.
Caridad entfernte sich ein wenig von den sieben Passagieren, die mit ihr an Bord des Schiffes gegangen waren, das den Guadalquivir aufwärts nach Sevilla fahren sollte. Müde suchte sie zwischen den Gepäckstücken nach einem Platz, um sich zu setzen. Das Schiff war eine einmastige Tartane, die eine Ladung des geschätzten Olivenöls aus der Flussebene um Sevilla nach Cádiz gebracht hatte.
Von der Bucht von Cádiz segelten sie die Küste entlang nach Sanlúcar de Barrameda an der Mündung des Guadalquivir. Vor Chipiona warteten sie mit anderen Schiffen auf die Flut und günstige Winde, um die so gefährlichen wie gefürchteten Sandbänke von Sanlúcar zu überwinden, die das gesamte Gebiet in einen Schiffsfriedhof verwandelt hatten. Nur wenn alle Voraussetzungen erfüllt waren, gingen die Kapitäne das Wagnis ein und fuhren mit der Flut flussaufwärts, die bis in die Nähe von Sevilla wahrzunehmen war.
»Es ist schon vorgekommen, dass Schiffe hundert Tage warten mussten, um über die Sandbank zu kommen«, erzählte ein Seemann einem prächtig gekleideten Passagier, der sofort einen besorgten Blick auf Sanlúcar und die spektakuläre, sumpfige Küste warf.
Caridad saß zwischen mehreren Säcken an die Reling gelehnt und überließ sich dem Schaukeln der Tartane. Auf dem Meer herrschte angespannte Ruhe, so wie unter den Leuten auf dem Schiff; das Gleiche galt für die übrigen wartenden Schiffe. Aber nicht nur das Warten zehrte an den Nerven, sondern auch die Furcht vor Angriffen durch Engländer oder Korsaren. Als die Sonne unterging, nahm das Wasser eine bedrohlich metallische Farbe an. Die besorgten Gespräche von Besatzung und Reisenden wurden leiser, bis schließlich nur noch ein Flüstern zu vernehmen war. Mit dem Verschwinden der Sonne wurde offenbar, dass Winter war. Feuchtigkeit nistete sich in Caridads Körper ein und vergrößerte noch ihr Kältegefühl. Sie hatte Hunger und war müde. Sie hatte sich die Jacke übergezogen, die genauso grau und verblichen war wie ihr Gewand. Ihre Erscheinung bildete einen starken Kontrast zu den übrigen Fahrgästen, deren Kleidung ihr luxuriös und bunt vorkam. Caridads Zähne klapperten, und sie bekam eine Gänsehaut, also suchte sie in ihrem Bündel nach der Decke. Ihre Finger berührten eine Zigarre. Sie betastete sie vorsichtig und erinnerte sich sehnsüchtig an ihr Aroma und ihre Wirkung.
Sie hüllte sich fest in die Decke. Don Damián hatte sie auf das Schiff gebracht, das erste, das aus dem Hafen von Cádiz auslaufen sollte.
»Fahr nach Sevilla«, hatte er ihr eingeschärft, nachdem er mit dem Kapitän den Preis ausgehandelt und aus eigener Tasche bezahlt hatte, »nach Triana. Dort gehst du zum Convento de las Mínimas und sagst den Nonnen, dass ich dich schicke.«
Caridad fehlte der Mut, ihn zu fragen, was Triana war oder wie sie das Kloster finden sollte, und der Geistliche hatte sie auf das Schiff gedrängt. Dabei hatte er sich nervös nach links und rechts umgeblickt, als hätte er Angst, jemand könnte sie zusammen sehen.
Caridad schnupperte an der Zigarre, und der Duft versetzte sie nach Kuba. Sie kannte doch nur ihre Hütte und die Plantage und die Zuckermühle, zu der sie jeden Sonntag mit den anderen Sklaven zum Gottesdienst ging, um anschließend bis zur Erschöpfung zu singen und zu tanzen. Von der Hütte zur Plantage, und von der Plantage zur Hütte, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Wie sollte sie da ein Kloster finden? Wer waren all diese fremden Menschen? Und Marcelo? Was war aus ihm geworden? Und wie mochte es ihrer Freundin María gehen, der Mulattin, mit der sie immer zusammen gesungen hatte? Und all den anderen? Was tat sie da, nachts auf einem fremden Schiff, in einem unbekannten Land, unterwegs zu einer Stadt, von der sie nicht einmal gewusst hatte, dass es sie gab?
Bei der Erinnerung an Marcelo wurden ihre Augen feucht. Sie tastete in ihrem Bündel nach dem Feuerstein, dem Zunder und einem Stück Stahl. Ob man sie rauchen lassen würde? In der Tabakpflanzung durfte sie das, es war ganz üblich. Während der gesamten Überfahrt hatte sie wegen Marcelo geweint. Sie war sogar nahe daran gewesen, sich ins Meer zu stürzen, um ihrem Leid ein Ende zu setzen. »Weg da! Willst du vielleicht ins Wasser fallen?«, hatte einer der Matrosen sie gewarnt. Und sie hatte gehorcht und sich von der Reling entfernt.
Hätte sie den Mut aufgebracht, ins Meer zu springen, wenn der Matrose nicht aufgetaucht wäre? Caridad wollte nicht weiter darüber nachdenken. Stattdessen beobachtete sie nun die Männer auf der Tartane. Sie wirkten nervös. Die Flut hatte zwar eingesetzt, doch es kam kein Wind auf. Einige rauchten. Sie schlug geschickt den Stahl gegen den Feuerstein, und es dauerte nicht lange und der Zunder brannte. Wo sollte sie hier den Baumpilz finden, aus dem sie Zunder herstellen konnte? Sie zündete die Zigarre an, inhalierte tief und überlegte, dass sie nicht einmal wusste, wie sie an Tabak gelangen sollte. Der erste Zug beruhigte ihr Gemüt. Die beiden nächsten Atemzüge sorgten dafür, dass sich ihre Muskeln entspannten, und sie überließ sich einem sanften Schwindel.
»Lässt du mich mitrauchen?«
Ein Schiffsjunge war vor ihr in die Hocke gegangen, sein Gesicht war schmutzig, aber fröhlich und freundlich. Eine Weile ließ Caridad sich von dem Lächeln mitreißen, mit dem der Junge auf ihre Antwort wartete. Sie hatte in dem Moment nur Augen für seine weißen Zähne, die genauso strahlten wie die von Marcelo, wenn er sich in ihre Arme warf. Sie hatte noch einen Sohn zur Welt gebracht, dessen Vater Don José war, doch ihr Herr hatte ihn verkauft, sobald der Junge nicht mehr auf die Obhut der zwei alten Frauen angewiesen war, die sich um die Kinder der Sklavinnen kümmerten, während diese arbeiteten. Alle teilten das gleiche Los, denn der Besitzer hatte keine Lust, die Kinder der Sklaven durchzufüttern. Marcelo, ihr zweiter Sohn, dessen Vater ein Schwarzer aus der Zuckermühle war, war anders: eine schwere Geburt, ein Kind mit Problemen. »Niemand wird ihn kaufen«, hatte der Plantagenbesitzer festgestellt, als Marcelo älter wurde und sich seine Unbeholfenheit und Einfältigkeit abzeichneten. Doch ihm wurde zugestanden, auf der Plantage zu bleiben, wie die Hunde oder Hähne oder Schweine, die sie hinter der Hütte aufzogen. »Er wird sterben«, hatten alle vorausgesagt. Doch Caridad hatte es nicht zugelassen und ergeben die Schläge und Peitschenhiebe eingesteckt, wenn man sie dabei erwischte, dass sie ihm trotzdem zu essen gab. »Wir geben dir das Essen, damit du arbeitest, nicht, damit du einen Idioten fütterst«, hatte der Vorarbeiter sie angebrüllt.
»Lässt du mich mitrauchen?«, bat der Schiffsjunge hartnäckig.
Warum nicht?, überlegte Caridad. Schließlich glich sein Lächeln dem ihres Marcelo. Sie bot ihm die Zigarre an.
»He! Wo hast du denn dieses Wunderwerk aufgetrieben?«, rief der Junge hustend nach dem ersten Zug. »Auf Kuba?«
»Ja«, hörte Caridad sich antworten, während sie die Zigarre wieder an sich nahm und an die Lippen führte.
»Wie heißt du?«
»Caridad«, antwortete sie, in eine Rauchwolke gehüllt.
»Dein Hut gefällt mir.«
Der Junge wartete ungeduldig auf den nächsten Zug. Caridad gab ihm erneut die Zigarre.
»Die Brise ist da!«
Der Ruf des Kapitäns unterbrach die Stille. Auf den anderen Schiffen waren ähnliche Rufe zu vernehmen. Südwind war aufgekommen, ideal, um die Sandbank zu überqueren. Der Schiffsjunge gab Caridad die Zigarre zurück und lief zu den anderen Seeleuten.
»Danke!«, sagte er noch schnell.
Anders als die übrigen Passagiere verfolgte Caridad das aufwendige Manöver nicht, das in dem engen Kanal drei Richtungswechsel erforderlich machte. Im gesamten Mündungsgebiet des Guadalquivir, an Land wie auf den Barkassen, die an den Ufern vertäut lagen, wurden Leuchtfeuer entzündet, um die Schiffe zu leiten. Sollte der Wind abflauen und sie auf der Hälfte der Strecke stehen bleiben, bestand vielfältige Gefahr, endgültig zu stranden. Caridad genoss den angenehmen Kitzel in ihren Muskeln und ließ zu, dass der Tabak ihre Sinne vernebelte. In dem Augenblick, in dem die Tartane in den gefürchteten Kanal einfuhr, an dem backbord der Turm von San Jacinto die Strecke beleuchtete, begann Caridad zu singen. Sie wiegte sich im Rhythmus ihrer Erinnerungen an die sonntäglichen Feste, wenn die Schwarzen aus den verschiedenen Sklavensiedlungen sich nach dem Gottesdienst in der Baracke der Plantage versammelten, zu der sie mit ihren Besitzern gekommen waren. Dort gestatteten ihnen die Weißen, zu singen und zu tanzen, als wären sie Kinder, die sich austoben und ihre harte Arbeit vergessen müssen. Doch mit jedem Tanzschritt und mit jedem Ton der Batá-Trommeln – der großen Iyá, der Mutter aller Trommeln, der Itótele oder der kleinen Okónkolo – hatten die Schwarzen in Wahrheit ihre eigenen Götter verehrt, die als Jungfrauen und Heilige der Christen maskiert waren.
Nun sang Caridad einfach weiter, ungeachtet der gebieterischen Befehle des Kapitäns und des hektischen Hin und Her der Besatzung. Sie bildete sich ein, sie würde Marcelo in den Schlaf wiegen, sie meinte, sein Haar zu berühren, seinen Atem zu hören, seinen Geruch wahrzunehmen … Sie warf eine Kusshand in die Luft. Der Junge hatte bestimmt überlebt! Gewiss wurde er von dem neuen Besitzer und vom Vorarbeiter beschimpft und geschlagen, aber die Sklaven auf der Plantage mochten ihn. Er lachte immer! Er war ein Junge, der zu allen sanft und gutmütig war. Marcelo wusste nichts von Sklaverei und Herrschaft. Er lebte in Freiheit. Nur zuweilen sah er den Sklaven in die Augen, als verstünde er ihr Leid und wollte ihnen Mut machen, sich von ihren Ketten zu befreien. Einige schenkten Marcelo ein trauriges Lächeln, andere kämpften angesichts seiner Unschuld mit den Tränen.
Caridad zog kräftig an der Zigarre. Bestimmt war er gut versorgt, daran hegte sie keinen Zweifel. Gewiss kümmerte sich María um ihn, die Sklavin, mit der zusammen sie gesungen hatte. Und Cecilio auch, obwohl man ihn gezwungen hatte, ihr den Sohn wegzunehmen. All die Sklaven, die mit den Ländereien verkauft worden waren, würden sich um ihn kümmern. Und ihr Junge war glücklich, das spürte sie. Aber Don José …
»Möge seine Seele niemals Ruhe finden!«, fluchte Caridad.
2
Triana lag auf der anderen Seite des Guadalquivir, außerhalb der Mauern von Sevilla. Diese Vorstadt war mit der Stadt über eine alte maurische Brücke verbunden, die auf zehn Barkassen ruhte, die im Flussbett ankerten und mit zwei schweren Eisenketten sowie mehreren Tauen von Ufer zu Ufer gesichert waren. Triana, wegen seiner Verteidigungsfunktion auch die »Wächterin von Sevilla« genannt, erlebte seine Blüte in der Zeit, in der Sevilla das Monopol für den Handel mit Amerika besaß; doch die nautischen Probleme, die die Versandung des Flusses verursachte, legten es Anfang des Jahrhunderts nahe, die Casa de Contratación, die königliche Behörde, die den Handel und den Schiffsverkehr mit den Kolonien in Amerika kontrollierte, nach Cádiz zu verlegen, was zu einem beträchtlichen Rückgang der Bevölkerungszahl und zum Verfall zahlreicher Gebäude führte. Die etwa zehntausend Bewohner von Triana lebten zum größten Teil auf einer beschränkten Fläche entlang des rechten Flussufers, die auf der anderen Seite von der Cava begrenzt wurde. Dieser Graben hatte zu Kriegszeiten, von den Wassern des Guadalquivir durchströmt, als erste Verteidigungslinie der Stadt gedient und die Vorstadt zur Insel gemacht. Jenseits des Grabens lagen verstreut ein paar Klöster, Einsiedeleien und Häuser sowie die weite, fruchtbare Ebene von Triana.
In einem dieser Klöster, dem Convento de Nuestra Señora de la Salud, lebten die Minimen, die Nonnen eines bescheidenen Ordens, die ein Schweigegelübde abgelegt hatten und ihr Leben in strenger Askese der Kontemplation und dem Gebet widmeten. Hinter dem Kloster, in Richtung der Calle de San Jacinto, lag die kleine Sackgasse Callejón de San Miguel mit dreizehn Gemeinschaftshöfen, in denen etwa fünfundzwanzig Familien lebten. Einundzwanzig dieser Familien waren Zigeunerfamilien, mit Großeltern, Söhnen und Töchtern, Onkeln und Tanten, Cousins und Cousinen, Nichten und Neffen, Enkeln und sogar Urenkeln. Alle diese einundzwanzig Familien betrieben Schmiedewerkstätten. In Triana gab es noch weitere Schmieden, die größtenteils Zigeunern gehörten, die bereits Jahrhunderte vor der Migration nach Europa in Indien oder in den armenischen Bergen aus diesem Beruf eine Kunst gemacht hatten. Doch der Callejón de San Miguel war das Zentrum der Schmiede und Kesselschmiede von Triana. Auf diese Gasse öffneten sich die Gemeinschaftshöfe, die im 16. Jahrhundert, während der Blütezeit der Vorstadt, errichtet worden waren. Einige waren nicht mehr als einfache Sackgassen mit ärmlichen ein- und zweistöckigen kleinen Häusern; andere waren zwei- oder dreistöckige, ineinander verschachtelte Gebäude um einen zentralen Patio, zu deren oberen Stockwerken man über offene Gänge mit Balustraden aus Holz oder Schmiedeeisen gelangte. Fast ausnahmslos handelte es sich um bescheidene Behausungen mit einem oder höchstens zwei Zimmern, wo in einer kleinen Nische auf einem Kohlenfeuer gekocht wurde, sofern es im Patio oder in der kleinen Sackgasse keine Feuerstelle für den allgemeinen Gebrauch sämtlicher Bewohner des Gemeinschaftshofes gab. Die Becken zum Waschen und die Latrinen, falls vorhanden, befanden sich im Patio und wurden von allen gemeinsam benutzt.
Anders als in den Wohngebäuden in Sevilla, wo sich in den Patios tagsüber nur Frauen und spielende Kinder aufhielten, herrschte in Triana in den Gemeinschaftshöfen der Schmiedehandwerker den ganzen Tag über geschäftiges Treiben, da die Werkstätten stets im Erdgeschoss lagen. Das unentwegte Hämmern auf dem Amboss hallte aus jeder Schmiede und vermischte sich in der Gasse zu einem eindringlichen metallischen Getöse; der Rauch der Kohlenfeuer, der meistens über die Patios oder gleich durch die Türen der einfachen Werkstätten ohne Schornsteine hinausquoll, war von überall in Triana aus zu sehen. Und im gesamten Callejón, immer von Getöse und Rauch umgeben, herrschte ein munteres Durcheinander von Männern, Frauen und spielenden Kindern, ein lebhaftes Lachen, Schwatzen, Rufen und Streiten. Zuweilen jedoch verstummten all diese Leute und hielten angespannt vor den Türen der Werkstätten inne: ein Vater, der seinen Sohn an der Schulter festhielt, ein alter Mann, der die Augen schloss, Frauen, die ihren Tanz unterbrachen, wenn sie den Klang eines Martinete hörten – den traurigen Gesang der Schmiede, der nur von dem monotonen Hämmern begleitet war, an dessen Rhythmus er sich anpasste, ein eigentümlicher Gesang, der sie schon immer, zu allen Zeiten und an allen Orten, begleitet hatte. Aus dem Klagen der Schmiede und dem Hämmern entstand dabei eine wunderbare Symphonie, die bei den Zuhörern eine Gänsehaut hervorrief.
An jenem 2. Februar 1748, an Mariä Lichtmess, jedoch stand die Arbeit in den Schmieden still. Einige wenige Zigeuner besuchten den Gottesdienst der Iglesia de San Jacinto und gingen zur Virgen de la Candelaria, um bei dieser Marienfigur die Kerzen segnen zu lassen, die ein wenig Licht in ihre Behausungen brachten; vor allem aber wollten sie Konflikte mit den gläubigen Nachbarn in Triana vermeiden, insbesondere mit den Priestern, Mönchen und Inquisitoren, denn für diesen Tag galt eine strikte Ruhepflicht.
»Behüte das Mädchen vor den Begierden der Payos«, knurrte eine heisere Stimme.
Die in Caló, der Sprache der Zigeuner, ausgesprochene Warnung erscholl in einem Patio im Callejón. Mutter und Tochter blieben stehen. Keine der beiden war überrascht, auch wenn sie nicht wussten, woher genau die Stimme kam. Sie erforschten mit ihren Blicken den Patio, bis Milagros in einer halbdunklen Ecke den silbrigen Schimmer der Knöpfe an der himmelblauen kurzen Jacke ihres Großvaters entdeckte. Dort stand er, aufrecht und still, mit gerunzelter Stirn und verlorenem Blick, wie üblich; auch beim Sprechen hatte er auf seiner kleinen erloschenen Zigarre herumgekaut. Das Mädchen, eine hübsche Vierzehnjährige, lächelte ihm zu und vollführte eine anmutige Drehung; der lange blaue Rock, der Unterrock und die grünen Tücher wirbelten zum Klimpern ihrer Halsketten durch die Luft.
»Alle in Triana wissen, dass ich Ihre Enkelin bin.« Beim Lachen leuchteten die weißen Zähne in ihrem Gesicht, das genauso dunkel war wie das ihrer Mutter und das ihres Großvaters. »Wer würde sich an mich heranwagen?«
»Die Wollust ist blind und tollkühn, Mädchen. Viele würden ihr Leben riskieren, um dich zu bekommen. Dann bliebe mir nichts anderes übrig, als dich zu rächen, und es gäbe nicht genügend Blut, um den Schmerz zu heilen. Vergiss das nie!«, fügte er, an die Mutter gewandt, hinzu.
»Ja, Vater«, pflichtete diese ihm bei.
Beide erwarteten einen Abschiedsgruß, eine Geste, ein Zeichen, doch der Großvater blieb erhobenen Hauptes in der Ecke stehen, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Schließlich zog Ana ihre Tochter am Arm, und sie verließen das Gebäude. Es war ein kalter Morgen. Der Himmel zeigte sich bewölkt und verhieß Regen, was allerdings die Bewohner von Triana nicht davon abzuhalten schien, sich zur Segnung ihrer Kerzen zur Iglesia de San Jacinto zu begeben. Zudem wollten auch viele Sevillaner das Kirchenfest nicht versäumen; mit dicken, langen Kerzen auf dem Rücken gelangten sie entweder über die Schiffsbrücke nach Triana, oder sie setzten mit einem der vielen Kähne über den Guadalquivir. Der Menschenauflauf verhieß einen einträglichen Tag, dachte Ana, bevor sie wieder an die Warnungen ihres Vaters dachte. Sie drehte sich zu Milagros um und beobachtete, wie stolz und aufrecht ihre Tochter ging und dabei stets alles im Blick hatte. Wie es sich für eine richtige Zigeunerin gehört!, stellte sie zufrieden fest. Ihre Tochter war nicht zu übersehen. Die kastanienbraune Mähne fiel ihr auf den Rücken, wo sie sich mit den grünen Fransen des Schultertuchs vermischte. Hier und dort steckte im Haar zudem noch ein buntes Band oder eine Perle; große silbrige Kreolen prangten an ihren Ohren, und Perlen- und Silberketten bewegten sich auf ihrem jugendlichen Busen, der in dem weiten und gewagten Ausschnitt ihrer weißen Bluse gefangen war. Der blaue Rock umhüllte eng ihre schmale Taille und reichte fast bis zu ihren nackten Füßen. Ein Mann musterte sie aus dem Augenwinkel. Milagros bemerkte es sofort, wie eine Katze, und drehte sich zu ihm um; die wie gemeißelten Gesichtszüge des Mädchens wurden sanft, und die dichten Augenbrauen schienen ein Lächeln zu überwölben. Also gehen wir es an, sagte sich die Mutter.
»Soll ich dir die Zukunft vorhersagen, junger Mann?«
Eigentlich wollte der kräftige Mann weitergehen, doch Milagros lächelte ihm freimütig zu und trat so nah an ihn heran, dass sie ihn fast mit ihren Brüsten streifte.
»Ich sehe eine Frau, die dich begehrt«, begann die junge Zigeunerin und sah ihm fest in die Augen.
Ana gelangte gerade rechtzeitig zu ihrer Tochter, um diese letzten Worte zu hören. Eine Frau … Was für einen Wunsch sollte dieser Mann sonst haben, der eine kleine Kerze trug? Er war groß gewachsen und wirkte gesund, lebte aber offensichtlich allein. Der Mann zögerte mehrere Sekunden, bevor er sich mit der anderen Zigeunerin befasste, die hinzugetreten war: Sie war älter, aber genauso ansehnlich und stolz wie das Mädchen.
»Willst du nicht mehr wissen?« Milagros zog die Aufmerksamkeit des Mannes wieder auf sich, indem sie tiefer in seine Augen blickte, in denen sie bereits Interesse entdeckt hatte. Sie versuchte, seine Hand zu ergreifen. »Du begehrst diese Frau doch, nicht wahr?«
Die Zigeunerin spürte, wie ihr Opfer nachgab. Mutter und Tochter kamen schweigend überein: leichte Arbeit. Ein verzagter, schüchterner Mann – er hatte versucht, ihren Blicken auszuweichen – in einem derben Körper. Bestimmt ging es um eine Frau, immer ging es um irgendeine Frau. Sie mussten ihn nur ermutigen, ihn anstacheln, damit er seine Scheu überwand.
Milagros war großartig, überzeugend. Mit dem Finger fuhr sie die Linien seiner Hand nach, als verkündeten sie tatsächlich die Zukunft des unbedarften Mannes. Ihre Mutter beobachtete sie stolz und belustigt zugleich. Für ihre Ratschläge erhielten sie ein paar Kupfermünzen. Dann wollte Ana dem Mann noch eine Zigarre aus ihren Schmuggelbeständen verkaufen.
»Zum halben Preis wie in den Tabakläden in Sevilla«, bot sie an. »Wenn du keine Zigarren magst, ich habe auch Schnupftabak, beste Qualität, ganz sauber, ohne Erde.« Milagros versuchte den Mann zu überzeugen, indem sie ihr Schultertuch zurückschlug, unter dem sie die Ware am Leib versteckt trug. Doch er setzte nur ein dümmliches Lächeln auf, als würde er in Gedanken bereits der Frau den Hof machen, die er bislang noch nicht anzusprechen gewagt hatte.
Den ganzen Tag über schwirrten Mutter und Tochter in der Menschenmenge hin und her, die sich zwischen der Plaza del Altozano am Castillo de San Jorge und der Iglesia de San Jacinto drängte, dem Gotteshaus, das auf der ehemaligen Ermita de la Candelaria errichtet worden war. Ihr Geschäft waren das Wahrsagen und der Tabakverkauf, immer auf der Hut vor den Wachen sowie vor den anderen Zigeunerinnen, die die unachtsamen Menschen bestahlen. Viele dieser Frauen gehörten zu ihrer eigenen Großfamilie. Ana und ihre Tochter jedoch brauchten solche Risiken nicht einzugehen – der Tabak verschaffte ihnen ausreichend Gewinn.
Deshalb versuchten sie auch, sich abseits der Menschenmenge zu halten, als Fray Joaquín von den Dominikanern unter freiem Himmel seine Predigt an der Stelle begann, an der später das Tor zur neuen Kirche stehen sollte. Die gottesfürchtigen Sevillaner, die sich auf dem Vorplatz drängten, waren indes weder für Wahrsagen noch für Tabak zu haben. Viele waren eigens nach Triana gekommen, um wieder einmal eine Predigt des streitbaren Dominikanermönchs zu hören. Von der improvisierten Kanzel im Freien ging Fray Joaquín mit seinen Ideen sogar noch weiter als der Benediktiner Fray Benito Jerónimo Feijoo. Fray Joaquín prangerte in seiner Predigt, die er mit lauter Stimme auf Spanisch und ohne ein Wort Latein hielt, die überkommenen Überzeugungen der Spanier an. Er reizte die Zuhörer, indem er die Tugend der Arbeit, sogar die mechanische oder die handwerkliche, gegen den falsch verstandenen Ehrbegriff verteidigte, der die Spanier zu Faulenzerei und Müßiggang anhielt. Er appellierte an den Stolz der Frauen, indem er die klösterliche Erziehung in Zweifel zog und von ihrer neuen Rolle in der Gesellschaft und in der Familie sprach. Er bekräftigte ihren Anspruch auf Bildung und die Rechtmäßigkeit ihres Wunsches auf eine eigenständige geistige Entwicklung. Für ihn war die Frau keine Dienerin des Mannes mehr, und ebenso wenig sollte sie weiterhin als unvollkommener Mann angesehen werden. Die Frau war keineswegs von Natur aus schlecht! Die Ehe sollte auf Gleichheit und gegenseitigem Respekt beruhen. Fray Joaquín behauptete – im Einklang mit anderen großen Denkern –, der Verstand habe kein Geschlecht, er sei weder männlich noch weiblich. Die Menschen drängten sich, um ihn zu verstehen, und genau das war der Moment, wie Ana und Milagros sehr wohl wussten, in dem die Zigeunerinnen die Begeisterung der Zuhörer ausnutzten, um deren Taschen zu leeren.
Nun näherten sich Ana und ihre Tochter, so gut es ging, der Stelle, von der aus Fray Joaquín zu der Menschenmenge sprach. Der Geistliche wurde von den etwa zwanzig Dominikanermönchen begleitet, die im Convento de San Jacinto lebten. Einige von ihnen sahen hin und wieder zum bleiernen Himmel auf, aus dem jedoch kein Tropfen fiel – Regen hätte das kirchliche Fest zerstört.
»Ich bin das Licht der Welt!«, rief Fray Joaquín mit lauter Stimme, um sich Gehör zu verschaffen. »Das waren die Worte, die uns Unser Herr, Jesus Christus, verkündet hat. Er ist unser Licht! Er ist das Licht, das in all den Kerzen gegenwärtig ist, die ihr bei euch führt und die auch Licht in …«
Milagros achtete nicht auf die Predigt. Sie starrte den Mönch an, der bald auf Mutter und Tochter aufmerksam wurde. Die bunten Gewänder der beiden Zigeunerinnen waren in dem Menschenauflauf nicht zu übersehen. Fray Joaquín zögerte. Für einen Moment verlor er den Faden, und seine Gesten zeigten keine Wirkung mehr auf die Gläubigen. Milagros spürte, dass er sich vergeblich bemühte, nicht zu ihr zu sehen. Doch sosehr er sich auch anstrengte, manchmal konnte er nicht umhin, und sein Blick verweilte gleich mehrere Sekunden auf ihr. Bei diesen Gelegenheiten zwinkerte Milagros ihm zu, und Fray Joaquín geriet ins Stottern; ein anderes Mal streckte sie ihm sogar die Zunge heraus.
»Mädchen!«, rügte Ana ihre Tochter und versetzte ihr einen Stoß mit dem Ellbogen. Anschließend blickte sie mit entschuldigender Miene zu dem Geistlichen. Fray Joaquín indes gelang es, von Milagros’ Angriffen befreit, wieder zu glänzen. Als er geendet hatte, entzündeten die Gläubigen ihre Kerzen an dem Feuer, das die Mönche vorbereitet hatten. Dann löste sich die Menschenmenge allmählich auf, und die beiden Frauen gingen wieder ihren Geschäften nach.
»Was sollte das?«, wollte die Mutter wissen.
»Ich mag es, wenn …«, begann Milagros und unterstrich ihre Worte mit einer koketten Geste. »Ich mag es, wenn er sich verspricht, wenn er stottert und rot wird.«
»Aber warum denn? Er ist ein Geistlicher!«
Das Mädchen musste einen Moment nachdenken.
»Ich weiß nicht«, erwiderte Milagros. Sie zuckte mit den Schultern und bedachte ihre Mutter mit einer belustigten Grimasse.
»Fray Joaquín hat Respekt vor deinem Großvater, und deswegen wird er auch dir mit Respekt begegnen, aber du darfst nicht mit Männern spielen! Auch nicht, wenn sie Geistliche sind«, beendete die Mutter ihre Warnung.
Wie nicht anders erwartet, wurde es ein einträglicher Tag, und Ana konnte all den geschmuggelten Tabak verkaufen, den sie zwischen ihren Gewändern verborgen hielt. Inzwischen kehrten die Bewohner von Sevilla über die Brücke oder mit den Fährkähnen in die Stadt zurück. Womöglich hätten sie noch dem einen oder anderen Passanten wahrsagen können, doch die schwindenden Menschenmassen offenbarten die Anwesenheit von allzu vielen Zigeunerinnen: sichtlich betagte Frauen, junge Frauen, zahlreiche halb nackte, nur mit Lumpen bekleidete Kinder, die alle das gleiche Ziel hatten. Ana und Milagros erkannten die Frauen aus dem Callejón de San Miguel wieder, Familienangehörige der Schmiede, aber auch viele Zigeunerinnen, die in den Elendshütten in der Nähe der Gärten des Kartäuserklosters lebten, das bereits in der Ebene vor Triana lag. Diese Zigeunerinnen belagerten immer noch hartnäckig die Leute, um ein Almosen zu erhaschen, sie versperrten ihnen den Weg und zerrten an ihren Gewändern, während sie einen Gott anriefen, an den sie nicht glaubten, und eine ganze Reihe Märtyrer und Heilige bemühten, deren Namen sie auswendig gelernt hatten.
»Ich glaube, für heute ist es genug, Milagros«, meinte die Mutter, als sie einem Paar den Weg frei machte, das einer Gruppe aufdringlicher Zigeunerinnen entgehen wollte.
Ein Rotzlöffel mit dreckigem Gesicht und schwarzen Augen, der die beiden Sevillaner verfolgte, stieß mit ihr zusammen, während er noch immer die Tugenden der heiligen Rufina beschwor.
»Hier, nimm!«, sagte Ana und gab ihm eine Kupfermünze.
Sie waren schon auf dem Rückweg, als sie feststellen mussten, dass die Mutter des kleinen Zigeunerjungen das Geldstück von diesem einforderte.
Im Callejón brodelte es. Für alle war es ein einträglicher Tag gewesen, denn an solchen religiösen Feiertagen waren die Bewohner von Sevilla besonders milde gestimmt. Männer plauderten in Gruppen in den offenen Türen, sie tranken Wein, rauchten und spielten Karten. Eine Frau zeigte ihrem Mann ihre Einkünfte, und zwischen den beiden entspann sich eine Diskussion, als er versuchte, das Geld für sich zu behalten. Milagros verabschiedete sich von ihrer Mutter und schloss sich einer Gruppe Mädchen an. Ana wiederum musste die Einkünfte aus ihrem Tabakhandel mit ihrem Vater abrechnen. Sie sah sich zwischen den anderen Männern nach ihm um. Doch sie konnte ihn nicht entdecken.
»Vater?«, rief sie laut, nachdem sie in den Patio des Hauses getreten war, in dem sie wohnten.
»Er ist nicht da.«
Ana drehte sich um und entdeckte im Türrahmen José, ihren Mann.
»Wo ist er denn?«
José zuckte die Schultern und machte mit einer Hand eine abschätzige Bewegung; in der anderen Hand hielt er einen Krug mit Wein. Seine Augen glänzten.
»Er ist kurz nach euch verschwunden. Bestimmt ist er zur Siedlung, um seine Verwandten zu treffen, wie immer.«
Ana schüttelte den Kopf. Sollte ihr Vater tatsächlich dort sein? Zuweilen hatte sie ihn schon in der Zigeunersiedlung hinter dem Kartäusergelände gesucht, ihn aber nicht gefunden. Würde er noch in der Nacht zurückkommen? Oder, wie so oft, erst nach einigen Tagen? Und in welchem Zustand?
Sie seufzte.
»Er kommt immer zurück«, blaffte José sie voller Sarkasmus an.
Seine Frau richtete sich auf, ihre Gesichtszüge verhärteten sich, und sie runzelte die Stirn.
»Leg dich bloß nicht mit ihm an!«, drohte sie leise. »Das habe ich dir schon oft gesagt.«
Ihr Mann verzog nur das Gesicht und kehrte ihr den Rücken zu.
Ja, er kam immer zurück. José hatte recht. Doch was machte er, wenn er nicht zu den Zigeunern beim Kartäuserkloster ging? Melchor berichtete niemals davon, und sobald sie nachhakte, zog er sich in seine unergründliche eigene Welt zurück. Wie anders war er doch gewesen, als sie ein Kind war! Ana konnte sich noch gut an ihren Vater von damals erinnern, an einen stolzen, hochmütigen und unerschütterlichen Mann, einen Menschen, bei dem sie immer Zuflucht fand. Doch als sie etwa zehn Jahre alt war, nahmen ihn die Häscher der Tabakwache fest, die den Schmuggel mit Tabak verfolgten. Es ging damals nur um ein paar Pfund Tabakblätter, und zudem wurde er zum ersten Mal erwischt. Eigentlich hätte die Strafe niedrig ausfallen müssen, doch Melchor Vega war Zigeuner, und man hatte ihn außerhalb eines der Dörfer festgenommen, die der König als Aufenthaltsorte für Zigeuner bestimmt hatte. Darüber hinaus trug er die Tracht der Zigeuner, ein ebenso teures wie auffälliges Gewand, das über und über mit Metall- und Silberplättchen bedeckt war; er führte seinen Stock mit sich, der ihn als Familienoberhaupt auswies, und auch sein Messer; zudem trug er Ohrschmuck; und dann beteuerten noch mehrere Zeugen, dass er Caló gesprochen habe. All das war verboten, ganz abgesehen davon, dass er den Finanzrat des Königreichs um Steuern betrogen hatte. Zehn Jahre Galeere. Das war die Strafe, die er erhielt.
Ana spürte, wie sich ihr Magen bei der Erinnerung an den Leidensweg verkrampfte, den sie mit ihrer Mutter während des Prozesses erlebte, vor allem während der Jahre von der Urteilsverkündung bis zu dem Tag, an dem ihr Vater tatsächlich in Puerto de Santa María an Bord einer der königlichen Galeeren gebracht wurde. Ihre Mutter hatte keinen Tag, keine Stunde, keine Minute aufgegeben. Und das hatte sie das Leben gekostet. Anas Augen wurden feucht, wie immer, wenn sie sich an diese Zeit erinnerte. Sie sah ihre Mutter wieder vor sich, wie sie erniedrigt um Barmherzigkeit bettelte, wie sie Richter, Amtmänner und Gefängnisaufseher um Gnade bat. Sie flehte Priester und Mönche an, sich für ihn einzusetzen, Dutzende Personen, die ihnen selbst den Gruß verweigerten. Sie versetzten, was sie nicht besaßen. Sie stahlen, sie betrogen, sie prellten, um die Schreiber und Advokaten zu bezahlen. Sie hungerten, um einen Kanten trockenes Brot in das Gefängnis bringen zu können, wo ihr Vater, wie so viele andere, auf das Ende des Prozesses und die Verkündung des Urteils wartete. Manche Gefangene schnitten sich während dieser grausamen Wartezeit eine Hand oder sogar einen Arm ab, um nicht auf der Galeere zu enden und dort einem langsamen wie sicheren, so schmerzhaften wie elendigen Tod entgegenzusehen.
Doch Melchor Vega hatte diese Folter überlebt. Ana trocknete sich die Augen mit den Ärmeln. Ja, das hatte er! Und eines Tages, als schon niemand mehr damit gerechnet hatte, war er wieder in Triana aufgetaucht, ausgemergelt, zerlumpt, geknickt, niedergeschlagen, mit schleppendem Gang, doch mit ungebrochenem Stolz. Er wurde zwar nie wieder der Vater, der ihr durch das Haar fuhr, wenn sie nach einem Streit unter Kindern bei ihm Trost gesucht hatte. Denn genau das hatte er getan! Er hatte ihr über das Haar gestrichen und sie liebevoll angesehen, um sie ohne Worte daran zu erinnern, wer sie war, nämlich eine Vega, eine Zigeunerin! Das schien das einzig Wichtige zu sein. Dieser Stolz auf ihre Herkunft, den hatte Melchor auch versucht, seiner Enkelin Milagros einzutrichtern. Kurz nach seiner Rückkehr hoffte ihr Vater, dass Ana noch einen Jungen zur Welt bringen würde. »Und wann kommt dein Sohn?«, fragte Melchor immer wieder. Und José, ihr Mann, fragte sie auch ohne Unterlass: »Wann bist du endlich wieder schwanger?« Es war, als ob der gesamte Callejón de San Miguel einen Jungen herbeisehnte. Josés Mutter, seine Tanten, seine Cousinen … sogar die Frauen der Familie Vega in der Siedlung beim Kartäuserkloster! Alle bedrängten sie mit der Frage, doch es sollte nicht sein.
Ana wandte den Kopf zu der Stelle, an der José nach ihrem kurzen Wortwechsel verschwunden war. Anders als ihr Vater hatte ihr Mann das nicht verkraftet, für ihn bedeutete es Scheitern und Erniedrigung, und nach und nach verschwanden die wenige Zärtlichkeit und Ehrerbietung aus dieser Ehe, die die Familien Vega und Carmona einst ausgehandelt hatten, bis sie durch den untergründigen Groll ersetzt wurden, der sich in ihrem harten Umgang miteinander zeigte. Melchor überschüttete Milagros mit all seiner Zärtlichkeit, und als er sich damit abgefunden hatte, dass es keinen Sohn geben würde, tat dies auch José. Ana wurde somit zur Zeugin im Wettstreit der beiden Männer und stand dabei stets auf der Seite ihres Vaters, den sie weitaus mehr liebte und schätzte als ihren Mann.
Inzwischen war es Nacht geworden. Wo Melchor wohl steckte?
Der Klang einer Gitarre holte Ana aus ihren Gedanken. Hinter sich, im Callejón, hörte sie, wie Leute hin und her liefen, wie Stühle und Bänke gerückt wurden.
»Fiesta!«, rief eine Kinderstimme.
Eine zweite Gitarre schloss sich der ersten an und versuchte, sich deren Melodie anzupassen. Kurz darauf war das Klappern von Kastagnetten zu vernehmen, dann fielen nach und nach immer mehr Kastagnetten ein und schließlich auch eine alte Metallrassel; alle schienen sich vorzubereiten, ohne Absprache oder Harmonie, so als wollten sie vorerst nur die Finger lockern, die später Tanz und Gesang begleiten sollten. Noch mehr Gitarren. Das Räuspern einer Frau, mit der gebrochenen Stimme des Alters. Ein Tamburin. Ana dachte an ihren Vater und daran, wie sehr er den Tanz liebte. Er kommt immer zurück, versuchte sie sich selbst einzureden. Das stimmte doch, oder? Schließlich war er ein Vega!
Als sie auf den Callejón trat, waren die Zigeuner bereits um ein Feuer versammelt.
»Los geht’s!«, ermutigte ein alter Mann, der vor dem Feuer saß, die anderen.
Alle Instrumente verstummten. Nur eine Gitarre, in den Händen eines jungen Mannes mit fast schwarzer Hautfarbe und mit einem schwarzen Pferdeschwanz, schlug die ersten Takte eines Fandango an.
Der Schiffsjunge, mit dem Caridad ihre Zigarre geteilt hatte, hatte sie begleitet. Die Tartane hatte in Triana an einem Landungssteg angelegt, hinter dem Hafen der Garnelenfischer, um Waren für die Vorstadt abzuladen.
»So, hier steigst du aus«, befahl der Kapitän der Schwarzen.
Der Junge lächelte Caridad an. Während der Schiffsfahrt hatten sie mehrmals zusammengesessen und geraucht. Unter dem Einfluss des Tabaks hatte Caridad schließlich auch verhalten und wortkarg die Fragen des Jungen beantwortet und Gerüchte widerlegt, die über dieses ferne Land im Umlauf waren: Kuba. Gab es dort tatsächlich einen so gewaltigen Reichtum? Was war mit den vielen Zuckerrohrplantagen? Und lebten dort wirklich so viele Sklaven, wie immer gesagt wurde?
»Eines Tages werde ich mit einem der großen Schiffe fahren!«, verkündete der Junge und ließ seiner Fantasie freien Lauf. »Und zwar als Kapitän! Ich werde über den Ozean fahren und Kuba kennenlernen.«
Als die Tartane anlegte, wartete Caridad, wie schon in Cádiz, zögerlich auf dem schmalen Stück Land zwischen dem Flussufer und der ersten Häuserreihe von Triana, von denen einige so nah am Guadalquivir standen, dass der Fluss die Fundamente frei gespült hatte. Einer der Lastenträger befahl ihr lautstark, zur Seite zu gehen, damit er einen großen Sack ausladen konnte. Bei dem Ruf wurde der Kapitän aufmerksam, er stand an der Reling und schüttelte den Kopf. Sein Blick kreuzte sich mit dem des Schiffsjungen, der seinerseits Caridad beobachtete. Die beiden Männer wussten, welches Schicksal dieser schwarzen Frau bevorstand.
»Du hast fünf Minuten«, gestand der Kapitän dem Jungen zu.
Der Schiffsjunge bedankte sich lächelnd für die Erlaubnis, sprang an Land und zog Caridad mit sich.
»Lauf. Los, schnell hinter mir her!«, drängte er sie. Ihm war bewusst, dass der Kapitän ihn an Land zurücklassen würde, wenn er nicht rechtzeitig zurück wäre.
Sie ließen die erste Häuserzeile hinter sich und gelangten zur Iglesia de Santa Ana. Dann liefen sie noch zwei Straßenzüge weiter und entfernten sich immer weiter vom Fluss. Der Schiffsjunge zog Caridad sichtlich nervös hinter sich her und wich den Passanten aus, die das Gespann befremdet betrachteten; schließlich hielten sie vor der Cava.
»Dort ist das Kloster der Minimen«, erklärte der Junge und zeigte auf ein Gebäude auf der anderen Seite des Grabens.
Caridad blickte in die Richtung, in die der Schiffsjunge deutete: ein flaches, weiß getünchtes Gebäude mit einer schlichten Kirche. Dann betrachtete sie den ehemaligen Verteidigungsgraben, der ihr den Weg versperrte: an vielen Stellen eine Senke voller Abfälle, an anderen Stellen nur notdürftig eingeebnet.
»Es gibt ein paar Stellen, an denen du auf die andere Seite kommst«, sagte der Junge, der sich Caridads Gedanken ausmalen konnte. »Bei der Iglesia de San Jacinto gibt es eine solche Stelle, aber das ist weit weg. Die Leute gehen einfach überall rüber, siehst du?« Er deutete auf mehrere Personen, die auf beiden Seiten des Grabens hinauf- und hinabstiegen. »Ich muss zum Schiff zurück«, verabschiedete er sich von Caridad, als er merkte, dass sie nicht reagierte. »Viel Glück!«
Caridad sagte nichts.
»Viel Glück!«, wünschte er noch einmal, ehe er zurückrannte.
Als sie nun allein war, konzentrierte sich Caridad auf das Kloster, den Ort, den Don Damián ihr genannt hatte. Auf einem engen Pfad, zwischen lauter Müll, querte sie den Graben. Auf der Tabakplantage gab es keinen Dreck, in Havanna schon. Sie hatte Gelegenheit gehabt, all den Abfall zu sehen, weil der Plantagenbesitzer sie einmal in die Stadt mitgenommen hatte, als er eine Lieferung Tabakblätter zum Hafenspeicher brachte. Wie konnten die Weißen nur so viel wegwerfen? Sie erreichte das Klostergebäude und drückte gegen eine der Türen. Sie war geschlossen. Caridad klopfte an. Sie wartete ab. Nichts. Sie klopfte noch einmal, schüchtern, um bloß keine Umstände zu machen.
»So doch nicht, Negerin!«, erklärte eine Frau und zog im Vorübergehen an einer Kette, die ein Glöckchen zum Läuten brachte.
Kurz darauf öffnete sich in einer der Türen ein vergittertes Guckloch.
»Der Friede des Herrn sei mit dir«, hörte sie die Pförtnerin sagen, der Stimme nach zu schließen eine alte Frau. »Was führt dich zu unserem Haus?«
Caridad nahm den Strohhut ab. Obwohl die Nonne sie gar nicht sehen konnte, senkte sie den Blick zu Boden.
»Don Damián hat gesagt, dass ich hierherkommen soll«, flüsterte sie.
»Ich verstehe dich nicht.«
Caridad hatte schnell geredet, so wie die afrikanischen Sklaven, wenn sie auf Kuba mit Weißen sprachen.
»Don Damián …« Caridad bemühte sich nun deutlich zu reden. »Er hat mir gesagt, dass ich hierhergehen soll.«
»Wer ist Don Damián?«, wollte die Frau an der Pforte nach einer geraumen Schweigepause wissen.
»Don Damián, der Priester auf der La Reina.«
»Die Königin? Was hast du denn mit der Königin zu schaffen?«, rief die Nonne.
»La Reina, die Königin, das Schiff aus Kuba.«
»Ach so! Ein Schiff, nicht Ihre Hoheit. Also … ich weiß nicht. Don Damián, hast du gesagt? Warte einen Moment!«
Als sich das Guckloch erneut öffnete, war eine feste, strenge Stimme zu vernehmen.
»Gute Frau, was hat dieser Priester dir gesagt, was du hier machen sollst?«
»Er hat gesagt, dass ich hierhergehen soll.«
Daraufhin schwieg die Nonne und ließ einige Sekunden verstreichen. Dann sprach sie mit sanfter Stimme weiter.
»Wir sind eine arme Klostergemeinschaft. Wir widmen uns dem Gebet, der Enthaltsamkeit, der Kontemplation und der Buße, nicht der Wohltätigkeit. Was solltest du hier machen können?«
Caridad gab keine Antwort.
»Woher kommst du?«
»Aus Kuba.«
»Bist du eine Sklavin? Was ist mit deinem Besitzer?«
»Ich bin … ich bin frei. Außerdem kann ich beten.« Don Damián hatte ihr eindringlich aufgetragen, das zu sagen.
Carid konnte das schmallippige Lächeln der Nonne nicht sehen.