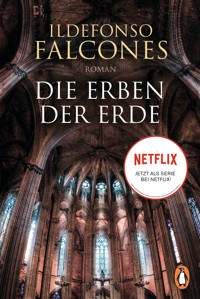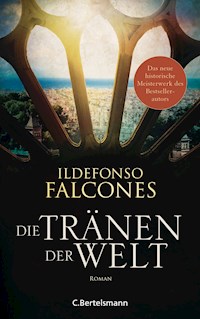5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein monumentales Leseerlebnis!
Andalusien, 1568. Nach Jahren der Unterdrückung erheben sich die spanischen Muslime gegen ihre christlichen Peiniger. Unter den Aufständischen ist auch der junge Maure Hernando, der sein Volk und seine Kultur vor dem Untergang retten will. Doch die Revolte wird bald zum blutigen Glaubenskrieg, und angesichts der von beiden Seiten begangenen Grausamkeiten wächst in Hernando das Bedürfnis nach Frieden und Aussöhnung der Religionen – ein Ziel, dem er fortan sein Leben widmet.
In seinem Weltbestseller über Glaube und Versöhnung erzählt Falcones die ergreifende Geschichte vom Aufstand der Muslime bis zu ihrer endgültigen Vertreibung, und entführt uns in ein faszinierendes al-Andalus am Wendepunkt der europäischen Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1319
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Ildefonso Falcones
Die
Pfeiler
des
Glaubens
Roman
Aus dem Spanischen von Stefanie Karg
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »La Mano de Fátima«
bei Grijalbo, Random House Mondadori, S.A., Barcelona.
Cervantes wird zitiert nach: Miguel de Cervantes Saavedra, Der geistvolle Hidalgo Don Quijote von der Mancha. Herausgegeben und übersetzt von Susanne Lange. © Carl Hanser Verlag, München 2008
1. Auflage
Copyright © 2009 Random House Mondadori, S.A., Barcelona
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-04909-6www.cbertelsmann.de
Für meine Söhne:Ildefonso, Alejandro, José María und Guillermo
Wenn ein Muslim kämpft oder sich im Gebiet der Ungläubigen aufhält, muss er sein Verhalten beizeiten an seine Umgebung anpassen. Nicht aufzufallen, kann für ihn dann von Vorteil oder sogar eine Pflicht sein, wenn sein Verhalten dem Wohle des Islam dient oder einen anderen Nutzen mit sich bringt – wie den Ungläubigen zu predigen, Geheimnisse zu erfahren und diese an Muslime weiterzugeben oder allgemein Schaden abzuwenden.
Ahmad Ibn Taymiya (1263–1328)
Berühmter arabischer Gelehrter
I In Allahs Namen
… Also kämpften wir Tag für Tag gegen den Feind, die Kälte, die Hitze, den Hunger, gegen den Mangel an Munition und Zaumzeug, gegen neue Kriegsschäden und Todesfälle, bis wir schließlich erleben durften, dass die Feinde –diese kampflustigen und stark bewaffneten Männer, die sich auf ihre vorteilhafte Lage und die Unterstützung durch die Türken und Barbaren verlassen hatten – besiegt waren und sich ergaben. Sie wurden von ihrem Land vertrieben und enteignet. Sie waren Gefangene, Männer und Frauen in Fesseln. Ihre Kinder wurden verkauft oder verschleppt, um weit weg von hier zu leben … Ein zweifelhafter Sieg, und manchmal stellte sich die Frage, ob Gott uns oder den Feind bestrafen wollte.
Diego Hurtado de Mendoza
Der Krieg von Granada, Erstes Buch
1
Juviles, Alpujarras, Königreich GranadaSonntag, 12. Dezember 1568
Das morgendliche Läuten der Kirchenglocken durchdrang die eisige Kälte in dem kleinen Dorf am Fuße der Sierra Nevada. Das metallische Echo brach sich in den felsigen Schluchten des Südhanges, erfüllte das fruchtbare Tal mit seinen Flüssen Guadelfo, Adra und Andarax, die sich aus den zahllosen Gebirgsbächen der verschneiten Gipfel speisten, und wurde schließlich von den steilen Hängen der Sierra Contraviesa zurückgeworfen. Jenseits davon erstreckten sich die steilen Täler der Alpujarras bis hin zum Mittelmeer. Etwa zweihundert Männer, Frauen und Kinder schleppten sich in der fahlen Wintersonne zur Kirche und versammelten sich schweigend am Hauptportal.
Vor dem schlichten ockerfarbenen Gotteshaus mit seinem wuchtigen Glockenturm lag ein weitläufiger Vorplatz, von dem aus sich ein Gewirr aus engen Gassen über den Hang ausbreitete. Die vielen kleinen Gebäude waren nur grob verputzt: ein- oder zweistöckige weiß getünchte Wohnhäuser mit winzigen Türen und Fenstern, Flachdächern und runden Kaminen. Auf den Flachdächern lagen Feigen, Paprika und Weintrauben zum Trocknen ausgebreitet. Die Dächer der weiter unten am Hang errichteten Häuser reichten meist gerade so an die Fundamente der weiter oben gelegenen heran, dass es von Weitem so wirkte, als wären sie aufeinandergebaut.
Auf dem verschneiten Kirchplatz standen bereits einige Kinder und etwa zwanzig Altchristen des Dorfes. Sie beobachteten eine alte Frau mit arabischen Gesichtszügen, die auf der obersten Sprosse einer an die Hauptfassade der Kirche gelehnten Leiter stand und die Winterkälte seit den frühen Morgenstunden ohne Mantel ertragen musste. Sie zitterte am ganzen Leib und klapperte mit den wenigen ihr noch verbliebenen Zähnen. Die eintreffenden Dorfbewohner waren allesamt Morisken, die muslimischen Nachfahren der in Spanien einst so mächtigen Mauren, vom König zur Taufe und zum öffentlichen Bekenntnis zum Christentum gezwungen. Diese Neuchristen gingen langsam auf die Kirche zu, ohne dabei den Blick von der alten Moriskin abzuwenden, die verzweifelt versuchte, das Gleichgewicht zu halten. Das Gelächter der Altchristen brach das Schweigen.
»Hexe!«
Mehrere Steine trafen die alte Frau, und die unterste Sprosse war bald mit Spucke bedeckt.
Das Läuten der Glocken verebbte, und die letzten Dorfbewohner eilten in die Kirche. Im unbeheizten Inneren kniete nur wenige Schritte vom Altar entfernt ein imposanter dunkelhaariger Mann mit sonnengegerbtem Gesicht auf dem eisigen Steinboden. Er hatte einen Strick um den Hals und die Arme wie ein Gekreuzigter von sich gestreckt. In jeder Hand hielt er eine brennende Kerze.
Vor einigen Tagen hatte dieser Mann der alten Frau auf der Leiter das Hemd seiner kranken Ehefrau gegeben, damit sie es in einer Quelle wusch, deren Wasser als heilkräftig galt. In dieser zwischen den schroffen Felsen und der üppigen Vegetation der Sierra Nevada versteckten Quelle wurde normalerweise keine Wäsche gewaschen. Als der Dorfpfarrer Don Martín die alte Frau dabei überraschte, wie sie das Hemd ins Wasser tauchte, war er sofort davon überzeugt, dass dies Hexenwerk sei – die Strafe ließ nicht lange auf sich warten: Sie musste den Sonntagmorgen auf der Leiter zubringen, dem öffentlichen Spott ausgesetzt. Doch auch der Moriske, der sie zur Hexerei angestiftet hatte, musste büßen und dem Gottesdienst kniend beiwohnen.
Kaum hatten die Dorfbewohner die Kirche betreten, trennten sich die Männer von den Frauen, die sich mit ihren Töchtern in die vorderen Bankreihen setzten. Der kniende Büßer starrte ihnen mit leerem Blick entgegen. Alle Anwesenden kannten ihn: Er war ein rechtschaffener Mann, der friedlich sein Land bestellte und sein Vieh versorgte. Er hatte doch nur seiner kranken Frau helfen wollen! Sobald alle Platz genommen hatten, begaben sich der Pfarrer Don Martín, der Pfründenbesitzer Don Salvador und der junge Sakristan Andrés zum Altar. Don Martín, ein stolzer Mann mit blassem Gesicht und rosigen Wangen, trug ein goldbesticktes Priestergewand aus Seide und machte es sich mit Blick zu den Gläubigen in einem thronartigen Sessel bequem, flankiert vom Pfründenbesitzer und dem jungen Sakristan. Die Kirchentür wurde geschlossen, und die Flammen der Kerzen hörten auf zu flackern. Die bunte Mudéjar-Holzkassettendecke der Kirche strahlte über dem so nüchternen wie tragischen Altarbild und den düsteren Gemälden der Seitenwände.
Der hagere, dunkelhäutige Sakristan schlug ein Buch auf und hüstelte.
»Francisco Alguacil«, las er laut vor.
»Hier.«
Andrés überprüfte, woher die Antwort kam, und trug etwas in das Buch ein.
»José Almer.«
»Hier.«
»Milagros Garvía. María Ambroz …« Je weiter Andrés in der Liste kam, desto knarrender wurde seine Stimme.
»Marcos Núñez.«
»Hier.«
»Du hast letzten Sonntag gefehlt«, stellte der Sakristan fest.
»Ich war …«, setzte der Mann zu einer Erklärung an, fand aber nicht die richtigen Worte und beendete den Satz auf Arabisch, während er aufgeregt ein Dokument hervorholte.
»Komm her«, befahl Andrés.
»Ich war in Ugíjar«, stieß er endlich hervor und brachte dem Sakristan das Dokument.
Andrés überflog das Schreiben und reichte es dem Pfarrer, der den Inhalt sorgfältig prüfte und kurz nickte. Der Prior der Stiftskirche von Ugíjar bestätigte, dass der Neuchrist Marcos Núñez aus Juviles am Sonntag, dem 5. Dezember, beim Hauptamt in jener Stadt gewesen war.
Über das Gesicht des Sakristans huschte ein sanftes Lächeln. Jeden Sonntag und an allen hohen Feiertagen musste er die Anwesenheit der Neuchristen überprüfen. Einige Aufrufe blieben unbeantwortet, was sorgfältig vermerkt wurde. Im Gegensatz zu Marcos Núñez konnten zwei Frauen ihr Fortbleiben am vorigen Sonntag nicht rechtfertigen und begannen hastig sich zu entschuldigen. Andrés blickte zum Pfarrer. Eine der Frauen gab ihren Versuch abrupt auf, als Don Martín ihr mit einer herrischen Geste bedeutete zu schweigen, die andere Frau behauptete, sie sei am letzten Sonntag krank gewesen.
»So fragt doch meinen Mann!«, rief sie und sah sich verzweifelt nach ihrem Ehemann um, der in einer der hinteren Reihen saß. »Er wird euch …«
»Sei still, du Teufelsanbeterin!« Don Martíns Brüllen brachte die Moriskin zum Schweigen, und der junge Sakristan notierte die Namen der beiden Frauen und die zu entrichtende Strafe: Sie sollten jeweils einen halben Real bezahlen.
Nachdem Andrés die Anwesenden gezählt hatte, begann Don Martín mit der Messe – nicht jedoch ohne den Sakristan vorher darauf hinzuweisen, dass der Büßer die Kerzen höher halten solle.
»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes …«
Nur wenige verstanden die Worte aus der Heiligen Schrift, und die meisten konnten der Zeremonie und den zahlreichen Wutausbrüchen des Priesters während der Predigt kaum folgen.
»Glaubt ihr etwa, das Wasser irgendeiner Quelle könne euch von einer Krankheit heilen?« Don Martín deutete auf den knienden Mann. Er drohte ihm mit dem Zeigefinger, und sein Gesicht war angespannt. »Kehrt um und tut Buße. Christus allein kann euch von Sorge und Leid erlösen, mit denen der Herr eure Zügellosigkeit, eure Blasphemie und eure Ketzerei bestraft!«
Viele Morisken verstanden kein Spanisch und verständigten sich mit den Christen durch eine Mischung aus Arabisch und Spanisch. Aber alle mussten das Vaterunser, das Ave-Maria, das Glaubensbekenntnis, das Salve-Regina und die Zehn Gebote aufsagen können, sonst wurden sie bestraft oder durften nicht heiraten. Die Männer und Frauen mussten deshalb den Katechismusunterricht besuchen. Erst wenn sie die Gebete auswendig aufsagen konnten, wurden sie vom Unterricht befreit.
Beim Gottesdienst sprachen alle die Gebete mit. Die Kinder schrien dabei so laut, dass die Eltern den Priester täuschen und heimlich »Allahu akbar«, »Allah ist groß«, dazwischenrufen konnten.
»O Erhabener! Führe mich mit deiner Macht …«, rief ein junger Moriske im Tumult des Vaterunser-Geschreis der Kinder.
Der Pfründenbesitzer Don Salvador drehte sich wütend zu ihnen und lauschte angestrengt.
Ein anderer Moriske nutzte die Gelegenheit und flehte: »O Stifter des Friedens …«
Don Salvador wurde rot vor Zorn.
Erst am Ende des Gebetes konnte man wieder die schroffe Stimme des Priesters heraushören.
»Lob sei Gott!«, wagte jetzt noch jemand in einer der hinteren Reihen zu rufen.
Die meisten Morisken erstarrten, einige richteten den Blick auf Don Salvador. Wer hatte es gewagt, Allah so offen zu preisen? Der Pfründenbesitzer drängte sich durch die Reihen und stieß dabei einige Männer zur Seite, konnte den Gotteslästerer aber nicht ausmachen.
Als die erste Hälfte des Gottesdienstes vorbei war, nahmen der Sakristan und der Pfründenbesitzer unter dem wachsamen Auge des Priesters die Gaben der Gemeinde entgegen: Münzen, Brot, Eier, Leinenstoff … Nur die Armen waren von der milden Gabe ausgenommen. Wenn hingegen die reichsten Gemeindemitglieder an drei Sonntagen hintereinander nichts abgaben, wurden sie bestraft. Andrés notierte sorgfältig, wer etwas und was jemand gab.
Als die »Todesglocke« erklang, wie die Morisken das helle Glöckchen nannten, das bei der Wandlung geläutet wurde, knieten sie missmutig zwischen den frommen Altchristen nieder. Das Glöckchen klingelte in dem Moment, in dem der Priester mit dem Rücken zur Gemeinde die Hostie hochhielt. Es ertönte wieder, als er den Kelch anhob. Don Martín wollte gerade die Einsetzungsworte sprechen, als er sich wegen der allgemeinen Unruhe in der Kirche plötzlich wutentbrannt umdrehte.
»Hunde!«, schrie er. »Haltet den Mund, ihr Häretiker! Kniet euch so hin, wie es sich gehört, um Christus, den einzig wahren Gott, zu empfangen! Du da!« Er deutete mit dem dünnen Zeigefinger auf einen alten Mann in der dritten Reihe. »Du wirst hier nicht deinem falschen Gott huldigen. Und ihr sollt euren Blick heben, wenn ihr das heilige Sakrament empfangt!«
Sein vernichtender Blick bohrte sich in zwei Morisken, ehe er mit dem Gottesdienst fortfuhr. Dann gingen die Männer und Frauen schweigend zu ihm. Die Altchristen empfingen den Segen mit Ehrfurcht, die meisten Neuchristen scherzten hingegen heimlich über diesen heiligen »Kuchen« und bekreuzigten sich verkehrt herum. Nach dem Friedenssegen verließ die Gemeinde die Kirche. Die Morisken eilten nach Haus, um den »Kuchen« wieder auszuspeien.
Die wenigen Altchristen des Dorfes standen noch immer vor der Kirchentür, um miteinander zu schwatzen. Sie achteten nicht darauf, dass ihre Kinder die alte Frau beschimpften, die inzwischen völlig entkräftet von der Leiter gefallen war und nun reglos und schwer atmend am Boden lag. In der Kirche warfen der Priester und seine beiden Gefährten dem Büßer unaufhörlich sein Vergehen vor, während sie die liturgischen Gegenstände vom Altar einsammelten und in die Sakristei brachten.
2
Die Morisken haben die Revolte begonnen, das ist wahr, doch es sind die Altchristen mit ihrer Arroganz, ihren Plünderungen und ihrer Rohheit, mit der sie die Frauen nehmen, die sie zur Verzweiflung treiben. Selbst die Geistlichen verhalten sich schändlich. Eine ganze Moriskengemeinde beschwerte sich unlängst beim Erzbischof über ihren Pfarrer. Er solle versetzt werden, bat die Gemeinde … Oder man solle ihn zumindest verheiraten, denn »alle unsere Kinder kommen mit seinen blauen Augen zur Welt«.
Francés de Álava, Spaniens Gesandter in Frankreich an Philipp II., 1568
Juviles war das größte von etwa zwei Dutzend Dörfern, die über die südlichen Ausläufer der Sierra Nevada verstreut lagen. Nur ein Viertel des felsigen Gebietes wurde bewässert und mit Weizen und Gerste bebaut. Der größere Teil war mit Weinstöcken, Olivenhainen, Feigen-, Esskastanien-, Walnuss- und vor allem unzähligen Maulbeerbäumen für die Seidenraupenzucht bepflanzt. Auch wenn die Seide aus Juviles nicht ganz so geschätzt wurde wie die aus anderen Gegenden der Alpujarras, war sie doch die wichtigste Einnahmequelle der Region.
Die Morisken bewirtschafteten auch noch das steilste Stück Land bis zu den hohen Gipfeln. Jeder fruchtbare Winkel wurde durch eines der unzähligen Terrassenfelder nutzbar gemacht.
Eines Tages, als die Sonne schon im Zenit stand, kehrte Hernando Ruiz von einem dieser Felder nach Juviles zurück. Der Junge war etwas über vierzehn Jahre alt, schlank und sehr flink. Er hatte dunkelbraunes Haar, und unter seinen buschigen Augenbrauen leuchteten große, auffallend blaue Augen.
Es war kalt, aber die Mittagssonne milderte die eisige Winterluft aus der Sierra Nevada. Hernando hatte gerade die letzten Früchte eines alten, knorrigen Olivenbaums geerntet, die beim Schütteln nicht herabgefallen waren. Er war zwischen den krumm gewachsenen Ästen hinaufgeklettert und hatte die noch unreifen Oliven von Hand gepflückt. Am liebsten wäre er dort geblieben, hätte Unkraut gejätet und wäre anschließend zu einem anderen Terrassenfeld gegangen, wo der alte Hamid vermutlich gerade seinen bescheidenen Landbesitz bearbeitete. Nur wenn die beiden allein waren, auf dem Feld arbeiteten oder in den Bergen Heilkräuter suchten, nannte Hernando ihn »Hamid« und nicht »Francisco« – denn das war sein christlicher Name, auf den er getauft worden war. Fast alle Morisken hatten zwei Namen: einen christlichen und einen muslimischen. Nur Hernando war einfach »Hernando« – im Dorf machte man sich deshalb oft über ihn lustig und verspottete ihn als den »Nazarener«.
Beim Gedanken daran verlangsamte der Junge seinen Schritt. Er war kein Nazarener! Er fegte mit dem Fuß einige Steine vom Weg und ging dann weiter in Richtung seines Zuhauses, das außerhalb des eigentlichen Dorfes lag. Dort hatte seine Familie genügend Platz gefunden, um eine zusätzliche Hütte zu bauen, die als Stall für die sechs Maultiere diente, mit denen sein Stiefvater durch die Alpujarras zog – sowie für das siebte, Hernandos Lieblingstier: die gute Alte.
Vor etwa einem Jahr hatte seine Mutter ihm den Grund für den verhassten Spitznamen erklärt. Er hatte seinem Stiefvater Ibrahim – »José« für die Christen – eines Morgens bei Sonnenaufgang geholfen, die Maultiere aufzuzäumen. Nach getaner Arbeit, als er sich mit einem sanften Klaps von der Alten verabschiedet hatte, warf ihn plötzlich eine heftige Ohrfeige zu Boden.
»Du Christenhund!«, schrie Ibrahim zornig. Der Junge schüttelte sich, um wieder zu sich zu kommen. Er glaubte hinter dem Stiefvater seine Mutter zu erkennen, wie sie mit gesenktem Haupt im Haus verschwand. »Du hast dem Tier den Sattelgurt falsch angelegt!«, brüllte Ibrahim. »Soll es sich unterwegs etwa wund reiben und dann nicht mehr arbeiten können? Du bist wirklich ein nutzloser Nazarener.« Ibrahim spuckte auf den Boden. »Du bist und bleibst ein Christenbastard.«
Hernando floh vor seinem Stiefvater und versteckte sich in einer Ecke des Stalls. Sobald das Hufklappern der Lasttierkolonne Ibrahims Aufbruch verkündete, erschien seine Mutter Aischa in der Hütte und brachte ihm einen Becher mit Limonade.
»Tut’s noch weh?«, fragte sie, kniete vor ihm nieder und fuhr ihm zärtlich durchs Haar.
»Warum sagen alle ›Nazarener‹ zu mir?«, schluchzte Hernando. Aischa schloss angesichts der Tränen ihres Sohns kurz die Augen und versuchte dann liebevoll, sein Gesicht zu trocknen. Hernando sah sie an. »Warum?«
»Einverstanden, du bist jetzt alt genug.« Aischa nickte kurz, setzte sich neben ihn auf den Boden und holte tief Luft. »Weißt du, vor etwas mehr als vierzehn Jahren hat sich der Pfarrer meines Heimatdorfes in Almería an mir vergangen …« Hernando sprang auf und starrte sie entsetzt an. »Ja, mein Junge. Ich schrie und wehrte mich, so wie es unsere Gesetze vorschreiben. Aber der Priester war so kräftig. Er hat mich weit außerhalb des Dorfes angesprochen, mitten auf dem Feld, am späten Vormittag. Es war ein sonniger Tag …«, erinnerte sie sich. »Dann …«, ihre Miene verfinsterte sich. »Ich war doch vollkommen hilflos!«, brach es aus ihr heraus. »Er hat meine Kleider mit einer einzigen Handbewegung zerrissen. Dann hat er mich auf den Boden gedrückt und …«
Aischa kehrte schwer atmend in die Gegenwart zurück und begegnete dem Blick ihres Sohnes.
»Du bist das Ergebnis dieser Schändung«, flüsterte sie. »Sie nennen dich den Nazarener, weil dein Vater ein christlicher Prediger ist. Es ist alles meine Schuld …«
Hernando brach erneut in Tränen aus. Auch Aischa kämpfte gegen den Strom der eigenen Tränen. Der Becher mit Limonade glitt ihr aus der Hand, als sie ihrem Sohn in die Arme fiel.
Die junge Aischa hatte mit den Hilfeschreien damals zwar ihre Ehre gerettet, aber als ihre Schwangerschaft offensichtlich wurde, suchte ihr Vater, ein einfacher Maultiertreiber, nach einem Weg, die Schande nicht fortwährend ansehen zu müssen. Die Lösung fand er in Ibrahim, einem jungen, gut aussehenden Maultiertreiber aus Juviles, dem er unterwegs des Öfteren begegnet war. Er bot ihm die Hand seiner Tochter und zwei Mulis als Mitgift an: ein Tier für das Mädchen und das andere für das ungeborene Kind. Ibrahim zögerte, aber er war jung, arm und konnte die Tiere gut brauchen. Außerdem, wer sagte denn, dass dieses Wesen jemals das Licht der Welt erblicken würde? Oder vielleicht würde es nicht einmal die ersten Monate überstehen … In dieser Gegend starben viele Kinder kurz nach der Geburt.
Ibrahim widerte die Vorstellung zwar an, dass ein Priester Aischa geschändet hatte, aber er ließ sich auf den Handel ein und nahm sie mit zu sich nach Juviles.
Doch Hernando kam als kräftiger Säugling zur Welt, noch dazu mit den blauen Augen des Priesters. Die Umstände seiner Zeugung kamen schnell ans Licht, und die Dorfbewohner hatten zwar Mitleid mit der jungen Frau, nicht aber mit dem Kind. Ihre Verachtung wurde noch größer, als sie merkten, wie sehr sich Don Martín und Andrés um den Jungen bemühten – so als wollten sie den Bastard des Priesters vor Mohammeds Anhängern retten.
Als Hernando seiner Mutter später die frisch geernteten Oliven gab, konnte sein Lächeln Aischa nicht täuschen. Sie fuhr ihm zärtlich durchs Haar, wie immer, wenn sie ihn traurig erlebte, und er ließ es trotz der anwesenden vier Stiefgeschwister zu. Seine Mutter konnte ihm nur äußerst selten ihre Liebe zeigen – nur dann, wenn sein Stiefvater nicht da war. Ibrahims Hass gegen den Nazarener mit den blauen Augen, den Lieblingsschüler der christlichen Geistlichen, war mit der Geburt seiner eigenen vier Kinder nur noch größer geworden. Mit neun Jahren wurde Hernando in den Stall verbannt und durfte nur noch dann im Wohnhaus essen, wenn sein Stiefvater unterwegs war. An diesem Tag stand das Essen bereits auf dem Tisch, und Hernandos vier Stiefgeschwister warteten auf ihn. Selbst der Jüngste, der vierjährige Musa, zog in seiner Anwesenheit ein mürrisches Gesicht.
»Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes«, sagte Hernando, ehe er sich auf den Boden setzte.
Der kleine Musa und sein siebenjähriger Bruder Aquil taten es ihm gleich und griffen mit den Fingern nach dem Essen: Lamm und Artischocken, mit Minze, Koriander und Safran in Essig und Öl gekocht. Raissa und Zahara, seine beiden Stiefschwestern, warteten darauf, dass die männlichen Familienmitglieder mit dem Essen fertig waren, damit sie selbst beginnen konnten.
Nach dem Lammgericht brachte die elfjährige Zahara noch ein Tablett mit Rosinen, aber Hernando blieb keine Zeit: Er hörte ein dumpfes Klappern in der Ferne und hob den Kopf. Seine Stiefbrüder bemerkten seine Unruhe und hörten auf zu essen. Keiner konnte die Ankunft der Maultiere so früh hören wie Hernando.
»Die Alte kommt!«, rief der kleine Musa.
Ibrahim kehrte nach Hause zurück.
»Lob sei Gott«, beendete Hernando die Mahlzeit und stand schnell auf.
Draußen wartete die ausgezehrte Alte geduldig auf ihn, sie trug kein Zaumzeug und war mit Sattelwunden übersät.
»Komm, Alte«, sagte Hernando und führte sie in den Stall.
Das ungleichmäßige Klappern der Hufe begleitete sie. Im Stall legte er ihr etwas Stroh hin und strich ihr über den Hals.
»Wie war die Reise?«, flüsterte er und untersuchte eine Wunde, die sie vorher noch nicht gehabt hatte.
Er sah ihr kurz beim Fressen zu, dann lief er schnell los – den Berghang hinauf. Sein Stiefvater erwartete ihn bestimmt schon im Versteck etwas abseits des Weges nach Ugíjar. Hernando lief einige Zeit querfeldein und achtete darauf, keinem Altchristen zu begegnen. Er umging die eingesäten Terrassenfelder und alle anderen Stellen, an denen zu dieser Tageszeit womöglich noch gearbeitet wurde. Ein wenig außer Atem gelangte er an eine nur schwer zugängliche Stelle, von der aus man auf die steile Felswand blicken konnte, wo Ibrahim bereits auf einem Vorsprung auf ihn wartete. Hinter dem Morisken standen die sechs schwer beladenen Maultiere, und im Fels konnte man viele Öffnungen erkennen, die in kleine Höhlen führten.
Ibrahim war ein großer, kräftiger Mann mit Vollbart. Er trug einen grünen Hut mit breiter Krempe und einen halblangen blauen Umhang, unter dem ein kurzer plissierter Rock hervorragte, der die Oberschenkel vor der Kälte schützte. Die Unterschenkel waren nackt, und an den Füßen trug er Lederschuhe mit Riemen. Zum Jahreswechsel würden die neuen Gesetze in Kraft treten. Dann musste Ibrahim wie alle Morisken im Königreich Granada seine Volkstracht gegen die übliche Kleidung der Christen eintauschen. Im Gürtel glänzte – obwohl dies schon jetzt verboten war – ein Krummdolch.
Als er seinen Stiefvater in der Ferne erblickte, verlangsamte Hernando seinen Schritt. Die Furcht, die ihn in dessen Nähe immer überkam, bedrückte ihn. Wie würde er ihn diesmal empfangen? Beim letzten Mal hatte er ihm eine Ohrfeige verpasst, weil er sich angeblich verspätet hatte, dabei war er ohne Umwege zu ihrem Treffpunkt gerannt. Auf den letzten Schritten zu Ibrahim beeilte er sich wieder.
»Warum kommst du so spät?«, fuhr ihn sein Stiefvater an.
Als Hernando sich an seinem Stiefvater vorbeizwängte, ging er in Deckung. Dennoch traf ihn ein heftiger Schlag am Kopf. Er stolperte auf das erste Maultier zu und schlüpfte dann geschickt an den übrigen Tieren vorbei in eine der Felshöhlen hinein. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, begann er die Waren, die sein Stiefvater von den Tieren ablud, in das sichere Versteck zu bringen.
»Das Öl hier ist für Juan«, sagte Ibrahim und reichte ihm einen bauchigen Tonkrug. Angesichts des fragenden Blicks seines Stiefsohns fügte er noch den muslimischen Namen hinzu: »Ich meine Aisar. Und der hier ist für Faris.« Hernando verstaute die Waren in der Höhle und versuchte sich die Namen der jeweiligen Besitzer zu merken.
Als die Maultiere von der Hälfte ihrer Last befreit waren, brach Ibrahim nach Juviles auf. Hernando blieb am Höhleneingang zurück und ließ seinen Blick über die weite Landschaft bis zur Sierra Contraviesa schweifen. Aber er hielt sich nicht lange damit auf, da er diesen Ausblick in- und auswendig kannte. Er ging in die Höhle und betrachtete neugierig die Gegenstände, die sie soeben abgeladen hatten, und die vielen anderen, die dort bereits seit Längerem lagerten. Hunderte ähnliche Höhlen dienten den Morisken in den Alpujarras inzwischen als Versteck für ihren Besitz. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit würden die Männer kommen und die Dinge mitnehmen, die sie brauchten. Jeder Transport lief gleich ab. Von wo auch immer der Stiefvater aufgebrochen war, bevor er Juviles erreichte, band er die Alte los und schickte sie nach Hause. »Sie kennt die Alpujarras besser als jeder von uns. Ich habe mein ganzes Leben auf diesen Wegen verbracht, und trotzdem hat mir das Maultier schon einige Male das Leben gerettet«, erzählte der Treiber immer wieder. Wenn Ibrahim sie losließ, trottete die Alte allein nach Hause, und Hernando lief sofort zu den Höhlen, um seinen Stiefvater zu treffen. Dort luden sie die Hälfte der Handelswaren ab, um so die hohen Steuern zu halbieren, die sein Stiefvater zu entrichten hatte. Die vielen Pachtherren, die den Zehnt oder die Erstlingsabgabe erhielten, und die zahllosen Büttel, die die Geldstrafen einzogen, hatten es sich angewöhnt, in die Häuser der Morisken einzudringen und alles mitzunehmen oder zu pfänden, was ihnen in die Hände fiel, selbst wenn der Wert der Gegenstände die eigentlichen Schulden überstieg. Später notierten sie nicht einmal den Erlös aus der Versteigerung, und die Morisken verloren auf diese Weise langsam, aber sicher ihren Besitz. Sie hatten bereits viele Klagen beim Richter von Ugíjar, beim Bischof und sogar beim Corregidor von Granada, dem Vertreter der Krone, vorgebracht, aber sie stießen nur auf taube Ohren, und die christlichen Steuereintreiber beuteten sie weiterhin ungestraft aus. Deshalb taten es alle Ibrahim gleich.
Hernando lehnte an der kalten Höhlenwand. Nun lag zwar eine lange Wartezeit vor ihm, aber er verstand die Notwendigkeit dieses Betruges. Anderenfalls würden die Christen sie noch ruinieren. Er half auch dabei, den Zehnt der Rinder, Ziegen und Schafe zu umgehen. Obwohl ihn seine Glaubensbrüder ansonsten mieden, hatte man ihn hierfür zum Mithelfer bestimmt. Es war wichtig, gut mit Zahlen umgehen zu können, wenn man den Steuereintreiber im Frühjahr um den Zehnt betrügen wollte. Zuerst wurden die Tiere auf einer ebenen Fläche zusammengetrieben. Dann wurde aus Ästen ein enger Gang gebildet, durch den ein Tier nach dem anderen getrieben wurde. Jedes zehnte Tier gehörte der Kirche. Aber die Morisken wussten, dass kleine Herden von dreißig oder weniger Tieren nicht der Zehntzahlung unterlagen und dass sie für solche Herden nur wenige Maravedíes bezahlen mussten. Wenn es wieder einmal so weit war, teilten sie deshalb in allgemeiner Übereinkunft die Herden in kleinere Gruppen. Dieser Kniff verlangte später sehr gute Rechenkünste, damit die ursprünglichen Herden wieder richtig zusammengestellt werden konnten.
Doch Hernandos Beteiligung an dieser List kam ihn teuer zu stehen. Der Junge blickte wütend in Richtung Höhlenwand und erinnerte sich an den Nachmittag, an dem man ihn für diese besondere Aufgabe ausgewählt hatte.
»Viele von uns können zählen, aber alle haben selbst Ziegen und Schafe, und das könnte zu Misstrauen führen«, hatte ein alter Moriske angeführt, der Hernando für die Aufgabe vorgeschlagen hatte. »Ibrahim und der Junge dagegen haben kein Interesse an den Tieren.«
»Was ist, wenn er uns verrät?«, wandte ein anderer Moriske ein. »Er verbringt zu viel Zeit bei den Pfaffen.«
Plötzlich schwiegen die anwesenden Männer.
»Keine Sorge. Ich kümmere mich darum«, versicherte Ibrahim ruhig.
An diesem Abend kam er zu seinem Stiefsohn in den Stall, als der gerade die Tiere versorgte.
»Frau«, brüllte der Maultiertreiber.
Hernando war erstaunt. Was hatte er denn nun schon wieder falsch gemacht? Und warum rief Ibrahim nach seiner Mutter? Aischa eilte zu den beiden. Aber noch ehe sie eine Frage stellen konnte, versetzte Ibrahim ihr mit dem Handrücken einen heftigen Schlag ins Gesicht. Aischa taumelte, Blut rann aus ihrem Mundwinkel.
»Sieh dir das gut an!«, knurrte Ibrahim. »Wenn du den Pfaffen auch nur ein Wort von den Höhlen oder den Tieren erzählst, verpasse ich deiner Mutter hundert davon. Verstanden?«
Hernando verbrachte den ganzen Nachmittag in der Höhle, bis kurz vor Einbruch der Dunkelheit der letzte Moriske gekommen war. Erst dann stieg er wieder ins Dorf hinab. Er kümmerte sich um die Maultiere, versorgte ihre Wunden und prüfte ihre körperliche Verfassung. An seinem Schlafplatz, in einer Ecke des Stalls, entdeckte er eine Schale mit Mehlbrei und einen Becher Limonade. Hungrig schlang er sein Abendessen herunter und verließ eilig die Hütte. Als er an der kleinen Tür des Wohnhauses vorbeikam, spuckte er aus. Im Haus lachten seine Stiefgeschwister, und aus dem Stimmengewirr war deutlich die raue Stimme seines Stiefvaters herauszuhören. Raissa entdeckte Hernando durch das Fenster und lächelte ihm flüchtig zu: Als einzige der Geschwister hatte sie manchmal Mitleid mit ihm, auch wenn ihre seltenen Liebesbekundungen – wie die von Aischa – nur hinter Ibrahims Rücken geschehen durften. Hernando ging eilig weiter und rannte dann schließlich zu dem Haus, in dem der alte Hamid wohnte.
Der hagere Moriske mit dem faltigen Gesicht war Witwer und zog sein linkes Bein beim Gehen leicht nach. Hernando wusste nicht genau, wie alt er war, aber er hielt ihn für einen der Ältesten im Dorf. Hamid lebte in einem armseligen Haus, das man bereits tausende Male nachgebessert hatte – ohne sichtlichen Erfolg. Die Tür stand leicht offen, aber Hernando klopfte dennoch dreimal an.
»Salam aleikum«, antwortete Hamid auf das dritte Klopfen. »Ich habe Ibrahim heute ins Dorf gehen sehen«, sagte er noch, als Hernando über die Schwelle trat.
Eine rauchende Öllampe brachte etwas Licht in den kleinen Raum. Von den Wänden bröckelte der Putz, und an der Decke gab es Wasserflecken, aber insgesamt wirkte es sauber und ordentlich. Im Kamin brannte kein Feuer, und das einzige Fenster hatte man verblendet, damit es nicht in sich zusammenfiel.
»Hast du schon gebetet?«
Hernando hatte mit dieser Frage gerechnet. Er wusste auch, was nun folgen würde: »Das Nachtgebet ist das einzige Gebet, das wir in Sicherheit verrichten können, weil die Christen dann schlafen.«
Der Sakristan hatte sich bemüht, Hernando nicht nur das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, sondern auch die christlichen Gebete. Der alte Hamid, der von den zwangsbekehrten Muslimen im Dorf als Alfaquí – als Gelehrter – geachtet wurde, tat das Gleiche mit dem Islam. Nachdem die Morisken im Dorf Hernando verstoßen hatten, hatte Hamid diese Aufgabe mit einem Eifer verfolgt, als stünde er nicht nur mit dem Sakristan, sondern mit der gesamten Gemeinde im Wettstreit. Draußen auf den Terrassenfeldern ließ er Hernando vor neugierigen Blicken geschützt beten, oder sie rezitierten gemeinsam die Suren, wenn sie allein in der Sierra Heilkräuter suchten.
Noch bevor Hernando antworten konnte, stand Hamid auf und verriegelte die Tür. Das Wasser stand bereits in sauberen Krügen bereit. Sie entkleideten sich schweigend und nahmen die Richtung der Qibla ein, gen Mekka.
»Ach, Gott, mein Herr«, betete Hamid, während er mit den Händen in den Tonkrug fuhr und sich dreimal wusch. Hernando tat es ihm gleich. »Mit deiner Hilfe hüte ich mich vor der Unreinheit und der Bosheit des zu steinigenden Satans!«
Dann wuschen sie sich, so wie es Vorschrift war: den Schambereich, die Hände, die Nase und das Gesicht, den rechten und den linken Arm von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen, den Kopf, die Ohren und die Füße bis zu den Knöcheln. Jede Waschung begleiteten sie mit den entsprechenden Formeln. Manchmal war Hamids Stimme nur noch ein kaum hörbares Flüstern. Das war das Zeichen des Alfaquí, dass Hernando die Führung übernehmen sollte. Der Junge lächelte, und die beiden setzten das Ritual fort.
»… am Tag des Gerichts …«, betete der Junge laut.
Hamid hielt die Augen halb geschlossen, er nickte zufrieden und stimmte wieder mit ein.
»…dem sein Buch in die Rechte gegeben wird, der wird einer leichten Rechenschaft unterzogen sein und wird fröhlich zu seinen Angehörigen …«
Nach den Waschungen begannen sie mit dem Nachtgebet. Dafür verbeugten sie sich zweimal und berührten mit den Händen die Knie.
»Lob sei Gott«, begannen sie einstimmig.
Gerade als sie auf Hamids einziger Decke knieten, mit Stirn und Nase den Stoff berührten, klopfte es an der Tür.
Die beiden erstarrten.
Es klopfte noch einmal, diesmal lauter.
Hamid schaute besorgt zu Hernando, der seinen Blick erwiderte. Seine blauen Augen funkelten im Licht der Öllampe. Er war ein alter Mann, aber Hernando …
»Hamid, mach auf!«
Hamid? Kein Christ hätte ihn bei diesem Namen gerufen. Der Alfaquí stand auf und öffnete die Tür.
»Salam aleikum.«
»Aleikum salam«, grüßte der Fremde zurück. Ein kleiner Mann mit dunkler, ledriger Haut, der erheblich jünger war als Hamid, betrat den nur schwach erleuchteten Raum.
»Das ist Hernando«, sagte Hamid ruhig. »Hernando, das ist Ali. Er kommt aus Órgiva und ist der Mann meiner Schwester. Was führt dich so spät noch zu mir? Du bist weit weg von zu Hause.« Statt einer Antwort deutete Ali mit dem Kinn fragend auf Hernando. »Dem Jungen können wir vertrauen«, versicherte Hamid.
Ali beobachtete Hernando, der aufstand und nickte. Hamid bat seinen Schwager, auf der Decke Platz zu nehmen. Er selbst setzte sich auf ein verschlissenes Kissen.
»Bring frisches Wasser und ein paar Rosinen«, bat er Hernando.
»Zum Jahreswechsel wird es eine neue Welt geben«, prophezeite Ali feierlich.
Die kaum zwanzig Rosinen in der Schale, die Hernando zwischen die beiden Männer stellte, waren Almosen der Dorfbevölkerung für den Alfaquí.
Hamid begleitete die Worte seines Schwagers mit einem wissenden Nicken. »Das habe ich gehört.«
Hernando beobachtete die beiden Männer neugierig. Er wusste nicht, dass Hamid Verwandte hatte, aber diesen Satz hörte er nicht zum ersten Mal. Sein Stiefvater sagte ihn immer wieder, vor allem wenn er von seinen Reisen aus Granada zurückkehrte. Der Sakristan hatte ihm erklärt, es gehe um die neue königliche Verordnung, die die Morisken zwang, sich wie Christen zu kleiden und nicht mehr Arabisch zu sprechen.
»In der Karwoche der Christen ist der Versuch dieses Jahr doch schon einmal gescheitert«, sagte Hamid weiter. »Warum sollte es dieses Mal anders sein?«
Hernando war verwirrt. Wovon sprach Hamid? Was für einen gescheiterten Versuch meinte er?
»Dieses Mal wird der Aufstand gelingen«, versicherte Ali. »Beim letzten Mal wussten alle in den Alpujarras von den Plänen. Deshalb hat auch der Marquis von Mondéjar in Granada davon erfahren, und unsere Glaubensbrüder im Albaicín-Viertel trauten sich nicht aus ihren Häusern.«
Hamid bat ihn weiterzusprechen. Hernando erstarrte, als er das Wort »Aufstand« hörte.
»Diesmal wurde entschieden, dass die Leute in den Alpujarras erst dann etwas erfahren, wenn die Eroberung von Granada kurz bevorsteht. Unsere Leute im Albaicín haben genaue Anweisungen, und es gab geheime Versammlungen mit den Männern aus der Vega von Granada, aus dem Lecrín-Tal und aus Órgiva. Die verheirateten Männer haben die verheirateten Männer angeworben, die Junggesellen die Junggesellen und die Witwer die Witwer. Mehr als achttausend Mann stehen für den Angriff auf die Alhambra bereit. Wir rechnen damit, dass die ganze Region hunderttausend Mann bewaffnen kann.«
»Wer steht diesmal hinter dem Aufstand?«
»Die Treffen finden im Haus eines Wachsziehers im Albaicín statt, er heißt Adelet. An den Versammlungen beteiligen sich auch Hernando El Zaguer, der Büttel von Cádiar, Diego López aus Mecina de Bombarón, Miguel de Rojas aus Ugíjar und Farax ibn Farax, Tagari, Mofarrix, Alatar …«
»Ich traue diesen Monfíes nicht«, unterbrach ihn Hamid.
Ali zuckte mit den Schultern.
»Du weißt«, setzte er zu ihrer Verteidigung an, »dass vielen von uns nichts anderes übrig bleibt, als in die Berge zu flüchten. Uns tun die Monfíes nichts! Du selbst wärst einer von ihnen, wenn du nicht …« Ali vermied, auf Hamids lahmes Bein zu schauen. »Die meisten von ihnen wurden Monfíes, weil ihnen das gleiche Unrecht zugefügt wurde wie dir.«
Ali sprach nicht weiter. Er wartete die Reaktion seines Schwagers ab. Hamid gab sich einige Sekunden seinen Erinnerungen hin und stimmte dann zu.
»Was für ein Unrecht …«, begann Hernando, aber angesichts der abweisenden Handbewegung, mit der Hamid auf seine Frage reagierte, sprach er nicht weiter.
»Wer nimmt noch an den Treffen teil?«
»Partal aus Narila, Nacoz aus Nigüeles, Seniz aus Bérchul.« Hamid hörte nachdenklich zu. Ali erklärte weiter: »Alles ist abgemacht. In Granada stehen die Männer aus dem Albaicín am Neujahrstag bereit. Sobald der Aufstand beginnt, klettern die anderen achttausend Mann … klettern wir über den Generalife-Palast in die Alhambra. Wir haben siebzehn Strickleitern, die gerade in Ugíjar und in Quéntar angefertigt werden. Ich habe sie selbst gesehen: Sie sind aus kräftigen Hanfstricken gemacht, und die Sprossen sind aus so festem Holz, dass drei Männer gleichzeitig hochklettern können. Und wir müssen uns wie Türken verkleiden, damit die Christen denken, wir hätten Hilfe von den Barbaresken oder vom Sultan erhalten. Die Frauen bereiten die Gewänder vor. Wir werden Granada genau an dem Tag zurückerobern, an dem es sich einst den kastilischen Königen ergeben hat.«
»Was geschieht, wenn die Stadt erst einmal eingenommen ist?«
»Dann wird uns Algier helfen. Der Groß-Türke wird uns helfen. Das haben sie versprochen. Spanien verkraftet keinen weiteren Krieg, seine Soldaten kämpfen schon in Flandern, in Amerika und gegen die Barbaresken und Türken.« Bei diesen Worten blickte Hamid zur Decke. »Lob sei Gott!«, flüsterte er.
»Die Prophezeiungen erfüllen sich, Hamid!«, rief Ali. »Es ist soweit!«
Dann herrschte Schweigen, nur noch Hernandos aufgeregter Atem war zu hören. Der Junge zitterte ein wenig und sah immer wieder von einem Mann zum anderen.
»Und was soll ich machen? Was kann ich schon ausrichten?«, fragte Hamid plötzlich. »Ich hinke …«
»Als direkter Nachfahre der Nasriden musst du bei der Eroberung von Granada dabei sein. Du bist ein Vertreter des Volkes, dem die Stadt immer gehört hat und dem sie wieder gehören wird. Deine Schwester begleitet dich gerne.«
Bevor Hernando eine Frage stellen konnte, drehte sich Hamid zu ihm um, nickte und mahnte ihn zur Geduld. Der Junge ließ sich wieder auf der Decke nieder, aber er konnte seine großen blauen Augen nicht von dem auf den ersten Blick so unscheinbaren Alfaquí abwenden. Hamid war ein Nachfahre der Nasriden-Dynastie, der Könige von Granada!
3
Hamid bot Ali an, die Nacht bei ihm zu verbringen, aber er lehnte die Einladung ab: Er wusste, dass Hamid nur ein einziges Bett besaß, und um seinen Gastgeber nicht zu beleidigen, behauptete er, er wolle noch einige Dinge mit einem anderen Bewohner von Juviles besprechen, der bereits auf ihn warte. Hamid gab sich damit zufrieden und begleitete ihn zur Tür. Hernando sah zu, wie sich die beiden Männer mit allen Förmlichkeiten voneinander verabschiedeten. Der Alfaquí blickte seinem Schwager nach, bis dieser vollends in der Dunkelheit verschwunden war, und verriegelte dann die Tür. Er wandte sich dem Jungen zu, sein faltiges Gesicht wirkte angespannt, und seine ansonsten so friedlichen Augen leuchteten.
Hamid blieb noch einen Augenblick an der Tür stehen und überlegte. Schließlich setzte er sich zu Hernando und lächelte ihn an. Aber die tausend Fragen, die dem Jungen durch den Kopf schossen – Nasriden? Welcher Aufstand? Was beabsichtigte der Groß-Türke? Was war mit den Algeriern? Warum sollte Hamid eigentlich auch ein Monfí sein? Gab es in den Alpujarras Barbaresken? –, bündelten sich in einer einzigen Frage:
»Wie kann es sein, dass du so arm bist, wenn du ein Nachfahre …«
Die Gesichtszüge des Alfaquí verdüsterten sich.
»Sie haben mir alles genommen«, antwortete er trocken.
Der Junge blickte zur Seite.
»Tut mir leid«, stieß Hernando hervor.
»Vor nicht allzu langer Zeit«, begann Hamid, »du warst schon längst auf der Welt, da gab es eine entscheidende Veränderung in Granada. Bis dahin waren wir Muslime nur vom Marquis von Mondéjar abhängig, dem Generalkapitän und somit Vertreter des Königs. Aber die vielen Beamten und gerissenen Juristen des Königlichen Obergerichts von Granada forderten – übrigens gegen den Willen des Marquis – die Hoheit über uns, und der König gab ihren Forderungen nach. Dann haben die Amtsschreiber und Juristen damit begonnen, alte Gerichtsverfahren gegen Muslime wieder aufzurollen. Sie ignorierten das Gewohnheitsrecht, das denjenigen von uns, die sich einem Lehnsherrn unterstellten, Straffreiheit für frühere Vergehen zusicherte. Davon hatten beide Seiten lange Zeit profitiert: Die Muslime siedelten sich friedlich in den Alpujarras an, und der König hatte Arbeiter, die ihm viel höhere Steuern zahlten als die Christen. Nur das Obergericht zog keinen Nutzen aus dieser Übereinkunft.« Hamid griff nach einer Rosine. »Nimm dir doch auch eine«, forderte er seinen Schüler auf.
Hernando wurde ungeduldig. Nein, er wollte nichts essen … Er wollte eine Antwort auf seine Frage hören. Er wollte, dass Hamid weitererzählte! Aber er fügte sich, nahm eine Rosine und kaute darauf herum.
»Also«, fuhr Hamid fort, »unter dem Vorwand, die aufständischen Muslime in den Bergen verfolgen zu wollen, bildeten die Amtsschreiber Söldnertruppen, die in Wirklichkeit nur aus ihren eigenen Dienern und Verwandten bestanden. Sie zahlten ihnen einen Sold, wie er im königlichen Heer noch nie bezahlt worden war. Er war sogar höher als der bei den Tercios in Flandern. Doch anstatt mit dem Schwert in den Kampf gegen die Monfíes zu ziehen, begannen die Amtsschreiber einen Papierkrieg gegen die friedfertigen Muslime, die den Boden ihrer Lehnsherren bestellten. Die Familien, denen man die alten Verfahren anhängte, zahlten dafür einen hohen Preis. Viele mussten ihre Häuser über Nacht verlassen und sich den Monfíes anschließen. Aber die Habgier der Beamten war damit noch lange nicht befriedigt: Sie begannen mit Nachforschungen zu jeglichem Landbesitz der Muslime, und die Familien, die keine Dokumente über ihren Besitz hatten, wurden gezwungen, erneut Abgaben an den König zu zahlen – oder ihr Land zu verlassen. Und viele von uns hatten nicht genug Geld.«
»Hattest du auch keine Dokumente?«, fragte Hernando.
»Nein«, antwortete Hamid betrübt. »Ich bin ein Nachfahre der Nasriden, des letzten Herrschergeschlechts von Granada. Meine … Familie«, und bei diesen Worten klang Hamids Stimme so erhaben, dass Hernando erschauderte, »gehörte zu den edelsten und vornehmsten Familien von Granada … Und dann kommt so ein bösartiger Schreiberling und nimmt mir mein Land und meine Reichtümer.«
Hernando war erschüttert. Hamid verharrte einen Moment in seinen schmerzhaften Erinnerungen. Doch dann hatte er sich wieder gefasst und sprach weiter.
»Die Spanier gaben dem Sultan von Granada Bu Abdillah, den die Christen Boabdil nennen, als Ausgleich für die Kapitulation die Alpujarras als Lehen, in die er sich mit seinem Hofstaat zurückzog. Zu diesem Hofstaat gehörte auch sein Cousin, mein Vater, ein angesehener Alfaquí. Aber das reichte diesen elenden Spaniern nicht: Ohne dass der Sultan davon erfuhr, kauften sie hinter seinem Rücken genau die Ländereien wieder zurück, die sie ihm soeben überlassen hatten – und vertrieben ihn. Zusammen mit dem Sultan verließen fast alle muslimischen Adligen und Notabeln Spanien. Aber mein Vater entschied, bei unseren Leuten zu bleiben, die seinen Rat als Alfaquí benötigten. Später verstieß Kardinal Cisneros auch noch gegen den Kapitulationsvertrag von Granada, der den Muslimen ein friedliches Dasein und die Glaubensfreiheit zugesichert hatte. Er überzeugte die Könige davon, alle Muslime zu vertreiben, die sich nicht zum Christentum bekehren ließen. Fast alle wurden zwangsbekehrt! Wir wollten unser Land nicht aufgeben. Das Land, auf dem wir einst zur Welt gekommen waren und auf dem unsere eigenen Kinder aufwuchsen. Die Christen veranstalteten mit Hunderten von uns Massentaufen, bei denen wir mit Weihwasser besprengt wurden. Viele von uns kamen aus den Kirchen und sagten, kein einziger Tropfen davon habe ihre Haut berührt, und deshalb seien sie nach wie vor Muslime. Als ich vor fünfzig Jahren auf die Welt kam …« Hernando beugte sich überrascht vor. »Du hast gedacht, ich sei älter?« Der Junge senkte den Kopf. »Es gibt Dinge, die lassen dich schneller altern als der Lauf der Jahre … Also, wir lebten damals friedlich auf den Ländereien, die uns Sultan Boabdil mündlich zugesprochen hatte. Niemand stellte unseren Besitz infrage, bis sich das Heer aus Beamten und Winkeladvokaten in Bewegung setzte. Dann …«
Hamid hielt inne.
»Dann haben sie dir alles genommen«, beendete Hernando den Satz mit bebender Stimme.
»Fast alles.« Der Alfaquí nahm eine weitere Rosine aus der Schale. »Fast alles«, wiederholte Hamid mit der Rosine im Mund. »Unseren Glauben konnten sie uns nicht nehmen, dabei war das für sie das Wichtigste. Und außerdem konnten sie mir nicht …«
Hamid stand schwerfällig auf und ging zu einer der Wände seiner Behausung. Dort scharrte er mit dem rechten Fuß im Erdboden, bis er auf eine längliche Holzbohle stieß. Er hob sie an einem Ende an und bückte sich, um einen in Stoff gehüllten Gegenstand darunter hervorzuholen. Hernando erriet aufgrund der länglichen, leicht gekrümmten Form, was es war.
Hamid wickelte den im schwachen Schein der Öllampe schimmernden Krummsäbel langsam aus und zeigte ihn dem Jungen.
»Das hier. Das hier konnten sie mir nicht nehmen. Auch wenn die Notare, Büttel und Sekretäre alle Seidengewänder, Edelsteine, Tiere und die ganze Getreideernte an sich rissen, gelang es mir, den wertvollsten Besitz meiner Familie vor ihnen zu verstecken. Diese Waffe hat schon der Prophet in seinen Händen gehalten … Friede und Gottes Segen mögen ihn begleiten«, fügte er andächtig hinzu. »Mein Großvater erzählte meinem Vater, dass dieser Säbel eine der Waffen ist, die Mohammed als Lösegeld von den Quraisch erhalten hatte, die er bei der Einnahme von Mekka gefangen nahm.«
An der kostbaren Scheide des Krummsäbels funkelten Metallplättchen mit arabischen Inschriften. »Eine Waffe aus dem Besitz des Propheten!« Hamid zog die glänzende Klinge aus der Scheide.
»Du wirst die Wiedereroberung der Stadt miterleben, die niemals hätte fallen dürfen«, sagte er feierlich und blickte auf die Waffe in seinen Händen. »Du wirst mit eigenen Augen sehen, wie sich die Prophezeiungen erfüllen und in al-Andalus wieder die Gläubigen herrschen werden.«
4
Juviles, Freitag, 24. Dezember 1568
Die Gerüchte im Dorf wurden schließlich von einem Trupp Monfíes bestätigt, der auf dem Weg nach Ugíjar durch Juviles zog.
»Alle Männer der Alpujarras im kriegsfähigen Alter müssen sich in Ugíjar einfinden«, befahlen sie den Bewohnern von Juviles. »Der Aufstand hat begonnen. Wir werden unser Land zurückerobern! In Granada wird wieder der Islam herrschen!«
Trotz der Geheimhaltung, mit der die Morisken des Albaicín-Viertels den Aufstand in Granada behandelten, verbreitete sich die Losung »Zum Jahreswechsel wird es eine neue Welt geben« in den Bergen wie ein Lauffeuer. Doch die Monfíes und die Bewohner der Alpujarras wollten den Neujahrstag nicht mehr abwarten. Sie überfielen einige Beamte, die auf dem Weg nach Granada waren und unterwegs die Bergdörfer gnadenlos und ohne Angst vor Strafen ausraubten. Die Monfíes brachten diese Beamten auf bestialische Weise um. Andere Aufständische legten sich mit einem Trupp Soldaten an, und auch die Morisken in Cádiar erhoben sich in großer Zahl: Sie plünderten die Dorfkirche und die Häuser der Christen und richteten unter den Bewohnern ein Blutbad an.
Als die berittenen Monfíes weitergezogen waren und sich die Christen in ihren Häusern verschanzten, schloss sich auch die muslimische Bevölkerung von Juviles dem Aufstand an: Die Männer bewaffneten sich mit Dolchen, Stichmessern, sogar mit dem ein oder anderen alten Schwert oder einer ausgedienten Arkebuse, die sie vor den christlichen Bütteln hatten verstecken können. Die Frauen holten ihre Schleier hervor und ihre farbenfrohen, mit Gold- und Silberstickereien verzierten Gewänder aus Seide, Leinen oder Wolle. Sie schmückten ihre Hände und Füße mit Henna und staffierten sich mit ihren traditionellen Gewändern aus, die sich so sehr von der christlichen Kleidung unterschieden. Einige trugen ihre hüftlangen Marlotas, andere lange hemdartige Gewänder, die am Rücken spitz zuliefen. Wadenlange, plissierte Pluderhosen wölbten sich über grobe Strümpfe. Die Füße steckten meist in Holzschuhen, die mit Lederriemen festgeschnürt waren. Das ganze Dorf war eine einzige Farbexplosion, überall leuchteten die verschiedensten Grün-, Blau- und Gelbtöne … aber alle Frauen bedeckten ihr Haupt: einige nur das Haar, die meisten aber das ganze Gesicht.
Hernando half Andrés seit den frühen Morgenstunden in der Kirche. Sie bereiteten die Christmette vor. Der junge Sakristan überprüfte gerade ein wertvolles Priestergewand, als die verriegelte Tür des Gotteshauses mit brachialer Gewalt aufgestoßen wurde und ein Pulk Morisken unter lautem Geschrei hereinstürmte. In der Menschenmenge befanden sich auch der Pfarrer und der Pfründenbesitzer, die man aus ihren Häusern gezerrt und hierher geschleppt hatte. Sie konnten sich kaum noch aufrecht halten, aber sobald sie zu Boden fielen, wurden sie mit Fußtritten wieder auf die Beine geholt.
»Was soll das?«, rief Andrés entsetzt. Aber schon verpassten die Morisken ihm ein paar Fausthiebe und warfen ihn zu Boden. Der Sakristan fiel Don Martín und Don Salvador vor die Füße.
Hernando wollte Andrés zunächst helfen, war aber wie erstarrt und beobachtete entsetzt das Geschehen. Die aufgebrachte Menge drang nun in die Sakristei ein. Die Männer brüllten und geiferten und traten alles zur Seite, was ihnen in den Weg kam. Sie rissen die Schränke auf und warfen den Inhalt auf den Boden. Plötzlich wurde Hernando grob am Kragen gepackt und neben den Pfarrer und seine Gefährten zu Boden geschleudert. Bei dem Aufprall schlug er sich das Gesicht auf.
Inzwischen trafen weitere Aufständische ein, die die christlichen Familien des Dorfes vor sich hertrieben. Diese Christen wurden brutal zu Hernando und den drei Würdenträgern vor den Altar gestoßen. Ganz Juviles war mittlerweile in der Kirche versammelt. Die Moriskenfrauen tanzten um die Christen herum und stießen mit schnellen Zungenbewegungen spitze Freudenschreie aus. Hernando beobachtete vom Boden aus die gesamte Szenerie: Ein Mann urinierte auf den Altar, ein anderer schnitt das Hanfseil der Kirchenglocke durch, um sie für immer zum Schweigen zu bringen, wieder andere hieben mit Beilen auf Heiligenbilder ein.
Vor dem Pfarrer und den übrigen Christen häuften sie Wertgegenstände auf: Kelche, Hostienteller, Kerzenleuchter, Priestergewänder … Alles unter dem ohrenbetäubenden Gebrüll der Männer und dem gellenden Freudengeschrei der Frauen. Hernando beobachtete, wie zwei kräftige Männer die vergoldete Tür des Tabernakels zertrümmern wollten. Aber plötzlich schien der Lärm zu verstummen, und Hernandos Sinne konzentrierten sich nur noch auf den Anblick seiner Mutter: Aischas entblößte Brüste wippten im Takt eines delirischen Tanzes, ihre langen schwarzen Haare fielen ihr über die Schultern, und ihre Zunge zuckte frenetisch im kreischenden Mund.
»Mutter«, flüsterte Hernando. Was tat sie da? Das war doch eine Kirche! Und außerdem … Wie konnte sie sich vor allen Männern so zur Schau stellen?
Als hätte sie sein Flüstern gehört, blickte sie zu ihrem Sohn. Hernando kam es wie eine Ewigkeit vor, aber plötzlich stand Aischa vor ihm.
»Lasst ihn los«, forderte sie keuchend die umstehenden Morisken auf. »Das ist mein Sohn. Er ist Muslim.«
Hernando konnte seinen Blick nicht von den entblößten Brüsten seiner Mutter abwenden, die nun schlaff herunterhingen.
»Das ist der Nazarener!«, hörte er einen Mann hinter sich rufen.
Die Erwähnung seines Spitznamens rief ihn schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Hernando drehte sich um. Er kannte den Morisken: Es war ein überaus hässlicher Schmied, mit dem sein Stiefvater immer wieder in Streit geriet. Aischa packte ihren Sohn am Arm und wollte ihn mit sich zerren, aber der Mann verpasste ihr einen Schlag.
»Warte, bis dein Mann mit den Maultieren zurückkommt«, sagte er höhnisch. »Er soll entscheiden.«
Mutter und Sohn tauschten verzweifelte Blicke aus. Aischas Augen verengten sich zu Schlitzen, ihre zusammengekniffenen Lippen bebten. Plötzlich drehte sie sich um und rannte davon. Der Sakristan saß neben Hernando und wollte ihm einen Arm um die Schulter legen, aber der Junge riss sich erschrocken los und sah seiner Mutter nach, die hastig die Kirche verließ. Sobald Aischas schwarze Mähne verschwunden war, nahm er das gewaltige Getöse um sich herum wieder wahr.
Ganz Juviles war ein einziges Fest. Die Morisken sangen und tanzten zum Klang der Tamburine, Trommelschellen, Schalmeien, Kesselpauken und Flöten durch die Straßen. Ibrahim kehrte stolz auf dem Rücken eines hellen, kräftigen Pferdes in das Dorf zurück und führte einen Trupp bewaffneter Morisken an. Seine Männer konnten sich nur mit Mühe einen Weg durch den Tumult auf den Straßen bahnen.
Ibrahim hatte sich dem Aufstand in Cádiar angeschlossen, wo er unterwegs mit seinen Tieren davon überrascht worden war. Dort hatte er Seite an Seite mit Partal und dessen Monfíes gegen eine Kompanie von fünfzig Arkebusenschützen gekämpft, die sie besiegt und getötet hatten.
Nun fragte Ibrahim nach den Christen im Dorf, und einige Dorfbewohner zeigten zwischen Rufen und Freudensprüngen auf die Kirche. Er lenkte seinen kräftigen Falben zum Eingang und wollte gerade in die Kirche hineinreiten, als das Pferd unruhig schnaubte und an der Tür stehen blieb. Der Tumult im Inneren kam einen Augenblick zur Ruhe, und man konnte Don Martíns Protest vernehmen.
»Gottesläs…!«
Aber sofort wurde der Pfarrer mit Fausthieben und Fußtritten zum Schweigen gebracht. Ibrahim spornte seinen Falben an und ritt über die am Boden verstreuten Bruchstücke der Kreuze und Heiligenbilder. Die Morisken stießen bei diesem Anblick ein erneutes Freudengeheul aus. Shihab, der Büttel des Dorfes, grüßte ihn aus der Ecke vor dem Altar, wo die Christen versammelt waren. Ibrahim ritt langsam auf sie zu.
»Die ganzen Alpujarras stehen in Waffen!«, sagte er, ohne vom Pferd abzusteigen, als er bei Shihab angekommen war. »Partal will, dass ich die Frauen, Kinder und die kampfunfähigen alten Männer hierher bringe, damit sie in der Burg von Juviles in Sicherheit sind. Dorthin habe ich auch die Beute aus Cádiar gebracht.«
Die Burg von Juviles lag ein wenig östlich vom Dorf. Das schwer zugängliche Bauwerk stammte aus dem 10. Jahrhundert. Die alten Mauern standen noch, wie auch einige der ursprünglich neun Türme. Der Burghof war groß genug, um die Morisken aus Cádiar aufzunehmen.
»In Cádiar hat kein einziger Christ überlebt!«, rief Ibrahim.
»Und was sollen wir mit denen hier machen?«, fragte ihn der Büttel und zeigte auf die Christen vor dem Altar.
Ibrahim wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, als ihm eine zweite Frage zuvorkam.
»Und der hier? Was sollen wir mit dem hier machen?« Der Schmied zerrte Hernando zwischen den Christen hervor.
Ein grausames Lächeln glitt über Ibrahims Gesicht, als er seinen Stiefsohn entdeckte. Diese verdammten blauen Augen! Am liebsten würde er sie dem Christenbastard …
»Du hast doch immer gesagt, dass er ein verdammter Christenhund ist«, fluchte der Schmied.
Das stimmte, das hatte er tausende Male gesagt … Aber jetzt brauchte er den Jungen. Der Monfí-Anführer hatte ihm das eindeutig gesagt, als Ibrahim von ihm seinen Sold gefordert hatte: das Schwert, die Arkebuse und den Falben des Hauptmanns Herrera, dem Anführer der Soldaten von Cádiar.
»Du arbeitest weiter als Maultiertreiber«, hatte Partal befohlen. »Wir brauchen dich. Wir müssen alles, was wir unseren Feinden abnehmen, in die Barbareskenstaaten bringen und dort gegen Waffen eintauschen. Was hilft dir ein Pferd, wenn du die Lasttiere mit der Beute zu Fuß begleiten musst?«
Aber Ibrahim wollte dieses Pferd unbedingt haben. Er glühte vor Verlangen danach, mit dem Schwert und der Arkebuse des Hauptmanns und noch dazu beritten gegen die verhassten Christen zu kämpfen.
»Mein Stiefsohn Hernando wird die Lasttiere führen«, hatte er Partal geantwortet. »Er kennt sich aus: Er kann die Tiere beschlagen und heilen, und sie folgen ihm. Ich werde die Männer anführen, die du mir zuteilst, um die Beute zu verteidigen.«
Partal strich sich über seinen Bart. El Zaguer, der Ibrahim gut kannte und alles mitbekommen hatte, setzte sich für ihn ein.
»Ibrahim gibt einen besseren Soldaten als einen Maultiertreiber ab«, stellte er fest. »Er ist mutig und geschickt. Und ich kenne seinen Sohn: Hernando kann sehr gut mit den Tieren umgehen.«
»Einverstanden«, gab Partal nach kurzem Überlegen nach. »Bring die Leute nach Juviles, und pass auf unsere Beute auf. Du und dein Sohn, ihr haftet dafür mit eurem Leben.«
Und jetzt wollten die Leute in Juviles Hernando gefangen nehmen, weil sie ihn für einen Christen hielten. Ibrahim blieb auf dem Falben sitzen und stammelte ein paar unverständliche Worte.
»Dein Stiefsohn ist ein Christ!«, brüllte der Schmied. »Das hast du selbst immer behauptet!«
»Ja, beweise es ihnen, Hernando!«, forderte Andrés den Jungen hoffnungsvoll auf. Einer der Morisken wollte sich schon auf den Sakristan stürzen, aber der Büttel hinderte ihn daran. »Bekenne dich zu deinem Glauben, Hernando«, flehte der Sakristan.
»Ja, mein Sohn. Bete zu Gott«, sagte Don Martín mit blutverschmiertem Gesicht und gesenktem Haupt. »Empfiehl dich dem wahrhaften …« Aber ein Fausthieb streckte ihn nieder.
Hernando ließ den Blick über die anwesenden Muslime und Christen schweifen. Was war er eigentlich? Andrés hatte sich mehr um seine Bildung als um die der anderen Dorfjungen gekümmert. Der Sakristan hatte ihn immer besser behandelt als sein eigener Stiefvater. Aber auch der alte Hamid hatte ihn als Freund und Schüler angenommen und ihm geduldig die Gebete und die Lehren der Muslime beigebracht, den Glauben seines Volkes. In Cádiar hat kein einziger Christ überlebt! Das hatte zumindest Ibrahim behauptet. Kalter Schweiß stand Hernando auf der Stirn: Wenn sie ihn als Christen ansahen, war sein Schicksal besiegelt …
Ibrahims Pferd tänzelte auf dem Kirchenboden. Ja, der Bastard war ein Christ! Er war der Sohn eines Priesters! Er kannte den Katechismus besser als jeder andere Muslim! Partal kannte seine Söhne nicht. Er könnte ihm ja sagen, Aquil sei …
»Du musst dich endlich entscheiden!«, forderte der Schmied. Die Menge wurde unruhig.
Ibrahim atmete tief durch, und in seinem Gesicht erschien ein boshaftes Lächeln.
»Ach, wisst ihr …«
»Was gibt es da zu entscheiden? Wer soll etwas wissen?«
Hamids Stimme brachte die aufgebrachte Menge in der Kirche zum Schweigen. Der Alfaquí trug eine einfache lange Tunika, über der die kostbare Scheide des Krummsäbels glänzte, die statt an einem Gürtel an einem einfachen Strick befestigt war. Er versuchte so aufrecht zu gehen, wie es sein steifes Bein zuließ. Das helle Klirren der Metallplättchen an der Säbelscheide war deutlich zu hören.
»Was gibt es da zu entscheiden?«, fragte Hamid noch einmal.
Hinter ihm konnte man Aischa keuchen hören. Sie war bis zu Hamids Hütte gelaufen, denn sie wusste von seiner Verbundenheit mit ihrem Sohn und von der Ehrfurcht, die ihm die Dorfbewohner als Alfaquí entgegenbrachten. Nur er konnte Hernando retten!
Hamid hatte in seiner Hütte angesichts Aischas üppiger Brüste, die nur notdürftig von ihrem unordentlichen Gewand verdeckt waren, den Blick abgewandt. »Bedecke dich«, hatte er sie aufgefordert, ebenso verwirrt wie sie selbst. Dann hatte er versucht, die Worte der Frau zu verstehen. Er hatte sie beruhigt und sie gebeten, langsamer zu sprechen. Aischa konnte schließlich alles erklären, und der Gelehrte zögerte nicht eine Sekunde. Beide eilten zur Kirche.
»Der Junge ist ein Christ!«, wiederholte der Schmied und stieß Hernando in die Seite.
Hamid runzelte die Stirn.
»Hör mal, Jusuf«, sagte er zum Schmied. »Sprich bitte das Glaubensbekenntnis.«
Der Schmied zuckte zusammen.
»Was hat denn das mit dem Glaubensbekenntnis zu tun?«, beschwerte sich Ibrahim.
»Halt den Mund!«, befahl ihm Hamid schroff.
»Sprich!«, forderte er den Schmied nochmals auf.
»Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt, und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist«, begann Jusuf.
»Weiter.«
»Das ist doch das Glaubensbekenntnis. Das reicht doch«, entschuldigte sich der Schmied.
»Nein. Das ist es nicht. In al-Andalus ist es das nicht. Jetzt sag das Glaubensbekenntnis unserer Vorfahren so auf, wie es sich gehört. Es sind schließlich unsere Vorfahren, die du mit deiner Tat rächen willst.«
Jusuf hielt dem Blick des Gelehrten einige Sekunden lang stand, aber dann sah auch er wie viele der anwesenden Morisken zu Boden.
»Sprich nun das Bekenntnis, das du deinen Kindern beibringen sollst, das du aber vergessen hast«, sagte Hamid. »Kann einer von euch die Eigenschaften Gottes aufsagen, wie es bei uns Sitte ist?«
Der Alfaquí ließ seinen Blick über die Morisken schweifen. Kein Einziger meldete sich zu Wort.
»Dann mach du es, Hernando«, bat Hamid den Jungen.
Hernando löste sich aus der bedrohlichen Umklammerung des Schmieds und griff zu einem der prachtvollen Priestergewänder. Er zögerte einige Augenblicke, bevor er sich nach der Qibla ausrichtete, das Seidengewand am Boden ausbreitete und darauf kniete.
»Nein!«, rief Andrés entsetzt. Aber die Morisken ließen ihn nicht weiterreden und prügelten auf ihn ein. Der Sakristan hielt sich die Hände schützend vor das Gesicht und begann zu schluchzen, als sein Schüler ihn verriet, indem er mit dem Bekenntnis der Muslime begann.
»Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Gott gibt, und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Er weiß, dass jeder Mensch wissen muss, dass es keinen Gott außer Gott gibt. Er schuf alle Dinge, die es auf der Welt gibt, das Große und das Kleine, den Thron und den Schemel, den Himmel und die Erde, das, was es dort gibt, und das, was es zwischen ihnen gibt.« Hernando hatte zunächst mit zittriger Stimme begonnen, aber bald wurde sein Tonfall immer kräftiger. »Alle Wesen sind von seiner Macht geschaffen, nichts bewegt sich ohne seine Erlaubnis.«
Selbst der Falbe hielt während des Gebets still. Hamid lauschte mit halb geschlossenen Augen den Worten seines Schülers. Aischa massierte nervös ihre Hände, so als wollte sie die einzelnen Worte aus dem Mund ihres Sohnes herauspressen.
»Er ist es, der über das, was verborgen und was allgemein bekannt ist, Bescheid weiß, er ist mächtig und weise«, endete der Junge.
Alle schwiegen. Dann ergriff Hamid das Wort.
»Wer wagt es jetzt noch zu behaupten, der Junge sei ein Christ?«
5
Die Christen in Juviles wurden mit Hamid als Aufseher in der Kirche eingeschlossen. Der Alfaquí sollte dafür sorgen, dass sie von ihrem christlichen Glauben abließen und sich zum Islam bekannten.
Ibrahim brach nun nach Norden in die Berge auf. Partal hatte ihm befohlen, auf seinem Weg durch die Bergdörfer die Bewohner aufzufordern, sich dem Aufstand anzuschließen. Ibrahim wurde dabei von einem bewaffneten Trupp aus sechs Männern begleitet. Einige hatten sich mit den Vorderladern der Arkebusenkompanie aus Cádiar bewaffnet, andere nur mit Stöcken und Schleudern aus Espartogras. Hernando sollte den Trupp begleiten und die Maultierkolonne beaufsichtigen, die die Beute aus Cádiar transportierte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!