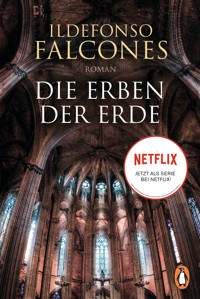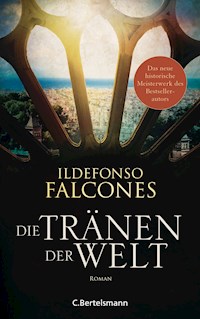9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kathedrale-des-Meeres-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Weltbestseller als Serie bei Netflix!
Spanien im 14. Jahrhundert: Die Landbevölkerung stöhnt unter dem Joch der Feudalherren. Barcelona jedoch ist frei. Und Barcelona ist reich. Hier macht der junge Arnau seinen Weg vom mittellosen Steinträger zu einem der angesehensten Bürger der Stadt. Er ist Teil eines unerhörten Plans: die Errichtung einer Kathedrale, die den Himmel stürmen soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1015
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Legende der Stadtkarte
ILDEFONSO FALCONES DE SIERRA, verheiratet und Vater von vier Kindern, arbeitet als Anwalt in Barcelona. Sein Debütroman Die Kathedrale des Meeres war ein überwältigender internationaler Erfolg. Mit weltweit mehr als sieben Millionen verkauften Büchern hat sich Falcones als der bestverkaufte spanische Autor historischer Romane verewigt.Zuletzt erschien bei Penguin sein Bestseller Das Lied der Freiheit.
Die Kathedrale des Meeres in der Presse:
»Ein großer, mächtiger, gewaltiger historischer Roman!Leidenschaftlich erzählt, voll Leid, Wärme und Kraft.« Bild am Sonntag
»Ein farbiges Historienpanorama.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Während uns Ken Follett den Geist des Mittelalters immer nur beschreibt, taucht Falcones ganz in ihn ein.« Diana Gabaldon in der Washington Post
Außerdem von Ildefonso Falcones lieferbar:
Das Lied der Freiheit
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
ILDEFONSO FALCONES
DIE
KATHEDRALE
DES MEERES
Historischer Roman
Aus dem Spanischen von Lisa Grüneisen
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die spanische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel La Catedral del Mar bei Grupo Editorial Random House Mondadori, S. L., Barcelona.
© 2006 by Ildefonso Falcones de Sierra
© dieser Ausgabe 2018 Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
© der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by Scherz Verlag, Frankfurt am Main
Covergestaltung: Bürosüd, München
Covermotiv: © Javier de Agustín
ISBN 978-3-641-23230-6V004
www.penguin-verlag.de
ERSTER TEIL
DIENER DER ERDE
1
1320
Das Gehöft von Bernat Estanyol
Navarcles, Principado de Cataluña
In einem unbeobachteten Moment blickte Bernat in den strahlend blauen Himmel hinauf. Die milde Septembersonne fiel auf die Gesichter seiner Gäste. Er hatte so viel Zeit und Mühe auf die Vorbereitung verwendet, dass nur schlechtes Wetter das Fest hätte verderben können. Bernat lächelte in den Herbsthimmel, und als er wieder nach unten blickte und das muntere Treiben sah, das auf dem gepflasterten Hof vor den Stallungen herrschte, lächelte er noch mehr.
Die etwa dreißig Gäste waren bester Dinge, denn die Ernte war dieses Jahr außerordentlich gut gewesen. Alle, Männer, Frauen und Kinder, hatten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gearbeitet, zunächst bei der Weinlese, dann beim Keltern, ohne sich einen Tag Ruhe zu gönnen.
Erst wenn der Wein in den Fässern und die Traubenmaische eingelagert war, um während der Wintertage Schnaps daraus zu brennen, feierten die Bauern ihre Herbstfeste. Und Bernat Estanyol hatte beschlossen, in dieser Zeit zu heiraten.
Bernat beobachtete seine Gäste. Sie hatten bereits im Morgengrauen aufstehen müssen, um zu Fuß den für einige von ihnen sehr weiten Weg von ihren Gehöften zu jenem der Estanyols zurückzulegen. Sie unterhielten sich angeregt, vielleicht über die Hochzeit, vielleicht über die Ernte, vielleicht auch über beides. Einige, wie etwa das Grüppchen, bei dem seine Vettern Estanyol und die Familie Puig standen, lachten schallend und warfen ihm vielsagende Blicke zu. Bernat merkte, wie er errötete, und ging nicht darauf ein. Er wollte sich nicht einmal vorstellen, was die Ursache der Heiterkeit war. Auf dem Hof verstreut erkannte er die Fontaníes, die Vilas, die Joaniquets und natürlich die Familie seiner Braut, die Esteves.
Verstohlen betrachtete Bernat seinen Schwiegervater Pere Esteve, der sich immer wieder über seinen gewaltigen Bauch strich, während er mit einigen Leuten redete, um sich dann unversehens einer anderen Gruppe zuzuwenden. Als Pere mit fröhlicher Miene in seine Richtung winkte, nickte Bernat ihm zum wiederholten Male zu. Dann schaute er sich nach den Brüdern seiner Braut um und entdeckte sie unter den Gästen. Vom ersten Moment an hatten sie ihn mit einem gewissen Argwohn behandelt, sosehr sich Bernat auch bemüht hatte, sie für sich zu gewinnen.
Er sah hinüber zu seinem Hof, dann wieder zu den Leuten, und verzog ein wenig den Mund. Plötzlich kam er sich trotz des heiteren Treibens alleingelassen vor. Es war noch kein Jahr her, dass sein Vater gestorben war, und was seine Schwester Guiamona anging, die seit ihrer Hochzeit in Barcelona lebte, so hatte sie nicht auf die Nachrichten geantwortet, die er ihr geschickt hatte – obwohl er sie so gerne wiedergesehen hätte. Sie war die einzige nahe Angehörige, die ihm nach dem Tod seines Vaters geblieben war.
Ein Todesfall, der den Hof der Estanyols für die ganze Gegend interessant gemacht hatte. Ein nicht enden wollender Strom von Kupplerinnen und Vätern mit Töchtern im heiratsfähigen Alter setzte ein. Vorher hatte sie nie jemand besucht, doch der Tod des Vaters, dem seine aufrührerische Art den Beinamen »der verrückte Estanyol« eingetragen hatte, weckte wieder die Hoffnungen jener, die ihre Töchter mit dem reichsten Bauern der Region verheiraten wollten.
»Es wäre an der Zeit für dich, zu heiraten«, sagten sie zu ihm. »Wie alt bist du?«
»Siebenundzwanzig, glaube ich«, war seine Antwort.
»In diesem Alter solltest du beinahe schon Enkel haben«, warfen sie ihm vor. »Was willst du alleine auf diesem Hof ? Du brauchst eine Frau.«
Bernat nahm die Ratschläge geduldig entgegen, wohl wissend, dass sie unweigerlich von dem Vorschlag einer Kandidatin gefolgt wurden, die stärker war als ein Ochse und schöner als der unglaublichste Sonnenuntergang.
Das Thema war nicht neu für ihn. Schon der verrückte Estanyol, der seit Guiamonas Geburt Witwer war, hatte versucht, ihn zu verheiraten. Doch sämtliche Väter mit heiratsfähigen Töchtern hatten den Hof unter Verwünschungen wieder verlassen, denn niemand konnte die Forderungen des verrückten Estanyol bezüglich der Mitgift erfüllen, welche die zukünftige Schwiegertochter mitbringen sollte. So hatte das Interesse an Bernat nachgelassen. Im Alter war der Vater noch schlimmer geworden, und seine Tobsuchtsanfälle hatten sich in Raserei verwandelt. Bernat hatte sich ganz der Bestellung des Landes und der Pflege seines Vaters gewidmet, und dann plötzlich, mit siebenundzwanzig Jahren, war er auf einmal allein und wurde förmlich belagert.
Der erste Besuch jedoch, den Bernat erhalten hatte, als er den Toten noch nicht begraben hatte, war der des Verwalters des Herrn von Navarcles gewesen, seines Feudalherren. »Wie recht du doch hattest, Vater!«, dachte Bernat, als er den Verwalter mit mehreren berittenen Soldaten kommen sah.
»Wenn ich sterbe«, hatte der Alte in seinen klaren Momenten immer wieder gesagt, »werden sie kommen. Dann musst du ihnen das Testament zeigen.«
Und mit diesen Worten hatte er auf den Stein gedeutet, unter dem, in Leder eingeschlagen, das Schriftstück mit dem letzten Willen des verrückten Estanyol lag.
»Warum, Vater?«, wollte Bernat beim ersten Mal wissen.
»Wie du weißt, besitzen wir dieses Land als Erbpacht. Aber ich bin Witwer, und wenn ich kein Testament gemacht hätte, hätte der Grundherr bei meinem Tod ein Anrecht auf die Hälfte unseres gesamten Hausrats und des Viehs. Dieses Recht nennt sich Intestia. Es gibt noch viele andere solcher Rechte zugunsten der Herren, und du solltest sie alle kennen. Sie werden kommen, Bernat, sie werden kommen, um mitzunehmen, was uns gehört, und nur wenn du ihnen das Testament zeigst, kannst du sie loswerden.«
»Und wenn sie es mir wegnehmen?«, fragte Bernat. »Du weißt ja, wie sie sind . . .«
»Selbst wenn sie es täten – es ist in den Büchern registriert.«
Der Zorn des Verwalters und des Grundherrn hatte sich in der ganzen Gegend herumgesprochen und den Sohn noch attraktiver gemacht, der den gesamten Besitz des Verrückten erbte.
Bernat erinnerte sich sehr gut an den Besuch, den ihm sein jetziger Schwiegervater vor dem Beginn der Ernte abgestattet hatte. Fünf Sueldos, eine Matratze und ein weißlinnenes Hemd, das war die Mitgift, die er für seine Tochter Francesca bot.
»Was soll ich mit einem weißlinnenen Hemd?«, wollte Bernat wissen, während er weiter das Stroh in der ebenerdigen Scheune des Hofes verteilte.
»Schau doch«, antwortete Pere Esteve.
Auf die Heugabel gestützt, blickte Bernat zum Eingang hinüber, zu dem Pere Esteve deutete. Das Gerät fiel ihm aus der Hand. Im Gegenlicht stand Francesca. Sie trug das weißleinene Hemd, und ihr gesamter Körper zeichnete sich darunter ab.
Ein Schauder war Bernat den Rücken hinabgelaufen, und Pere Esteve hatte gelächelt.
Bernat war auf das Angebot eingegangen, gleich dort im Heuschober, ohne sich dem Mädchen auch nur zu nähern. Aber er hatte kein Auge mehr von ihm gewendet.
Es war eine überstürzte Entscheidung gewesen, das wusste Bernat, aber er konnte nicht behaupten, dass er sie bereute. Dort drüben stand Francesca, jung, schön, stark. Sein Atem beschleunigte sich. Noch heute . . . Was das Mädchen wohl dachte? Empfand sie genauso wie er? Francesca beteiligte sich nicht an der fröhlichen Unterhaltung der Frauen. Sie stand schweigend und mit ernstem Gesicht neben ihrer Mutter und quittierte die Scherze und das Gelächter der anderen mit einem gezwungenen Lächeln. Ihre Blicke begegneten sich für einen Moment. Sie errötete und sah zu Boden, doch Bernat beobachtete, wie sich ihre Brüste unruhig hoben und senkten. Die Erinnerung an das weißleinene Hemd und den darunter durchschimmernden Körper beflügelte erneut Bernats Phantasie und Verlangen.
»Herzlichen Glückwunsch!«, hörte er hinter sich, während ihm jemand kräftig auf den Rücken klopfte. Sein Schwiegervater war zu ihm getreten. »Gib gut auf sie acht«, setzte er hinzu, während er Bernats Blick folgte und auf das Mädchen deutete, das nicht mehr wusste, wohin es schauen sollte. »Möge das Leben, das du ihr bietest, wie dieses Fest sein . . . Es ist der beste Festschmaus, den ich je gesehen habe. Mit Sicherheit kommt nicht einmal der Herr von Navarcles in den Genuss solcher Köstlichkeiten!«
Bernat hatte seine Gäste gut bewirten wollen und siebenundvierzig Laibe Weißbrot aus Weizenmehl vorbereitet – keine Gerste, kein Roggen oder Dinkel, wie sie die Bauern für gewöhnlich aßen. Helles Weizenmehl, weiß wie das Hemd seiner Frau! Mit den Laiben beladen, war er zur Burg von Navarcles gegangen, um sie im Backhaus des Grundherrn zu backen, in der Annahme, dass zwei Laibe wie sonst auch als Bezahlung ausreichen würden. Beim Anblick der Weizenbrote waren die Augen des Bäckers groß wie Teller geworden, um sich dann zu zwei schmalen Schlitzen zu verengen. Diesmal hatte der Preis sieben Laibe betragen, und als Bernat die Burg verließ, hatte er laut auf das Gesetz geflucht, das es ihnen untersagte, Backöfen in ihren Häusern zu haben.
»Gewiss«, antwortete er seinem Schwiegervater, während er die unangenehme Erinnerung beiseiteschob.
Die beiden blickten über den Hof. Man mochte ihm einen Teil des Brotes gestohlen haben, dachte Bernat, aber nicht den Wein, den seine Gäste nun tranken – den besten, den sein Vater abgefüllt hatte und der jahrelang gereift war –, nicht das gepökelte Schweinefleisch, den Gemüseeintopf mit Huhn und natürlich auch nicht die vier Lämmer, die, ausgenommen und auf Stangen gespießt, langsam über dem Feuer brieten und einen unwiderstehlichen Duft verbreiteten.
Plötzlich kam Bewegung in die Frauen. Der Eintopf war fertig, und die Schüsseln, die die Gäste mitgebracht hatten, wurden gefüllt. Pere und Bernat setzten sich an den einzigen Tisch, der im Hof stand, und die Frauen bedienten sie. Niemand nahm auf den übrigen vier Stühlen Platz. Stehend, auf Holzklötzen sitzend oder direkt auf der Erde hockend begannen die Leute, dem Festmahl zuzusprechen, den Blick auf die Lämmer gerichtet, um die sich unentwegt einige Frauen kümmerten, während sie Wein tranken, plauderten, riefen und lachten.
»Ein wirklich großartiges Fest«, urteilte Pere Esteve zwischen zwei Bissen.
Jemand ließ die Brautleute hochleben, und alle stimmten mit ein.
»Francesca!«, rief ihr Vater und erhob das Glas auf die Braut, die bei den Frauen stand.
Bernat sah das Mädchen an, das erneut wegschaute.
»Sie ist aufgeregt«, entschuldigte Pere sie mit einem Augenzwinkern. »Francesca, Tochter!«, rief er. »Stoß mit uns an! Nutz die Gunst der Stunde, bald sind wir alle weg . . . fast alle jedenfalls . . .«
Das Gelächter verschüchterte Francesca noch mehr. Das Mädchen hob zögerlich ein Glas, das man ihm in die Hand gedrückt hatte, trank einen kleinen Schluck und wandte sich dann ab, um sich wieder dem Lamm zu widmen.
Pere Esteve stieß mit Bernat an, dass der Wein aus dem Glas schwappte. »Du wirst schon dafür sorgen, dass sie ihre Schüchternheit verliert«, sagte er mit seiner dröhnenden Stimme, sodass es alle Anwesenden hören konnten.
Lachend und scherzend sprachen alle dem Wein, dem Schweinefleisch und dem Gemüseeintopf zu. Als die Frauen gerade das Lamm vom Feuer nehmen wollten, verstummte eine Gruppe von Gästen und sah zum Waldrand hinter einigen weiten Feldern hinüber, am Ende einer sanften Anhöhe, auf dem die Estanyols einen Teil der Rebstöcke gepflanzt hatten, die so hervorragenden Wein gaben.
Binnen Sekunden herrschte Schweigen unter den Anwesenden.
Drei Reiter waren zwischen den Bäumen erschienen, gefolgt von einigen uniformierten Männern zu Fuß.
»Was mag er hier wollen?«, flüsterte Pere Esteve.
Bernats Blick folgte den Männern, die am Feldrain entlang auf sie zukamen. Die Gäste murmelten leise.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Bernat schließlich, gleichfalls flüsternd. »Er ist noch nie hier vorbeigekommen. Das ist nicht der Weg zur Burg.«
»Dieser Besuch gefällt mir überhaupt nicht«, erklärte Pere Esteve.
Die Männer näherten sich langsam. Statt des munteren Plauderns, das bislang im Hof geherrscht hatte, waren nun alle verstummt. Nur die Stimmen der Reiter waren zu vernehmen; bis zum Hof konnte man ihr Lachen hören. Bernat blickte zu seinen Gästen. Einige von ihnen hielten die Köpfe gesenkt. Er sah sich nach Francesca um, die bei den Frauen stand. Die polternde Stimme des Herrn von Navarcles war weithin zu hören. Bernat spürte, wie ihn die Wut packte.
»Bernat! Bernat!«, rief Pere Esteve, während er ihn am Arm fasste. »Was machst du noch hier? Lauf zu ihnen, um sie zu begrüßen.«
Bernat sprang auf und lief los, um seinen Herrn willkommen zu heißen.
»Willkommen in Eurem Haus«, begrüßte er ihn keuchend, als er vor ihm stand.
Llorenç de Bellera, Herr von Navarcles, zügelte sein Pferd und hielt vor Bernat an.
»Bist du Estanyol, der Sohn des Verrückten?«, fragte er schroff.
»Ja, mein Herr.«
»Wir waren auf der Jagd, und auf dem Heimweg zur Burg hat uns dieses Fest überrascht. Was ist der Anlass?«
Zwischen den Pferden konnte er die mit der Jagdbeute beladenen Soldaten sehen: Kaninchen, Hasen und Rebhühner. ›Euer Besuch ist es, der einer Erklärung bedarf‹, hätte er gerne geantwortet. ›Oder hat Euch der Bäcker von dem Weißbrot erzählt?‹
Sogar die Pferde schienen auf seine Antwort zu warten. Ganz still standen sie da und sahen ihn aus ihren großen Augen an.
»Es ist meine Hochzeit, mein Herr.«
»Mit wem hast du dich vermählt?«
»Mit Pere Esteves Tochter, mein Herr.«
Llorenç de Bellera sah Bernat schweigend über den Kopf seines Pferdes hinweg an. Die Tiere schnaubten laut.
»Und?«, bellte Llorenç de Bellera.
»Meine Frau und ich würden uns sehr geehrt fühlen, wenn Eure Herrschaft und Ihre Begleiter die Güte hätten, sich zu uns zu gesellen.«
»Wir sind durstig, Estanyol«, gab der Herr de Bellera zur Antwort.
Die Pferde setzten sich in Bewegung, ohne dass die Reiter ihnen die Sporen geben mussten. Bernat ging mit gesenktem Haupt neben seinem Herrn zum Gehöft zurück. Am Ende des Weges hatten sich sämtliche Gäste versammelt, um sie zu begrüßen. Die Frauen blickten zu Boden, die Männer hatten die Kopfbedeckungen abgenommen. Ein leises Raunen erhob sich, als Llorenç de Bellera vor ihnen anhielt.
»Los, los!«, befahl er, während er vom Pferd stieg. »Das Fest soll weitergehen.«
Die Leute gehorchten und machten schweigend kehrt. Mehrere Soldaten traten zu den Pferden und kümmerten sich um die Tiere. Bernat geleitete seine neuen Gäste zu dem Tisch, an dem zuvor Pere und er gesessen hatten. Ihre Schüsseln und ihre Gläser waren verschwunden.
Der Herr de Bellera und seine beiden Begleiter nahmen Platz. Bernat trat einige Schritte zurück, während sie sich zu unterhalten begannen. Die Frauen trugen eilig Weinkrüge, Gläser, Brot, Schüsseln mit Gemüseeintopf und Teller mit gepökeltem Schweinefleisch und frisch gebratenem Lamm auf. Bernat sah sich nach Francesca um, konnte sie aber nirgends entdecken. Sie befand sich nicht mehr unter den Frauen. Sein Blick begegnete dem seines Schwiegervaters, der bei den übrigen Gästen stand, und Bernat deutete mit dem Kinn in Richtung der Frauen. Pere Esteve schüttelte fast unmerklich den Kopf und wandte sich ab.
»Feiert weiter!«, rief Llorenç de Bellera, eine Lammhaxe in der Hand. »Los, macht schon!«
Schweigend gingen die Gäste zu den Feuerstellen, über denen das Lamm gebraten hatte. Nur eine Gruppe rührte sich nicht vom Fleck, unbemerkt von den Blicken des Herrn und seiner Freunde. Es waren Pere Esteve, seine Söhne und einige weitere Gäste. Bernat entdeckte das weißleinene Hemd seiner Braut in ihrer Mitte und trat zu ihnen.
»Verschwinde, du Dummkopf«, fuhr ihn sein Schwiegervater an.
Bevor er etwas sagen konnte, drückte ihm Francescas Mutter einen gefüllten Teller in die Hand und wisperte: »Kümmere du dich um den Herrn und halte dich von meiner Tochter fern.«
Die Bauern begannen, schweigend das Lamm zu verzehren, während sie verstohlen zu dem Tisch hinübersahen. Im Hof waren nur das Gelächter und das Johlen des Herrn von Navarcles und seiner beiden Kumpane zu hören. Die Soldaten ruhten sich abseits des Festes aus.
»Vorher hat man euch lachen hören«, schrie der Herr de Bellera, »so laut, dass ihr uns das Wild erschreckt habt. Lacht, verdammt nochmal! Nun lacht schon!«
Niemand lachte.
»Bauerntölpel«, sagte er zu seinen Begleitern, die ihrerseits die Bemerkung mit lautem Gelächter quittierten.
Die drei stillten ihren Hunger mit dem Lammbraten und dem Weißbrot. Das gepökelte Schweinefleisch und den Gemüseeintopf ließen sie stehen. Bernat aß etwas abseits im Stehen, während er aus den Augenwinkeln zu der Gruppe hinübersah, in deren Mitte Francesca sich verbarg.
»Mehr Wein!«, forderte der Herr von Bellera und hob sein Glas. »Estanyol!«, brüllte er dann, während er sich unter den Gästen nach ihm umsah. »Nächstes Mal, wenn du deine Pacht zahlst, bringst du mir von diesem Wein, nicht dieses Gesöff, mit dem dein Vater mich bisher betrogen hat«, hörte ihn Bernat hinter sich schreien. Francescas Mutter kam mit einem Krug herbeigelaufen.
»Estanyol, wo steckst du?«
Der Mann hieb mit der Faust auf den Tisch, als die Frau gerade neben ihm stand, um sein Glas zu füllen. Einige Tropfen Wein spritzten auf die Kleider von Llorenç de Bellera.
Bernat stand bereits neben ihm. Die Freunde des Grundherrn lachten über das Missgeschick, und Pere Esteve hatte die Hände vors Gesicht geschlagen.
»Du alte Eselin! Wie kannst du es wagen, den Wein zu verschütten?« Die Frau senkte unterwürfig den Kopf, und als der Grundherr Anstalten machte, sie zu ohrfeigen, wich sie zurück, stolperte und fiel hin. Llorenç de Bellera wandte sich seinen Freunden zu und brach in schallendes Gelächter aus, als er sah, wie die Frau davonschlich. Dann wurde er wieder ernst und wandte sich an Bernat.
»Ah, da bist du ja, Estanyol. Sieh nur, was das alte Tatterweib angerichtet hat! Willst du deinen Herrn beleidigen? Bist du so blöd? Weißt du etwa nicht, dass die Gäste von der Herrin des Hauses bewirtet werden sollten? Wo ist die Braut?«, fragte er dann, während er seinen Blick über den Platz schweifen ließ. »Wo ist die Braut?«, brüllte er noch einmal, als Bernat schwieg.
Pere Esteve nahm Francesca am Arm und ging hinüber zum Tisch, um sie an Bernat zu übergeben. Das Mädchen zitterte.
»Eure Herrschaft«, sagte Bernat, »dies ist meine Frau Francesca.«
»Das ist schon besser«, bemerkte Llorenç, während er sie schamlos von oben bis unten musterte, »schon viel besser. Von nun an wirst du uns den Wein einschenken.«
Der Herr von Navarcles nahm wieder Platz und hielt dem Mädchen sein Glas hin. Francesca ging einen Krug holen und eilte zurück, um ihn zu bedienen. Ihre Hand zitterte, als sie versuchte, den Wein einzuschenken. Llorenç de Bellera packte sie am Handgelenk und hielt sie fest, während sich der Wein ins Glas ergoss. Dann zog er sie am Arm zu sich und nötigte sie, auch seine Begleiter zu bedienen. Die Brüste des Mädchens streiften sein Gesicht.
»So serviert man Wein!«, rief der Herr von Navarcles, während Bernat neben ihm die Fäuste ballte und die Zähne zusammenbiss.
Llorenç de Bellera und seine Freunde zechten weiter und riefen immer wieder nach Francesca, um die Szene ein ums andere Mal zu wiederholen.
Die Soldaten fielen jedes Mal in das Lachen ihres Herrn und seiner Kumpane ein, wenn das Mädchen sich über den Tisch beugen musste, um den Wein einzuschenken. Francesca versuchte, ihre Tränen zurückzuhalten, und Bernat stand ohnmächtig daneben und merkte, wie ihm das Blut über die Handflächen zu laufen begann, weil sich seine Fingernägel ins Fleisch gegraben hatten. Die Gäste sahen jedes Mal schweigend weg, wenn das Mädchen Wein nachschenken musste.
»Estanyol!«, grölte Llorenç de Bellera, während er aufstand und Francesca am Handgelenk packte. »In Ausübung des Rechts, das mir als deinem Herrn zusteht, habe ich beschlossen, die erste Nacht mit deiner Frau zu verbringen.«
Die Begleiter des Herrn de Bellera quittierten die Worte ihres Freundes mit lautem Beifall. Bernat stürzte zum Tisch, doch bevor er ihn erreichte, sprangen die beiden Männer, die betrunken wirkten, auf und legten die Hände auf ihre Schwerter. Bernat erstarrte. Llorenç de Bellera sah ihn an, grinste und brach dann in lautes Gelächter aus. Das Mädchen sah Bernat hilfesuchend an.
Bernat trat einen Schritt vor, doch die Schwertspitze eines der beiden Freunde des Adligen bohrte sich in seine Magengrube. Hilflos blieb er erneut stehen. Francesca sah ihn unverwandt an, während sie zur Außentreppe des Gehöfts geschleift wurde. Als der Besitzer des Landes sie um die Taille fasste und über seine Schulter warf, begann das Mädchen zu schreien.
Die Freunde des Herrn von Navarcles setzten sich wieder hin und tranken und lachten weiter, während sich die Soldaten am Fuß der Treppe postierten, um Bernat den Zutritt zu verwehren.
Bernat stand an der Treppe vor den Soldaten und nahm weder das Gelächter der Freunde des Herrn de Bellera wahr noch das Schluchzen der Frauen, weder das Schweigen seiner Gäste noch die groben Scherze der Soldaten, die mit vielsagenden Blicken zum Haus hinübersahen. Er hörte nur Francescas Schreie, die aus dem Fenster im ersten Stock drangen.
Der Himmel war immer noch strahlend blau.
Nach einer Zeit, die Bernat endlos vorkam, erschien Llorenç de Bellera erhitzt auf der Treppe und gürtete den Jagdrock zu.
»Jetzt bist du an der Reihe, Estanyol!«, rief er mit seiner dröhnenden Stimme, während er an Bernat vorbei zum Tisch zurückging. »Doña Caterina«, setzte er an seine Begleiter gewandt hinzu und meinte seine junge Ehefrau, die er erst kürzlich geheiratet hatte, »ist es leid, dauernd von meinen ganzen Bastarden zu erfahren, und mir hängt ihr Gejammer allmählich zum Hals heraus. Erfülle deine Pflicht als guter Ehemann!«, befahl er, wieder an Bernat gewandt.
Bernat senkte den Kopf. Unter den aufmerksamen Blicken aller Anwesenden stieg er mühsam die Außentreppe hinauf. Er betrat das erste Zimmer, einen großzügigen Raum, der als Küche und Esszimmer diente, mit einem gewaltigen Herd an der einen Wand, über dem sich ein beeindruckender schmiedeeiserner Kaminabzug befand. Bernat hörte seine eigenen Schritte auf dem Holzboden, während er die Treppe in den zweiten Stock hinaufstieg, wo die Schlafräume und der Speicher lagen. Er steckte den Kopf durch die Luke im obersten Zimmer und spähte in den Raum, ohne sich ganz hineinzuwagen. Es war kein Laut zu hören.
Mit dem Kinn auf Höhe des Fußbodens, der Körper noch auf der Treppe, sah er Francescas Kleider im Zimmer verstreut liegen; das weißleinene Hemd, der Stolz der Familie, war zerfetzt und zerrissen. Er stieg ganz nach oben.
Francesca lag völlig nackt und mit verlorenem Blick zusammengekauert auf der neuen Matratze, die nun mit Blut befleckt war. Ihr verschwitzter, mit Kratzern und blauen Flecken übersäter Körper regte sich nicht.
»Estanyol!«, hörte Bernat Llorenç de Bellera von unten brüllen. »Dein Herr wartet auf dich.«
Von Krämpfen geschüttelt, erbrach sich Bernat, bis nur noch grüne Galle kam. Francesca rührte sich immer noch nicht. Bernat stieg hastig hinab. Als er bleich unten ankam, gingen ihm die furchtbarsten Gedanken im Kopf herum. Nahezu blind, stieß er mit dem massigen Llorenç de Bellera zusammen, der am Fuß der Treppe stand.
»Es sieht mir nicht so aus, als hätte der frischgebackene Ehemann die Ehe vollzogen«, sagte Llorenç de Bellera zu seinen Begleitern.
Bernat musste aufschauen, um den Herrn von Navarcles anzusehen.
»Ich . . . ich konnte nicht, Euer Herrschaft«, stotterte er.
Llorenç de Bellera schwieg einen Moment.
»Nun, wenn du nicht kannst, so bin ich mir gewiss, dass einer meiner Freunde kann . . . oder einer meiner Soldaten. Ich habe dir doch gesagt, dass ich nicht noch mehr Bastarde will.«
»Ihr habt kein Recht . . .!«
Die Bauern, die die Szene beobachteten, zuckten zusammen bei dem Gedanken, welche Folgen diese Anmaßung nach sich ziehen würde. Der Herr von Navarcles packte Bernat mit einer Hand am Hals und drückte zu, während Bernat nach Luft schnappte.
»Wie kannst du es wagen? Willst du etwa Vorteile aus dem legitimen Vorrecht deines Herrn ziehen, mit der Braut zu schlafen, und später mit einem Bastard auf dem Arm ankommen, um Forderungen zu stellen?« Llorenç schüttelte Bernat, bevor er ihn losließ. »Willst du das? Was Recht ist, bestimme einzig und allein ich, verstanden? Hast du vergessen, dass ich dich bestrafen kann, wann immer und wie immer ich will?«
Llorenç de Bellera ohrfeigte Bernat so kräftig, dass dieser zu Boden ging.
»Meine Peitsche!«, brüllte er wütend.
Die Peitsche! Als Kind war Bernat gezwungen gewesen, gemeinsam mit seinen Eltern der öffentlichen Bestrafung eines armen Kerls beizuwohnen, dessen Vergehen nie genau bekannt geworden war. Das Geräusch, mit dem der Lederriemen auf den Rücken dieses Mannes niedergefahren war, klang ihm noch heute in den Ohren. Er hatte es lange Jahre seiner Kindheit hindurch Nacht für Nacht gehört. Damals hatte sich keiner der Anwesenden zu rühren gewagt, und so war es auch heute. Bernat rappelte sich hoch und sah zu seinem Herrn hinauf; dieser stand vor ihm wie ein Fels und wartete mit ausgestreckter Hand darauf, dass ihm einer seiner Diener die Peitsche reichte. Bernat erinnerte sich an den wunden Rücken des unglücklichen Mannes damals, eine blutige Masse, aus dem selbst der Zorn des Herrn keinen Fetzen mehr herauszureißen vermocht hatte. Er kroch auf allen vieren zur Treppe, die Augen verdreht und zitternd wie ein Kind, das von Albträumen heimgesucht wurde. Niemand rührte sich. Niemand sprach. Und die Sonne strahlte immer noch vom Himmel.
»Es tut mir leid, Francesca«, stammelte er, nachdem er sich, gefolgt von einem Soldaten, mühsam die Treppe hinaufgeschleppt hatte.
Er löste die Hose und kniete neben seiner Frau nieder. Das Mädchen hatte sich nicht bewegt. Bernat betrachtete seinen schlaffen Penis und fragte sich, wie er dem Befehl seines Herrn Folge leisten sollte. Mit einem Finger streichelte er Francesca sanft über die Seite.
Francesca reagierte nicht.
»Ich muss . . . wir müssen es tun«, flehte Bernat und packte sie am Handgelenk, um sie zu sich umzudrehen.
»Fass mich nicht an!«, schrie Francesca ihn an und erwachte aus ihrer Lethargie.
»Er wird mir die Haut in Fetzen herunterreißen!« Bernat drehte seine Frau mit Gewalt zu sich herum und wälzte sich auf ihren nackten Körper.
»Lass mich los!«
Sie rangen miteinander, bis es Bernat gelang, sie an beiden Handgelenken zu fassen und zu sich hochzuziehen. Trotzdem wehrte sich Francesca weiter.
»Es wird ein anderer kommen«, flüsterte er ihr zu. »Es wird sich ein anderer finden, der . . . der dir Gewalt antut!« Die Augen des Mädchens kehrten in die Realität zurück und sahen ihn anklagend an. »Er wird mir die Haut in Fetzen vom Körper ziehen . . .«
Francesca hörte nicht auf, sich zu sträuben, aber Bernat warf sich ungestüm auf sie. Die Tränen des Mädchens reichten nicht aus, um das Verlangen zu bezähmen, das bei der Berührung ihres nackten Körpers in Bernat aufgekeimt war, und er drang in sie ein, während Francesca die ganze Welt zusammenschrie.
Das Geschrei war ganz nach dem Geschmack des Soldaten, der Bernat gefolgt war und nun ohne jede Scham die Szene in der Bodenluke lehnend verfolgte.
Bernat war noch nicht fertig, als Francesca ihren Widerstand aufgab. Allmählich verwandelte sich ihr Geschrei in Schluchzen. Begleitet vom Weinen seiner Frau, kam Bernat zum Höhepunkt.
Llorenç de Bellera hatte die verzweifelten Schreie gehört, die aus dem Fenster im zweiten Stock drangen, und als sein Spitzel ihm meldete, dass die Ehe vollzogen worden sei, ließ er die Pferde holen und ritt mit seinem unheilvollen Gefolge davon. Die meisten Gäste folgten seinem Beispiel und machten sich niedergedrückt auf den Heimweg.
Es wurde still auf dem Hof. Bernat lag auf seiner Frau und wusste nicht, was er tun sollte. Erst jetzt bemerkte er, dass er sie fest an den Schultern gepackt hatte. Er ließ sie los, um sich neben ihrem Kopf auf der Matratze abzustützen, doch sein Körper sank wie leblos auf ihren. Er versuchte, sich aufzurichten, und da begegnete er Francescas Blick, die durch ihn hindurchsah. In dieser Haltung musste er bei jeder Bewegung erneut den Körper seiner Frau berühren. Bernat wollte dieser Situation entkommen, wusste aber nicht, wie er das anstellen sollte, ohne dem Mädchen wehzutun. Er wünschte sich, schweben zu können, um von Francesca wegzukommen, ohne sie berühren zu müssen.
Nach einigen endlosen Momenten der Unentschlossenheit rückte er ungeschickt von dem Mädchen ab und kniete neben ihr nieder. Er wusste immer noch nicht, was er tun sollte: aufstehen, sich zu ihr legen, das Zimmer verlassen oder sich rechtfertigen . . . Er wandte den Blick von Francescas Körper ab, die immer noch unbewegt dalag, ihre Blöße vulgär zur Schau gestellt. Er versuchte, ihr Gesicht zu erkennen, das weniger als zwei Handbreit von seinem entfernt war, aber es gelang ihm nicht. Er blickte nach unten, und beim Anblick seines nackten Gliedes überkam ihn plötzlich Scham.
»Es tut mir . . .«
Eine unerwartete Bewegung von Francesca überraschte ihn. Das Mädchen hatte ihm das Gesicht zugewandt. Bernat versuchte, Verständnis in ihrem Blick zu erkennen, doch dieser war völlig leer.
»Es tut mir leid«, begann er noch einmal. Francesca sah ihn immer noch an, ohne die geringste Regung zu zeigen. »Es tut mir leid. Es tut mir leid. Er . . . er hätte mir die Haut vom Leib gerissen«, stotterte er.
Bernat dachte an den Herrn von Navarcles, wie er mit ausgestreckter Hand vor ihm gestanden und auf die Peitsche gewartet hatte. Er forschte erneut in Francescas Blick: Leere. Bernat versuchte, eine Antwort in den Augen des Mädchens zu finden, und erschrak: Ihr Blick war ein stummer Schrei, eine Fortsetzung des Schreis, den er zuvor von ihr gehört hatte.
Unbewusst streckte Bernat die Hand aus und näherte sie Francescas Wange, so als wollte er ihr begreiflich machen, dass er sie verstand.
»Ich . . .«, versuchte er es erneut.
Er berührte sie nicht. Als sich seine Hand näherte, verkrampften sich sämtliche Muskeln des Mädchens. Bernat schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
Francesca blieb reglos und mit abwesendem Blick liegen.
Schließlich hörte Bernat auf zu weinen, stand auf, zog die Hose hoch und verschwand durch die Bodenluke, die ins Untergeschoss führte. Als seine Schritte verklungen waren, stand auch Francesca auf und ging zu der Truhe, die das gesamte Mobiliar der Schlafkammer darstellte, um sich ihre eigenen Kleider herauszuholen. Als sie sich angezogen hatte, suchte sie langsam ihre verstreut herumliegenden Habseligkeiten zusammen, darunter das kostbare weißleinene Hemd. Sie faltete es sorgfältig zusammen, wobei sie darauf achtete, dass die Fetzen genau aufeinander zu liegen kamen, und legte es in die Truhe.
2
Francesca schlich durchs Haus wie eine gequälte Seele. Sie erfüllte ihre hausfraulichen Pflichten, doch sie tat es schweigend, während eine Traurigkeit von ihr ausging, die schon bald jeden Winkel des Hauses der Estanyols erfasste.
Bernat hatte oft versucht, sich für das zu entschuldigen, was geschehen war. Je weiter der Schrecken ihres Hochzeitstages in die Ferne rückte, desto ausführlicher wurden Bernats Erklärungen: die Angst vor der Grausamkeit des Herrn, die Folgen sowohl für ihn als auch für sie, wenn er den Gehorsam verweigert hätte. Und »Es tut mir leid« – Tausende Male hatte Bernat diese Worte zu Francesca gesagt, die ihn ansah und ihm stumm zuhörte, so als wartete sie auf den Moment, in dem Bernats Ausführungen unweigerlich auf denselben entscheidenden Punkt kamen: »Es wäre ein anderer gekommen, hätte ich es nicht getan . . .« An diesem Punkt verstummte Bernat jedes Mal. Jede Entschuldigung versagte, und erneut stand die Vergewaltigung zwischen ihnen wie eine unüberwindliche Hürde. Die Entschuldigungen und das Schweigen, das er zur Antwort bekam, legten sich über die Wunde, die Bernat schließen wollte, und das schlechte Gewissen ging in den alltäglichen Pflichten verloren, bis Bernat schließlich vor Francescas Gleichgültigkeit resignierte.
Jeden Morgen, wenn er bei Tagesanbruch aufstand, um sein hartes Tagewerk als Bauer zu verrichten, sah Bernat aus dem Schlafzimmerfenster. Das hatte er schon mit seinem Vater getan, selbst in dessen letzten Zeiten. Gemeinsam hatten sie sich auf die mächtige steinerne Brüstung gelehnt und den Himmel betrachtet, um zu sehen, was für ein Tag sie erwartete. Sie hatten über ihr fruchtbares, von regelmäßigen Ackerfurchen durchzogenes Land geblickt, das sich in das weite Tal zu Füßen des Gehöfts erstreckte, sie hatten den Vögeln zugehört und aufmerksam auf die Geräusche der Tiere im Stall gelauscht. Es waren Momente stillen Einverständnisses zwischen Vater und Sohn und ihrem Land gewesen, die wenigen Minuten, in denen sein Vater wieder zu Sinnen zu kommen schien. Bernat hatte davon geträumt, diese Momente mit seiner Frau zu teilen, anstatt sie alleine zu erleben, während er sie im Untergeschoss wirtschaften hörte, und ihr all das erzählen zu können, was er selbst aus dem Mund seines Vaters gehört hatte, wie dieser vorher von seinem, und so weiter über Generationen hinweg.
Er hatte davon geträumt, ihr erzählen zu können, dass dieses reiche Land einmal freieigener Besitz der Estanyols gewesen war und seine Vorfahren es mit Freude und Sorgfalt bestellt und seine Früchte geerntet hatten, ohne Abgaben oder Steuern zahlen zu müssen oder überheblichen, ungerechten Herren verpflichtet zu sein. Er hatte davon geträumt, mit ihr, seiner Frau, der zukünftigen Mutter der Erben dieses Landes, dieselbe Trauer teilen zu können, die er mit seinem Vater geteilt hatte, als dieser ihm von den Gründen berichtet hatte, deretwegen die Kinder, die sie ihm einmal schenken würde, nun, dreihundert Jahre später, eines anderen Knechte sein würden. Er hätte ihr gerne voller Stolz erzählt, dass vor dreihundert Jahren die Estanyols und viele andere als freie Männer ihre Waffen in ihren Häusern aufbewahrt hatten, um unter dem Befehl des Grafen Ramon Borrell und seines Bruders Ermengol d’Urgell das alte Katalonien vor den Einfällen der Sarazenen zu verteidigen. Er hätte ihr gerne erzählt, wie mehrere Estanyols unter dem Befehl des Grafen Ramon in dem siegreichen Heer gekämpft hatten, welches in Albesa, unweit von Balaguer in der Ebene von Urgel, die Sarazenen des Kalifats von Córdoba besiegte. Sein Vater hatte ihm voller Begeisterung davon erzählt, wenn sie die Zeit dazu gehabt hatten, doch die Begeisterung war Wehmut gewichen, als er vom Tod des Grafen Ramon Borrell im Jahre 1017 berichtete. Ihm zufolge hatte dieser Todesfall sie zu Leibeigenen gemacht. Der fünfzehnjährige Sohn des Grafen Ramon Borrell war diesem auf den Thron gefolgt. Seine Mutter, Ermessenda von Carcassonne, hatte die Regierungsgeschäfte übernommen, und die Barone von Katalonien, die Seite an Seite mit den Bauern gekämpft hatten, nutzten nun, da die Grenzen des Prinzipats gesichert waren, das Machtvakuum. Sie bedrängten die Bauern, jene zu ermorden, die nicht nachgaben, und sich dann ihres Landes zu bemächtigen. Den früheren Besitzern erlaubten sie, den Boden weiterhin zu bestellen, wenn sie dem Grundherrn einen Teil ihrer Ernte ablieferten. Die Estanyols hatten nachgegeben, aber viele Familien auf dem Lande waren grausam dahingemetzelt worden.
»Als freie Männer, die wir waren«, hatte sein Vater ihm erzählt, »haben wir Seite an Seite mit den Rittern gegen die Mauren gekämpft – als Fußvolk natürlich –, aber gegen die Ritter hatten wir keine Chance. Als die nächsten Grafen von Barcelona die Zügel in Katalonien wieder an sich reißen wollten, sahen sie sich einem reichen und mächtigen Adel gegenüber, mit dem sie zu paktieren gezwungen waren, und das immer auf unsere Kosten. Zuerst war es unser Land, das alte Katalonien, dann unsere Freiheit, unser Leben . . . und schließlich unsere Ehre. Deine Großeltern waren es, die unsere Freiheit verloren«, hatte er mit zitternder Stimme erzählt, den Blick unverwandt auf die Felder gerichtet. »Man untersagte ihnen, ihr Land zu verlassen. Man machte sie zu Leibeigenen, die an ihren Grund und Boden gefesselt waren, wie später ihre Kinder – ich – und ihre Enkelkinder – du. Unser Leben . . . dein Leben liegt in den Händen des Grundherrn, dem es obliegt, Recht zu sprechen, und der das Recht hat, uns zu misshandeln und unsere Ehre zu verletzen. Wir können uns nicht einmal wehren! Wenn dir jemand Unrecht tut, musst du zu deinem Grundherrn gehen, damit dieser Entschädigung fordert, und wenn er sie bekommt, behält er die Hälfte für sich.«
Dann zählte er ihm immer wieder die zahlreichen Rechte des Herrn auf, Rechte, die sich Bernat ins Gedächtnis eingegraben hatten, weil er es nie gewagt hatte, den aufgebrachten Monolog seines Vaters zu unterbrechen. Der Herr konnte von einem Leibeigenen jederzeit einen Teil seines Besitzes einbehalten, wenn dieser ohne Testament starb, wenn er kinderlos blieb oder seine Frau Ehebruch beging, wenn der Hof abbrannte oder er diesen belieh, wenn er die Leibeigene eines anderen Grundherrn heiratete und natürlich, wenn er ihn verlassen wollte. Der Grundherr konnte in der ersten Nacht mit der Braut schlafen, er konnte die Frauen dazu verpflichten, seine Kinder zu stillen, und ihre Töchter, als Mägde auf der Burg zu dienen. Ein Leibeigener war verpflichtet, ohne Entgelt das Land des Grundherrn zu bestellen und zur Verteidigung der Burg zu kämpfen. Er musste einen Teil der Erträge seiner Felder abliefern und seinen Herrn oder seine Gesandten in seinem Haus aufnehmen und sie während ihres Aufenthaltes bewirten. Er musste für die Nutzung des Waldes oder des Weidelandes ebenso zahlen wie für die Benutzung der herrschaftlichen Schmiede, des Backhauses oder der Mühle, und er musste zu Weihnachten und anderen Feiertagen Geschenke abliefern.
Und was war mit der Kirche? Als er seinem Vater diese Frage gestellt hatte, war dessen Stimme noch wütender geworden.
»Mönche, Ordensleute, Priester, Diakone, Erzdiakone, Kanoniker, Äbte, Bischöfe . . . sie alle sind um keinen Deut besser als die Feudalherren, die uns unterdrücken! Sie haben uns sogar untersagt, den Habit zu nehmen, damit wir unser Land nicht verlassen können und unsere Knechtschaft ewig währt!«
»Bernat«, hatte er ihm bei diesen Gelegenheiten geraten, wenn die Kirche zur Zielscheibe seines Zorns wurde, »vertraue nie denen, die behaupten, Gott zu dienen. Sie werden dir gute Worte geben, die so hochgestochen sind, dass du sie nicht verstehst. Sie werden dich mit Argumenten zu überzeugen versuchen, denen nur sie folgen können, bis sie sich deines Verstandes bemächtigt haben. Sie werden dir gegenüber als gütige Menschen auftreten, die behaupten, uns vor dem Bösen und der Versuchung erretten zu wollen, doch in Wirklichkeit steht ihre Meinung über uns fest, und all diese Soldaten Christi, wie sie sich nennen, werden keinen Deut von dem abweichen, was in ihren Büchern steht.«
»Vater«, hatte Bernat ihn daraufhin gefragt, »was steht in ihren Büchern über uns Bauern?«
Sein Vater hatte über die Felder geblickt, bis dorthin, wo sie in den Himmel übergingen.
»Sie sagen, wir seien wie die Tiere, unfähig zu begreifen, was Höflichkeit bedeutet. Sie sagen, wir seien schändlich, niederträchtig und verabscheuungswürdig, schamlos und unwissend. Sie sagen, wir seien grausam und starrsinnig, wir hätten keine Ehre verdient, weil wir sie nicht zu schätzen wüssten, und verstünden nur die Sprache der Gewalt. Sie sagen . . .«
»Ist es denn so, Vater?«
»Das wollen sie aus uns machen, mein Sohn.«
»Aber Ihr betet jeden Tag, und als Mutter starb . . .«
»Zur Jungfrau bete ich, mein Sohn, zur Jungfrau. Unsere Jungfrau Maria hat nichts mit den Mönchen und Priestern zu schaffen. An sie können wir weiterhin glauben.«
Bernat Estanyol hätte sich gerne morgens auf die Fensterbrüstung gelehnt und mit seiner jungen Frau gesprochen, ihr erzählt, was ihm sein Vater erzählt hatte, und mit ihr gemeinsam über die Felder geschaut.
Im Oktober spannte Bernat die Ochsen an und lockerte mit dem Pflug die Felder auf, damit Sonne, Luft und Dünger der Erde wieder Kraft gaben. Dann säte er mit Francescas Hilfe das Getreide aus. Sie warf aus einem Korb die Saatkörner aus, während er zunächst mit dem Ochsengespann die Erde umpflügte und sie nach der Aussaat mit Hilfe einer schweren Eisenplatte wieder festdrückte. Sie arbeiteten schweigend, ein Schweigen, das nur von den Rufen unterbrochen wurde, mit denen Bernat die Ochsen antrieb und die im ganzen Tal widerhallten. Bernat glaubte, durch die gemeinsame Arbeit würden sie sich ein wenig näherkommen, aber Francesca blieb gleichgültig. Sie nahm ihren Korb und warf die Saat aus, ohne ihn auch nur anzusehen.
Der November kam, und Bernat widmete sich den Arbeiten, die in dieser Zeit des Jahres zu tun waren. Er mästete die Schweine, machte Feuerholz für das Gehöft und Häcksel für die Felder, bereitete die Äcker und Gemüsebeete vor, die im Frühjahr bestellt wurden, und beschnitt und pfropfte die Reben. Wenn er nach Hause kam, hatte sich Francesca um den Haushalt, den Gemüsegarten, die Hühner und die Kaninchen gekümmert. Abend für Abend setzte sie ihm schweigend das Essen vor und ging dann schlafen. Morgens stand sie vor ihm auf, und wenn Bernat nach unten kam, standen das Frühstück und der Brotbeutel mit dem Mittagessen auf dem Tisch. Während er frühstückte, hörte er, wie sie das Vieh im Stall versorgte.
Weihnachten war im Handumdrehen vorüber, und im Januar endete die Olivenernte. Bernat besaß nicht sehr viele Olivenbäume, gerade genug, um den Bedarf des Hofes an Öl zu decken und die Abgaben an den Herrn zu zahlen.
Danach ging es für Bernat ans Schweineschlachten. Zu Lebzeiten seines Vaters hatten sich die Nachbarn, die sonst nur selten zum Hof der Estanyols kamen, stets am Schlachttag eingefunden. Bernat hatte diese Tage als wahre Festtage in Erinnerung. Die Schweine wurden geschlachtet, und dann wurde gegessen und getrunken, während die Frauen das Fleisch verarbeiteten.
Eines Morgens erschienen die Esteves: Vater, Mutter und zwei der Brüder. Bernat begrüßte sie im Hof. Francesca wartete hinter ihm.
»Wie geht es dir, Tochter?«, fragte ihre Mutter.
Francesca antwortete nicht, ließ sich jedoch umarmen. Bernat beobachtete die Szene: Die Mutter schloss ihre Tochter liebevoll in die Arme, in der Hoffnung, diese werde es ihr gleichtun. Doch das tat sie nicht; sie blieb stocksteif. Bernat sah seinen Schwiegervater an.
»Francesca«, sagte Pere Esteve nur, während er es nicht über sich brachte, seiner Tochter in die Augen zu blicken.
Ihre Brüder begrüßten sie mit einer Handbewegung.
Francesca ging zum Stall, um das Schwein zu holen; die übrigen blieben im Hof stehen. Niemand sagte etwas, nur das erstickte Schluchzen der Mutter war zu hören. Bernat war versucht, sie zu trösten, ließ es jedoch bleiben, als er sah, dass weder ihr Mann noch ihre Söhne Anstalten dazu machten.
Francesca erschien mit dem Schwein, das sich weigerte, ihr zu folgen, so als wüsste es, welches Schicksal ihm bevorstand, und übergab es ihrem Mann. Bernat und Francescas Brüder warfen das Schwein um und setzten sich darauf. Die schrillen Schreie des Tieres hallten durch das ganze Tal der Estanyols. Pere Esteve trennte ihm mit einem sicheren Schnitt die Kehle durch, und alle warteten schweigend ab, während das Blut des Tieres in die Schüsseln floss, die von den Frauen ausgetauscht wurden, wenn sie voll waren.
Sie tranken nicht einmal ein Glas Wein, während Mutter und Tochter das mittlerweile zerteilte Schwein verarbeiteten.
Als gegen Abend die Arbeit beendet war, versuchte die Mutter erneut, ihre Tochter zu umarmen. Bernat beobachtete die Szene und wartete auf eine Reaktion seiner Frau, doch die gab es nicht. Ihr Vater und ihre Brüder verabschiedeten sich mit gesenktem Blick von ihr. Die Mutter trat zu Bernat.
»Ruf mich, wenn du meinst, dass das Kind kommt«, sagte sie zu ihm, etwas abseits von den anderen. »Ich glaube nicht, dass sie es tun wird.«
Die Esteves machten sich auf den Heimweg. Als Francesca an diesem Abend die Treppe zur Schlafkammer hinaufstieg, konnte Bernat nicht anders, als auf ihren Leib zu starren.
Ende Mai, am ersten Tag der Ernte, blickte Bernat, die Sichel über der Schulter, auf seine Felder. Wie sollte er alleine das ganze Getreide einbringen? Vor zwei Wochen hatte er Francesca jegliche Anstrengung verboten, nachdem sie zweimal ohnmächtig geworden war. Bernat blickte erneut über die riesigen Felder, die ihn erwarteten. Die Frauen auf dem Land bekamen ihre Kinder während der Arbeit, aber nachdem Francesca zum zweiten Mal zusammengebrochen war, hatte er nicht umhingekonnt, sich Sorgen zu machen. Und wenn das Kind nicht seines war?
Bernat packte die Sichel und begann mit Kraft, das Korn zu schneiden. Die Ähren flogen nur so durch die Luft. Die Mittagssonne stand hoch am Himmel. Bernat hielt nicht einmal inne, um zu essen. Das Feld war schier endlos. Er hatte immer gemeinsam mit seinem Vater das Korn geschnitten, selbst als dieser bereits krank gewesen war. Die Getreideernte schien ihm neue Kraft zu verleihen. »Auf geht’s, mein Sohn!«, hatte er ihn ermuntert. »Warten wir nicht, bis uns ein Unwetter oder ein Hagelschauer die Ernte vernichten.« Und dann hatten sie gesichelt. Wenn einer von beiden müde war, hatte er Unterstützung beim anderen gesucht. Sie hatten im Schatten gegessen und guten Wein getrunken, den gereiften seines Vaters, und geplaudert und gelacht . . . Nun hörte er seine Sichel durch die Luft zischen und die Ähren schneiden, sonst nichts, nur die Sichel, und die Frage, wer der Vater seines zukünftigen Kindes war, ging ihm einfach nicht mehr aus dem Kopf.
In den folgenden Tagen war Bernat bis Sonnenuntergang bei der Ernte. Einmal arbeitete er sogar im Mondschein. Wenn er zum Gehöft zurückkehrte, stand das Abendessen auf dem Tisch. Er wusch sich am Becken und aß lustlos. Bis sich eines Abends plötzlich die Wiege bewegte, die er während des Winters getischlert hatte, als Francescas Schwangerschaft nicht mehr zu übersehen gewesen war. Bernat bemerkte es aus den Augenwinkeln, löffelte aber weiter seine Suppe. Ein Löffel, zwei, drei. Die Wiege bewegte sich erneut. Bernat starrte hinüber, der vierte Löffel mit Suppe war in der Luft versteinert. Er sah sich im Raum um, ob etwas auf die Anwesenheit seiner Schwiegermutter hindeutete, aber nein. Francesca hatte das Kind alleine zur Welt gebracht . . . und sich dann schlafen gelegt.
Er legte den Löffel hin und erhob sich. Doch bevor er die Wiege erreichte, blieb er stehen, drehte sich um und setzte sich wieder. Stärker als je zuvor überkamen ihn Zweifel bezüglich dieses Kindes.
»Alle Estanyols haben ein Muttermal neben dem rechten Auge«, hatte sein Vater zu ihm gesagt. Er selbst hatte es, und auch sein Vater hatte es gehabt. »Dein Großvater hatte es auch«, hatte dieser beteuert, »und der Vater deines Großvaters . . .«
Bernat war erschöpft. Er hatte von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne auszuruhen gearbeitet. Seit Tagen tat er das nun schon. Erneut sah er zu der Wiege hinüber.
Er stand wieder auf und trat zu dem Kind. Es schlief friedlich, die Fäustchen geöffnet, unter einer Decke, die aus den Fetzen eines weißleinenen Hemdes genäht war. Bernat drehte das Kind zu sich um, um sein Gesicht zu sehen.
3
Francesca sah das Kind nicht an. Sie gab dem Kleinen, den sie Arnau genannt hatten, erst die eine Brust, dann die andere, aber sie sah ihn nicht an. Bernat hatte viele Bäuerinnen ihre Kinder säugen sehen, und alle, von der reichsten bis zur ärmsten, hatten sie gelächelt, die Augen gesenkt oder ihre Kinder gestreichelt, während sie ihnen die Brust gaben. Nicht so Francesca. Sie wusch das Kind und versorgte es, doch in den zwei Monaten seines Lebens hatte Bernat nicht einmal gehört, dass sie mit ihm geschäkert hätte. Sie spielte nicht mit ihm, fasste es nicht an den Händchen, noch küsste oder kitzelte sie es. ›Was kann der Kleine dafür?‹, dachte Bernat, wenn er Arnau auf dem Arm hielt. Dann ging er mit ihm weg, um fernab von Francescas Kälte mit ihm zu sprechen und ihn zu streicheln.
Denn es war sein Kind. ›Alle Estanyols haben es‹, sagte sich Bernat, wenn er das Muttermal küsste, das Arnau neben der rechten Augenbraue hatte. »Wir alle haben es«, sagte er dann noch einmal laut, während er den Jungen zum Himmel hob.
Dieses Muttermal war bald mehr als nur eine Beruhigung für Bernat. Wenn Francesca zur Burg ging, um Brot zu backen, hoben die Frauen die Decke hoch, unter der Arnau lag, um ihn zu betrachten. Francesca ließ sie gewähren, und dann lächelten sie sich vor den Augen des Bäckers und der Soldaten zu. Und als Bernat ging, um das Land seines Herrn zu bestellen, klopften ihm die Bauern auf die Schultern und gratulierten ihm, diesmal vor den Augen des Verwalters, der ihre Arbeit überwachte.
Llorenç de Bellera hatte viele Bastarde, doch noch nie waren irgendwelche Forderungen erfolgreich gewesen. Sein Wort galt mehr als das einer ungebildeten Bäuerin, doch unter seinesgleichen wurde er nicht müde, mit seiner Männlichkeit zu prahlen. Es war offensichtlich, dass Arnau Estanyol nicht sein Sohn war, und der Herr von Navarcles begann ein spöttisches Grinsen bei den Bäuerinnen zu bemerken, die zur Burg kamen. Von seinen Gemächern aus sah er, wie sie untereinander und sogar mit seinen Soldaten tuschelten, wenn sie Estanyols Frau begegneten. Das Gerücht machte nicht nur unter den Bauern die Runde, und Llorenç de Bellera wurde zum Gespött von seinesgleichen.
»Iss nur tüchtig, Bellera«, ermunterte ihn grinsend ein Baron, der zu Besuch auf der Burg weilte, »mir ist zu Ohren gekommen, dass du Kräfte brauchst.«
Alle Anwesenden, die am Tisch des Herrn von Navarcles saßen, quittierten die Bemerkung mit schallendem Gelächter.
»Auf meinem Grund und Boden«, erklärte ein anderer, »lasse ich nicht zu, dass ein Bauernweib meine Männlichkeit in Frage stellt.«
»Lässt du etwa Muttermale verbieten?«, gab der Erste, schon unter dem Einfluss des Weins, zurück und erntete erneutes Gelächter, das Llorenç de Bellera mit einem gezwungenen Lächeln beantwortete.
Es geschah Anfang August. Arnau schlief in seiner Wiege im Schatten eines Feigenbaums auf dem Vorplatz des Gehöfts. Seine Mutter arbeitete im Garten bei den Ställen, und sein Vater, der stets ein Auge auf die hölzerne Wiege hatte, trieb die Ochsen immer wieder über das Getreide, das er im Hof ausgebreitet hatte, um die wertvollen Körner aus den Ähren zu dreschen, die sie während des Jahres ernähren sollten.
Sie hörten sie nicht kommen. Drei Reiter preschten im Galopp auf den Hof: Es waren der Verwalter Llorenç de Belleras sowie zwei weitere Männer. Sie waren bewaffnet und saßen auf beeindruckenden Schlachtrössern, die speziell für den Krieg gezüchtet worden waren. Bernat bemerkte, dass die Pferde nicht gepanzert waren wie bei den Ausritten seines Herrn. Wahrscheinlich hatten sie es nicht für nötig erachtet, sie zu wappnen, um einen einfachen Bauern einzuschüchtern. Der Verwalter hielt sich ein wenig abseits, aber die anderen beiden gaben ihren Tieren die Sporen. Die Pferde, die für den Kampf abgerichtet waren, zögerten nicht und gingen auf Bernat los. Bernat stolperte rückwärts und fiel schließlich hin, genau neben den Hufen der unruhigen Tiere. Erst jetzt zügelten die Reiter ihre Pferde.
»Dein Herr«, rief der Verwalter, »Llorenç de Bellera, verlangt nach den Diensten deiner Frau als Amme für Don Jaume, den Sohn deiner Herrin Doña Caterina.«
Bernat versuchte aufzustehen, doch einer der Reiter gab seinem Pferd erneut die Sporen.
Der Verwalter wandte sich an Francesca: »Nimm dein Kind und komm mit!«
Francesca nahm Arnau aus der Wiege und ging mit gesenktem Kopf hinter dem Pferd des Verwalters her. Bernat schrie auf und versuchte aufzustehen, doch bevor es ihm gelang, ging ihn einer der Reiter erneut mit seinem Pferd an und warf ihn um. Er versuchte es erneut, immer wieder, jedes Mal mit dem gleichen Ergebnis: Die beiden Reiter trieben unter Gelächter ihr Spiel mit ihm, indem sie ihm nachsetzten und ihn umwarfen. Schließlich blieb er keuchend und kraftlos auf dem Boden liegen, genau vor den Vorderläufen der Tiere, die unruhig auf ihren Trensen kauten. Als der Verwalter in der Ferne verschwunden war, machten die Reiter kehrt und gaben ihren Pferden die Sporen.
Es war wieder still auf dem Hof. Bernat blickte der Staubwolke hinterher, die die Reiter hinterließen, und sah dann hinüber zu den Ochsen, die sich an den Ähren gütlich taten, über die sie wieder und wieder getrottet waren.
Von jenem Tag an versorgte Bernat mechanisch das Vieh und die Felder, während er in Gedanken bei seinem Sohn war. Nachts wanderte er durchs Haus. Er vermisste das Kindergebrabbel, das Leben und Zukunft verhieß, das Knarren der Wiege, wenn Arnau sich bewegte, das durchdringende Weinen, wenn er Hunger hatte. Er versuchte in jedem Winkel, an den Wänden, überall den unschuldigen Duft seines Jungen zu erhaschen. Wo er jetzt wohl schlief? Da stand sein Bettchen, das er mit seinen eigenen Händen getischlert hatte. Wenn er schließlich Schlaf fand, weckte ihn die Stille wieder auf. Dann kauerte sich Bernat auf der Matratze zusammen und ließ die Stunden verstreichen. Die Geräusche des Viehs im Erdgeschoss waren seine einzige Gesellschaft.
Bernat ging regelmäßig zur Burg des Llorenç de Bellera, um Brot zu backen, und dachte dabei an Francesca, die dort eingeschlossen war und Doña Caterina und dem launischen Appetit ihres Sohnes zu Diensten sein musste. Die Burg – so hatte ihm sein Vater einmal erzählt, als sie dort zu tun hatten – war am Anfang nicht mehr als ein Wachturm auf der Anhöhe eines kleinen Vorgebirges gewesen. Jetzt gruppierten sich um den Burgturm herum ohne jegliche Ordnung das Backhaus, die Schmiede, einige neue, größere Pferdestallungen, Kornspeicher, Küchen und Gesindehäuser.
Die Burg war über eine Meile vom Hof der Estanyols entfernt. Die ersten Male hatte er nichts über seinen Jungen in Erfahrung bringen können. Wen auch immer er fragte, die Antwort war stets die gleiche: Seine Frau und sein Sohn befänden sich in Doña Caterinas Privatgemächern. Der einzige Unterschied bestand darin, dass einige, wenn sie ihm antworteten, höhnisch lachten, während andere den Kopf senkten, so als wollten sie dem Vater des Kindes nicht in die Augen schauen. Bernat nahm die Ausflüchte über einen ewig scheinenden Monat lang hin, bis er eines Tages, als er mit zwei Laiben Brot aus dem Backhaus kam, einem schmutzigen Schmiedeburschen begegnete, den er manchmal über seinen Kleinen ausgefragt hatte.
»Was weißt du über meinen Arnau?«, fragte er ihn.
Weit und breit war niemand zu sehen. Der Junge versuchte, ihm auszuweichen, als ob er ihn nicht gehört hätte, doch Bernat hielt ihn am Arm fest.
»Ich habe dich gefragt, was du über meinen Arnau weißt.«
»Deine Frau und dein Sohn . . .«, begann der Junge mit gesenktem Blick.
»Ich weiß, wo sie sind«, fiel ihm Bernat ins Wort. »Meine Frage ist, ob es Arnau gut geht.«
Der Junge bohrte seine Zehen in den Sand, den Blick immer noch gesenkt. Bernat schüttelte ihn.
»Geht es ihm gut?«
Der Bursche sah nicht auf, und Bernat schüttelte ihn erneut.
»Nein, tut es nicht!«, schrie der Junge. Bernat trat einen Schritt zurück, um ihm in die Augen zu sehen. »Nein, tut es nicht«, wiederholte der Junge. Bernat sah ihn fragend an.
»Was ist mit ihm?«
»Ich kann nicht . . . Wir haben Befehl, dir nichts zu sagen . . .« Die Stimme des Jungen brach.
Bernat schüttelte ihn erneut heftig und erhob die Stimme, ohne sich darum zu scheren, dass er die Wache auf sich aufmerksam machen konnte.
»Was ist mit meinem Sohn? Was ist mit ihm? Antworte!«
»Ich kann nicht. Wir können nicht . . .«
»Würde das deine Meinung ändern?«, fragte er ihn und hielt ihm einen Brotlaib hin.
Der Schmiedebursche riss die Augen auf. Ohne zu antworten, riss er Bernat das Brot aus den Händen und biss hinein, als hätte er tagelang nichts gegessen. Bernat zog ihn in eine Ecke, wo sie vor Blicken sicher waren.
»Was ist mit meinem Arnau?«, fragte er noch einmal nachdrücklich.
Der Junge sah ihn mit vollem Mund an und gab ihm ein Zeichen, ihm zu folgen. Verstohlen schlichen sie sich an den Hauswänden entlang bis zur Schmiede. Sie schlüpften hinein und gingen in den hinteren Teil. Der Junge öffnete die Tür zu einem kleinen Verschlag, in dem Material und Werkzeug auf bewahrt wurden, und ging hinein. Bernat folgte ihm. Kaum waren sie drinnen, hockte sich der Bursche auf den Boden und stürzte sich auf das Brot. Bernat sah sich in dem kleinen Raum um. Es war brütend heiß. Er entdeckte nichts, was ihm erklärt hätte, warum der Schmiedelehrling ihn dorthin geführt hatte: In diesem Raum gab es nur Werkzeuge und altes Eisen.
Er sah den Jungen fragend an. Dieser deutete in eine Ecke des Verschlags, während er genüsslich weiterkaute. Bernat wandte sich dorthin.
Auf einigen Holzplanken lag in einem zerfransten Weidenkorb verlassen und abgemagert sein Sohn und schien dort auf seinen Tod zu warten. Die weißleinene Decke war schmutzig und zerlumpt. Bernat konnte den Schrei nicht unterdrücken, der sich seiner Brust entrang. Es war ein erstickter Schrei, ein unmenschliches Schluchzen. Er nahm Arnau und drückte ihn an sich. Das Kind reagierte nur sehr schwach, aber es reagierte.
»Der Herr hat befohlen, deinen Sohn hierzulassen«, hörte Bernat den Schmiedeburschen sagen. »Am Anfang ist deine Frau noch ein paar Mal am Tag vorbeigekommen, um ihn zu beruhigen und ihm die Brust zu geben.«
Bernat drückte den kleinen Körper mit Tränen in den Augen an seine Brust, um ihm Leben einzuhauchen.
»Zuerst kam der Verwalter«, erzählte der Junge weiter. »Deine Frau wehrte sich und schrie . . . Ich habe es gesehen, ich war in der Schmiede.« Er deutete auf einen Spalt in der Bretterwand. »Aber der Verwalter ist sehr kräftig . . . Als er fertig war, kam der Herr in Begleitung einiger Soldaten herein. Deine Frau lag auf dem Boden, und der Herr begann, über sie zu lachen. Dann lachten alle. Von da an warteten jedes Mal neben der Tür die Soldaten darauf, dass deine Frau herauskam, um deinen Sohn zu stillen. Sie konnte sich nicht wehren. Seit einigen Tagen kommt sie kaum noch. Die Soldaten . . . sie fallen über sie her, sobald sie Doña Caterinas Gemächer verlässt. Sie schafft es nicht mal mehr bis hierher. Manchmal sieht der Herr sie, aber er lacht nur.«
Ohne zu überlegen, hob Bernat sein Hemd und schob den kleinen Körper seines Sohnes darunter. Dann verbarg er die Ausbuchtung hinter dem Brot, das ihm verblieben war. Der Kleine bewegte sich nicht. Der Schmiedelehrling sprang auf, als Bernat zur Tür ging.
»Der Herr hat es verboten. Du kannst nicht einfach . . .!«
»Lass mich vorbei, Junge!«
Der Bursche versuchte, ihm zuvorzukommen. Bernat hatte keinen Zweifel daran. Während er mit einer Hand das Brot und den kleinen Arnau festhielt, ergriff er mit der anderen eine Eisenstange, die an der Wand lehnte, und drehte sich unerwartet um. Die Stange traf den Jungen am Kopf, als er gerade aus dem Verschlag schlüpfen wollte. Er fiel zu Boden, ohne dass ihm die Zeit blieb, ein Wort zu sagen. Bernat sah nicht einmal hin. Er ging einfach hinaus und zog die Tür hinter sich zu.
Es war leicht, die Burg Llorenç de Belleras zu verlassen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Bernat unter dem Brotlaib den geschundenen Körper seines Sohnes trug. Erst als er vor dem Burgtor stand, dachte er an Francesca und die Soldaten. In seiner Wut machte er ihr Vorwürfe, weil sie nicht versucht hatte, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, ihn vor der Gefahr zu warnen, in der sich ihr Kind befand, dass sie nicht um Arnau gekämpft hatte . . . Bernat drückte den Körper seines Sohnes an sich und dachte an all die Zeit, die er untätig gewesen war, während Arnau auf ein paar elenden Holzplanken den Tod erwartete.
Wie lange würden sie brauchen, um den Jungen zu finden, den er niedergeschlagen hatte? Ob er tot war? Hatte er die Tür des Verschlags hinter sich geschlossen? Unzählige Fragen schossen Bernat durch den Kopf, während er zu seinem Hof zurückging. Ja, er hatte sie geschlossen, er erinnerte sich vage daran.